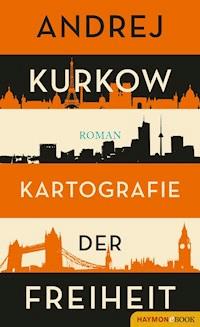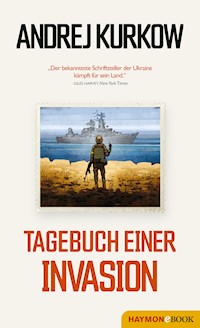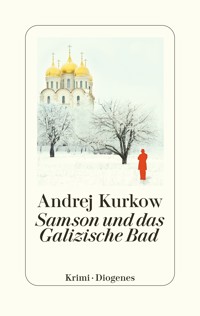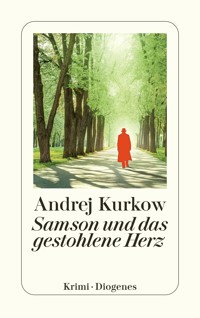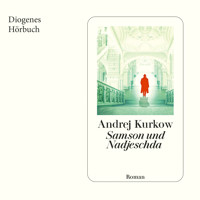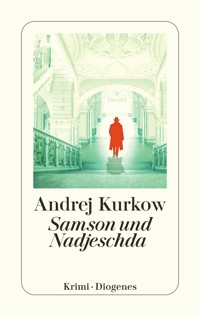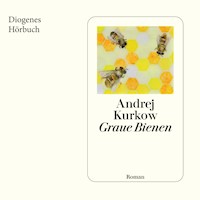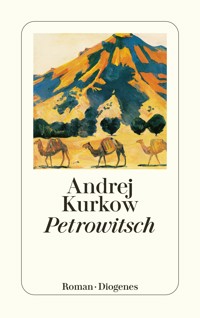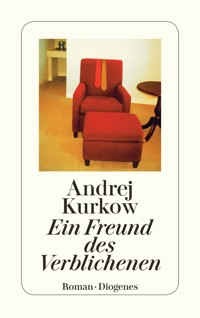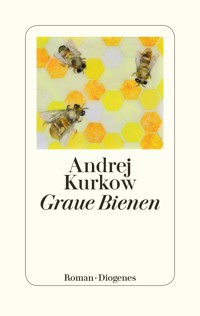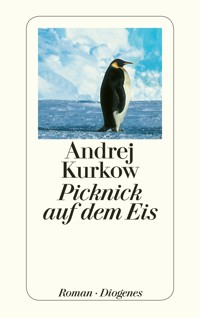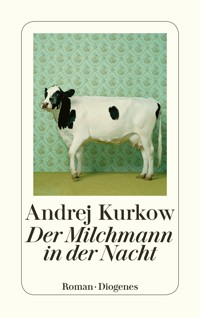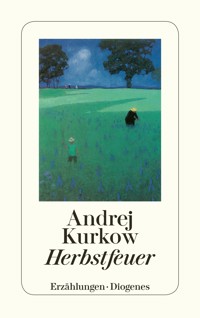
8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Diogenes Verlag AG
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Iwan wird Stammkunde in einem kleinen Feinschmeckerlokal, dessen Chefkoch Dymitsch er kennen- und schätzenlernt. Eines Tages ist Dymitsch verschwunden, doch hat er extra für Iwan eine Folge von Gerichten hinterlassen, die ihm seine Nichte Vera kochen und an fünf Abenden hintereinander servieren soll. Alles schmeckt köstlich, doch wieso hat Iwan später winzige Sandkörnchen zwischen den Zähnen? Und was will der Rechtsanwalt, der am fünften Tag zum Abendessen erscheint? Poetisches, Humorvolles und Skurriles aus der Ukraine – vor und nach der ›orangen Revolution‹.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 203
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Andrej Kurkow
Herbstfeuer
Erzählungen
Aus dem Russischen von Angelika Schneider
Diogenes
Herbstfeuer
Das neue Jahrtausend rückte näher. Oma Olja saß auf einem Schemel unter dem Aprikosenbaum und hielt den laut tickenden Wecker in den Ärmel geschoben. Der Baumstamm war mit Männerkleidern umwickelt, um ihn vor dem Frost zu schützen. Als sie die langsamen Bewegungen der Zeiger eine Weile verfolgt hatte, drehte sie den Alarm des Weckers genau auf Mitternacht und stellte ihn auf die glatte, mit einer Eiskruste überzogene Schneefläche. Ein frostiger Wind kam auf, und man hörte das kartonartige Aneinanderscharren der Trockenfische, die dicht an dicht von den kahlen Zweigen des Aprikosenbaums herabhingen. ›Wer hat mir die bloß über den Zaun geworfen?‹ fragte sich Oma Olja, während sie ihren Neujahrsbaum betrachtete.
(Epigraph anstelle eines Epilogs)
Vom Standpunkt des Grases aus betrachtet, fängt alles Gute im Frühjahr an und endet im Herbst, kurz vor dem ersten Schneefall.
Über das Dorf Lipowka, nicht weit von Kiew entfernt, legte sich ein windiger Abend. Es wehte wirklich ein starker Wind an diesem Abend. Fast in jedem Hof brannte ein offenes Feuer, in das die Bauern wie in einen Ofen das schon trockene Laub und abgebrochene Zweige aus dem Garten warfen. Sie stopften jeglichen Abfall dort hinein, der die Fähigkeit hatte, sich in Rauch und ein bißchen Asche zu verwandeln. Der Wind vermischte den Rauch der verschiedenen Feuer zu einem einzigen dicken Qualm, der schließlich das immer noch zur Kolchose gehörende Feld erreichte, das genau hinter Oma Oljas Gemüsegarten anfing.
Der Rauch, der sich mit der Abendluft vermischte, roch stark nach Herbst. Der alte Nachbar, der die übliche Ladung Laub in sein Feuer warf, stieß die Heugabel in die Erde, atmete die kühle, rauchige Luft ein, und da sie ihn in der Kehle kratzte, hustete er.
Der Nachbar wälzte die Zunge im Mund herum und überlegte. Er versuchte den Geruch des Rauches näher zu bestimmen. Irgend etwas war an diesem Geruch, was ihm vertrauter war als der gewöhnliche Rauch des Herbstfeuers. Aber was war das? Er wiegte den Kopf hin und her, sah in die wiederauflodernden Flammen, nahm nochmals die Heugabel zur Hand und ging langsam auf einen bestimmten Blätterhaufen zu. Ein Drittel aller gefallenen Blätter mußte von dem Walnußbaum stammen, der hinter dem Haus wuchs. Er hatte sie noch nicht in Brand gesetzt, aber er roch schon im voraus, wie sich jetzt gleich das Parfum des Rauches verändern würde. Denn die Walnußblätter verbrannten mit dem leckersten Geruch.
Irgendwo brannten noch andere Feuer, und andere Bauern schnupperten den abendlichen Rauch. Irgend jemandem schien es, als rieche der Rauch nach Salz und Geräuchertem. Die Bauern verbrannten in Ruhe weiterhin ihren Abfall. Das ganze Dorf verbrannte Blätter – und Oma Olja verbrannte ihren Mann.
Diese Geschichte hatte, wie alles Gute, vom Standpunkt des Grases aus betrachtet, im Frühjahr angefangen. Allerdings war das schon dreißig Jahre her. Genau in dem Hof, wo jetzt ein Räucherfeuer brannte, hatte man drei Tage lang die Hochzeit von Olja und Fjodor gefeiert. Drei Tage lang hatte man gegessen und getrunken, man hatte zu Harmonikamusik getanzt und war hinter der Scheune zu einem kurzen Nickerchen umgefallen. Drei Tage lang ein wildes Fest, aber dann begann das eigentliche Leben. Das war nicht besser und nicht schlechter als bei anderen auch.
Fjodor war ein vitaler Mann. Obwohl er dünn war, konnte er ohne zu ermüden stundenlang Holz hacken, damit sie es später im Winter warm hätten. Er konnte aus einer besoffenen Schlägerei mit den Zigeunern ohne jeden Kratzer hervorgehen. Die Zigeuner waren ins Dorf gekommen, um Sachen zu verkaufen – ganz offensichtlich Diebesgut. Als sie alles verkauft hatten, tranken sie Wodka und luden ihre Stammkunden, von denen Fjodor einer war, dazu ein. Und als alle sich einen angetrunken hatten, fingen sie an, sich über die Preise der gekauften-verkauften Dinge zu streiten. Das konnte natürlich nicht ohne Keilerei ausgehen, obwohl die Preise immer tief waren, so daß sie sich jeder leisten konnte. Und wenn man kein Geld hatte, konnte man bei den Zigeunern sogar Waren gegen Selbstgebrannten Schnaps oder selbstgezogenen Tabak tauschen.
Fjodor kaufte gern billige Dinge, trank gern einen über den Durst und prügelte sich gern im angetrunken Zustand. Aber am allerliebsten ging er fischen. Wie gut, daß nicht weit weg ein Bach floß und noch näher am Haus zwei Teiche lagen, in denen die Kolchose damals versuchte Fische zu züchten. Man hatte schon länger damit begonnen, und es waren tatsächlich schon eine Menge Fische in den Teichen. Dank der Abwesenheit des erst kürzlich eingesparten Nachtwächters kamen nachts die hiesigen Bewohner mit Eimern und Angeln an die Teiche und fingen so viele Fische, wie sie in ihre Eimer packen konnten.
Olja mochte keinen Fisch. Und auch Fjodor mochte sie nur in Form von Trockenfisch. Er kam gegen Morgen heim, nahm mit dem Messer die Fische aus, legte sie in Salz und hängte sie in der Scheune auf eine Schnur. Dann ging er schlafen.
Die Scheune lag neben der Sommerküche, und wenn Olja kochte, runzelte sie jedesmal mißbilligend die Stirn, sowie ein Lüftchen ihr den schwach salzigen Geruch entgegentrug.
Fjodor wartete, bis der Trockenfisch so hart war, daß man damit einen Hänfling auf dem hölzernen Tisch hätte totschlagen können, und während er an dem Fisch roch, bis sich ein dümmliches Lächeln auf seinem Gesicht ausbreitete, verlangte er, daß Olja ihm Kartoffeln kochte. Dann aß er den Fisch zu den Kartoffeln und spülte mit einer sogenannten ›Bürste‹ nach – ein Glas Bier mit einem halben Glas Wodka. Das war sein ganzes Glück!
Und Olja kochte die Kartoffeln, wusch die Wäsche, führte die Kuh auf die Weide, ertrug ihren Mann schweigend und tat all das, was die Frauen auf dem Dorf schon seit Ewigkeiten zu tun haben. Das Leben verlief einfach und doch schwer.
Als sie fünfundvierzig geworden war, fingen die Nachbarskinder an, sie ›Oma Olja‹ zu nennen.
Dann kam die Unabhängigkeit, und das Land änderte seinen Namen. Der Kolchosvorsitzende fuhr weg, um irgendwo Deputierter zu werden, und sein Sohn wurde neuer Kolchosvorsitzender.
Olja versuchte die Veränderungen zu begreifen, aber der Nachbar Danil beruhigte sie. Er sagte, es würde sowieso alles genau so bleiben wie es war. Danil konnte man glauben – er war der einzige in ihrer Straße, der Zeitungen abonniert hatte.
Und tatsächlich: Nichts änderte sich, und das Leben ging genau so weiter wie vorher. Wieder kamen Zigeuner mit billigen, abgenutzten Sachen angefahren, mit rostigen Sägen und Beilen. Und wieder gab es Besäufnisse und Prügeleien und den ärgerlichen Geruch des gedörrten Fisches aus der Scheune, direkt neben der Sommerküche. Und der Kartoffelkäfer flog von der Kolchose her in ihren Gemüsegarten, und es gab keine Rettung vor ihm. Fjodor schlief, und sein Geschnarche drang durchs offene kleine Fenster ihrer Bauernkate über den Hof.
Nachts lag Olja allein auf dem breiten Bett. Die Wirbelsäule tat weh vom vielen Bücken, und deshalb wollte der Schlaf nicht kommen. Olja lag da und dachte daran, daß sich ihr Eheleben längst in zwei geteilt hatte. Das hieß, es hatte sich wie in ihr Eheleben und sein Eheleben aufgeteilt. Sie ernährte ihn, wusch für ihn und bekam ihn praktisch nicht zu Gesicht. Und er hackte sorgfältig Holz für den Winter, fing nachts Fische, schlief am Tag, und abends trank er entweder mit den Zigeunern oder schlenderte durchs Dorf. Was tat er sonst noch? Nichts. In den letzten zwei Jahren hatte er lediglich einen Aprikosenbaumsetzling in den Garten gepflanzt. Und auch der war nicht angegangen und schließlich vertrocknet. Jetzt streckte er nur noch seine toten Zweige von sich.
So lag Olja da und dachte, daß sie mit Fjodor eigentlich nichts gemeinsam hatte außer diesem breiten Bett. Und auch dort schliefen sie nur abwechselnd. Kinder hatten sie keine. Vielleicht lag es an ihr, vielleicht aber auch nicht. Zum Arzt war sie schließlich nicht gegangen. Der Arzt war weit weg, in der Gebietshauptstadt. Sie hätte einen ganzen Tag gebraucht, um zu ihm zu fahren. Was sie mit Fjodor hatte, war kein Familienleben, sondern eher so etwas wie eine Minikolchose, nur daß jeder seine Pflichten freiwillig erfüllte.
Vor dem Fenster war alles still. Die Nacht brach herein, und im Zimmer machte sich der Geruch des gedörrten Fisches breit, der aus der geschlossenen Scheune drang.
Seit einiger Zeit hatte Olja bemerkt, daß Fjodors Augen fröhlicher geworden waren. Gewöhnlich wurden sie vor dem Angeln fröhlicher oder vor dem Abendessen, und plötzlich wurden sie das mitten am Tag. Etwas stach in Oljas Brust. Aufmerksam beäugte sie Fjodor.
Auf Fjodors trockenem Gesicht zeigte sich Stolz – und Entschlossenheit. Er verschwand immer öfter irgendwohin. Draußen war später Vormittag, die Sonne schien mit aller Kraft, und er hatte ein weißes Hemd und ein Jackett übergezogen. Er bat Olja um Geld für den Bus, für eine Fahrkarte in die Stadt und zurück. Widerstrebend wickelte sie ihr Taschentuch auf und gab ihm das Geld.
Er nahm eine leere Tasche, ging in die Scheune, die neben der Sommerküche lag. Dann schritt er, schon mit vollgestopfter Tasche, zur Gartenpforte. Stolz und selbstsicher. Und sagte kein einziges Wort. Aber sein ganzes Benehmen sagte: ›Warte nur, du wirst schon sehen!‹
›Was soll ich denn sehen?‹ dachte Olja, die seinem Rücken hinterhersah.
Dann sah sie in die unverschlossene Scheune, bemerkte, daß all diese unzähligen Reihen gedörrten Fischs, die auf Schnüren unter der Decke gehangen hatten, verschwunden waren.
»Na, Gott sei Dank!« seufzte Olja, die dachte, daß der Fisch nun ein für allemal aus ihrem Leben verschwunden wäre.
Die augenblickliche Erleichterung nahm jede Menge Gewicht von ihr. Sie lächelte sogar triumphierend. All der Fisch, der zwischen ihr und ihrem Mann gestanden hatte, war verschwunden. Jetzt konnte man wirkliche Veränderungen im Leben erwarten und nicht bloß solche, die aus Umbenennungen von Straßen und Dörfern bestanden. Plötzlich erinnerte sie sich an all das Gute, das sie von Fjodor in diesen dreißig Jahren ihres gemeinsamen Lebens gehört und gesehen hatte. Es war leicht, sich an all das zu erinnern, denn allzuviel gab es da nicht.
Auf diese Freude hin öffnete sie eine Flasche Himbeergeist vom letzten Jahr und trank ein Schnapsglas aus.
Abends kam Fjodor mit der leeren Tasche zurück. Er gab ihr das Geld für den Bus zurück und zeigte ihr noch einen ganzen Packen Scheine, den er fest in der Hand hielt. Nicht viel, aber auch nicht wenig. Olja schätzte, daß es wohl für ein paar Kilo Schweinefleisch vom Markt reichen müßte. Aber er gab ihr das Geld nicht. Er steckte es in die Tasche seines Jacketts. Dann zog er sich den alten Trainingsanzug mit den abgeschabten Stellen an den Knien an, griff sich Eimer und Angel und zog los.
Es wurde schon dunkel. Olja stand an der Gartenpforte und hörte, wie der Eimer am Henkel immer leiser und leiser hin und her quietschte, sich langsam Richtung Teiche entfernend.
Und wieder hatte Olja eine schlaflose Nacht. Und der Schmerz in den müden Armen und das Gefühl von einer unendlichen Blödheit im Kopf – das war wegen der morgendlichen Hoffnung auf Veränderung. Veränderungen würde es keine geben. Die gab es wohl überhaupt nicht. Auf die wartete man bloß immer.
Und durch das geöffnete Fenster drang nachts immer noch schwach der Geruch von gedörrtem Fisch, obwohl längst keiner mehr in der Scheune hing. Das wußte sie genau. Sie war in den vergangenen Tagen mehrmals nachsehen gegangen. Sie sah, daß kein Fisch mehr da war, lächelte und machte sich wieder an ihre Arbeit im Gemüsegarten. Wie leicht es sich da arbeitete!
Eines Morgens führte Olja die Kuh auf die Weide, und als sie zurückkam, stank der ganze Hof wieder nach Fisch. Fjodor stand mit dem Rücken zu ihr vor einem Tisch, den er in den Boden gerammt hatte. Er nahm die Fische aus. Unten auf dem Boden kaute die Nachbarskatze die weggeworfenen Innereien. Olja spuckte verächtlich aus und ging in den Gemüsegarten.
Abends nahm Fjodor wieder seine Angelausrüstung und trug nun nicht nur einen, sondern zwei leere Eimer zum Teich.
So ging das Abend für Abend. Schon war die ganze Scheune bis unter die niedrige Decke mit Fischen zugehängt, und sogar die Vorratskammer, in der die leeren Dosen für die fertig konservierten Fische aufbewahrt wurden, war voll. Dann begann er im Hinterhof Pfosten in die Erde zu schlagen und auch zwischen ihnen Leinen zu spannen.
Schweigend und mürrisch verfolgte Olja das Geschehen. Von weitem sah sie Fjodors Gesicht und bemerkte in seinen Augen einen fieberhaften Eifer.
›Vielleicht ist er durchgedreht?‹ dachte sie. ›Vielleicht müßte man ihn zum Arzt bringen?‹ Aber dann fiel ihr ein, daß das hieße, ins Kreiszentrum zu fahren, und das war eine ganze Tagesreise. Und hier fegten Stürme übers Land, die Kartoffelkäfer kamen von der Kolchose herübergekrabbelt, der Klee überzog den ganzen Gemüsegarten von den Rändern her. Mal wuchs er plötzlich zwischen den Tomatenpflanzen hervor, mal aus den Karottenbeeten. Und mit nichts konnte man ihn packen außer mit den bloßen Händen. Das Innere der Pflanze mußte man samt Kraut herausreißen und dann ganz sorgfältig die unterirdischen Wurzelausläufer herausziehen, damit sie nicht an einem anderen Ende wieder hervorkamen. Dazwischen mußte man ab und zu mal aufatmen, und Olja seufzte so aus tiefstem Herzen, daß ihr schon nach zwei-, dreimal ausatmen viel leichter wurde. So konnte sie sich schon wieder hinunterbücken, über die künftige Ernte. Auch wenn sie die ganz große Zukunft nicht voraussehen konnte, eins konnte sie vorhersehen: Es würde eine gute Ernte geben! Kartoffeln, Wirsing, Lauch, Zwiebeln …
Die Sonne schien, als wolle sie den Beginn des Herbstes abschwächen. Die Lerchen flogen irgendwo am Himmel und sangen. Sie jubilierten geradezu, als wenn bei ihnen alles in schönster Ordnung wäre.
›Wie es wohl wäre, ein Vogel zu sein?‹ dachte Olja und sah an sich herunter, betrachtete ihre dikken kräftigen Arme, ihren muskulösen Rumpf, der einem Fäßchen glich, besah sich ihre Beine, die dieses Fäßchen unermüdlich trugen. ›Ach nein, was wäre ich schon für ein Vogel!‹ sagte sie sich, mit einem Blick gen Himmel, wo die Lerchen immer noch jubilierten.
Sie richtete den Rücken auf, atmete tief durch, sog die Luft ein – und spuckte aus. Wieder der verfluchte Fischgeruch; aber diesmal roch es nicht nur nach dem üblichen salzgedörrten Fisch, sondern es roch nach verfaultem Fisch. Sie sah sich um, sah ihr Haus, ihr Anwesen. Sie betrachtete es, aber irgendwie ohne Liebe, ohne Achtsamkeit im Blick. Als ob es ihres wäre und doch nicht ihres.
Fjodor hängte inzwischen auf dem Hinterhof schon die Fische auf die gespannten Leinen. Er brauchte keinen anderen Geruch. Das war er – der Reichtum. Gesalzen, gedörrt. Getrocknetes Geld. Die Sonne an der richtigen Stelle, und schon trocknete sie die Fische und nahm nicht einmal Geld dafür. Und er würde sie dann in die Stadt bringen, zu den Bierbuden.
Was das dem Volk brachte? Für das Volk war das Bier ohne Trockenfisch, wie wenn man die Zunge auf Sandpapier rieb. Die Leute kamen angerannt, kauften ihm alles ab und ließen ihr Geld in seine Taschen fließen. Und das war nur gerecht, denn er hatte es nicht gestohlen, sondern mit seiner ehrlichen Arbeit verdient.
So Gott wollte, würde es noch vor dem ersten Frost für ein altes Motorrad reichen. Die Zigeuner hatten ihm gesagt, daß irgendeiner von ihnen eine alte IS-Sport verkaufte! Zuerst würde er das Motorrad kaufen und dann etwas für seine Frau, damit sie ihm kein schiefes Gesicht zog. Vielleicht ein Kleid. Oder vielleicht sogar eine Pelzmütze oder ein Tuch aus Ziegenhaar.
Wieso hatte er bloß früher nicht daran gedacht, Fische zum Verkaufen zu dörren? Er war doch immer ein Meister in Sachen Trockenfisch gewesen! Jeder, dem er mal einen geschenkt hatte, hatte später noch einmal danach gefragt. Und wie sie ihn gefragt hatten! Was war das für eine Zeit jetzt! Nein wirklich, das war gar keine schlechte Zeit. Man mußte nur überlegen, was man woher nahm und wohin brachte. Mit anderen Worten: Kapitalismus. ›Gar nicht schlecht‹, dachte Fjodor. ›Wir gewöhnen uns auch daran, werden es uns zu eigen machen und weiterleben! Die Teiche sind ja groß. Sie sind riesig und gehören niemandem!‹
Und abends zog er wieder los, Eimer in Eimer gestapelt, weil er sie so bequemer tragen konnte, und in der anderen Hand die Angel, die Würmer aus dem Garten und etwas Teig. Die Fische in den Teichen waren blöd, sie bißen bei allem an. Und sie knabberten nicht erst, nein sie schluckten sofort den ganzen Haken! Wahrscheinlich waren sie sehr hungrig.
Nicht mal am Sonntag ruhte sich Fjodor aus. Wenn er von den Teichen kam, nahm er die Fische aus und salzte sie ein. Schließlich spannte er noch Leinen zwischen der Sommerküche und der Veranda, er verhängte mit diesen Leinen den ganzen Hof. Und dann begann er sofort, Fisch zum Trocknen darauf zu hängen. Auf dem hinteren Hof hing schon so viel Fisch, daß nicht mal eine Sardelle mehr Platz gehabt hätte.
Er nahm seinen nächtlichen Fang auseinander, dann zog er sich um. Die Fische, die neben der Sommerküche schon fertig getrocknet waren, brachte er in die Scheune und ging schweigend vom Hof.
Olja sah ihm durch ein kleines Fenster nach. Draußen war Sonntag, aber in ihrem Herzen war Montag, und sie hätte am liebsten ausgespuckt. In der Bauernkate war es stickig. Man hätte das Fenster öffnen müssen, aber dann wäre der ganze Fischgeruch hereingezogen. So war es schlecht, aber anders wäre es noch schlimmer gewesen.
Olja trat hinaus und führte die Kuh auf die Weide. Sie schlug den eisernen Pflock in die Erde und setzte sich daneben. Bloß gut, daß der Wind zum Bauernhaus hin wehte. So atmete sie die frische Luft ein, und der Klee duftete. Die Kuh kaute Gras und klirrte mit ihrer Kette. Auch Olja schaute ins Gras.
›Die Erde ist ohne Gras eine Wüste! Wie ein kahler Schädel. Dort, wo das Gras ist, da ist das Leben, da sind Würmer und Käfer – und Kühe. Und wenn man sich die Erde kahl vorstellte, ohne Gras … Wenn es keine Gemüsebeete, keine Gärten gäbe? Ein toter Platz, eine Einöde. Fängt etwa alles mit dem Gras an?‹
Olja dachte lange nach. Und über ihr sangen die Lerchen wieder die letzten Herbstlieder. Die Kuh rasselte mit ihrer Kette, riß Gras ab und schmatzte mit ihrem schweren Maul.
›Der Mensch ist wie das Gras‹, dachte Olja. ›Kaum ist er der Erde entwachsen, schon stirbt er ab. Das Bauernhaus wird leer stehen, der Garten vom Sturm verwüstet werden …‹ Und einen Garten bepflanzen mußte doch eine der ältesten Tätigkeiten überhaupt sein. Vielleicht sogar älter als das Gras … nein, das konnte nicht sein. Wahrscheinlich war am Anfang das Gras gewesen, und dann kam der Gemüsegarten. Die Menschen hatten gesehen, wie das Gras wuchs, und waren Bauern geworden. Sie sahen, welche der Tiere dieses Gras fraßen, und hielten sich diese Tiere.
Olja sah ihre Kuh voller Zärtlichkeit an.
›Die Kuh frißt sich satt – und gibt Milch!‹ dachte sie weiter. ›Und ich trinke mich morgens an der Milch satt – und gehe in den Gemüsegarten, um zu arbeiten …‹
Genau bei diesem Gedanken änderte sich die Windrichtung und wehte von ihrem Hof den Fischgeruch herüber, salzig, schwer und zäh. Und es war, als hörten die Lerchen mit einem Mal zu singen auf. Oljas Augen füllten sich mit Tränen. Sie standen einen Moment in ihren Augen und rollten dann langsam die Wangen herab. Sie tat sich selbst leid. Es tat ihr um ihr Leben leid, in dem es nur drei Feiertage gegeben hatte, und das war vor dreißig Jahren gewesen. Damals, als sie Hochzeit gespielt hatten. Und dann? Ein wortkarger, unzärtlicher Mann, von dem sie weder ein liebes Wort noch je ein Geschenk bekommen hatte. Alles wie früher in der Kolchose: Sie molk die Kuh, er hackte das Holz. Dann wärmten sie sich beide am Ofen und tranken schweigend Milch. Eine Dummheit war das, aber kein Leben. Und jetzt noch dieser Fisch! Man hätte meinen können, er hätte eine neue Liebe gefunden, denn es war doch so: Er hatte sie völlig gegen den Fisch eingetauscht. Nachts war er mit dem Fisch zusammen, tagsüber war er mit dem Fisch zusammen. Und sie mußte bloß wegen ihm diesen alptraumhaften Geruch ertragen. Manchmal schien es ihr, daß sogar schon die Milch, und selbst die Kuh, nach Fisch roch.
Man konnte es nur durchstehen und auf den Winter warten. Im Winter fing er nicht so viel, und dörren konnte er bei Frost auch nicht. Im Winter würde alles zum Stillstand kommen. Im Winter würde auch der Fischgeruch erfrieren. Bei Frost verliert sich jeder Geruch schnell, es ist, als wenn es ihn gar nicht gegeben hätte.
Olja ließ die Kuh grasen und ging ins Dorf, um dort spazierenzugehen. Sie ging an den Nachbargrundstücken vorbei, betrachtete kritisch deren Gemüse- und Ziergärten. Vielerorts hatte man schon Abfallhaufen aufgetürmt. Bald würden die Feuer rauchen, und eine ganze Woche lang läge Qualm in der Luft. Und sie hatte noch nicht einmal das Laub im Garten zusammengefegt. Und auch der Hof war schon lange nicht mehr gekehrt worden.
Ein paarmal blieb sie an Nachbarzäunen stehen und wechselte mit den Nachbarinnen ein paar Worte. Die Gespräche waren wie ein Echo in einem Brunnen: ›Und was macht deiner?‹ – ›Na ja, geht so. Und deiner?‹
Sie kehrte heim. Sie ging unter den aufgehängten Fischen hindurch, den Atem anhaltend. Dann nahm sie den Rechen – und ab in den Garten. Ordnung machen.
Sie harkte mit dem Rechen einen Haufen Blätter zusammen, der halb so groß wie sie selbst war. Danach war sie erschöpft. Sie kehrte auf den Hof zurück und setzte sich an den in die Erde gerammten Tisch. Er roch nach Fisch, aber Olja hatte schon keine Kraft mehr, um aufzustehen. Sie saß da, wärmte sich an der Sonne und ertrug den Fischgeruch.
Aber der Wind rieb die kartontrockenen Fische gegeneinander. Er wehte Sehnsucht heran. Und von den Gedanken in Oljas Kopf war einer sehnsüchtiger als der andere.
So war sie zum Beispiel morgens an Oksanas Bauernhaus vorbeigekommen. Ungepflegt stand das Haus da, die Farbe blätterte ab, es war leer. Und an der Gartenpforte war ein Kettenschloß. Früher hatte hier eine ganz normale Familie gewohnt. Oksana und Stepan. Sie war Buchhalterin der Kolchose und er Traktorfahrer und Mechaniker gewesen. Alles war ganz normal gewesen: Sie arbeitete und versorgte den Haushalt, er arbeitete und trank. Und manchmal trank er nur und arbeitete gar nicht. Er schlug sie oft, wenn er betrunken war. Einmal im Frühjahr, es war wohl im März gewesen, hatte er sie so geschlagen, daß sie aus dem Haus weglief. Zwei Tage lang versteckte sie sich bei den Nachbarn, legte sich Spitzwegerichwickel auf ihre Blutergüsse, die sie am ganzen Körper hatte. Und dann geschah etwas mit ihr, so sagten die Nachbarn. Wie wenn in ihrem Inneren etwas geklickt hätte und plötzlich ihr Gesicht veränderte. Scharfkantig wurde ihr Gesicht und entschlossen, wo es doch bis dahin sanft und gutmütig gewesen war. Und als dieser Wandel mit ihrem Gesicht passiert war, stand sie vom Bett der Nachbarin auf zog sich an und ging nach Hause.
Ihren Mann hat man durch den Verwesungsgeruch gefunden, nach vier Tagen. Er lag im Holzhaus mit einem Loch im Kopf. Mit was sie ihn erschlagen hatte, wußte man nicht, nur daß sie seitdem keiner mehr gesehen hatte. Man sagte, daß sie in ihre alte Heimat geflohen wäre, nach Weißrußland.
Nein, Olja wäre nicht weggelaufen. Sie war nicht so. Aber ihr Mann war auch nicht so einer. Wenn er auch wortkarg war und völlig durchgedreht mit seinem Fisch, daß er sie schlagen würde – nein, niemals! Vielleicht wär’s besser, wenn er’s täte? Vielleicht wäre das besser, als wenn er den ganzen Hof und das Holzhaus mit seinem Fisch verstänkerte?
Olja zuckte die Achseln bei ihren Überlegungen.
Diesen Stepan, Oksanas Mann, hatte man auf Kosten der Kolchose beerdigt. Und niemand hatte sich je wieder an ihn erinnert. Und auch Oksana hatte man anscheinend nicht wirklich gesucht. Ein Kriminalkommissar war gekommen, hatte ein Protokoll aufgenommen, das war alles gewesen. Und nun stand das Bauernhaus da wie ein Denkmal. Wieso sollte Oksana nicht von da zurückkehren, wo sie sich versteckt hielt? Vielleicht würde man ihr sofort verzeihen, man wußte ja schließlich, was für einer ihr Ehemann gewesen war.
Wieder zuckte Olja die Achseln und drehte sich von der Sonne weg. Sie betrachtete das Gras zwischen den Bäumen. Das Gras war noch grün. Es war, als ob es sich wieder aufrichtete, nachdem Olja die Last des Laubes von ihm weggerecht hatte.
So würde sich auch Oksana wieder aufrichten können, wieder aufblühen, nun da sie Stepan umgebracht hatte. Wenn man das Unkraut ausriß, schossen sofort alle guten Pflanzen in die Höhe, und erst recht wenn man danach noch weiterjätete!