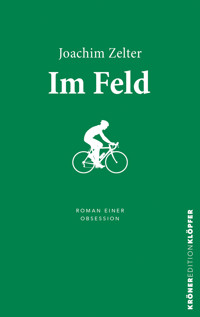9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Alfred Kröner Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Edition Klöpfer
- Sprache: Deutsch
Dass er einen Autounfall hatte, dass dabei einiges passiert sei, insbesondere in seinem Kopf und mit seinem Gedächtnis. Dass er zehn Tage im Koma gelegen habe und erst seit Kurzem wieder wach sei ... Und: dass er Claus Urspring heiße und er Ministerpräsident sei und es auch bleiben werde - ein politischer Begriff, ein Inbild der Vertrautheit und Unverrückbarkeit, der kurz vor einem alles entscheidenden Wahlkampf stehe ... All das und noch einiges mehr erfährt Claus Urspring, ein von Wahlkampfhelfern und politischen Beratern Getriebener, ein soufflierter und inszenierter Mensch, der seit seinem Unfall kaum mehr weiß, wer er einmal war und was mit ihm eigentlich ist. Zwischen liebenswerter Ahnungslosigkeit und kindlichem Erstaunen, zwischen Fremdsteuerung und eigensinniger Selbstbehauptung erzählt der Roman einen um Erinnerungen und Selbstfindung ringenden Helden, der sich in einer Welt wieder findet, in der Politik nur noch leere Inszenierung und inhaltloser Schein ist.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 195
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Der Ministerpräsident
Joachim Zelter
Der Ministerpräsident
Joachim Zelter, 1962 in Freiburg geboren, studierte und lehrte englische Literatur in Tübingen und Yale. Seit 1997 freier Schriftsteller. Autor von Romanen, Erzählungen und Theaterstücken, die an zahlreichen deutschen und österreichischen Bühnen gespielt werden. Sein Werk wurde vielfach ausgezeichnet, u.a. mit dem Thaddäus-Troll-Preis, der Fördergabe der Internationalen Bodenseekonferenz, dem Großen Stipendium der Kunststiftung Baden-Württemberg sowie dem Jahresstipendium des Landes Baden-Württemberg. Bei Klöpfer & Meyer sind erschienen: »Briefe aus Amerika« (1998), »Die Würde des Lügens« (2000), »Die Lieb-Haberin« (2002), »Das Gesicht« (2003), »Betrachtungen eines Krankenhausgängers« (2004), »Schule der Arbeitslosen« (2006), »How are you, Mr. Angst?« (2008), »Der Ministerpräsident« (2010) und »Die Welt in Weiß« (2011).
Das E-Book einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung des Verlags unzulässig und strafbar. Der Nutzer verpflichtet sich, die Urheberrechte anzuerkennen und einzuhalten.
Nutzungsbedingungen: Der Erwerber erhält ein einfaches und nicht übertragbares Nutzungsrecht, das ihn zum privaten Gebrauch des E-Books und all der dazugehörigen Dateien berechtigt. Der Inhalt dieses E-Books darf von dem Kunden vorbehaltlich abweichender zwingender gesetzlicher Regeln weder inhaltlich noch redaktionell verändert werden. Insbesondere darf er Urheberrechtsvermerke, Markenzeichen, digitale Wasserzeichen und andere Rechtsvorbehalte im abgerufenen Inhalt nicht entfernen. Der Nutzer ist nicht berechtigt, das E-Book – auch nicht auszugsweise – anderen Personen zugänglich zu machen, insbesondere es weiterzuleiten, zu verleihen oder zu vermieten. Das entgeltliche oder unentgeltliche Einstellen des E-Books ins Internet oder in andere Netzwerke, der Weiterverkauf und/oder jede Art der Nutzung zu kommerziellen Zwecken sind nicht zulässig. Das Anfertigen von Vervielfältigungen, das Ausdrucken oder Speichern auf anderen Wiedergabegeräten ist nur für den persönlichen Gebrauch gestattet. Dritten darf dadurch kein Zugang ermöglicht werden. Die Übernahme des gesamten E-Books in eine eigene Print- und/oder Online-Publikation ist nicht gestattet. Die Inhalte des E-Books dürfen nur zu privaten Zwecken und nur auszugsweise kopiert werden. Diese Bestimmungen gelten gegebenenfalls auch für zum E-Book gehörende Audiodateien.
© 2023 Alfred Kröner Verlag, Stuttgart
ISBN E-Book: 978-3-520-76626-7
Herstellung: Horst Schmid, Mössingen.
Satz: CompArt, Mössingen.
Mehr über das Verlagsprogramm des Alfred Kröner Verlags
finden Sie unter www.kroener-verlag.de.
eBook-Herstellung: Brockhaus Commission, Kornwestheim
Für Monica in Dankbarkeit
The cess of majesty
Dies not alone, but like a gulf doth draw
What’s near it with it. Or it is a massy wheel
Fix’d on the summit of the highest mount,
To whose huge spokes ten thousand lesser things
Are mortis’d and adjoin’d, which when it falls,
Each small annexment, petty consequence,
Attends the boist’rous ruin. Never alone
Did the King sigh, but with a general groan.
William Shakespeare,
Hamlet
Der Tod eines Königs ist nicht der Tod eineseinzigen, sondern zieht, wie ein Strudel, alles,was ihm nahe kommt, mit sich. Er ist wie einRad, das vom Gipfel des höchsten Bergs heruntergewälzt, unter seinen ungeheuren Speichen tausend kleinere Dinge zertrümmert. Ein König seufzt nie allein; wenn er leidet, leiden alle.
William Shakespeare,
Hamlet
Was ein Sonntag ist? Wollte ich wissen. Denn heute war Sonntag. Das sagte mir die Ärztin. Also fragte ich sie, was das sei, ein Sonntag? Und sie antwortete: Ein Sonntag ist ein Tag. Ein Tag neben anderen Tagen. Es gibt nicht nur einen, sondern viele Tage. Heute ein Tag, morgen ein Tag, übermorgen ein Tag … Das war einleuchtend.
Ich wollte eine Zahl wissen, eine grobe Zahl, wie viele Tage es ungefähr geben könnte: 300 Tage, 600 Tage, 1000 Tage? Nein, sagte die Ärztin, es sind sieben Tage. Nur sieben Tage? Das war wenig. Sie fragte, ob ich einige dieser Tage kennen würde? Nein, ich kannte keinen dieser Tage. Sie nannte zum Beispiel den Sonntag. Das sei ein Tag, sagte sie. Ob mir vielleicht andere Tage einfielen? Und ich sagte Mondtag. Das war ein Tag, der mir einfiel. Und sie sagte: Ja, fast richtig, Montag, ohne Mond, und sie nannte weitere Tage, Dienstag, Mittwoch, und ich nannte ihr die restlichen Tage, Donnerstag und Freitag und Samstag, und sie war glücklich.
Sieben Tage, vier Jahreszeiten, zehn Finger, zwölf Monate, neunundzwanzig Buchstaben und zahlreiche andere Zahlen, die ich kannte. Zum Beispiel mein Geburtsdatum. Oder die Geheimnummern meiner Scheckkarten. Oder einige Telefonnummern. Die Ärztin fragte nach diesen Nummern, und ich nannte ihr die Nummern in rasender Geschwindigkeit, und das überraschte sie.
Sie blieb bei mir und sprach von Lücken.
Lücken?
Jawohl, Lücken.
Welche Lücken?
Sie meinte Lücken in meinem Kopf. Namenslücken, Freundeslücken, Familienlücken, Berufslücken, Landschaftslücken, Erinnerungslücken, Wortlücken und andere Lücken … Sie setzte sich auf einen Stuhl und fand immer weitere Lücken. Ich fragte sie, was das sei, eine Lücke? Sie antwortete: Eine Lücke sei etwas, das nicht mehr ist, wo vorher etwas war. Vielleicht ist bei einer Lücke aber auch etwas nicht da, wo vorher auch nichts da war. Wie will man das wissen? Sie sagte nichts.
Ich sollte ihr nachsprechen. Oder mit ihr sprechen. Oder angefangene Wörter weitersprechen. Die Unterschiede zwischen einzelnen Buchstaben mit meiner Zunge spüren, zum Beispiel den Unterschied zwischen den Buchstaben D und T. T nicht wie D sprechen, D nicht wie T sprechen. Nicht Tuten, sondern Duden. Nicht Busen, sondern Blusen. Sie trug weiße Blusen. Wunderschöne Blusen.
Herr März kam. So nannte er sich: März. Julius März. März wie Januar, Februar, März. Er kannte mich. Er kannte mich mit einer Vehemenz, die mich beeindruckte. Er fragte gar nicht: Ob auch ich ihn kenne? Es gab für ihn keinen Zweifel, dass ich ihn kenne. Schon seit Jahren. So sah er jedenfalls aus. Als würde oder müsse man ihn schon lange kennen. Er sprach lautstark. In mein Bett hinein. Und über mein Bett hinweg: Was ich für Sachen machen würde? Heijeijei. Was mit meinem Gesicht sei? Heijeijei. Ich hörte von einer Lähmung. Einer Lähmung meiner rechten Gesichtshälfte. So erklärte ihm das die Ärztin. Das rechte Auge schließe nicht ganz. Dafür reagierten die Pupillen. Bei einer immer noch starren Mimik. Und mein Mund sei noch ein wenig schief. Doch das werde wieder. Hörte ich sie sagen. Und März antwortete: Hoffentlich. Er verabschiedete sich. Drückte meine Hand. Mit beiden Händen drückte er meine Hand. Und er sagte: Du. Nicht Sie, sondern Du. Dann ging er.
Kein Radio, kein Fernsehapparat. Dass das nicht gut sei, sagte die Ärztin, ein Radio, ein Fernseher an meinem Bett. Jedenfalls nicht jetzt. Dass mich das aufregen und erschrecken könnte. Dafür Blumen, in allen Farben und Variationen. Verbunden mit Grüßen und den besten Wünschen von zahllosen Menschen.
Sie, die Ärztin, reichte mir ein Notizheft, in das ich schreiben sollte. Zum Beispiel meinen Namen, Claus Urspring. Ich konnte den Namen auf Anhieb schreiben. Obgleich der Name seltsam klang. Wie aus einem Traum. Claus Urspring. Und ich konnte den Namen auch lesen. Doktor Claus Urspring. Was die Ärztin erfreute. Sie freute sich auch über meine Schrift. Sie sagte, das sei eine sehr flüssige und schöne Schrift. Ich fragte sie nach ihrem Namen, und sie antwortete: Doktor Wolkenbauer. Und ich schrieb den Namen ins Notizheft.
Alles, was mir einfiel, sollte ich aufschreiben. Was ich wusste und was ich nicht wusste. Was ich wissen wollte oder auch nicht wissen wollte. Was ich verstand oder nicht verstand. All das sollte ich aufschreiben. Selbst über den Schnee sollte ich schreiben. Ich wünsche mir einige Zeilen von Ihnen über den Schnee, sagte sie. Schreiben Sie Erinnerungen, Szenen, Bilder, Überlegungen zum Schnee.
Schnee?
Jawohl, Schnee.
Oft verstand ich sie nicht. Sie sagte dann: Falls ich etwas nicht verstehen würde, dann sei das nicht schlimm. Ich solle dann einfach einen Strich in mein Heft machen. Auf die rechte Seite. In eine Spalte mit der Überschrift: Verstehe ich nicht. Und so machte ich Strich auf Strich. Verstehe ich nicht. Zum Beispiel als sie über das Wort Doktor in meinem Namen sprach. Doktor Urspring. Dass das kein Vorname sei, Doktor, sondern ein Titel, eine Anrede, ein Rang. Das sei ein Doktor. Sie sei Doktor und ich sei Doktor, aber die Pflegerin, sie sei kein Doktor – was ich nicht verstand. Warum sollte sie kein Doktor sein? Warum nicht? Trotzdem nickte ich. Bis Frau Doktor Wolkenbauer mir das Notizheft aus der Hand nahm und all die Striche sah, die ich gemacht hatte: Verstehe ich nicht. Warum ich dann trotzdem die ganze Zeit genickt hätte? Wenn ich sie gar nicht verstehen würde. Um ihr eine Freude zu machen, antwortete ich.
Dass ich einen Autounfall gehabt hatte. Dass dabei einiges passiert sei, insbesondere in meinem Kopf und mit meinem Gedächtnis. Dass ich zehn Tage im Koma gelegen hätte. Dass ich erst seit Kurzem wieder wach sei. Dass alle Welt bestürzt und besorgt gewesen sei – und ohne Worte. Wegen meines Unfalls.
Unfall?
Jawohl, Unfall.
Doch ich verstand nicht Unfall, sondern Umfall, und ich fragte März, was das bedeute, ein Umfall? Und März lächelte und sagte: Dass das kein Umfall gewesen sei, den ich hatte, sondern ein Unfall. Das sei ein Unterschied. Er beäugte die Infusionsflasche und blätterte in Akten. So nannte er die Papiere auf seinem Schoß. Akten. Er grüßte. Er grüßte von Mitarbeitern und Freunden. Er grüßte von seiner Frau und von zahllosen Namen. Er grüßte mit zählenden Fingern. Er grüßte, bis ich müde wurde.
Ein Blumenstrauß stand auf meinem Nachttisch. Auf einem anderen Tisch standen weitere Blumensträuße. Blumenstrauß neben Blumenstrauß. Nie sah ich so viele Blumensträuße. Während März telefonierte: Dass es mir täglich besser gehe. Dass mein Zahlengedächtnis sehr zufriedenstellend sei. Angesichts der Schwere des Unfalls. Dass ich zum Beispiel die Nummern meiner Scheckkarten kennen würde. Dass ich die Blumen auf meinem Nachttisch riechen könne. Dass das ein gutes Zeichen sei, habe ihm die Ärztin versichert. Dass ich immer deutlicher sprechen würde. Nur hin und wieder verwechselt er noch Namen und Zeiten und Gesichter. Doch das wird wieder. So März.
Er wich nicht von meiner Seite. Ob er mir etwas bringen dürfe? Etwas zu trinken? Oder sonst irgendetwas? Ich verneinte. Er saß bedächtig auf einem Stuhl und beobachtete alle im Raume befindlichen Apparaturen. Zum Beispiel die Anschlüsse über meinem Bett: Sauerstoff. Vakuum. Druckluft. Er berührte die Anschlüsse mit seinen Fingern – ehrfurchtsvoll. Oder er lief durch das Zimmer und zählte Blumensträuße. Siebzehn Blumensträuße. Allein nur in meinem Zimmer. Und weitere Blumensträuße standen oder warteten vor dem Zimmer. Er zählte nicht nur Blumensträuße, sondern auch Infusionsflaschen. Drei verschiedene Infusionen, die mir zugeführt wurden. Und er erzählte mir, dass gleich nach dem Unfall acht verschiedene Schläuche in mir gewesen waren: Beatmungsschlauch, Magensondenschlauch, Katheterschlauch, Drainageschlauch und vier Infusionsschläuche.
Und er erzählte mir von Mitpatienten, die er, März, in der Klinik gesehen hatte, alles nette und respektable Patienten: Schauspieler, Bankiers, Universitätsprofessoren … Auch ein Fußballspieler. Selbst Patienten aus Amerika. Mancher Patient ließ grüßen. Und ich grüßte zurück. Wer immer dieser oder jener Patient, der mich grüßte, auch sein mochte. Ich grüßte zurück. Über manche Patienten, die März gesehen hatte, sprach er flüsternd: Auch so ein …
Wie bitte?
Auch so ein …
Auch so ein wer?
Auch so ein (geduckt gesprochen) Versehrter. Fast jeder Patient, von dem er sprach, war ein Auch. Auch so ein Fall. Auch so eine Sache. Auch so ein Unglück.
Und er zählte wieder Blumensträuße. Mehr als zwanzig Blumensträuße, die nun in meinem Zimmer standen. Er behandelte diese Blumen wie überfällige Gaben. Na also, sagte März, wenn ein neuer Blumenstrauß hereingetragen wurde. Na also. Als ob es höchste Zeit wäre. Und er sprach erneut ein Auch: Auch gut, wenn eine Topfpflanze hereingebracht wurde. Oder: Auch so ein Fall. Wenn der Hubschrauber neue Patienten in die Klinik brachte. Oder er sagte: Oder. Es geht doch, oder? Oder er sagte denn. Geht es denn? Danke ja, es ging denn. Oder wenn nicht denn, dann bereits oder schon …
Denn, bereits, schon – fragte er die Ärztin. Er wolle nicht beunruhigen. Doch es müssten einige Akten verlesen werden. Und Unterschriften geleistet werden. Nur ganz wenige, jedoch sehr wichtige Unterschriften. Unterschriften von einiger Tragweite. Doch Frau Wolkenbauer verbot das, und Julius März packte die Akten wieder zusammen. Für einige Zeit wirkte er devot. Er half den Schwestern beim Abräumen des Essens. Mit leichten Verbeugungen stand er auf und öffnete ihnen die Tür. Deutete federnden Schrittes an, wie gesund er ist. Und er lobte. Er lobte die Ärzte, er lobte die Pfleger, er lobte die Klinik. Heiligenberg. Er sagte: Das sei eine sehr gute Klinik. In nicht wenigen Fachbereichen sei die Klinik führend. Patienten aus aller Welt seien hier. Auf einem Korridor habe er sogar arabische Stimmen gehört. Und er las mir aus dem Klinikprospekt einige Sätze vor: Heiligenberg. Traumatologisches Schwerpunktkrankenhaus der Maximalversorgung. Fast ein wenig schwärmerisch sagte er das. Maximalversorgung. Mitten im Hochschwarzwald. Er zeigte mir den Prospekt. Damit ich eine Ahnung bekomme, wo ich überhaupt war. Nicht irgendwo, sondern in Heiligenberg. Ich blätterte in dem Prospekt und betrachtete die Fotos. Das Klinikum hoch erhoben im Schwarzwald. Unten im Tal liegt Nebel. Die Klinik aber steht in der aufgehenden Sonne. Ein Hubschrauber fliegt auf sie zu. Willkommen.
Er fragte einen Pfleger, ob er stolz sei? Stolz? Worauf? fragte der Pfleger, und März deutete auf mich. Ob er, der Pfleger, nicht ein wenig stolz sei, mich behandeln zu dürfen. Claus Urspring. Der Pfleger nickte. Als er gegangen war, holte März erneut Akten hervor, die er mir vorlegte. Nur ein kurzer Blick, sagte er. Nur ein Blick. Ein leichtes Nicken, ein oder zwei Wörter, die ich vielleicht zu einem Vorgang im Groben sagen könnte – nicht mehr.
Als Frau Wolkenbauer den Raum betrat, erklärte er ihr, dass das nur ein ganz kurzer Blick gewesen sei, den ich in eine Akte geworfen hatte, nur ein flüchtiger Blick, nicht mehr, erklärte er ihr, die sich entschieden gegen jedes weitere Aktenstudium verwahrte. Zumindest kein Aktenstudium in meinem gegenwärtigen Zustand. Einstweilen versteckte März die Akten in meinem Kulturbeutel. Wenn wir uns allein glaubten, dann holte er sie wieder hervor, um mir die Akten zu zeigen. Er las mir aus den Akten vor, und ich nickte – zustimmend. Oder nachdenklich, wenn auch er nachdenklich nickte.
Dass er nicht drängen wolle, so März zu Frau Wolkenbauer, dass er vielmehr abschätzen wolle, wie viele Wochen die weitere Genesung noch dauern werde? Nicht Wochen, sondern Monate, antwortete Frau Wolkenbauer. Monate. Und März schwieg. Und er fragte sie, welcher Art meine Einschränkungen denn seien? Kognitive Einschränkungen, neurologische Einschränkungen und motorische Einschränkungen, erklärte Frau Wolkenbauer. Hinzu kam noch eine Einschränkung meines Gangs. Ein Hinken, das sich gezeigt habe. Julius März hatte es selbst bemerkt, als wir einige Schritte auf dem Flur gegangen waren. Aber du hinkst ja, hatte er gesagt und das den Ärzten gemeldet. Also auch noch ein Hinken. Auch das noch, sagte März.
Er saß am Telefon und sagte: Ich sei auf dem Weg der Besserung. Es würden noch Untersuchungen durchgeführt. Er sehe diesen Untersuchungen mit Zuversicht entgegen. Mein Zahlengedächtnis sei schon wieder so gut wie früher. Er kennt PIN-Nummern, Telefonnummern und Postleitzahlen. Auch Geburtstage. Und historische Jahreszahlen. Er spricht ganze Sätze. Er weiß, dass er Ministerpräsident ist, und er will es auch bleiben. Sagte März. Er sagte auch, dass ich in vielen Dingen schon wieder ganz der Alte sei. Claus Urspring, wie man ihn kennt. Und auch zu mir sagte er, dass ich schon fast wieder der Alte sei. Claus Urspring. Wie er leibt und lebt.
Er ließ Frau Wolkenbauer wissen, dass in zwei Wochen ein Termin sei. Was für ein Termin? fragte Frau Wolkenbauer. Ein politischer Termin, so März. Frau Wolkenbauer lehnte das ausdrücklich ab, und März beschwichtigte, dass ich die Klinik deshalb nicht zu verlassen brauchte. Es wäre nur hilfreich, wenn ich ein paar Worte sprechen würde, zu einigen Delegierten, so März, Delegierte des Landesparteitags. Man sei in Sorge um mich, und ein paar wenige Worte von mir wären äußerst wichtig. Nur ein paar wenige allgemeine Worte, als Videoaufzeichnung gesprochen, was Frau Wolkenbauer ebenfalls ablehnte. Nicht in meinem gegenwärtigen Zustand. März meinte persönliche Worte, keine politischen Worte, was Frau Wolkenbauer trotzdem verweigerte. Weshalb März vorschlug, wenn schon kein Grußwort, dann vielleicht eine Filmeinspielung, wie ich einige Meter im Klinikpark laufe: erste Gehbilder fortschreitender Genesung. Genau das, was man von einer Genesung erwarte. Oder, statt eines Grußwortes, ein einzelnes Grußbild: nicht im Krankenbett, nicht im Pyjama, auch nicht im Bademantel, sondern im Trainingsanzug auf einem Stuhl sitzend. Ein leichtes Winken. Wie zum Gruß.
Eine Frau kam ins Zimmer. Sie sagte: Ich will zu meinem Mann. Sie sagte das zu Frau Wolkenbauer, die mir gerade Blut abnahm, und sie sagte das auch zu mir: Ich will zu meinem Mann. Und sie schaute mich an, als könnte ich ihr vielleicht weiterhelfen. Mein Mann. Also suchte ich mit ihr, nach ihrem Mann. Zumindest suchte ich mit meinen Augen. Ob er vielleicht irgendwo in der Nähe sein könnte. Oder draußen im Gang war. Doch sie ging nicht nach draußen, sondern blieb bei mir. Sie sagte: Die Bettdecke meines Mannes. Sie sei viel zu dünn. Und sie meinte meine Decke, die der Pfleger bitte wechseln solle. Oder die Infusionsflasche. Sie sei fast leer. Und in der Tat: Sie war fast leer. Und es war meine Infusionsflasche, nicht die Infusionsflasche eines anderen. Wenn Sie bitte danach schauen würden, sagte sie. Und der Pfleger schaute danach, und er schaute nach mir, als wäre ich in der Tat ihr Mann.
Wenn sie Mann sagte, dann schnürte sie ihren Bauch zusammen und betonte jeden einzelnen Buchstaben. Mein Mann. Vorher machte sie eine kleine Pause. Um Luft zu holen oder Anlauf zu nehmen, um das zu sagen: mein Mann.
Sie stand wie in einem Fundbüro. Als wollte sie einen Koffer abholen. Mein Mann. Oder sie saß stumm auf einem Stuhl. Ich bin auch noch da. So saß sie vor mir. Ich bin auch noch da. Sie fragte: Woran ich denke? Was mit mir sei? Warum ich nichts sage? Warum ich nicht zuhöre? Warum ich sie nicht anschaue? Warum ich mich verstecke? Warum ich ihren Namen nicht spreche? Warum ich sie nicht berühre? Und sie nichts frage? Und sie nicht anlächle? Oder streichle?
März kam mir zur Hilfe. Er beruhigte sie und führte sie aus dem Zimmer. Später kam er zu mir zurück und sagte: Das werde wieder. Sie, meine Frau, sei nur ein wenig verstört. Verstört infolge meines Unfalls. Verstört wegen meines Zustandes nach dem Unfall. Verstört darüber, dass ich sie nicht mehr kenne. Oder kennen wolle? So viele Zahlen und Namen, die ich auf Anhieb kennen würde, Kontonummern und Telefonnummern, ja sogar die Telefonnummer meiner Frau, die ich ihr aufgesagt hatte – nur meine Frau selbst würde ich nicht mehr kennen. Das sei sehr schade.
Doch das werde wieder, so März.
Wer sie ist? Woher sie kommt? Seit wann wir verheiratet sind? Warum ich überhaupt verheiratet bin? Der Gedanke war mir fern. Verheiratet zu sein. Eine Frau zu haben. Oder von einer Frau gehabt zu werden. Ob das überhaupt notwendig sei? fragte ich März. Er antwortete: Nicht unbedingt notwendig, aber hilfreich, aus zahllosen Gründen. Auch aus politischen Gründen. Nicht zuletzt wegen des bevorstehenden Wahlkampfs. Es sei gut und richtig, wenn ein Ministerpräsident eine Frau habe.
Man könnte genauso gut etwas anderes haben, dachte ich: Einen Hund. Ein Pferd. Oder ein Fahrrad … Oder Kinder. Und ich fragte März nach Kindern: Ob ich Kinder habe? Und er sagte: Nein. Und ich fragte: Ob meine Frau bei dem Unfall dabei gewesen sei? Und er sagte nein. Ob bei dem Unfall irgendjemand zu Schaden gekommen sei? Aber nein, so seine Antwort: Niemand sei bei dem Unfall zu Schaden gekommen, außer mir.
März schlug vor, erst einmal andere Fragen anzugehen, zum Beispiel die Frage meines Kabinetts. Er legte mir eine Liste vor. Mein Kabinett. Was ein Kabinett ist? Es ist ein Beraterkreis. Ob ich das Wort Kabinett schon einmal gehört hätte? Es rief eine entfernte Erinnerung hervor. Eine Erinnerung an sonderbare Gestalten aus meiner Schulzeit. Daran erinnerte mich das, das Wort Kabinett. Mir kam das Wort Rarität in den Sinn. Rarität und Kabinett. Ein Raritätenkabinett. Doch März sagte: Mein Kabinett sei kein Raritätenkabinett, sondern ein Ministerkabinett. Er legte mir eine Liste mit Namen vor, die ich lernen sollte: elf Minister in zehn Ministerien. Und ich fragte: Warum nicht elf Minister für elf Ministerien? Und März antworte: Weil es einen Minister ohne ein eigenes Ministerium gibt. Und ich fragte: Ob das nicht traurig sei? Ein Minister, der gar kein eigenes Ministerium hat. Und März winkte ab und sagte: Das sei nun einmal so. Das sei ein weites Feld.
Er zeigte mir Fotos. Ob mir manche Gesichter etwas sagen würden? Nein. Zum Beispiel der Finanzminister? Leider nein. Oder der Minister für Ernährung und Ländlichen Raum? Nein. Die Fotos sagten mir nichts. Oder sie sagten etwas anderes als das, was März hören wollte. Zum Beispiel der Minister für Wissenschaft, Forschung und Kunst. Er sah aus wie ein armes, überladenes Eselchen. So sah er aus. Doch März sagte, es sei nicht wesentlich, wie er aussehe. Wichtig sei, dass er Minister sei, Minister für Wissenschaft, Forschung und Kunst. Ein anderer Minister sah aus wie ein alter Klassenkamerad von mir. Ein Schulfreund namens Gernold Strobel. So beherzt blickte mich dieser Minister an. Wie Gernold Strobel. Eifrig, zuvorkommend und zu allem bereit. Doch war dies nicht Gernold Strobel, sondern der Minister für Kultus, Jugend und Sport.
Es glich dem Vokabellernen in der Schule: die Namen der Ministerien, die ich lernte, und die Namen der Minister, die ich ebenfalls lernte, wie auch die dazugehörigen Gesichter. Jeder Minister hatte Eigenschaften, die März mir nannte: Finanzminister – bockig; Wirtschaftsminister – willig; Kultusminister – eifrig; Justizminister – rechthaberisch. März malte mit roter Tinte Ausrufezeichen. Vorsicht! Justizminister! Vorsicht! Schwierig! Wie Warnschilder auf einer Straße. Und er deutete mit einem langen Stift auf das Wort Staatsministerium. Was dieses Ministerium sei? Was dieses Ministerium bedeute? Was dieses Ministerium mache? Es plane, es koordiniere, es regiere, es empfehle, es helfe, es berate: den Regierungschef, den Landesvater, den Ministerpräsidenten – einen Menschen wie mich.
All das machte mich müde. Ich betrachtete viel lieber Bildbände von Landschaften. Zum Beispiel den Bodensee. Oder den Rhein. Ich betrachtete wunderschöne Mädchen, die von einem Boot ins Wasser springen. Mit fliegenden Haaren und nassen Badeanzügen. Ich wollte viel lieber diese Bilder sehen statt Ministerbilder. Auch Frau Wolkenbauer war gegen die Ministerbilder. Sie seien gegen jede Abmachung. Sie störten den Therapieverlauf. Also nahm sich März zurück und versteckte die Kabinettslisten und Ministerbilder unter meiner Bettdecke. Wenn er sich unbeaufsichtigt glaubte, dann holte er sie wieder hervor und fragte mich ab.
Ein Arzt trat an mein Bett. Ich hatte ihn bislang noch nicht gesehen. Er sagte: Wenn Sie bitte Ihr Bein freimachen würden, Herr Ministerpräsident. Dann untersuchte er mein Bein. Ob das schmerzhaft sei? Er überprüfte die Innen- und Außenrotation der Hüfte. Er bat mich aufzustehen. Ich sollte einige Schritte gehen. Dabei beäugte er meinen Gang – kommentarlos. Oder auch nicht kommentarlos. Er sagte einige Worte zu Frau Wolkenbauer. Und auch zu März. Auch das noch, sagte März. Und ich hätte ihn gerne gefragt: Was denn sonst noch? Doch März hatte nur noch Ohren für den Arzt, der mehr zu März sprach als zu mir. Er veranlasste eine zusätzliche Röntgenuntersuchung: eine Untersuchung der rechten Hüfte. Um ganz sicher zu gehen. Wegen meines schiefen Gangs. Wahrscheinlich eine Nebenverletzung im Gefüge all der anderen Verletzungen. So der Arzt.
Als er später die Röntgenbilder mit Frau Wolkenbauer an meinem Bett besprach, war die Rede von einer Veränderung. Wo? Hier. Eine Veränderung des Hüftkopfes. Diagnostisch eindeutig. Er habe sich die Aufnahmen immer wieder angeschaut, die Röntgenbilder auf dem zentralen Klinikcomputer noch einmal vergrößert. Man sollte das im Auge behalten. Womöglich eine Durchblutungsstörung des Hüftkopfes. Infolge einer partiellen Fraktur. Und er veranlasste weitere Untersuchungen, eine MRT-Untersuchung. Eine solche Untersuchung könnte weitere Aufschlüsse geben. März wirkte besorgt. Was das bedeute, eine Durchblutungsstörung des Hüftkopfes? Ob das eine ernstere Sache sei? Oder nur vorübergehend? Der Arzt reagierte ausweichend. Man müsse die weiteren Untersuchungen abwarten. Und er ging.