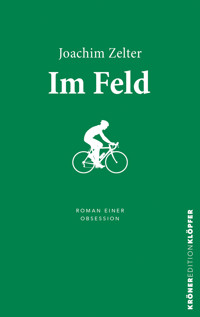9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Alfred Kröner Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Edition Klöpfer
- Sprache: Deutsch
Hier ist er: Heinrich Manns Roman »Der Untertan«, ganz anders, neu erzählt für unsere Zeit. Mit großem menschlichem Gespür erzählt Joachim Zelter, was längst überfällig war: die Entwicklungsgeschichte des modernen Untertanen in der Welt von heute, erzählt von der frühen Schulzeit bis zum Erwachsenenalter, von den Siebzigerjahren bis in die Jetztzeit. Ein Psychogramm, ein gesellschaftliches Sittengemälde, ein Spiegelbild individueller wie kollektiver Anpassung - und menschlicher Entfremdung. Unnachahmlich beschreibt Joachim Zelter das Zusammenspiel von Selbstverleugnung, Nicht-Sein und Aufgehen im Anderen, im Mächtigen und im geschichtlich Werdenden. Am Ende erzählt der Roman unser aller Geschichte: Wie wir zu dem geworden, was wir heute sind.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 196
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Joachim Zelter 1962 in Freiburg geboren, studierte und lehrte englische Literatur in Tübingen und Yale. Seit 1997 freier Schriftsteller. Autor zahlreicher Romane, Erzählungen und Theaterstücke. Sein Werk wurde vielfach ausgezeichnet, u.a. mit dem Thaddäus-Troll-Preis, der Fördergabe der Internationalen Bodenseekonferenz, dem Großen Stipendium der Kunststiftung Baden-Württemberg sowie dem Jahresstipendium des Landes Baden-Württemberg. Bei Klöpfer & Meyer sind beispielsweise (und in mehreren Auflagen) erschienen: »Die Würde des Lügens«, »Betrachtungen eines Krankenhausgängers«, »Schule der Arbeitslosen«, »Die Welt in Weiß« sowie, hoch gelobt: »Der Ministerpräsident«, mit dem Joachim Zelter 2010 auf der Longlist zum Deutschen Buchpreis stand.
www.joachimzelter.de
Das E-Book einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung des Verlags unzulässig und strafbar. Der Nutzer verpflichtet sich, die Urheberrechte anzuerkennen und einzuhalten.
Nutzungsbedingungen:
Der Erwerber erhält ein einfaches und nicht übertragbares Nutzungsrecht, das ihn zum privaten Gebrauch des E-Books und all der dazugehörigen Dateien berechtigt. Der Inhalt dieses E-Books darf von dem Kunden vorbehaltlich abweichender zwingender gesetzlicher Regeln weder inhaltlich noch redaktionell verändert werden. Insbesondere darf er Urheberrechtsvermerke, Markenzeichen, digitale Wasserzeichen und andere Rechtsvorbehalte im abgerufenen Inhalt nicht entfernen. Der Nutzer ist nicht berechtigt, das E-Book – auch nicht auszugsweise – anderen Personen zugänglich zu machen, insbesondere es weiterzuleiten, zu verleihen oder zu vermieten. Das entgeltliche oder unentgeltliche Einstellen des E-Books ins Internet oder in andere Netzwerke, der Weiterverkauf und/oder jede Art der Nutzung zu kommerziellen Zwecken sind nicht zulässig. Das Anfertigen von Vervielfältigungen, das Ausdrucken oder Speichern auf anderen Wiedergabegeräten ist nur für den persönlichen Gebrauch gestattet. Dritten darf dadurch kein Zugang ermöglicht werden. Die Übernahme des gesamten E-Books in eine eigene Print- und/oder Online-Publikation ist nicht gestattet. Die Inhalte des E-Books dürfen nur zu privaten Zwecken und nur auszugsweise kopiert werden. Diese Bestimmungen gelten gegebenenfalls auch für zum E-Book gehörende Audiodateien.
ISBN E-Book: 978-3-520-76628-1
© 2023 Alfred Kröner Verlag, Stuttgart
Herstellung: Horst Schmid, Mössingen.
Satz: CompArt, Mössingen.
Mehr über das Verlagsprogramm des Alfred Kröner Verlags
finden Sie unter www.kroener-verlag.de.
eBook-Herstellung:
Brockhaus Commission, Kornwestheim
UNTERTAN
Joachim Zelter
UNTERTAN
Roman
KrönerEditionKlöpfer
Für Simone
Dass das menschliche Leben lebenswert ist oder vielmehr lebenswert gemacht werden kann oder sollte.
HERBERT MARCUSE,
Der eindimensionale Mensch
FRIEDERICH OSTERTAG
war ein verträumtes Kind, das kaum wusste, wie ihm geschah oder was man von ihm eigentlich wollte. Oft fühlte er sich blutleer, so als wäre er soeben krank geworden oder verstorben und würde nur noch zum Schein weiterleben, ein Scheinlebender in den überwarmen Zimmern des Elternhauses.
Lachhaft. Das war das Wort. Als Friederichs Vater Friederichs Mutter zum ersten Mal nach Hause gebracht hatte, da hatte Friederichs Großmutter noch im selben Moment gesagt: »Diese Frau willst du heiraten. Das ist ja lachhaft.« Dabei hatte Friederichs Vater sie nur nach Hause bringen und ihr das Geschäft zeigen wollen und bei dieser Gelegenheit auch das übrige Haus, eines der ältesten Häuser der Stadt. Er hatte sie ins Wohnzimmer führen und ihr feierlich das Gemälde über dem Sofa zeigen wollen:
»Das ist er.«
»Wer?«
»Heinrich Ostertag.«
Der Höhepunkt jeder Hausführung. Heinrich Ostertag, der Erfinder des berühmten Brettspiels.
»Welches Brettspiels?«
»Fang den Hut.«
»Fang den Hut?«
»Jawohl, Fang den Hut.«
Dass sein Urgroßvater, Heinrich Ostertag, es gewesen war, der dieses Spiel erfunden hatte. Eines der schönsten und ältesten Spiele der Welt.
All das erklärte Friederichs Vater Friederichs Mutter, als er sie zum ersten Mal ins Haus brachte, bis die Großmutter kam und Friederichs Mutter nach draußen schickte und zu Friederichs Vater sagte:
»Und diese Frau willst du heiraten.«
»Ja.«
»Das ist ja lachhaft.«
Er heiratete sie trotzdem.
Die Hochzeit ereignete sich mit dem Wort wenigstens. Wenigstens eine neue Frisur. Wenigstens eine richtige Bluse. Wenigstens eine hochdeutsche Aussprache. Wenigstens war das ständige Wort, das Friederichs Mutter zu hören bekam. Angesichts der bevorstehenden Hochzeit. Ein Unding von Hochzeit. Eine Hochzeit zur Unzeit. Für die Großmutter eine Tiefzeit, ein Tiefpunkt in einer Tiefzeit. Und wenn schon eine solche Hochzeit, dann wenigstens ein anständiges Hochzeitskleid oder andere Leintücher. Wenigstens über wenigstens, das durch das Haus hallte. Was Friederichs Mutter auch tat und sagte, es war nicht mehr als ein Wenigstens. Sie verwechselte Besteckstücke, aß in der falschen Besteckreihenfolge, schnitt Pellkartoffeln mit dem Messer …
»Doch nicht mit dem Messer!«
In ihrer Aufregung sagte sie sogar Fand den Hut statt Fang den Hut. Die Großmutter war außer sich:
»Aber doch nicht Fand den Hut!«
Es stellte sich sogar heraus, dass sie noch nie in ihrem Leben Fang den Hut gespielt hatte. Wie so etwas möglich sein kann. Eine Kindheit ohne Fang den Hut. Als wäre das gar keine Kindheit gewesen.
Es gab Momente, in denen Friederichs Mutter weglaufen wollte, zunächst allein, später dann mit Friederich, der noch gar nicht geboren worden war. Und es gab Augenblicke, da sie mit ihm auf einer Brücke stand und in Gedanken schon gesprungen war.
Als Friederich Ostertag geboren wurde, da sah er dem Vater durchaus ähnlich, was die Großmutter erfreute, sie sogar für ihn einnahm: »Er sieht ihm sogar ähnlich«, sagte sie. Als wäre damit ein Anfang geschafft. Obgleich er oft weinte, was der Mutter zugeschrieben wurde. Alles Weinende, alles Traurige, alles Lärmende – das war die Mutter. Das Artige und Anmutige war dagegen der Vater und natürlich auch der Großvater und noch mehr noch der Ururgroßvater, Heinrich Ostertag, der Erfinder von Fang den Hut.
Nur ganz selten spielte man bei den Ostertags tatsächlich Fang den Hut. Man betrachtete das Spiel vielmehr. Man erfreute sich an dessen bloßer Anwesenheit, an den leuchtenden Hütchen, die wie die Figuren eines Schachspiels behutsam hin- und hergeschoben wurden, während der Vater im Sessel saß und Zeitung las und gelegentlich von dem Geschäft sprach.
Von dem Geschäft sprach man meist als dem Geschäft, nur selten von einem Spielwarengeschäft. So als wären den Ostertags all die Spiele im Schaufenster ein wenig unheimlich. Ein notwendiges Übel. So wie auch die lärmenden Kinder, die im Geschäft ein- und ausgingen. Wenn es denn unbedingt sein muss, so die Blicke des Vaters. Wenn es unbedingt sein muss. Sobald die Kinder wieder draußen waren, da atmete der Vater auf, da war das Geschäft wieder ein ernsthaftes Geschäft, und kein Spielwarengeschäft. So wie auch Friederichs Zimmer kein Spielzimmer war, sondern eher ein Jugendzimmer mit soliden Möbeln. Keine Spur von Spielsachen, die den Eindruck eines solchen Zimmers nur zu stören schienen. Und wenn Friederich dennoch einmal im Schaufenster ein Spiel entdeckte, das er gerne nach oben genommen hätte, dann waren diese Spiele nur Ausstellungsstücke oder für ihn völlig ungeeignet. Entweder war Friederich für ein Spiel noch zu jung oder bereits viel zu alt. Jedes Spiel, nach dem er griff, war deplatziert oder verfehlt, zu klein oder zu groß, passte nicht in sein Zimmer oder nicht zu seinem Alter, oder war eine Lächerlichkeit oder Albernheit. Nur ein Schachspiel hätte man ihm gelassen, wären die Figuren nicht aus Plastik gewesen, sondern aus richtigem Holz.
Die Aussicht auf den Pfänder, auf die Alpen, auf den Bodensee – all das ersetzte die fehlenden Spiele. Mit dem Fernglas beobachtete er Ausflugsdampfer und Fährschiffe. Er beobachtete nicht nur, sondern er fuhr im Geiste mit diesen Schiffen über den See, mal als Passagier, mal als Schiffsjunge oder Kapitän. Er fuhr mit diesen Schiffen die Ufer entlang oder quer über den See in die Schweiz. Oder er betrachtete stundenlang den Säntis, sah sich (mit einer Hand an der Gardinenschnur) als Bergsteiger in furchterregenden Steilhängen, durch die er sich Meter für Meter emporarbeitete. Das waren Friederichs Spiele, und die Großmutter, die das sah, sie schimpfte nicht. Kein Möbelstück hatte Friederich dabei beschädigt oder auch nur verschoben – höchstens in Gedanken.
Sie stand mit ihm am Fenster und sagte: »Ach die Schweiz.« Sie stand oft mit ihm am Fenster und blickte in die Schweiz. In der ganzen Stadt gab es kein Haus mit einem besseren Blick auf die Schweiz. Ein Blick, der nachts sogar noch schöner war als tags. Nachts leuchteten all die Uferstraßen und Ortschaften am See, und sie leuchteten auf der Schweizer Seite wärmer als irgendwo sonst.
Das Wort Mittelstand. Wie oft dieses Wort im Wohnzimmer gesprochen wurde. Wenn der Vater, mit der Welt zufrieden, die Zeitung zusammenfaltete. Oder er mit diesem Wort eine Mahlzeit beschloss: »Ach der Mittelstand.« Meist mit einem leichten Seufzen gesprochen. »Ja, der Mittelstand.« Zunächst verstand Friederich darunter nur so etwas wie einen Verkaufsstand, vielleicht einen Obst- oder Gemüsestand in der Mitte des Marktplatzes. Erst mit den Jahren eröffnete sich Friederich die Tragweite des Wortes. Mittelstand. Zum Beispiel das Ostertägliche Geschäft – das war Mittelstand. Wie auch das Bekleidungsgeschäft um die Ecke. Mittelstand. Doch die Wurstbude am Bahnhof, das war kein Mittelstand, das war außerhalb der Welt.
Der Vater erklärte ihm: Mittelstand, das sei die Mitte von allem, das sei weder oben noch unten, links noch rechts, reich noch arm … Mittelstand, das sei eine eigene Welt, ein gebohnertes Treppenhaus, ein Tischgebet, ein gemeinsames Mittagessen, ein Mittagschlaf, ein Herabschreiten ins Geschäft. Mittelstand, das sei die Mitte von allem: die Mitte der Familie, die Mitte der Mitarbeiter, die Mitte der Stadt, die Mitte der ganzen Welt.
ALS FÜNFJÄHRIGER WURDE ER EINGESCHULT.
Auch das war Mittelstand. Ein Vorausgehen, ein Vorausschauen, wo andere Kinder Fahrrad fuhren oder im See badeten. Der Vater selbst ging mit Friederich zur Schule, um ihn anzumelden. Er begrüßte den Schulleiter, überreichte ihm ein Schachspiel, ein Geschenk der Firma, deutete auf Friederich, der einen Anzug trug und einen Diener machte. Als der Schulleiter von Friederichs Alter sprach, da war das für den Vater kein Hinderungsgrund, sondern eher ein Zeichen von Schnelligkeit und Auffassungsgabe. So als wäre die Zahl fünf bereits eine eigene Leistung. Ein Akt des Mutes und kühner Freiwilligkeit. Der Junge langweile sich sonst. Und der Vater reichte dem Schulleiter eine Schriftprobe von Friederichs Namen, den Friederich eigenhändig geschrieben hatte – nur hin und wieder hatte die Großmutter die Hand ein wenig geführt, und der Schulleiter war angetan von der Festigkeit, der Deutlichkeit dieser Schrift. Man könne es einmal versuchen, so der Schulleiter – die Zahl fünf war nun eine Zahl, die ganz auf Friederichs Seite stand. Eine Zahl, die später einmal wie eine Reserve in die Schlacht geworfen werden könnte, sollte Friederich irgendwann einmal ein Jahr verlieren oder ein Jahr wiederholen müssen. Immer hätte Friederich dann noch einen Rückhalt, eine eiserne Reserve, wo die Reserven anderer Schüler dann schon aufgebraucht wären – sagte der Vater und sagte auch der Schulleiter. Sie nickten einander zu. Sie sprachen Lieblingssätze: Wissen ist Macht. Oder: Nur der frühe Vogel fängt den Wurm … Und sie reichten einander zum Abschied die Hand.
Aus dem größten Schaufenster des Geschäfts hatte der Vater einen Schulranzen für die Einschulung geholt, das größte und teuerste Modell mit zahllosen Schlitzen, Reißverschlüssen und Seitentaschen – Modell Diplomat. Dazu bekam Friederich einen Füller, Stifte und einen großen Atlanten, in dem er blätterte. Die letzten Tage vor der Einschulung verbrachte er im Geschäft, wo er den Mitarbeitern präsentiert wurde, dem Prokuristen, den Abteilungsleitern, von denen er auch Glückwünsche entgegennahm für die Aufnahmeprüfung in die Schule, die er auf Anhieb bestanden hatte. Bereits der Schulranzen und der Atlas wirkten wie Auszeichnungen. Der Vater ließ es sogar in die Zeitung setzen: Unser Sohn, fünfjährig, kommt in die Schule. Und Friederich freute sich. Er sprach immer wieder die Zahl fünf. Er zählte sie mit seinen Fingern auf. Oder er zählte sie mit seinen Fingern nach: Fünf. Er zählte anders als die anderen Kinder. Andere zählten jedes neue Lebensjahr mit Stolz. Friederich zählte dagegen jedes fehlende Lebensjahr wie eine Auszeichnung. Fünf Jahre und schon in der Schule.
Eine Vielzahl mit Süßigkeiten gefüllter Schultüten hing im Schaufenster, doch waren diese Schultüten nicht für Friederich bestimmt, sondern für gewöhnliche Kinder, die damit lärmend zur Schule gingen, während für Friederichs Vater derlei Tüten Albernheiten waren, nichts für Friederich, der ohne eine Schultüte in die Schule lief, nur mit seinem Ranzen, und dabei gar nicht wie ein Erstklässler aussah, sondern eher schon wie ein Zweit- oder gar Drittklässler. Selbst der Hausmeister, der ihn sah, winkte ihn, da er ohne Schultüte war, sogleich in den Raum der zweiten Klasse, und so konnte Friederich für einige wenige Momente ein Gefühl größter Erhabenheit auskosten: Fünf Jahre, und schon in der zweiten Klasse.
Man entdeckte den Irrtum. Man brachte ihn von der zweiten in die erste Klasse. Man hörte nicht auf seine Einwände. Man hörte überhaupt nicht auf ihn.
Nur in den allerersten Stunden konnte sich Friederich zurechtfinden, als es zum Beispiel darum ging, sich vorzustellen, den Namen zu sagen – er sagte den Namen, indem er aufstand und eine leichte Verbeugung machte. Er erwähnte das Spielwarengeschäft und den Vater und den Ururgroßvater, Heinrich Ostertag, den Erfinder von Fang den Hut … Und er setzte sich. Dann begann eine Welt der Buchstaben, der Zahlen, der Fragen und Nachfragen und Hausaufgaben. Die Schulbücher waren keine Dekorationen mehr, die man halten oder stapeln oder mit denen man sich verbeugen konnte. Die Bücher bestanden aus voranschreitenden Übungen, die ihm bald unbegreiflich wurden. Mit jeder Seite wuchs seine Ratlosigkeit – manche Lehrer sprachen von Aufregung, andere von Begriffsstutzigkeit. Wo anfänglich noch Bilder, da wuchsen mit jeder weiteren Seite die Buchstaben, und mit den Buchstaben wuchsen die Wörter, immer länger werdende Wörter, und wenn Friederich dabei war, einzelne Stellen eines Wortes zu begreifen, da wurde einfach weitergeblättert. Alle Blätter schienen ihm ein Umund Weiterblättern. Wie davonfahrende Züge.
Bis nächste Woche. Bis morgen früh … Friederich war noch gar nicht bei einem Wort angekommen, da sprach man bereits von nächster Woche oder morgen früh. Und von neuen Hausaufgaben. Und weiteren Seiten. Andere Kinder lasen aus diesen Seiten vor, während Friederich stumm daneben saß. Er überlegte sich notdürftige Antworten: »Bücher, Stäbe, Staben …« Daher, dachte er, komme das Wort Buchstaben. Doch er dachte falsch. Und er versuchte sich an neuen Antworten: das Licht, die Augen, der weite Schulweg, der schwere Schulranzen, die vielen Bücher, das Gelächter der anderen Schüler … Oder er spürte eine immer größer werdende Müdigkeit, die über ihn kam, da er nachts schlecht schlief, und wenn er schlief, dann träumte er von bizarren Gestalten, zum Beispiel von einer flatternden Eule, die sich auf ihn setzte und furchtbare Rechenaufgaben an ihn richtete. Er kannte diese Eule aus dem Mathematikbuch, wenn eine Aufgabe besonders schwierig war. Das ganze Mathematikheft bestand aus Eulen. Und bald auch sein Zimmer: Eulen und immer mehr Eulen, die nachts auf seiner Schulter saßen.
»Ein, zwei Tage gehe ich noch hin, dann weiß ich Bescheid.« So hatte es Friederich zum Ende des ersten Schultages den Eltern verkünden wollen. Mit dem ganzen Stolz eines heimkehrenden Kindes. »Ein, zwei Tage gehe ich noch hin, dann weiß ich Bescheid.« Doch er wusste nicht Bescheid. Er wusste vieles, nur nicht Bescheid.
Zu Beginn seiner Schulzeit dachte er noch, es gehe in einer Schule darum, einen Raum auszufüllen oder eine Zeit abzusitzen. Es gehe um Höflichkeit und die Fähigkeit, in einer Fremde Haltung zu bewahren. Es gehe um Kulissen, die man hin- und herschiebe, so wie der Lehrer die Tafel hin- und herschob. Ein Buch war für ihn eine Art Dekoration, wie ein Blumenstrauß oder eine Tapete. Wer käme auf die Idee, einen Blumenstrauß oder eine Tapete ernsthaft zu lesen. So wie auch im Wohnzimmer der Eltern zahlreiche Bücher standen – doch nie sah Friederich irgendjemanden in ihnen lesen. Warum jetzt also plötzlich Lesen. All die Bücher schienen ihm nur Ornament und Zierrat, eine Gewohnheit, ein Hintergrund. Kaum anders als die Aussicht auf den Bodensee. Oder wie die Zeitung, die der Vater nach jedem Mittagessen auffaltete. Nur ein Bild, eine Gewohnheit, ein Recken und Strecken und Ausbreiten der Arme.
In dieser Art hatte er sich die Schule vorgestellt – als ein Abschreiten, ein Verbeugen, ein Hinsetzen, ein Aufschlagen von Büchern, ein Nicken und Zustimmen … Er hatte sogar gedacht, passabel Französisch zu können, da ja auch der Vater passabel Französisch konnte, wenn er mit Geschäftsfreunden aus der Französischen Schweiz am Telefon sprach. Sein Französisch war ein lautes, sich überschlagendes Ähm. Ähm … Und immer weitere Ähms. In den unterschiedlichsten Tonlagen. Ähm, ähm, ähm … Und es waren diese Ähms, die auch Friederich vor der ganzen Klasse sprach – und er hielt das ernsthaft für Französisch.
Die Fassungslosigkeit, mit der der Vater die ersten Anrufe aus der Schule entgegennahm und nach Erklärungen suchte … – und Besserung versprach. Etwa in Form einer Schallplatte, die er Friederich gab, auf der Deutschübungen gesprochen waren, zum Beispiel das ABC, das Friederich noch immer nicht konnte und das ihm die Schallplatte nun vorsprach. A, B, C … Oder Wörter mit scharfem S: Fuß, Ruß, Schoß … Und andere Wörter, die Friederich in den Schlaf sprachen. Und die ihn wieder aus dem Schlaf rissen: Es zischen die Fischezwischen zwei Schiffen … Damit wurde er früh morgens geweckt. Hineinschütteln war das Wort. Man werde all das in ihn hineinschütteln, so der Vater. Die Zahlen, die Buchstaben, die Zischworte.
Nach stundenlangen Hausaufgaben waren Friederichs Blicke abwesend und glasig. Um ihn herum die Stimmen des Vaters und der Großmutter. Bücher wurden aufgeschlagen und wieder geschlossen. Der Füller rutschte aus seiner Hand. Und eine Ohrfeige ins Gesicht. Und eine weitere Ohrfeige, weil Friederichs Müdigkeit immer größer wurde. Im Dämmerlicht des Spätnachmittags. Aufgerissene Münder, die Buchstaben spien. Bruchstücke einer Bruchrechnung. Die Zahl fünf. Wie eine Entschuldigung gesprochen. »Er ist ja erst fünf.« Wie eine letzte, vorläufige Rettung.
Was würde passieren, wenn er nicht mehr fünf, sondern irgendwann sechs wäre, und Friederich beschloss, diesen Geburtstag zu vertagen, an der Zahl fünf mit aller Kraft festzuhalten.
Einzig in den Fächern Mitarbeit und Betragen gab es wohlwollende Noten, ein gut und ein sehr gut. Wenn man das Zeugnis in einem bestimmten Winkel hielt, dann konnte es sogar den Eindruck von Erfolg erwecken, beginnend mit den beiden ersten Zeilen: Mitarbeit und Betragen – gut und sehr gut. Für einige Momente konnte man sich an diesen beiden Noten festhalten, ohne den Schrecken weiter unten zu sehen. Mitarbeit und Betragen. Anwesend zu sein und sich dabei noch höflich und zuvorkommend zu verhalten, mit einem wachen und zustimmenden Ausdruck, zum Beispiel dem Lehrer die Kreide reichend oder die Tafel wischend. Das war nachvollziehbar.
Doch waren Mitarbeit und Betragen allenfalls Trostnoten. Während die übrigen Noten in den anderen Fächern fern ab waren von irgendeinem Entgegenkommen aufgrund von Mitarbeit und Betragen. Sie waren Ausdruck reinster Vergeblichkeit. Und Aussichtslosigkeit. Trotz aller Mitarbeit und allen Betragens.
Dass die Wiederholung der ersten Klasse nicht in Frage komme. So der Vater. Dass man eine Schulzeit so nicht beginnen könne, mit der Wiederholung einer ganzen Klasse. Dass damit der Altersvorsprung jetzt schon verspielt wäre. Dass er nur diesen einen Sohn habe, und keinen anderen Sohn. So der Vater. Am Telefon. Und immer wieder am Telefon. Er telefonierte mit einer neuen Grundschule. Sie lag schon gar nicht mehr wirklich in Lindau, sondern in einem Vorort, in Bad Schachen, ein Ort mit alten Bäumen in einem alten Park und einem berühmten Hotel, in dem der Vater gelegentlich Kaffee trank und auf den Bodensee blickte. Er sprach abwechselnd die Worte gut und sehr gut: ein sehr gutes Gut und ein gutes Sehr gut … Für Betragen und Mitarbeit. Oder Mitarbeit und Betragen. Und er sprach nicht mehr nur von Betragen und Mitarbeit, sondern auch von Mittelstand: Betragen und Mittelstand. Der Mittelstand als eine Form von Betragen. Und das gute Betragen als eine Eigenschaft des Mittelstandes. Und als Friederich das Wort Mittelstand hörte, da hoffte er, dass sich nun alles zum Besseren wenden würde, denn wann immer der Vater das Wort Mittelstand sprach, da wurde seine Stimme mitfühlend, versöhnlich, fast ein wenig fröhlich.
Der Vater ließ sich von der neuen Schule sämtliche Schulbücher schicken, die im nächsten Schuljahr durchgenommen wurden. Zwei Nachhilfelehrer sollten Friederich regelmäßig unterrichten, bereits in den Sommerferien. Ein Mathematiklehrer sollte mit ihm alle Aufgaben des neuen Rechenbuches durchrechnen. Er sollte ihm die Aufgaben vorrechnen, und Friederich würde sie nachrechnen. Oder das Nachgerechnete wenigstens auswendig lernen. Insbesondere die Aufgaben mit den Eulen. Und eine schon ältere Schülerin sollte ihm Deutschnachhilfe erteilen, eine echte Gymnasiastin, die Altgriechisch und Latein lernte. Eines Tages saß sie im Wohnzimmer, und der Vater fragte sie, ob sie tatsächlich Latein könne, ob sie vielleicht ein paar Worte auf Latein sprechen könnte, und sie sprach die Worte: Flamma flagrat. Die Flamme flackert. Der Vater war beeindruckt. Fast schien es, als ballte sich seine Hand zu einer kleinen Faust. Flamma flagrat.
Wörter wie Paukenschläge. Flamma flagrat. Oder Claudia in Germania nata est. Wenn Friederichs neue Schule davon nicht beeindruckt sein würde. Zumal in der neuen Schule Latein gar nicht unterrichtet wurde. »Gerade deshalb«, so der Vater. Latein als ein Aufmischen, ein Vorpreschen oder wenigstens ein Ablenkungsmanöver. So der Vater. Nicht nur Rechnen und Deutsch, sondern auch Latein. Die Flamme flackert. Und er verließ mit feierlichen Schritten den Raum, ließ die beiden in ihrer Nachhilfestunde sitzen. Sylvia, die Nachhilfelehrerin, las Friederich aus dem Deutschbuch vor, flüssiger als je ein Mensch aus diesem Buch gelesen hatte. Mit lateinischem Akzent, wie Friederich glaubte, und Friederich sprach ihr nach, wenn auch in eigenen Worten. Sie sprach ihm auch Gedichtzeilen vor, und er sprach sie so lange nach, bis er sie auswendig konnte, Gedichte von Goethe, Eichendorff und Schiller …
»Warum das?«, so der Vater.
Um diese Zeilen in der Klasse vortragen zu können. Sollte er aufgerufen werden, dann Goethe und Schiller. So Sylvia. Und der Vater war begeistert: Goethe und Schiller. Und weitere Dichter. Welcher Lehrer könnte Friederich das verbieten. Goethe und Schiller. Wenn Friederich aus einem Schulbuch vorlesen soll und er spricht stattdessen Goethe und Schiller. Und der Vater erzählte das im ganzen Haus. »Friederich liest jetzt. Er liest Goethe und Schiller.«
Sie sprach ihm außergewöhnliche Sätze vor, zum Beispiel den Satz: »Die deutsche Sprache kennt keinen Ablativ.« Wer wollte das bestreiten. Jeder Lehrer müsste ihm hier zustimmen. »Die deutsche Sprache kennt keinen Ablativ.« Ein Satz, den Friederich immer wieder in der neuen Schule sprach. »Die deutsche Sprache kennt keinen Ablativ.« Und es waren diese lateinischen Momente, in denen Friederich den anderen Schülern sogar ein wenig voraus war.
Der Vater hörte die Ratschläge von Ärzten und Pädagogen. Er las diese Ratschläge in der Zeitung oder er hörte sie im Radio. Dass zum Beispiel ein gefüllter Magen dem Gehirn das Blut nehme, sagte das Radio. Also gab es für Friederich lange Zeit kein Frühstück mehr, allenfalls ein Glas Milch. Dass, so eine andere Stimme, Schokolade reine Gehirnnahrung sei, also bekam Friederich fortan täglich eine Tafel Schokolade, wie eine ärztliche Maßnahme. Dass Weihnachten die schulischen Leistungen beflügeln könne, so ein Experte, also feierte die Familie auf eine unwirkliche Weise Weihnachten. Dass Weihnachten ein Atavismus sei, so ein Pädagoge, also verzichtete die Familie wieder darauf.
Fasnet verbrachte man in der Wohnung, hinter geschlossenen Vorhängen. Der Vater behandelte die Umzüge mit wegwerfenden Bewegungen. Nur unten im Geschäft war die Fasnet nicht zu umgehen. Es gab Schaufenster, die der Vater notgedrungen umgestaltete. Fasnet. Und Friederich verstand unter Fasnet nicht Fasnet, sondern Fastnett – eine Zeit, in der alles um ihn herum fast ein wenig nett erschien: die Lehrer, die Schüler, die Menschen auf der Straße. Fast nett.
In einem der Schaufenster hing ein prächtiger Indianerschmuck, den Friederich immer wieder betrachtete. Er dachte daran, diesen Indianerschmuck zu tragen, und sei es nur während der Fasnetzeit – doch Friederichs Vater tat das als Verrücktheit ab. Die bloße Idee schien bereits eine Untat. Indianer, ausgerechnet Indianer. Während Friederich sich immer offener vor das Schaufenster stellte und mit allem Nachdruck darauf bestand, einmal in seinem Leben Indianer sein zu dürfen. »Indianer!« Seine Stimme war auf der ganzen Straße zu hören. »Indianer!« Passanten drehten sich um. »Indianer!« Und sein Vater kam aus dem Laden und holte ihn herein.
Statt mit Weihnachten oder mit der Fasnet beschäftigte