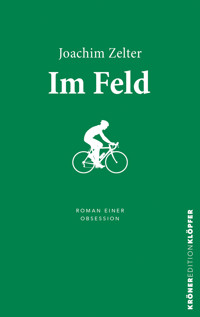9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Alfred Kröner Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Edition Klöpfer
- Sprache: Deutsch
Was hier erzählt wird, ist keine Fiktion. Alles ist wahr, oder bewegt sich zumindest nahe an der Realität. Abweichungen des Erzählten von wirklichen Begebenheiten oder wahren Verhältnissen wären also rein zufällig - oder ein letzter Tribut an die Literatur. Lakonisch, melancholisch und mit beißendem Witz: Joachim Zelters tragikomische Novelle beschreibt einen Literaturbetrieb, in dem es um Vieles geht, kaum mehr aber um die Literatur selbst. In dem Autorinnen und Autoren wichtiger sind als ihre Werke - und Lebensläufe bedeutsamer als jede sprachlich-literarische Fähigkeit.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 86
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
EINEN BLICK WERFEN
Joachim Zelter
EINEN BLICK WERFEN
Literaturnovelle
KrönerEditionKlöpfer
Das Sagen ist nämlich nicht nur der Ausdruck, sondern die Realisierung des Denkens.
Walter Benjamin
Denkbilder
Inhalt
Kapitel 1
Kapitel 2
Anmerkung
Was hier erzählt wird, ist keine Fiktion. Alles ist wahr, oder bewegt sich zumindest nahe an der Realität. Abweichungen des Erzählten von wirklichen Begebenheiten oder wahren Verhältnissen wären also rein zufällig – oder ein letzter Tribut an die Literatur.
Er meldete sich in der Dritten Person. Selim Hacopian hat ein Buch geschrieben. So begann der Brief. In der Dritten Person. So wie Caesar in der Dritten Person von sich geschrieben hatte. Selim Hacopian hat ein Buch geschrieben. Keine fünf Jahre ist das her. Aus dem Nichts kam dieser Brief. Er erreichte mich als E-Mail. Noch immer denke ich an die Tragweite dieses ersten Briefes. Was zum Beispiel passiert wäre, wenn ich diesen Brief gar nicht beantwortet hätte. Selim Hacopian hat ein Buch geschrieben. Warum gerade ich, dem er das mitteilen wollte, dass er ein Buch geschrieben hatte. Und warum gerade ich, der auf eine solche Mitteilung reagieren sollte. Selim Hacopian hat ein Buch geschrieben. Dann machte er eine kleine Pause, ein paar Leerzeilen …, und fügte hinzu: Er würde Ihnen gerne was schiecken.
Ich antwortete postwendend: Bitte nichts schicken. Was immer er auch zu schicken gedachte. Dass sich auf meinem Schreibtisch Berge von Arbeit stapelten. Also bitte nichts schicken. Das antwortete ich ihm, und erst jetzt bemerkte ich die Schreibweise des Wortes schiecken. Schon diese Schreibweise weckte meine Befürchtungen. Er würde gerne was schiecken. Das klang nach Umständlichkeit und Verschrobenheit und Arbeit. Also antwortete ich: Bitte nichts schicken. In welcher Schreibweise auch immer er mir etwas schicken wollte. Bitte nichts schicken.
Später entdeckte ich im Anhang seiner E-Mail eine Datei, die dem Brief beigefügt war, womit seine Frage, ob er mir etwas schicken dürfe, von Anfang an obsolet war. Er schickte. Was immer ich dazu auch sagen würde. Er schickte. Das Geschickte war schon längst auf meinem Computer. Noch bevor ich die Frage überhaupt gesehen oder bedacht hatte. Er schickte.
Er schickte einen Lebenslauf. Als ob er damit signalisieren wollte: Sehen Sie, es ist doch nur ein Lebenslauf. Geboren in Namangan, Usbekistan, Übersiedlung der Familie nach Pakistan, von dort ausgewandert nach Ägypten. Religion Koptisch. Davor andere Konfessionen. Offiziersanwärter. Eine erste Chinareise. Eine zweite Chinareise. Kamelreitlehrer. Pyramidenführer. Tauchlehrer. Übersiedlung nach Deutschland. Begegnung mit Gerhard Schröder. Koch auf einem Flussschiff. Studium der Byzantinistik und Ägyptologie …
Der Lebenslauf lese sich in der Tat wie ein Abenteuerroman, antwortete ich ihm, um irgendetwas zu antworten, denn als Abenteuerroman wollte er den Lebenslauf wohl verstanden wissen – ein Lebenslauf wie ein unabweisbares Schaut-nur-her. Hier bin ich. Das bin ich.
Er dankte. Selim Hacopian dankt. Er dankte für meine Antwort – so einsilbig und knapp meine Antwort auch gewesen war. Und er fragte: Ob ich ein Buch für ihn signieren würde? Er meinte ein Buch von mir, das er eigens gekauft und gelesen hatte und das er gerne noch einmal lesen wollte. Sobald ich es signiert habe. Und er schickte mir – auf dem Postweg – mein Buch, in das er eine Markierung gemacht hatte, wo ich es am besten für ihn signieren sollte. Also signierte ich: Für Selim Hacopian mit allen guten Wünschen. Und ich steckte das Buch in einen Umschlag und brachte es zur Post.
Er dankte, fast überschwänglich, mit einer Reihe von E-Mails und auch mittels einer gewaltigen Postkarte, die er mir geschickt hatte: Danke! Mehrere Male klingelte das Telefon. Auf der Anzeige war immer dieselbe Nummer zu sehen, genau die Nummer, die er mir auf die Postkarte geschrieben hatte, um ihn anrufen zu können. Er sprach nicht direkt auf meinen Anrufbeantworter. Er holte vielmehr Luft. Er atmete. Oder wartete. Bis ich abnehmen würde. Oder bis er selbst irgendwann auflegte. Aus der Umständlichkeit des aufgelegten Hörers klang Enttäuschung – und die Frage: Ob ich denn nicht mit ihm sprechen wolle? Er würde so gerne mit mir sprechen. Über mein Buch und über andere Dinge. So jedenfalls klang die Art des aufgelegten Hörers.
Ich erklärte ihm per E-Mail, dass ich sehr beschäftigt sei, in nächster Zeit auch unterwegs zu einer Schriftstellertagung – und dann zu einer Lesereise.
Lesereise?
Ja, Lesereise.
In regelmäßigen Abständen schrieb er mir nun E-Mails und fragte mich danach: Wie war Lesereise? Oder: Hoffe angenehme Lesereise. Ich antwortete nicht. Und als ich – nach weiteren Briefen, die er gesendet hatte – doch antwortete, da erklärte ich, dass ich bereits erneut auf dem Sprung sei, zu einer weiteren Lesereise. Lesereise auf Lesereise. Immer weitere aufeinander aufbauende oder ineinander verschachtelte Lesereisen.
Dann hörte ich eine Stimme. Ich war in der Stadt beim Einkaufen und hörte jemanden rufen: Herr Schrieftsteller! Ich eilte weiter, so als hätte ich mit dieser Stimme nichts zu tun, und auch nichts mit dem Wort Schriftsteller …
Herr Schrieftsteller!
In immer kürzeren Abständen.
Herr Schrieftsteller!
Ich antwortete im Weiterlaufen, mit immer schneller werdenden Schritten, dass es jetzt nicht gehe, dass ich unterwegs sei zu letzten Besorgungen – fast hätte ich gesagt: Besorgungen vor einer weiteren Lesereise, doch ich sagte etwas anderes, während ich mit großen Schritten weiterlief und er – eine untersetzte Gestalt – mir mit kleinen Schritten und leichten Verbeugungen folgte. Herr Schrieftsteller. Im Spiegel eines Schaufensters sah ich den Größenunterschied: ich ungewöhnlich groß, er außergewöhnlich klein. Eine kindhafte Erscheinung. In dienerhaften Bewegungen lief er hinter mir her, immer ein oder zwei Schritte hinter mir, ohne eine zu große Distanz zwischen uns aufkommen zu lassen.
Er fragte nach meiner Lesereise. Er sagte nicht Lesereise, sondern Leserreise.
Wie war Leserreise?
Nicht Leserreise, sondern Lesereise, antwortete ich. Das sei ein Unterschied.
Er nickte erstaunt.
Dann zustimmend.
Später sogar ehrerbietend.
Nicht Leserreise, sondern Lesereise.
Als wollte er sagen: Nicht böse sein, Herr Schrieftsteller. Und er folgte mit kleinen Schritten. Eine Tasse Cappuccino, die ich irgendwo, in einem abgelegenen Café trinken wollte, und es bestand kein Zweifel mehr, dass wir gemeinsam in dieses Café eintreten würden, er und ich, um endlich, wie er meinte, um uns endlich kennenzulernen. Eine Kellnerin servierte mir eine große Portion Cappuccino, während er nur eine kleine Portion bestellte, die kleinstmögliche Portion – so als wären diese beiden völlig unterschiedlichen Tassen eine Form von Ehrerbietung. Oder von natürlichem Gefälle.
Er trank in kleinen Schlücken. Vielleicht, um möglichst lange von dem Augenblick zu zehren. Und sprach das Wort Mittagspause. Als wäre das eine ungeheuerliche Sache.
Miettagspause.
Wie Miete sprach er das.
Miettagspause.
Dass diese Miettagspause zu einer Stelle gehöre, eine Stelle in der Stadtbücherei. Seine Frau habe diese Stelle für ihn aufgetan. Er sagte nicht Frau, sondern Braut.
Meine Braut.
Mit einer entwaffnenden Arglosigkeit sagte er das. Und mit großen Mundbewegungen. Meine Braut. So wie er alles, was er sagte, in geradezu kindlicher Ergebenheit aussprach – und mit einem heiligen Ernst: Meine Braut. Die Miettagspause. Die Stelle.
Er staube Regale ab.
Er binde Bücher ein.
Oder räume Bücher auf.
Und er habe dort meine Bücher entdeckt. Beim Abstauben der Regale habe er sie entdeckt. Und angefangen in ihnen zu lesen. Schon während der Arbeit. Hinter Regalen sitzend. Oder in einem Waschraum. Und er habe die Bücher dann ausgeliehen und mit nach Hause genommen. Weil er eine Leidenschaft für Bücher habe. Er sprach von ihnen wie von Freunden. Nicht nur von meinen Büchern sprach er so, sondern auch von anderen Büchern. Er behandelte sie wie Verbündete oder Freunde, menschliche Wesen, mit denen man sich unterhält, sich streitet oder auf Reisen geht …
Als er hierherkam.
Selim Hacopian.
Vor wenigen Jahren.
Ohne irgendetwas.
Außer sich selbst.
Und einem Koffer.
Und ein paar Büchern.
Nur seine Frau.
Die er kennengelernt hatte.
An einer Straßenbahnhaltestelle.
Nachdem er sich neben sie gesetzt hatte.
Und er sie angeschaut hatte.
Und sie nach ihrem Namen gefragt hatte.
Und sie ihren Namen gesagt hatte.
Und er ihren Namen gesprochen hatte. Wie noch nie ein Mensch ihren Namen gesprochen hatte. Einfach so. Und beide zusammen aufgestanden waren und durch die Stadt gingen … Und zusammenblieben. Und sie damit anfing, seine Papiere zu sichten, und sie dann zu ordnen. Und mit ihm zu den Ämtern ging. Und an Schaltern für ihn sprach. Und auf Gängen mit ihm wartete. Und ihn heiratete. Und mit ihm zusammenlebte. Und eine Stelle für ihn aufgetan hatte, die ja gar keine richtige Stelle war, sondern nur eine Art von Stelle, ein Praktikum, ein Anfang oder ein Übergang …
All das erzählte er mir, und ich fragte, ob seine Mittagspause nicht längst zu Ende sei. Doch er wich aus. Was sei diese Mittagspause – im Vergleich zu dem Umstand unseres Zusammentreffens. Was sei diese Mittagspause im Vergleich zu dem, was er mir noch alles sagen wollte, zum Beispiel über meinen neuen Roman. Er wollte einiges dazu sagen. Worüber er gelacht und worüber er geweint habe. Und welche Stellen des Romans er seiner Braut vorgelesen habe. Und was sie dazu gesagt habe. Und was er dann wieder dazu gesagt habe …
Ob Herr Schrieftsteller…
Ja?
In einer freien Minute …
Minute?
Vielleicht einen Blieck werfen könnte …
Einen Blick?
Einen kleinen Blieck …
Worauf?
Auf einige Seiten …
Die er geschrieben hatte.
Es wäre ihm eine Ähre.
Seine Hand griff in einen winzigen Rucksack, der bei ihm lag, und ich sah bereits die ersten Seiten, die er mir zu zeigen gedachte und die ich auf keinen Fall lesen wollte. Gibt es doch kaum etwas Quälenderes als eine solche Frage: Ob man vielleicht einen Blick werfen könnte – nicht auf eine Zeitung, nicht auf ein Bild, nicht auf einen Sonnenuntergang, sondern auf ein Manuskript, das einem gereicht wird. Aus dem Nichts. Wenn ein solches Manuskript nicht irgendein Manuskript ist, sondern gleich das eines Schriftstellers oder eines Menschen, der von sich glaubt, er könnte ein Schriftsteller sein oder er sei dazu bestimmt, ein Schriftsteller zu werden. Obgleich es schon viel zu viele gibt. Wenn also – ohne Vorwarnung – ein Manuskript auf den Tisch gelegt wird, das man