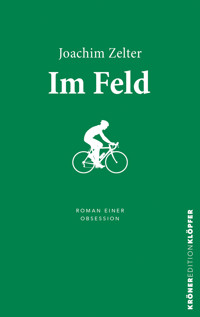
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Alfred Kröner Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Edition Klöpfer
- Sprache: Deutsch
»Rennradtreff. Christi Himmelfahrt. Donnerstag um 10 Uhr. Der Radverein lädt ein. Auch Nichtmitglieder sind willkommen!« Mit dieser Ankündigung gerät der Erzähler mitten hinein in die Parforce-Fahrt einer Rennradgruppe, die bald alle Maße und Vorstellungen sprengt. Virtuos erzählt Joachim Zelter die Sogwirkung eines rastlosen Pelotons: das Zusammenwirken von Fahrrad, Mensch und sozialer Gruppe. Ein Räderwerk der Tempoverschärfungen, der Höhenmeter und der immer größer werdenden Distanzen, ein fortwährendes Weiter und immer weiter so. Am Ende handelt Joachim Zelters Roman von uns allen: von Anpassung und Bereitwilligkeit, von Leistungsdruck und subtiler Tempoverschärfung, von der Unfähigkeit, auch nur eine Pedalumdrehung auszulassen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 136
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Joachim Zelter
IM FELD
Roman einer Obsession
KrönerEditionKlöpfer
Die einzige Würde des Menschen [ist die] eigensinnige Auflehnung gegen seine Lage, die Ausdauer in einer für unfruchtbar erachteten Anstrengung. […] Sie begründet eine Askese. Und das alles für nichts, nur um zu wiederholen und um auf der Stelle zu treten.
ALBERT CAMUS. Der Mythos von Sisyphos.Ein Versuch über das Absurde.
Inhalt
Prolog
Prolog
Er war schweißüberströmt. In tänzelnder Ruhelosigkeit fuhr er um mich herum. Ohne abzusteigen. Seine Beine steckten in Klickpedalen. Er trug das Trikot eines Radvereins. Sein Rennrad hatte zahlreiche Aufschriften. Er wirkte orientierungslos. Als hätte man ihn soeben aufgeweckt. Offensichtlich war er schon seit Stunden unterwegs, im Taumel einer atemberaubenden Tour, nach zahlreichen Abfahrten und Steigungen. In immer enger werdenden Kreisen fuhr er um mich herum und fragte: Wo bin ich?
Wie bitte?
Wo bin ich?
Ich gab ihm die Antwort, und er fuhr weiter.
Rennradtreff.Christi Himmelfahrt. Donnerstags um 10 Uhr. Der Radverein lädt ein. Auch Nichtmitglieder sind willkommen … Susan hatte in einer Zeitung davon erfahren. Sie hatte mir die Zeitung sogar selbst gezeigt: Warum ich dort nicht einmal hinfahre und mich vorstelle? Oder einfach mitfahre? Und sie reichte mir die Zeitung.
Ob sie das nur zufällig gefunden hatte oder längst bemerkt hatte, dass ich es gewesen war, der diese Notiz schon seit Tagen entdeckt hatte. Wer weiß. Auch Nichtmitglieder sind willkommen. Und sie schaute mich an, wie man einen Menschen anschaut, der endlich seine Bestimmung gefunden hat.
Wir saßen am Frühstückstisch. Die Zeitung lag noch immer ausgebreitet, und Susan wunderte sich über mich: Warum meine Zurückhaltung? Warum war ich nicht schon längst bei meinen Rädern? In fieberhaften Vorbereitungen auf eine derartige Gelegenheit? Jetzt, wo wir endlich hier waren, in der Stadt meiner Träume, in Freiburg im Breisgau. Mit viel Aufwand waren wir hierhergezogen, mit mehreren Umzugswagen und mit den besten Vorsätzen. Draußen schien die Sonne, und zum ersten Mal sprach Susan Freiburg mit Zuversicht, ja, in einem neuen Ton. Sie sprach es wie Freisinn, Freiberg oder Freude. Als würde sie sich tatsächlich freuen.
Auf einem Bücherbord lagen Tourenführer und Landkarten. Breisgau und Umgebung. Der Schwarzwald, der Kaiserstuhl, die Vogesen. Wie Speisekarten hatte ich diese Karten immer wieder studiert, die Summe spektakulärer Passstraßen und Touren. Möglichkeiten über Möglichkeiten, von denen Flachländer nicht einmal zu träumen wagen. Das Wort Hochschwarzwald war ein treibendes Wort gewesen, nicht einfach nur Schwarzwald, sondern Hochschwarzwald. Am Ende waren wir nur deshalb überhaupt hierhergezogen, wegen solcher Wörter.
Im Keller befand sich mein neues Rennrad. An der Decke hingen weitere Räder. Alles wohlgeordnet und bedacht. In einem Zustand ständiger Bereitschaft. Wie für eine solche Zeitungsanzeige gemacht. Susan folgte mir hinab, doch blieb ihr diese Welt nach wie vor fremd: meine vielen Räder, meine immer länger werdenden Rennradfahrten, meine zunehmende Beschäftigung mit Wattzahlen, Trittfrequenzen und Trainingsmethoden. Irgendwann konnte sie es kaum mehr glauben, dass das tatsächlich ich war, mit dem sie das alles erlebte: Ein Leben um Räder, Schaltungen und Kettenölen … – und nicht enden wollenden Tagestouren, in die ich auch sie immer mehr miteinbezogen hatte, bis ihr all das völlig verleidet war, jeder Gedanke an Rennrad oder Fahrrad, selbst an die allerkürzesten Strecken.
Sie hatte Recht. Die Stadt ergab für uns keinen wirklichen Sinn, weder einen beruflichen noch einen privaten Sinn. Wenn überhaupt, dann ergab all das nur einen Radsportsinn. Wenn man sich dieser Stadt mit den Augen eines Radsportlers oder eines Radbesessenen nähert – dann ergibt das alles plötzlich einen Sinn: die Vielzahl an Strecken, die Berge und endlosen Ebenen, und all das auf engstem Raum. Teilweise beginnen die ersten Anstiege schon am Rande der Stadt. Nur einige wenige Pedalumdrehungen, und schon gehen sie los, nicht irgendwelche Hügel, sondern wirkliche Berge.
Ansonsten hatten wir kaum das Geld, um überhaupt hierherzuziehen. Wir hatten auch keinen Plan und keine wirkliche Vorstellung. Weder Bekannte noch Freunde. Nur Susan und ich und einige Reiseführer – und die besondere Art, mit der sie mir an diesem Morgen die Zeitung reichte.
Ich pumpte Reifen auf. Susan schaute mich an: in einer Mischung aus Anteilnahme, Ratlosigkeit und Verständnis. Als hätte sie nie etwas anderes erwartet. So blickte sie mich jetzt an. Sie brachte mir sogar mein frisch gewaschenes Radtrikot und meine schwarze Radhose, so, als wäre diese Ausfahrt ein erster Arbeitstag oder eine Art Antrittsbesuch. Sie reichte mir auch eine Broschüre der AOK, auf der dieser Radtreff noch einmal gesondert hervorgehoben war, mit Straßenangaben und den besten gesundheitlichen Empfehlungen.
Ich holte mein Rennrad und richtete es her: fixierte die Laufräder, schraubte an den Klickpedalen und ölte die Kette; füllte Wasserflaschen und holte aus der Küche einen Stapel Energieriegel. All das, was man so macht, wenn man sich auf eine längere Tour begibt.
Im Flur standen noch Farbeimer und Umzugskisten, doch Susan schob mich nach draußen und meinte, sie könne diese Kisten auch allein auspacken.
Wirklich?
Ja.
Sie winkte mir nach, nachdem ich endlich aufgestiegen und in den Pedalen war, und ich winkte zurück, bis wir uns nicht mehr sahen. Ich fuhr langsam und bedächtig, nicht wissend, in welche Richtung ich fahren sollte, ob ich überhaupt zu diesem Radtreff hinsollte, oder mich erst einmal in aller Ruhe allein einrollen. Noch über dreißig Minuten waren es bis zu diesem Treff. Laut Broschüre sollte man sich an einem Denkmal einfinden. Es handelte sich offenbar um ein Denkmal Martin Heideggers. So jedenfalls sah es aus. Zur Sicherheit schaute ich noch einmal nach: Heidegger-Denkmal, 10 Uhr. Um Pünktlichkeit wurde gebeten. Ich schaltete einige Gänge runter, rollte immer langsamer, von Hausfrauen und Kindern auf gewöhnlichen Stadträdern überholt. Nur zur! Nur zu! Ich winkte sie vorbei. Als hätte ich einen Defekt oder würde noch einmal nach den Bremsen schauen. Jede Pedalumdrehung war eine Unschlüssigkeit, ein Hinauszögern. In der Tat: wie eine Einschulung. So fühlte ich mich. So hatte Susan mich losgeschickt. Als wäre das (nach unserem Umzug) ein erster Schul- oder Arbeitstag. Trotz Feiertag. Trotz Christi Himmelfahrt. Oder vielleicht sogar gerade deshalb.
Ich justierte noch einmal die Schaltung: Klick, klick, klick … Hochschalten und wieder runterschalten. Alles bestens. Die Kette geölt. Neun Gänge auf jedem Blatt. 27er-Ritzel. Begleitet von der Überlegung, zunächst einmal eine einfache Strecke zu fahren, Freiburg und Umgebung, und dies in aller Ruhe, ein gemütliches Einrollen, um einen Eindruck von der Gegend zu bekommen. So oder so ähnlich. Die Beine zu lockern und die Landschaft zu genießen. Nichts weiter.
Vor mir sah ich einen Rennradfahrer …, einen Fahrer, der so aussah, als könnte er tatsächlich zu diesem Treffpunkt fahren. Er wirkte entschlossen und im selben Moment verhalten. So wie ich selbst wahrscheinlich entschlossen und zugleich verhalten wirkte – wie wenn man sich erst einmal sammeln wollte. Alle ernstzunehmenden Radfahrer müssen sich erst einmal sammeln. Einrollen, durchschalten und sich sammeln.
Ich folgte ihm, nach links, rechts, geradeaus, durch Stadtviertel hindurch, die ich noch nicht kannte, bis weitere Radfahrer zu sehen waren. Und in der Tat. Da war es, das Denkmal des Philosophen. Heidegger mit einem Buch, auf einem Wanderstock gestützt. Ich ging in die Bremsen, um das erst einmal aus der Ferne zu beobachten: das Denkmal und die dort anwesenden Radfahrer. Fingerte an meinen Reißverschlüssen und an meiner Sonnenbrille. Neben mir die Bremsgeräusche weiterer Fahrer. Von überall her kamen neue dazu. Ein beiläufiges Aufschauen und Grüßen. Als hätte man mich erwartet oder würde mich bereits kennen. Was mir einerseits schmeichelte und mich zugleich beunruhigte. Um irgendetwas zu sagen, fragte ich nach dem Denkmal. Ist das hier Heidegger? Ist das hier das Denkmal?
Ja, ja, so die Antwort.
Was sollte es sonst sein.
Und ich nickte und stand in Heideggers Schatten, neben anderen Fahrern und anderen Schatten. Das Denkmal war eine willkommene Art der Umschreibung, des Abwartens, des Zögerns und Umkreisens. Um zur Not noch sagen zu können: Seinetwegen bin ich überhaupt nur hier. Nicht wegen dieses Radtreffs, sondern wegen ihm. Ein Anhänger seiner Philosophie. Zumindest ein interessierter Leser. Sein und Zeit, Wegmarken und Holzwege. Um nur einige seiner Schriften zu nennen. Mein Rennrad dagegen nur Beiwerk. Nicht der Rede wert. So wie der Spazierstock Heideggers.
Doch niemanden interessierte das.
Immer mehr Räder, die nun von allen Seiten auf uns zufuhren. Ein Heransurren von links, rechts, vorne, hinten. Fahrrad auf Fahrrad. Jetzt bereits eine beträchtliche Ansammlung, und ich war mittendrin. Glänzende Räder, farbige Trinkflaschen, leuchtende Trikots und funkelnde Sonnenbrillen. Man beachtete mich nicht oder schaute nur auf mein Rennrad. Taxierende Blicke auf technische Details: auf Rahmen, Laufräder und Schaltung. Blicke dieser Art. Radfahrerblicke. Vielleicht auch Blicke auf mein unbedarftes Trikot. Was trägt er für ein komisches Trikot?
Das Trikot war natürlich eine Lächerlichkeit im Vergleich zu den Trikots der anderen Fahrer: hell leuchtende, dick buchstabierte Trikots des hiesigen Radvereins, Trikots, die gar keinen Zweifel aufkommen lassen, dass dies der Inbegriff eines Vereins ist, eines wirklichen Radsportvereins. Mein Trikot dagegen nur ein mattes Grün. Die dünn gezogenen Pfeile wirkten darin fast zerbrechlich. Sie zeigten vage nach oben, doch dieses Zeigen wirkte eher wie ein hilfloses Aufbegehren. So jedenfalls schaute man mich an. Oder schien mich anzuschauen, von Trikot zu Trikot. Vielleicht betrachtete man mich auch im Lichte der ersten Schwarzwaldgipfel, die von hier aus bereits zu sehen waren. Wenn er wüsste. Was das für Berge sind. Keine Autobahnbrücken, sondern wirkliche Berge.
Die meisten Fahrer saßen jedoch gelangweilt nach vorne gebeugt: Ellbogen auf den Lenker gestützt. Andere beäugten Rahmen, Schaltwerke oder Waden. Teilweise erschreckende Waden. Wie gemalt. Braungebrannt. Die Summe abertausender Trainingskilometer.
Vom Sockel des Denkmals aus wurde nun gesprochen. Ein Vertreter des Radvereins stand dort und hieß uns willkommen. Für alle, die neu seien, einige grundsätzliche Dinge: Jeder hat ein technisch einwandfreies Fahrrad mit funktionstüchtigen Bremsen und trägt einen Helm. Die Teilnahme erfolgt auf eigenes Risiko. Bei Materialschäden zahlt die Versicherung in der Regel nicht. Umsichtig fahren. Keine unnötigen Risiken. Wir wollen niemanden im Krankenhaus besuchen. Dies nur nebenbei. Oder vorweg. Und er erklärte: drei Gruppen. Eine langsame Gruppe mit einem 23er-Stundenschnitt, eine mittlere Gruppe mit einem 27er-Schnitt und eine schnelle Gruppe mit einem 30er-Schnitt. Im Zweifel immer in einer langsameren Gruppe fahren. Kein falscher Ehrgeiz. Frühzeitig Handzeichen geben. Links, rechts, Kreuzungen, Pfosten, Hindernisse … Windschatten fahren. Hintereinander, nicht nebeneinander fahren. In Zweierreihen. Die Gruppe bleibt zusammen. Den Anweisungen des Gruppenführers Folge leisten. Keine Extratouren. Bei Anstiegen gibt der Führer die Gruppe frei. Jeder fährt dann sein eigenes Tempo. Oben warten und wieder sammeln.
Irgendwelche Fragen?
Nein.
Nur ein nervöses Tänzeln der anwesenden Räder.
Die einzelnen Gruppenführer stellten nun nacheinander ihre Touren vor. Schnelle Gruppe, mittlere Gruppe, langsame Gruppe. Wörter wie Warmfahren, kleinere Anstiege und: je nachdem. Je nach Lust und Laune und Verfassung der Gruppe. Und schon hörte man von allen Seiten das Einrasten der Radschuhe in die Klickpedale. Klack, klack, klack. Und es bildeten sich – all die Räder nun kreuz und quer fahrend – die drei Gruppen.
Die Gruppenführer gaben Handzeichen. Langsame Gruppe hier. Mittlere Gruppe hier. Schnelle Gruppe hier!
Was mit mir sei?
Nichts.
Zu welcher Gruppe ich gehöre?
Zu keiner.
Man schob mich in die nächstbeste Gruppe hinein, als wäre mein Zögern reine Koketterie. Auf geht’s! Klack, klack … Meine Radschuhe rasteten in die Pedale, und ich setzte mich in Bewegung. Dann fuhren wir. Wie ein anfahrender Zug in der Ausfahrt aus einem Bahnhof. Aus dem Augenwinkel sah ich noch einmal das Denkmal. Heidegger schien uns nachzuwinken.
Ich hielt mich hinten. Eine Art Zuschauer oder Gast, der ich ja auch war. Vor mir etwa dreißig Fahrer. In Zweierreihen. In der Tat wie ein Zug, der nun die letzten Meter eines Bahnsteigs hinter sich lässt. Betont langsam fahrend. Fast überbetont langsam. Jedenfalls langsamer, als ich das erwartet hatte. Ich fühlte mich gut – auf eine angenehme Art sogar schläfrig. Nach Wochen zum ersten Mal so etwas Gleichklang und Ruhe. Keine Umzugskisten, keine Einwohnermeldeämter mehr, sondern Rennräder und gebeugte Rücken, in den Farben des hiesigen Radvereins. Trikot neben Trikot, Hinterrad neben Hinterrad …
Und? Zum ersten Mal?
Wie bitte?
Zum ersten Mal dabei?
Ja. Und ich stellte mich vor: Staiger.
Was?
Frank Staiger.
Wie bitte?
So heiße ich.
Für einen Moment wusste er nicht, was damit gemeint war. Ich meinte meinen Namen, doch mein Nebenfahrer dachte bei Staiger an etwas ganz anderes. Er dachte an die Fahrradmarke Staiger, eine Marke, die ich weder fuhr noch kannte – weshalb er mich nun für eine Weile ratlos anschaute, mein Fahrrad genau inspizierend. So wie auch ich nicht sofort verstand, als er sich nun mit Stevens vorstellte. Er meinte nicht sich, sondern sein Rennrad, auf dessen Rahmen er deutete. Stevens. Er berührte den Rahmen, offenbar eine Besonderheit von Rahmen, so wie ein Musiker sein Instrument berührt. Ehrfurchtsvoll. Und an seiner Seite fuhren weitere Rahmen, die mich jetzt ebenfalls begrüßten: Storck, Klein, Look, Trek, Ghost …
Aus Göttingen?
Ja.
Man beäugte mein Trikot. Radvereinigung Göttingen. Mit den viel zu dünnen Pfeilen. Und man meldete das gleich nach vorne …
Göttingen.
Was?
Da kommt einer aus Göttingen.
Göttingen?
Ja, Göttingen.
Man schien derlei Städte zu sammeln. Städte, die von weither hierherpilgerten, um an einer Rennradfahrt teilzunehmen. Ein besonderer Fall. Als ein solcher wurde ich fortan behandelt. Mancher Fahrer ließ sich zurückfallen, um sich das genauer anzuschauen: Radvereinigung Göttingen. Dazu die aufstrebenden Pfeile. Allerhand.
Das Trikot war ein Ärgernis. Ich hätte es niemals anziehen dürfen. Immer neue Räder umkreisten mich nun. Simonelli, Bergamont, Rose … – Fahrradmarken aus Hochglanzprospekten, die mich in den Blick nahmen: Göttingen. In der Tat Göttingen. Denn jeder Eingeweihte weiß ja, was Göttingen für Radfahrer eigentlich bedeutet. Es bedeutet: nicht ein einziger ernstzunehmender Berg – weit und breit. Autobahnbrücken als einzige nennenswerte Erhebungen. Oder Parkhäuser. Sonst nur Flachland. Das Wort Radvereinigung allein schon deshalb eine Lächerlichkeit: eine Flachlandvereinigung, ein sinnloses Aufbegehren gegen die Erbärmlichkeit der norddeutschen Tiefebene und gegen das unsägliche Wetter.
In welcher Gruppe ich mich überhaupt befand? – fragte ich, um irgendetwas zu fragen. Ich fragte kaum anders als ein Reisender, der das einen Schaffner in einem immer schneller werdenden Zug fragen würde. In welchem Zug fahre ich eigentlich? Man gab mir zur Antwort: in der mittleren Gruppe. Und mir schien das genau richtig. Mittlere Gruppe. Um die hundert Kilometer. Vielleicht auch ein wenig mehr. Je nach Wetter. 27er-Schnitt. Welliges Terrain.
So wurde mir das berichtet. Zumindest mein Nebenfahrer sagte das, immer noch der Fahrer mit dem kostbaren Rennradrahmen: Stevens. Er sprach jetzt von den vielen Neuerungen und Vorzügen dieses Rahmens, von dessen Leichtigkeit, Reaktionsfähigkeit und dem unglaublichen Vortrieb. Dass man mit ihm die Berge geradezu hinauffliege. Ja, fliege! Er war kaum mehr zu bremsen, schien mit seinem Rad geradezu verschmolzen. Und das schon seit Jahren. Zentaurengleich. So saß er auf seinem Fahrrad. Jemand rief nun von hinten: Stevens. Das ist Stevens. So fährt Stevens. Kein anderer als Stevens. Jeder nannte und kannte ihn hier nur noch als Stevens.
Stevens fuhr nun dichter an mich heran und erklärte: Landauer führe die Gruppe.
Wer?
Landauer.
Und das schien eine Besonderheit.
Warum?
Wie bitte?
Warum das so besonders sei?
Die Frage befremdete ihn. Da frage einer ernsthaft bei einem Gruppenführer wie Landauer warum. Er fuhr kopfschüttelnd weiter, während ich mich nach Landauer umschaute, doch man informierte mich: Landauer sei noch gar nicht hier. Er sei noch unterwegs mit einer anderen Gruppe. An einem Feiertag wie heute führe er gleich mehrere Touren: eine Frühtour und dann eine spätere Tour. Er stoße nachher noch zu uns, in einer Art fliegendem Wechsel, von einer ersten Tour, die er irgendwo hinbringe, zu unserer Tour, die er dann persönlich übernehme. Persönlich übernehme. Das klang nach einer Zäsur. Wie ein neuer Lehrer, der eine Klasse übernimmt; oder ein besonderer Arzt, der eine Operation übernimmt. So klang das.
Stevens war wieder an meiner Seite. Eine Weile fuhren wir nebeneinander. Er schien zu lächeln, ob nun wegen der bevorstehenden Tour oder immer noch wegen meines Trikots. Die Pfeile auf dem Trikot waren der Gipfel von all dem. Zu allem Überfluss zeigten sie auch noch nach oben, auf Berge, die es in Göttingen weit und breit nicht gibt. Doch Stevens schien sich für diese Pfeile kaum zu interessieren. Er sprach immer noch von Landauer, dass es ein Glück sei, dass ein Fahrer wie er unsere Gruppe überhaupt führe, dass Landauer eigentlich ein vielbeschäftigter Mann sei, dass er sich bei einer längeren Ausfahrt wie heute grundsätzlich erst später einfinde, um die Gruppe dann zu übernehmen.





























