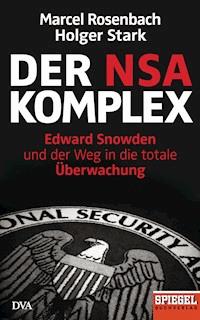
8,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: DVA
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Edward Snowden hat enthüllt, wie weitgehend die Geheimdienste unser Leben überwachen. Nahezu täglich kommen neue Details der allumfassenden Spionage ans Licht. Die SPIEGEL-Autoren Marcel Rosenbach und Holger Stark konnten große Teile der von Edward Snowden bereitgestellten und „streng geheim“ eingestuften Dokumente aus den Datenbanken der NSA und des britischen GCHQ auswerten. In ihrem Buch zeigen sie die gesamte Dimension eines Überwachungsapparates auf, der nicht nur die Privatsphäre bedroht, sondern die Grundlagen demokratischer Gesellschaften – und damit selbst diejenigen, die bislang glaubten, sie hätten nichts zu verbergen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 488
Veröffentlichungsjahr: 2014
Ähnliche
Marcel Rosenbach und Holger Stark
DER NSA-KOMPLEX
Edward Snowdenund der Weg in die totale Überwachung
Deutsche Verlags-Anstalt
1. AuflageCopyright © 2014 Deutsche Verlags-Anstalt, München, in der Verlagsgruppe Random House GmbH und SPIEGEL-Verlag, HamburgAlle Rechte vorbehaltenTypografie und Satz: DVA /Brigitte MüllerGesetzt aus der ScalaISBN 978-3-641-14150-9www.dva.de
Inhalt
Einleitung
1 – Der Insider
2 – Die Flucht
3 – Der mächtigste Geheimdienst der Welt
4 – Das goldene Zeitalter der Überwachung
5 – Die Ziele der Überwachungsmaschine
6 – Ein neuer Kalter Krieg
7 – Unter Freunden
8 – Wir Überwachten
Epilog
Unser Dank
Chronik: Die Snowden-Enthüllungen
Glossar
Register
Einleitung
Es war ein milder Abend Anfang Juni 2013, als der Chef der National Security Agency (NSA) in Berlin eintraf. Für den nächsten Morgen hatten seine Leute ein dichtes Programm für ihn organisiert: mittags ein Besuch im Kanzleramt, ein Vier-Augen-Gespräch mit Gerhard Schindler, dem Präsidenten des deutschen Bundesnachrichtendienstes, später ein Abendessen mit hochrangigen deutschen Sicherheitsbeamten. Es war ein Gegenbesuch, eine Visite unter Partnern, die gerade dabei waren, ihre Zusammenarbeit zu verstärken. Erst ein paar Wochen zuvor hatte eine deutsche Delegation das NSA-Hauptquartier in Fort Meade besucht, nun revanchierte sich Alexander.
Bis zu seiner Pensionierung im Frühjahr 2014 war Keith Alexander der mächtigste Geheimdienstchef der Welt. Er stand nicht nur der supergeheimen National Security Agency vor, mit rund 40000 Mitarbeitern und einem Etat von 10,6 Milliarden Dollar der größte Nachrichtendienst der westlichen Welt. Er führte außerdem das Cyberkommando der amerikanischen Streitkräfte. Alexander ist Absolvent der Eliteakademie West Point, er war in Deutschland stationiert, er sieht die Welt mit den Augen eines Vier-Sterne-Generals, dessen Uniform kaum noch Platz für neue Orden lässt. Der NSA-Chef hat eine hochgezogene Stirn und kindliche Augen, er lächelt gerne, aber er wirkt immer auch ein wenig, als würde er sich zu seinen Gesprächspartnern herablassen. Selbst dann, wenn er es ist, der als Gast erwartet wird.
Alexander genießt die ihn umgebende Aura des Allwissenden. Gespräche mit ihm sind von einem konstruktiven und geschmeidigen Tonfall geprägt, berichten Leute, die ihn häufiger getroffen haben. Aber er lasse nie Zweifel daran, wie die Rollen verteilt sind. Der Chef der NSA ist sich seiner Macht bewusst.
Doch an diesem Freitagmorgen im Juni ist in Berlin ein Hauch von Veränderung zu spüren. Alexander beginnt seinen Tag mit einem Arbeitsfrühstück in einem Club am Berliner Gendarmenmarkt, er ist mit Hans-Georg Maaßen verabredet, dem Präsidenten des Bundesamtes für Verfassungsschutz. Wenn sich der Chef der NSA und der Chef des Verfassungsschutzes treffen, dann ist es ungefähr so, als würde Volkswagen-Chef Martin Winterkorn sich mit einem lokalen Vertragshändler zusammensetzen. Maaßen ist eigentlich nicht in der Position, die NSA zu kritisieren. Aber er stellt während des Frühstücks eine unschuldige Frage. Wie Alexander die aktuellen Enthüllungen über die Arbeit der NSA beurteile?
Die Leaks? Alexander lächelt. Die NSA-Affäre ist erst ein paar Tage alt, bislang sind nur eine Handvoll Dokumente aus den Datenbanken der NSA an die Öffentlichkeit gelangt. Noch sieht es nicht so aus, als könnten die Veröffentlichungen der NSA gefährlich werden. In der Öffentlichkeit ist zu diesem Zeitpunkt noch unbekannt, wer dahinter steckt, Edward Snowden hat sich noch nicht zu erkennen gegeben. Aber die NSA weiß bereits, wer der Mann ist, der alles ins Rollen gebracht hat. Der Leaker, antwortet Alexander auf Maaßens Frage schließlich, sei nur »ein kleiner Verräter aus Hawaii«. Es ist eine abfällige Bemerkung, ein Satz, der viel aussagt über die Denkweise der Washingtoner Elite.
Edward Joseph Snowden hat mit diesem Machtsystem gebrochen. Er wuchs als Sohn zweier Regierungsangestellter in Maryland auf, in Kleinstädten zwischen Washington und Fort Meade, dem Hauptsitz der NSA. Mit Anfang zwanzig, also in einem Alter, in dem viele seiner Altersgenossen hierzulande noch in Hörsälen sitzen, begann Snowden, für die CIA und die NSA zu arbeiten, bis er sich entschied, dieses bürgerliche Leben hinter sich zu lassen: sein sechsstelliges Jahresgehalt, seine Wohnung im malerischen Waipahu im Süden Oahus auf Hawaii, die Wasserfälle, das Schnorcheln mit den Schildkröten in der Lagune von Hanauma Bay – und seine Freundin Lindsay Mills, eine gut aussehende Tänzerin, die es liebte, mit ihm die Natur auf Hawaii zu erkunden. Andere Menschen würden ein solches Leben als Traum beschreiben. Für Snowden wurde es zum Alptraum.
Als Snowden in den Dienst des amerikanischen Sicherheitsapparates eintrat, tat er dies noch als Patriot im konservativen Sinn: Er wollte in den Irak, kämpfen, sein Land verteidigen. Er schien nicht anders zu sein als Hunderttausende amerikanischer Jungs, die das College verlassen, um ihrem Staat zu dienen. Doch die Jahre bei den Geheimdiensten haben ihn verändert. Sie haben aus Snowden zunächst einen Zweifler, dann einen Kritiker und schließlich einen Gegner gemacht. Er hatte Zugang zu den Computersystemen, die streng geheime Dokumente beherbergen, und er begann, die unter Verschluss gehaltenen Dossiers zu lesen: Berichte über Observationen, klandestine Einbrüche, digitale Sabotage, tödliche Drohnenangriffe, sein Kopf sog sich voll mit den schmutzigen Geheimnissen. Was er zu sehen bekam, wenn er sich als »ejsnowd« einloggte, brachte ihn in immer größere Gewissensnöte.
Zwei Mal hat Edward Snowden seinen Intelligenzquotienten testen lassen, beide Male lag das Ergebnis über 145.1 Ein Mann wie er ist kein Befehlsempfänger, er muss überzeugt sein von dem, was er tut. Snowden las, und seine Überzeugung schwand. Mehr noch, er war entsetzt.
Geheimdienste sind ein Herrschaftsinstrument. Ihre lange Geschichte basiert auf der Erkenntnis, dass Wissen immer auch Macht bedeutet. Bei Snowden, dem anfangs so loyalen Geheimdienstmitarbeiter, der mit seinem Seitenscheitel und der Fünfziger-Jahre-Brille wie ein junger Mitarbeiter an einem naturwissenschaftlichen Institut aussieht, führte sein zunehmendes Wissen jedoch nicht zu einem Gefühl der Macht. Vielmehr fühlte er sich ohnmächtig – und fasste einen Entschluss. Er hätte kündigen und einen Job in der IT-Branche suchen können, aber er wählte einen anderen Weg.
»Mein Motiv ist, die Gesellschaft darüber zu informieren, was in ihrem Namen geschieht – und gegen sie gerichtet ist«, sagte er in seinem ersten Interview, in dem er sich als NSA-Whistleblower offenbarte. Da hatte er sich von Hawaii bereits nach Hongkong abgesetzt. Im Gepäck hatte er ein paar Hunderttausend Dokumente der NSA, des britischen Geheimdienstes GCHQ, des australischen DSD, des kanadischen CSE sowie der Neuseeländer – aus Sicht seiner ehemaligen Chefs war das der schlimmste Diebstahl geheimen Materials »in der Geschichte der amerikanischen Geheimdienste«, wie der ehemalige CIA-Vize Michael Morell urteilt.
Es ist nicht ohne Ironie: Seit Jahren warnen US-Sicherheitspolitiker vor einem »Cyber-Pearl-Harbor«, einem digitalen Angriff aus dem Nichts. Nun braute sich ein »perfekter Sturm« (wie es der oberste Geheimdienstkoordinator der USA, James Clapper, nannte) ausgerechnet in Kunia auf Hawaii zusammen. Snowdens Haus war nur rund eine halbe Stunde Autofahrt von Pearl Harbor entfernt.
Mit seiner spektakulären Flucht, die ihn von Hawaii über ein Hotel in Hongkong nach Moskau in die Transitzone des Flughafens Scheremetjewo und schließlich in ein Versteck im Großraum der russischen Hauptstadt führte, hat Snowden die größte Geheimdienstaffäre seit dem Ende des Kalten Krieges ausgelöst. Er hat eine Debatte angestoßen, wie die Welt sie bislang nicht kannte. Das streng geheime Material, das er seitdem gegen alle Regeln des Geheimdienstgewerbes zugänglich macht, zeigt deutlich, dass sich mit dem Siegeszug des Internets etwas Grundlegendes verändert hat: Anders als noch vor wenigen Jahrzehnten, als Minox-Kameras und Mikrofilme die Spionagewerkzeuge der Wahl waren und Agenten sich noch physischen Zugang zu den Geheimnissen ihrer Gegner verschaffen mussten, sind die Überwachungsmöglichkeiten im Digitalzeitalter nahezu grenzenlos.
Das Internet, gefeiert als wichtigstes Werkzeug zur Verbreitung der Demokratie, ist zur Bühne des größten Überwachungsprogramms in der Geschichte der Menschheit geworden. Eine Million Ziele attackieren die USA täglich, erfassen die Daten von sechs Millionen potentiellen neuen Zielen und durchleuchten Tag für Tag 380 Terabyte an Informationen. Das sind die Zahlen aus dem Jahr 2010. Jeden Tag kommen sechs Milliarden Metadaten von Menschen dazu, die telefonieren, chatten oder mailen. All dies addiert sich zu vier Billiarden Datensätzen, die 2010 in den Superrechnern der NSA gespeichert waren – derart viel, dass die Agency neue Mega-Rechenzentren wie das in Utah baut.2
Durch die Enthüllungen aus dem Snowden-Material, die in Europa vor allem vom »Guardian« und dem SPIEGEL, in den USA von der »Washington Post« und der »New York Times« vorangetrieben wurden, ist ein System sichtbar geworden, das einer simplen Prämisse folgt: Der Datenhunger staatlicher Sicherheitsbehörden ist unersättlich.
Zu den konstituierenden Merkmalen von Rechtsstaaten und freien Demokratien gehört allerdings, dass die verdachtsunabhängige Überwachung von Personen untersagt ist. Behörden sollen erst dann tätig werden, wenn sie begründeten Anlass dafür haben. Seit den Anschlägen vom 11. September 2001 – und getrieben von den neuen technischen Möglichkeiten – ist dieses Prinzip des Rechtsstaates weitgehend außer Kraft gesetzt worden. Entstanden ist stattdessen eine neue Überwachungsideologie, die alle rechtsstaatlichen Grundannahmen in ihr Gegenteil verkehrt: Aufgezeichnet und gespeichert werden so viele Informationen wie möglich. Denn jeder und alles kann verdächtig sein oder es noch werden. Analysten müssen die Überwachungsziele nicht mehr von Hand eingeben, lernen wir aus den Snowden-Papieren. Vielmehr müssen sie in Ausschluss-Datenbanken notieren, welche Nummern, Mail-Endungen oder Unternehmungen nicht überwacht werden sollen. Die Grundeinstellung vieler Systeme, der »Default« des modernen Überwachungsstaats ist: All you can get – alles, was du kriegen kannst.
Eines der Programme, deren Existenz Snowden öffentlich gemacht hat und das für diesen maßlosen Anspruch sinnbildlich ist, trägt den schönen Namen »Tempora«. Es wird federführend vom britischen Geheimdienst GCHQ betrieben, aber NSA-Analysten haben vollen Zugriff auf seine Fanggründe. Mit »Tempora« werden die Lebensadern unseres digitalen Alltags angezapft, Glasfaserkabel, in denen Informationen in unvorstellbar großen Mengen kursieren und aus denen alles abgesaugt wird, was die Geheimdienste in die Finger bekommen können. Für rund drei Tage können sie diesen »full take« speichern und auswerten – »big access« zu »big data«, so preist es die NSA intern. 40 Milliarden Informationseinheiten pro Tag waren es im Jahr 2012, Tendenz rapide steigend. Die Dreitagesfrist gilt nur, weil die Speicherkapazitäten derzeit nicht mehr hergeben. Deshalb bauen die Dienste die neuen Massenspeicher – man kann sie sich als gigantische Festplatten für unsere ausspionierten Kommunikationsinhalte vorstellen. Geheime Welt-Archive des Internets, der Mobilfunknetze und der Satellitenkommunikation, zu denen nur Geheimdienst-Analysten Zugriff haben.
Jeder Anruf, jede SMS, jeder Facebook-Chat und Google-Hangout kann für Überwachungsbehörden irgendwann einmal eine Bedeutung bekommen, das ist die Logik der NSA und des britischen GCHQ (und vieles spricht dafür, dass die Nachrichtendienste Chinas, Russlands und anderer Staaten kaum anders operieren). Mit seinen Enthüllungen hat Edward Snowden die Dimension dieses neuen Überwachungsstaates im Zeitalter des Internets bloßgelegt und gezeigt, dass für die Geheimdienste der Großmächte in den vergangenen Jahren vor allem ein Kriterium galt: das der technischen Realisierbarkeit. Was möglich war oder dank neuer Technik möglich wurde, wurde gemacht.
Die Geschichte des Edward Joseph Snowden ist deshalb mehr als nur ein neuer Geheimdienstskandal von besonderer Tragweite. Sie ist eine Parabel über eine Generation junger Weltbürger, deren Denkweise durch das Internet geprägt wurde und die nicht bereit sind, das Handeln von Regierungen einfach hinzunehmen, weil das bequemer ist, risikoärmer. Snowden ist Teil einer neuen Generation, die radikal moralisch denkt und argumentiert. Sie versteht das Internet als ihr ureigenes Refugium, einen Ort dezentraler und unzensierter Kommunikation, an dem sie sich, frei von den Fesseln des analogen Alltags, weitgehend unreglementiert entfalten und selbst verwirklichen kann. Es ist ein Ort für den digitalen Citoyen. Im politischen Koordinatensystem lassen sich viele Vertreter dieser Generation am ehesten als libertär einordnen – radikal freiheitsliebend. Staatliche Eingriffe in ihren digitalen Lebensraum lehnen die Vertreter dieser Generation ab, viele zweifeln die Legitimität solcher Regulierungsversuche generell an.
Eine Überwachungsarchitektur, wie sie die NSA und andere Geheimdienste aufgebaut haben, ist für sie eine wahr gewordene Dystopie. Sie ist Gift für die Freiheit, auf die Idee des Libertären prallt die Praxis des Totalitären. Die Enthüllungen Edward Snowdens rehabilitieren Leute wie Julian Assange, der mit seinen Tiraden gegen den Überwachungsstaat vielen vor kurzem noch als Paranoiker und Verschwörungstheoretiker galt.
Der Gründer von WikiLeaks ist einer der frühen, herausragenden Protagonisten dieser Generation. Bradley Manning, der junge Soldat, der sich mittlerweile Chelsea nennt, war so fasziniert von ihm und seiner Enthüllungsplattform, dass er 2010 eine Dreiviertelmillion amerikanischer Regierungsdokumente an WikiLeaks übergab. Edward Snowden hat die Geschichte der beiden noch als Mitarbeiter des nachrichtendienstlichen Komplexes genau verfolgt und daraus Schlüsse für seinen Umgang mit den geheimen NSA-Dokumenten gezogen. Wie Assange versteht sich Snowden als moderne Form eines klassischen Freiheitskämpfers. Beide haben einen transnationalen und postideologischen, aber dennoch leidenschaftlichen Blick auf die Welt.
Der Kampf für Transparenz und die Freiheit des Internets ist eine der großen Auseinandersetzungen unserer Zeit, ein Kulturkampf um die digitale Zukunft, vergleichbar mit dem Furor der Achtundsechziger-Generation, die gegen die reaktionäre Weltsicht der Eltern aufstand und die Konfrontation mit den Mächtigen nicht scheute. Vor diesem Hintergrund ist die radikale Bereitschaft zur Aufgabe der eigenen bürgerlichen Existenz zu verstehen, die Assange wie Snowden auszeichnet.
Was sich verändert hat, sind die Waffen, mit denen dieser Kulturkampf ausgefochten wird, und dadurch auch die Macht eines Einzelnen, der mittlerweile eine scheinbar erdrückende Übermacht herausfordern kann. Dieselbe Technik, die das System der Überwachung so weitreichend und allumfassend werden ließ, macht eben jenes System so verwundbar wie nie zuvor. Ein einzelner technisch versierter Mitarbeiter einer Vertragsfirma und ein paar handelsübliche Notebooks und Speicherutensilien reichten aus, um Staatsgeheimnisse der höchsten Geheimhaltungsstufe in einem nie dagewesenen Umfang zu entwenden, unbemerkt von Vorgesetzten und allen Sicherungssystemen. Er hat das System mit dessen eigenen Waffen getroffen.
Die Protagonisten der anderen Seite sind sich dieser fundamentalen Auseinandersetzung bewusst. »Wir erhalten für unsere Arbeit nicht viel Beifall, aber sie ist absolut superb«, sagte etwa Keith Alexander bei einer Anhörung vor dem amerikanischen Kongress.3 »Nichts von dem, was veröffentlicht wurde, hat gezeigt, dass wir irgendetwas Illegales oder Unprofessionelles tun.« Der NSA-Chef hat diesen Satz Ende Oktober 2013 gesagt, nur ein paar Tage, nachdem wir im SPIEGEL enthüllt hatten, dass die NSA über viele Jahre die CDU-Vorsitzende und spätere Bundeskanzlerin Angela Merkel überwacht hatte. Ein Angriff, der sich einreiht in die Überwachung der Europäischen Union, der Vereinten Nationen und diverser Staats- und Regierungschefs.
Es ist diese Hybris, die der größten Geheimdienstaffäre seit dem Ende des Kalten Krieges eine zweite politische Dimension verleiht. Außer den sogenannten »Five Eyes« (Fünf Augen), der angelsächsischen Koalition mit England, Neuseeland, Kanada und Australien, kennt Amerika keine Freunde. Das ist die traurige Erkenntnis aus dieser Affäre. Die ganze Welt ist aus Sicht der Vereinigten Staaten ein Angriffsziel, auch für vermeintlich enge Verbündete wie die Bundesrepublik Deutschland gilt keine Ausnahme. »The greatest nation on earth«, wie die Amerikaner ihr Land gerne nennen, kann sich scheinbar alles erlauben.
»Ich glaube, dass Amerika außergewöhnlich ist«, hat US-Präsident Barack Obama vor der Vollversammlung der Vereinten Nationen im Herbst 2013 gesagt.4 Er benutzte das Wort »exceptional«, und die NSA ist für die Vereinigten Staaten eine Waffe, die ihr hilft, diesen Sonderstatus auch geopolitisch durchzusetzen. Intern macht die NSA keinen Hehl aus dem Ziel ihrer Arbeit, aus ihrer »Vision«. Es gehe um die globale »Informationsvorherrschaft«, heißt es in einer Selbstdarstellung der Behörde.
Es verwundert kaum, dass sich das schlechte Gewissen der USA trotz des eingetretenen globalen Flurschadens in Grenzen hält. »Dies ist die Zeit für Führungsstärke in einer gefährlichen und chaotischen Welt«, sagte der einflussreiche Republikaner Mike Rogers, Vorsitzender des Geheimdienstkomitees im US-Repräsentantenhaus nach Bekanntwerden der Merkel-Überwachung. »Es ist nicht die Zeit, sich zu entschuldigen.«5
Dass er mit seinen Enthüllungen an einem empfindlichen Nerv rühren und mit dem militärisch-nachrichtendienstlich-industriellen Komplex einen übermächtigen Gegner herausfordern würde, war Edward Snowden bewusst: »Ich werde für meine Handlungen leiden müssen.« Tatsächlich gab es in den vergangenen Monaten bedenkliche Reaktionen auf seine Enthüllungen, manche von ihnen ähnlich entlarvend wie die von ihm bereitgestellten Dokumente. Wie schon im Fall von Julian Assange und Bradley (nun Chelsea) Manning forderten Politiker die Todesstrafe gegen den Whistleblower und fantasierten in Talkshows über Exekutionsmethoden. Der ehemalige NSA-Chef Michael Hayden sagte auf einer Tagung zur Cybersicherheit im Herbst 2013, ihm sei danach, Snowdens Namen auf die Todesliste der US-Streitkräfte zu setzen. Der Republikaner Mike Rogers erwiderte, er sei gerne bereit, Hayden dabei zu helfen.
Wie tief die Vereinigten Staaten sich durch den 30-Jährigen und seine Tat herausgefordert fühlten, zeigte sich etwa im Juli 2013, als die USA mehrere europäische Regierungen aufforderten, der aus Moskau kommenden Regierungsmaschine des bolivianischen Präsidenten Evo Morales den Überflug zu verweigern, weil sie Edward Snowden an Bord wähnten. Die Maschine musste einen ungeplanten Tankstopp in Wien einlegen und wurde durchsucht. Snowden war nicht an Bord, aber ganz Lateinamerika empört. Doch diplomatische Verwicklungen hatten die USA bewusst in Kauf genommen. Die Machtdemonstration und Warnung an potentielle Fluchthelfer war es ihnen wert.
Es sollte nicht bei diesem einen Einschüchterungsversuch bleiben. Staatliche Drohgebärden trafen in der Folge nicht nur Snowden und seine direkten Unterstützer, sondern auch die Medien. Der Chef des britischen Geheimdienstes etwa erdreistete sich, Journalisten als Terrorhelfer zu diffamieren, da al-Qaida aus den Veröffentlichungen Hinweise auf Überwachungsmethoden ziehen könne. Und der US-Geheimdienstkoordinator James Clapper behauptete, durch die Enthüllungen seien die Vereinigten Staaten unsicherer geworden, wofür er »Snowden und seine Komplizen« verantwortlich mache. Mit den »Komplizen«, legte sein Sprecher nach, habe der »Director of National Intelligence« all jene gemeint, die Snowden bei den »nicht autorisierten Veröffentlichungen« von Geheimmaterial geholfen hätten.
Während der Arbeit mit dem NSA-Material haben wir viel darüber diskutiert, was demokratische Staaten im Namen der »nationalen Sicherheit« im letzten Jahrzehnt glaubten tun zu müssen und rechtfertigen zu können. Die Vereinigten Staaten haben auf den Schock der Anschläge vom 11. September 2001 mit den berüchtigten »erweiterten Vernehmungsmethoden« reagiert, mit Waterboarding von Verdächtigen in Geheimgefängnissen, mit Entführungen auf offener Straße, geheimen Verschleppungsflügen und Internierungslagern für »ungesetzliche Kombattanten« in Guantanamo. Parallel haben sie, wie wir dank Edward Snowden nun wissen, einen Überwachungsapparat aufgebaut, wie es ihn zuvor nie gegeben hat.
Doch die US-Amerikaner sind damit nicht allein. Ihre engsten Partner aus Großbritannien sind ihnen in Anspruch und technischen Möglichkeiten nahezu ebenbürtig. Und nirgendwo wurden Journalisten und Medien für ihre Arbeit mit den Snowden-Materialien stärker angefeindet, nirgendwo waren sie gravierenderen Einschüchterungsversuchen ausgesetzt als im Land der altehrwürdigen britischen Demokratie. Die britische Regierung forderte von der Redaktion des »Guardian« nicht nur unverhohlen die Rückgabe des Geheimmaterials (»Ihr hattet euren Spaß«), sondern sie drohte offen mit juristischen Konsequenzen.
Schließlich bestanden Regierungsvertreter darauf, dass »Guardian«-Mitarbeiter vor ihren Augen mit Bohrmaschine und Winkelschleifer die MacBooks zerstörten, auf denen die Dokumente gespeichert waren. Wohl wissend, dass der Zerstörungsakt rein symbolisch war – natürlich hatte die Redaktion längst Sicherungskopien in die USA gebracht. Die Festplatten-Zerstörung im Keller des Londoner »Guardian«-Gebäudes ist schon jetzt Teil der Mediengeschichte, und zwar als Symbol staatlicher Ohnmacht und Willkür, als brutaler Eingriff in die Pressefreiheit. Sie zeigt, dass demokratische Errungenschaften in vermeintlichen Krisenphasen selbst in gefestigten Demokratien schneller erodieren, als wir es für möglich gehalten hätten.
Uns selbst erreichte die Affäre an einem Sonnabend Mitte Juni 2013. Wir waren gerade auf dem Rückweg von der Jahrestagung der Journalistenvereinigung »Netzwerk Recherche«, als das Handy klingelte. Am Apparat war ein alter Bekannter, der sagte, Glenn Greenwald, einer der Journalisten, die sich mit Snowden in Hongkong getroffen und Teile von dessen Archiv erhalten hatten, sei bereit, sich mit uns zusammenzusetzen. Am nächsten Morgen saßen wir gespannt im Flugzeug nach Rio de Janeiro, Greenwalds Wohnort, im Handgepäck ein paar Festplatten, Laptops, ein Cryptophone und Verschlüsselungssoftware.
Wir trafen uns in einem Hotel an der Copacabana. Es war ein lauer Sommerabend, am Strand feierten Fußballfans bis spät in die Nacht, sie sangen und schwenkten die gelb-roten Fahnen Spaniens, das in der Vorrunde des Confederations Cup gerade gegen Uruguay gewonnen hatte. Es gab Caipirinha und frische Ananas. Gegen 22 Uhr, mit zwei Stunden Verspätung, schlurfte Greenwald in die Hotellobby. Er trug Bermudashorts, Badelatschen und ein ausgewaschenes T-Shirt, über der Schulter hing ein schwarzer Rucksack, in dem er die Festplatten voller amerikanischer Staatsgeheimnisse bei sich trug. »Sie sind heute bei mir zuhause eingebrochen und haben einen Computer gestohlen«, sagte er, erkennbar mitgenommen. »Womit kann ich helfen?«
Greenwald wies uns auf diverse Dokumente zu Deutschland hin, bat allerdings um Verständnis, dass wir sie uns auf anderem Weg besorgen müssten. Und so flogen wir unverrichteter Dinge am nächsten Morgen wieder ab.
Zurück in Berlin bemühten wir uns um ein Treffen mit der Dokumentarfilmerin Laura Poitras, die wie Greenwald von Snowden kontaktiert und nach Hongkong gebeten worden war. Poitras hatte von unserem Flug nach Rio gehört, wir kannten uns flüchtig von unseren früheren Recherchen zum Thema WikiLeaks. Sie war bereit, sich mit uns zu treffen und über die NSA zu reden. Sie fragte interessiert nach unserer bisherigen Arbeit, nach unseren Erfahrungen mit Themen der inneren Sicherheit, sie erkundigte sich nach unseren Kontakten in deutschen und europäischen Behörden, nicht nach einzelnen Namen, sondern nach der Art des Netzwerks. Wir schlugen eine Kooperation vor. Wir würden gemeinsam an Geschichten für den SPIEGEL arbeiten, sie als Koautorin und freie Mitarbeiterin. So kam es – und bei der Zusammenarbeit half sicher, dass wir seit Jahren auch über verschlüsselte Mails und Chats kommunizieren.
Inzwischen haben wir viele Monate lang NSA-Dokumente ausgewertet, die meisten davon sind als »top secret« eingestuft und explizit nicht für die Augen von Ausländern bestimmt. Wir beschäftigen uns seit 20 Jahren mit der Arbeit der Geheimdienste, haben in den frühen neunziger Jahren schon Vorlesungen des CIA-Aussteigers und frühen Whistleblowers Philip Agee6 an der Universität Hamburg gehört, gemeinsam über die Anschlagspläne der sogenannten Sauerland-Gruppe in Deutschland berichtet, die dank Hinweisen der NSA aufflog – und haben von 2010 an zusammen mit WikiLeaks die Kriegstagebücher aus Afghanistan und Irak sowie die diplomatischen Depeschen veröffentlicht. Doch nie zuvor haben wir einen derart tiefen und intimen Einblick in die Arbeit von Nachrichtendiensten und in die Denkweise ihrer Auftraggeber in der Politik nehmen können wie durch die Arbeit mit den NSA-Dokumenten.
Journalisten sind in ihrer Arbeit zunehmend mit Inszenierungen konfrontiert. Anfang Juli, kurz nach dem Beginn der Enthüllungen, versicherte Barack Obama: Wenn er wissen wolle, was Angela Merkel denke, dann rufe er sie an. Ein paar Monate später wusste die Bundeskanzlerin, dass es ihr nicht besser ergangen war als Millionen anderer Bürger. Redetexte, Stellungnahmen und Interviews werden von Pressestellen, PR-Beratern und Juristen gelesen, geprüft und weichgespült. Die NSA-Dokumente sind anders, sie sind roh, ungeschminkt, sie waren nie für die Augen von Journalisten oder für die Öffentlichkeit bestimmt, deshalb formulieren die Analysten und Mitarbeiter ihre Ziele, Ambitionen und Probleme vergleichsweise offen. Sie werden natürlich darauf achten, wie das Geschriebene auf Kollegen und Vorgesetzte wirkt, aber abgesehen davon müssen sie keine Rücksichten nehmen. Und so lesen sich die Materialien dann auch, etwa wenn sich NSA-Mitarbeiter in einer Präsentation über iPhone-Käufer als »zahlende Zombies« lustig machen, die für die Wanze in der eigenen Hosentasche auch noch viel Geld ausgeben. Das Dokument ist mit einem Foto von glücklichen Jugendlichen illustriert, die ihr gerade erstandenes Gerät vor einem Apple-Store stolz in die Kameras halten.
Wie ihre Wortwahl auf ausländische Leser wirken würde, haben die Geheimdienstangestellten mit Sicherheit nicht bedacht, immerhin findet sich auf vielen Papieren die Aufschrift »Noforn« – also »No Foreigners«, nicht für ausländische Augen bestimmt. Es handelt sich bei dem NSA-Material um ein gigantisches Konvolut aus PowerPoint-Präsentationen, Einträgen im internen Geheimdienst-Wiki und dem hauseigenen Intranet, in dem es teilweise nicht anders zugeht als in dem vieler Firmen und Behörden. Es werden darin Weiterbildungsvorträge im »Friedman Auditorium« in Fort Meade angekündigt, denen die Mitarbeiter im Saal oder über Videokonferenzen folgen können, es gibt Aprilscherze, Beiträge zu Thanksgiving und zum Muttertag eine Grußkarte: »Thanks, Mums!«. Langgediente Mitarbeiter erinnern sich an ihre schönsten Auslandsaufenthalte und schreiben kleine Oden auf das Rheinland oder das Oktoberfest. Nur dass sich bei der NSA neben unzähligen belanglosen Mitteilungen eben auch Erfolgsmeldungen finden wie jene, man habe den Mail-Account des mexikanischen Präsidenten erfolgreich gehackt. Wenn diese oder eine andere Meldung den Mitarbeitern besonders gut gefällt, können sie sie im internen sozialen Netzwerk »Spyspace« teilen, genau wie bei Facebook.
Die Dokumente verraten mehr als ihre konkreten Sachinhalte, sie sagen etwas aus über den Geist ihrer Verfasser und über das Arbeitsklima. Es gibt eine Menge Einladungen zu sozialen Events wie zu Grillfesten. Die NSAler treffen sich etwa zum Frühlingsangrillen, für das alle Teilnehmer fünf Dollar in die Gemeinschaftskasse zahlen. Auch Genderfragen werden diskutiert, in der Mitarbeiterzeitung der »Yakima Research Station« wird beispielsweise ausführlich diskutiert, warum sich so wenige Frauen für Ingenieurjobs bei der NSA interessieren.
Gefühlsäußerungen finden sich in den Dokumenten naturgemäß eher selten, deshalb fallen sie besonders ins Auge. Hin und wieder jubeln die Kryptologen, wenn sie eine besonders harte Nuss geknackt haben: »Yay Yay!«, freut sich beispielsweise einer, als das Videokonferenzsystem der Uno erfolgreich infiltriert ist. »Champagner!«, fordern britische Codeknacker, als sie einen neuen BlackBerry-Kompressionsstandard gehackt haben.
Was auffällt, sind die Sehnsucht nach einer Prise Leichtigkeit und ein zuweilen etwas kruder Sinn für Humor. Er zeigt sich in schrägen Grafiken und Comicfiguren, die manche der NSA-Programme als Emblem tragen, im Falle des Programms »Mystic« ist es ein rauschebärtiger Zauberer. Ein ansonsten staubtrockenes Glossar der internen Abkürzungen enthält unvermittelt auch das Akronym »LOL« für »laugh out loud«, das in Chats und Mails für einen Lacher steht. Und eine interne Erfolgsmeldung für eine geglückte Operation in Kasachstan wird tatsächlich mit einem Foto von »Borat« illustriert, dem Klamaukhelden aus dem gleichnamigen Kinofilm.
In diesem Buch versuchen wir uns an einer Gratwanderung. Einerseits werden bislang teils unbekannte Operationen und Praktiken der NSA beschrieben, von denen wir meinen, dass ihre Beschreibung im öffentlichen Interesse ist und Gegenstand einer breiten Diskussion sein sollte. Eine lebendige Demokratie braucht eine Debatte über die weitgehend im Geheimen entstandenen Überwachungsapparate und deren ständig wachsende Fähigkeiten. Diese Debatte ist unseres Erachtens überfällig.
Andererseits kann es nicht das Ziel von kritischem Journalismus sein, den Gegnern und erklärten Feinden von Demokratien in die Hände zu spielen oder das Geschäft anderer Geheimdienste zu betreiben. Deswegen haben wir in einem ausführlichen Diskussionsprozess abzuwägen versucht, wo die Grenzen öffentlichen Interesses verlaufen – und an verschiedenen Stellen auf die Publikation sensibler Informationen verzichtet.
Die NSA zieht diese Grenzen naturgemäß anders. Über Monate hatten wir wöchentlich mit dem Hauptquartier in Fort Meade zu tun, zeitweise auch mit dem Weißen Haus. Jeden Freitag, zum Redaktionsschluss des SPIEGEL, rangen wir mit dem Geheimdienst über die Details der Recherche, manchmal per Mail, manchmal per Telefonkonferenz. An einem dieser Freitage dauerte es eine gefühlte Ewigkeit, bis alle Teilnehmer zusammengeschaltet waren. Am Hörer war die Sprecherin der NSA, die ankündigte, dass »eine größere Zahl an Regierungsmitarbeitern« in der Leitung sei. Auf unsere Nachfrage, ob wir wissen dürften, mit wem wir telefonieren, antwortete sie: »Nein, nicht zu diesem Zeitpunkt.« Selbst mit einem Mindestmaß an Transparenz tut sich die NSA schwer, jene Behörde, die sich selbst einen Anspruch auf totale Information anmaßt. Allerdings mussten wir die Erfahrung machen, dass sich der britische Geheimdienst GCHQ noch restriktiver verhielt.
Dabei scheinen die Geheimen im Vereinigten Königreich den SPIEGEL durchaus wahrzunehmen, jedenfalls stolperten wir bei unserer Arbeit am Snowden-Material über einen als »streng geheim« eingestuften Hinweis auf eine unserer eigenen Geschichten. Der SPIEGEL habe dem GCHQ in Deutschland kurzen Ruhm beschert, hieß es darin. Tatsächlich hatten wir im Jahr 2008 über die damaligen Pläne des Bundesinnenministeriums berichtet, im Kölner Bundesverwaltungsamt eine deutsche Version des GCHQ einzurichten7 – der damalige Staatssekretär August Hanning war nach einem Besuch der britischen Lauschzentrale so begeistert gewesen, dass er der festen Auffassung war, so etwas brauche man hierzulande auch.
Unsere Erfahrungen mit der US-Regierung selbst waren nicht viel besser als mit den Geheimdiensten. Anfragen nach einem Hintergrundgespräch beantwortete eine Sprecherin von US-Präsident Obama mit E-Mails wie dieser: »Das Team im Weißen Haus hat diese Woche keine Zeit, sich zu diesem Thema zu treffen.«8 Diese Woche, das galt für das gesamte Jahr 2013, natürlich nur für uns ausländische Journalisten. Mit den amerikanischen Kollegen von der »New York Times« oder der »Washington Post« führt das Weiße Haus regelmäßig solche Gespräche.
An einem kalten, klaren Wintertag kurz vor Weihnachten 2013 öffnete die NSA ihre Türen schließlich doch einen Spalt breit und ermöglichte uns einen Besuch in der »Schattenfabrik«, wie der amerikanische Journalist James Bamford den Geheimdienst genannt hat. Neben diesem Besuch vor Ort stützt sich dieses Buch auf Gespräche mit aktiven und ehemaligen Geheimdienstlern in den USA, Deutschland und anderen Ländern, mit dem Kanzleramt und dem Weißen Haus. Wir haben uns mit investigativen Journalistenkollegen und Wissenschaftlern getroffen, die sich schon seit Jahrzehnten mit der Behörde und ihrer Arbeit befassen. In Brüssel haben wir EU-Kommissare wie Neelie Kroes befragt und mit Ermittlern aus verschiedenen Nationen sowie Mitarbeitern europäischer Telekommunikationsunternehmen gesprochen, die den Auftrag haben, das Ausmaß der Spähangriffe aufzuklären. In New York haben wir die Räume der ausgespähten Mission der EU besichtigt. In einem Besucherraum im Erdgeschoss der amerikanischen Botschaft in Berlin haben wir den US-Botschafter John Emerson erlebt, der sich größte Mühe gab, freundlich und doch verbindlich zu erklären, warum es keinesfalls einen Rundgang durch das Dachgeschoss des Gebäudes geben werde – weder für Journalisten noch für deutsche Behörden. Wir haben Barack Obama in Berlin und Washington bei seinen Rechtfertigungsversuchen beobachtet und uns bei Nachbarn, früheren Freunden und seiner Highschool nach Edward Snowden erkundigt. Mit Snowden selbst hatten wir über die Monate verschiedentlich Kontakt per verschlüsseltem Chat, so wie an einem Freitagabend Ende November, als er uns über diesen Kanal ein kurzes Manifest zuschickte, das wir in der nächsten SPIEGEL-Ausgabe abdruckten und für das er den Satz formulierte: »Wer die Wahrheit ausspricht, begeht kein Verbrechen.«
Edward Snowden ist mittlerweile zu einer bekannten Figur geworden. Sein Konterfei zierte die Titelseiten fast aller Zeitungen weltweit, viele erklärten ihn zur Person des Jahres 2013. Demonstranten tragen Snowdens Gesicht als Maske. Je nach Perspektive sehen ihn die Leute als Helden oder als Verräter, sie wünschen ihm den Friedensnobelpreis, eine lange Haftstrafe und manche sogar den Tod. Obama sagt über Snowden, er sei »kein Patriot« und solle sich wie jeder anständige Amerikaner einem Gerichtsverfahren stellen. Gleichzeitig räumt selbst der US-Präsident ein, dass Snowden eine öffentliche Debatte über Geheimdienstreformen ermöglicht hat, die das Land »gebraucht« habe.
Snowden selbst würde sich wohl eher als Antiheld beschreiben. Wenn sich Julian Assange mit dem ihm eigenen Furor als eine Art digitaler Che Guevara inszeniert, tritt Snowden eher wie ein nüchterner Menschenrechtsanwalt auf, der ruhig argumentierend für seine Sache wirbt. Am liebsten würde er gar nicht über sich, sondern nur über die NSA reden, scheint es. Snowden spricht nachdenklich und leise. Er ahnt, dass es für ihn kein Zurück in sein bürgerliches Leben gibt. Er bezeichnet sich selbst als verbrannten Mann, er sagt: »Ich weiß, dass die Übergabe dieser Informationen an die Öffentlichkeit mein Ende markiert.«
Vielleicht hat die Chefin der mächtigen NSA-Abteilung für technische Überwachung eine Ahnung gehabt, vielleicht war es aber auch nur eine Floskel, als sie ihre Leute am 22. November 2011 in einer Grundsatzrede im Hauptquartier der NSA auf unruhige Zeiten einschwor. »In den kommenden zwölf Monaten werden noch einige Überraschungen auf uns zukommen, kein Zweifel«, sagte die leitende NSA-Mitarbeiterin. »Wir müssen das Unerwartete erwarten.« Als die Rede über das hauseigene digitale schwarze Brett verbreitet wurde, bereitete Edward Snowden gerade seine Flucht vor.
Es sollte noch 18 Monate dauern, bis das Unerwartete geschah.
1 Nach Angaben seines Vaters Lon Snowden, »Stern« vom 7.11.2013.
2 Die Zahlen stammen aus einer geheimen Präsentation für die »Pacific SigDev Conference 2010«.
3 Während einer Anhörung vor dem Geheimdienstausschuss des US-Repräsentantenhauses am 29.10.2013.
4 Rede Obamas vor den Vereinten Nationen am 24.9.2013.
5 Während einer Anhörung vor dem Geheimdienstausschuss des US-Repräsentantenhauses am 29.10.2013.
6 Agee war ein früher Whistleblower. Er arbeitete für die CIA in Mexiko und anderen Ländern und verließ den Geheimdienst unter anderem wegen dessen Subversion demokratisch gewählter Regierungen in Lateinamerika und den Kooperationen mit Rechtsextremisten, die die CIA zur Verfolgung ihrer Ziele einging. Agees Enthüllungsbuch Inside the Company erschien 1975 und wurde in mehr als 20 Sprachen übersetzt (dt. CIA intern.Tagebuch 1956 –1974, Hamburg 1979). In seiner Biografie On the Run (1987) schildert er die Geschichte seiner Flucht, die erstaunliche Parallelen zum Fall Snowden aufweist: Es gab Todesdrohungen gegen ihn, er wurde als KGB-Agent bezeichnet und sein Pass für ungültig erklärt. In den neunziger Jahren lebte er als Staatenloser lediglich mit einem Duldungsstatus in Hamburg-Eppendorf und hielt als Gastdozent Vorlesungen über sein Lebensthema, bevor er nach Kuba zog und dort ein Online-Reiseportal namens Cubalinda eröffnete. Agee starb am 7. Januar 2008 in Havanna.
7 Marcel Rosenbach und Holger Stark: »Der ganz große Lauschangriff«, DER SPIEGEL vom 19.5.2008, abrufbar unter: http://www.spiegel.de/spiegel/print/d-57038058.html.
8 E-Mail der Sprecherin des Nationalen Sicherheitsrates im Weißen Haus, Caitlin Hayden, vom 1.7.2013.
»Jeder, der je in einem Meeting mit Ed gesessen hat, wird das Gleiche sagen: dass er eine Klasse für sich war.«
Ein Exkollege über Edward Snowden
Normalerweise begann der Morgen von Dave M. Churchyard damit, dass er sich durch den Verkehr von Genf kämpfte. Churchyard wohnte in der Nähe der Altstadt in einem sanierten Appartement im Stadtteil Saint-Jean, das ihm das amerikanische Konsulat vermittelt hatte. Er fuhr einen schweren, dunklen Geländewagen, der die morgendlichen Fahrten durch das malerische Genf bequem machte, ihn aber auch von der Umgebung entrückte. Churchyard war erst 24 Jahre alt, es war sein erster längerer Aufenthalt in Europa, weit entfernt von der amerikanischen Ostküste, wo er aufgewachsen war. Ein Gefühl von Sicherheit konnte ihm nur guttun.
Der Weg zur Arbeit führte am Westufer des Genfer Sees hinauf, ließ die Ile Rousseau rechter Hand liegen, in das Diplomatenviertel hinein, wo die Vereinten Nationen ihr Quartier haben. Churchyard mochte den Verkehr in Genf nicht. Er fürchtete ständig, dass er in jemanden hineinfahren würde. Für einen Amerikaner, der sechsspurige Highways gewohnt ist, waren die Gassen zu schmal, dazu kamen die Bus- und Fahrradspuren, ganz zu schweigen von den Straßenbahnen.
Sein Arbeitsplatz war die amerikanische Mission bei den Vereinten Nationen, die zugleich das amerikanische Konsulat beherbergte, Route de Pregny 11, nur ein paar Meter vom UN-Gebäude am Palais des Nations entfernt. Die diplomatische Dependance gehört zu den größeren weltweit, gleich vier Botschafter hat die US-Regierung nach Genf entsandt, dazu Dutzende Diplomaten, deren Auftrag es ist, vor Ort den Kontakt zu mehr als hundert Regierungen und Nichtregierungsorganisationen zu halten.
Churchyard besaß einen Diplomatenpass und damit Immunität, aber sein Auftrag hatte wenig mit Völkerverständigung zu tun. Sein Schreibtisch stand in einem besonders gesicherten Trakt der Botschaft, in dem keine normalen Diplomaten und kein Ortspersonal erwünscht waren. Er arbeitete für die .
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!





























