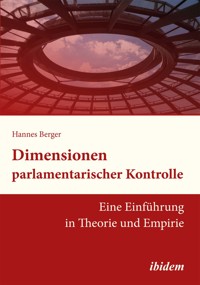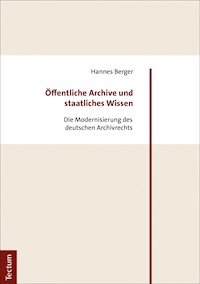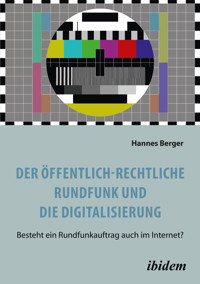
15,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ibidem
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
Kaum ein sozialer Wandlungsprozess ist von solcher Relevanz wie die Digitalisierung von Staat, Verwaltung und Gesellschaft. Insbesondere der Mediensektor ist von diesen Veränderungen betroffen. Mittlerweile sind die öffentlich-rechtlichen Rundfunksender vielfältig im Internet vertreten. Sie betreiben Mediatheken, Newsletter und Online-Shops. Der vorliegende Band untersucht diese neuen Formen des Rundfunks und widmet sich den damit verbundenen Fragen des Verfassungs- und Medienrechts. Auf die einleitende Einordnung der Digitalisierung in die Rechtshistorie des Rundfunkwesens folgt eine verfassungsrechtliche Untersuchung des Rundfunkauftrages aus Artikel 5 Absatz 1 Satz 2 des Grundgesetzes. Die in Fachkreisen nach wie vor hochumstrittene Frage, ob die öffentlich-rechtlichen Internetangebote verfassungsrechtlich zulässig sind, wird ausführlich behandelt. Die einzelnen Onlineaktivitäten werden dabei detailliert am Maßstab des Grundgesetzes beurteilt. Insgesamt bietet dieses Buch damit einen sehr aktuellen und differenzierten Beitrag zum Verfassungsrecht und zum Medienrecht des 21. Jahrhunderts.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 208
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
ibidem-Verlag, Stuttgart
Inhaltsverzeichnis
A.Allgemeiner Teil – Die „dienende“ Rundfunkfreiheit
I.Einleitung
1.Problemaufriss
Die Aufgabe der Rechtsordnung und der Rechtswissenschaft ist es, auf Probleme, die im Zuge von gesellschaftlichen Entwicklungen auftreten, zu reagieren und Lösungen aufzuzeigen. Die Nutzung und die Vielfalt der Medien zu Beginn des 21. Jahrhunderts befinden sich inmitten einer bedeutenden Beschleunigung. Das veränderte Verhalten wird hervorgerufen durch den Ausbau der Kommunikationstechnik, die Erschwinglichkeit der technischen Endgeräte und die damit einhergehend im Lebensalter früher einsetzende Gewöhnung an die neuen Kommunikationsformen.
Diese rasante Entwicklung begann bereits in den 1980er Jahren mit den durch Satelliten- und Kabeltechnik gestiegenen Möglichkeiten für Private, am kommunikativen Prozess teilzuhaben. Der Anstieg und die enorme Rezeption privater Hörfunk- und Fernsehprogramme sind dafür ebenso ein Anzeichen wie auch die Diversifizierung der Medienformen und der Endgeräte.[1]Hatte bereits im Jahr 1987 die technische Möglichkeit, den sogenannten Videotext auf freien Sendefrequenzen zusätzlich zum Fernsehprogramm zu senden, für erheblichen Rechtsstreit zwischen privatwirtschaftlicher Presse und öffentlich-rechtlichem Rundfunk gesorgt[2], so sollte dies doch nur eine Vorahnung der juristischen Herausforderungen sein, die im Zuge des spätestens im Jahre 1995 aufkommenden Internets entstanden. Die einsetzende Verbreitung derpersonalcomputersowie der bis heute anhaltende Ausbau des Zugangs der privaten Haushalte zumWorld Wide Web[3]führten zu einer Fülle an rechtswissenschaftlichen Fragestellungen und Problemen – beispielsweise im Arbeitsrecht[4], Urheberrecht[5], zum Datenschutz[6], zum Vertragsrecht im Internet[7]und ebenso zu strafrechtlichen Belangen[8]. Die massenhafte Nutzung neuer Kommunikationsformen wieE-Mail,Chats,Video-Plattformenundsozialer Netzwerkeführte überdies auch zu einer Reihe von verfassungsrechtlichen Fragen, wie beispielhaft die Anwendbarkeit des Fernmeldegeheimnisses nach Art. 10 Abs. 1 GG im Onlinebereich.[9]Grundsätzlich musste geklärt werden, wie das Kommunikationshandeln im Internet grundrechtlich geschützt wird. Ist das Eintippen eines Kommentares in einen Chatverlauf durch die Meinungsfreiheit aus Art 5 Abs. 1 S. 1 GG geschützt oder fällt es bereits aufgrund seiner Textform unter den Schutzbereich der Pressefreiheit gemäß Art. 5 Abs. 1 S. 2 GG? Ist das Hochladen einer Videodatei auf eine allgemein zugängliche Video-Plattform wie etwaYouTubebereits als Rundfunk im verfassungsrechtlichen Begriffsverständnis zu qualifizieren? Und, so ließe sich dies sogar weiterfragen, müsste daraus eventuell auch die Konsequenz folgen, dass für dieses Hochladen eine Genehmigung notwendig ist, wie es die Landesmediengesetze für den privaten Rundfunk vorsehen?[10]Der Streit um solche und ähnliche Fragen hält bis heute an.
Die juristische Debatte um die verfassungsrechtliche Einordnung der Internetkommunikation ist nach wie vor von keiner herrschenden Meinung, dafür aber durch eine Vielzahl an Vorschlägen und Wortmeldungen bestimmt. Keineswegs erleichtert wird diese Auseinandersetzung durch den bereits seit Längerem bekannten[11], aber in der jüngsten Vergangenheit umso deutlicher hervortretenden Entwicklungseffekt der Medien: die Konvergenz.[12]Als im Jahr 1999 der erste Plasma-Fernseher zum Verkauf angeboten wurde, der die Röhrenfernseher ab diesem Zeitpunkt in erstaunlicher Schnelligkeit abzulösen begann[13], war ein wichtiger Schritt für eine Vermischung der Medienrezeption getan. Spätestens ab dem Jahr 2010 waren die Geräte so weit entwickelt, dass sie über ihre ursprüngliche Funktion der Wiedergabe des entlang eines Sendeplanes ablaufenden Programms weit hinauswuchsen. Die Fähigkeiten der neuen Geräte übertreffen die einzelnen Gerätefunktionen von Radio, TV-Gerät, Computer und Telefon und fusionieren sie zu ineinandergreifenden Kommunikationsformen. Die geräteübergreifende Fähigkeit, einen Zugang zum Netz herzustellen und als Eingabe- wie Ausgabegerät zu fungieren, lässt die Unterschiede der einzelnen Endgeräte verschwimmen. Mit modernen Fernsehern lässt sich mittels Eingabe über die Fernbedienung oder angeschlossener Tastatur problemlos im Internet surfen. Laptops und Computer können über eine Internetverbindung die inzwischen auch online vertretenen Fernsehprogramme und Radiosender wiedergeben. Das hat sogar die interessante Konstellation zur Folge, dass man über ein an das Internet angeschlossenes TV-Gerät das zu diesem Zeitpunkt laufende Fernsehprogramm einerseits über den üblichen Weg per Kabel oder Satellit ansehen kann, oder andererseits ebenjenes Fernsehprogramm über einen vom Rundfunkveranstalter im Internet eingestellten Stream abrufen kann. Dank der technisch fortgeschrittenen Leistungen ist ein Unterschied der Bild- und Tonqualität nicht mehr auszumachen. War nun die Medienrezeption über die modernen TV-Geräte und die feststehenden Computer noch an die eigene Wohnung ortsgebunden, fand die ohnehin veränderte Nutzung einen weiteren Schub durch die massenhafte Verbreitung des iPhones und daran anknüpfende Konkurrenzprodukte.[14]Diese Geräte haben weder optisch oder funktionell noch viel mit dem Vorgänger des Mobiltelefons zu tun. Smartphones sind im Grunde tragbare multimediale Computer. Neben der üblichen Einwahl in das Telefonnetz des Anbieters über die Sendefunkmasten besitzen sie zudem entweder die Technik des Mobilfunkstandards der dritten Generation (3G)[15]oder neuerdings auch der vierten Generation.[16]Diese in die Smartphones und auch in Tablet-PCs eingebauten Technologien erlauben es dem Nutzer, selbst unterwegs einen Zugang zum Internet herzustellen, der solchstabile Übertragungswege aufbaut, dass problemlos und ohne Zeitverzögerung Hörfunkprogramme, Videos und ganze Filme abgespielt werden können. Grundlegend entwickelt sich das World Wide Web insbesondere unter Jugendlichen zur primären Informationsquelle.[17]Durch die Vermischung von Eingabe und Ausgabe sowie durch die gleichzeitig nutzbaren Medienformen von Text, Ton, Bild usw. geben die mobilen Smartphones dem Konvergenztrend der Medien einen unvorhergesehenen Schub, weshalb sie oftmals als die „Konvergenzmaschinen“ schlechthin gelten.[18]Allein während schnellen Auto- oder Zugfahrten und in Teilen des ländlichen Raumes kommt es noch zu Verbindungsproblemen.
Die Rechtswissenschaft, die allein durch das Aufkommen des Internets vor einer Vielzahl an Fragen steht, sieht ihre Begriffe durch die gewandelte Mediennutzung einer großen Herausforderung ausgesetzt.[19]Verfassungsrechtliche Begriffe aus einer Zeit, in der selbst etwas wie der Videotext undenkbar war, müssen mit einigem Aufwand gegenüber den modernen Begebenheiten ausgelegt werden. Angesichts der Verschmelzung der Endgeräte und ihren Möglichkeiten, starre und bewegte Bilder, Text und Ton sowie die passive Rezeption und die aktive Beteiligung an Kommunikation zeitgleich zu verbinden, stellen sich Fragen nach der Gültigkeit der dogmatisch fein untergliederten Begriffe der Meinungs-, Presse- und Rundfunkfreiheit des Art. 5 Abs. 1 GG.
Insbesondere für die rechtsdogmatische Ordnung des Rundfunks in Deutschland hat die massenhafte Nutzung des Internets eine juristische Debatte ausgelöst, die noch nicht im Geringsten ausgefochten zu sein scheint. Dies liegt begründet in der „Sondersituation“[20]des Rundfunks, der in Form einer dualen Ordnung[21]sowohl von öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten, als auch von privaten Rundfunkveranstaltern angeboten wird. Die gebührenfinanzierten öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten stützen ihre Legitimation auf eine vom Bundesverfassungsgericht entwickelte Dogmatik des Rundfunks, die sich in den Anfangsjahren der Bundesrepublik noch auf das Argument der Senderknappheit berief und später auf einen öffentlich-rechtlichen Rundfunkauftrag, der Meinungsvielfalt und inhaltlichen Standard garantieren sollte.[22]
Den Trend zur Präsenz im Online-Bereich verfolgen auch die Rundfunkanstalten mit Vehemenz. Das laufende Programm lässt sich über Livestreams abrufen[23], in Mediatheken wird ein Großteil der zurückliegenden Sendungen archiviert und zum Abruf bereitgestellt. Ob Nachrichtensendung[24]oder Smartphone-Applikation[25], der Sonntagabendkrimi[26], eine Partnerbörse[27]oder kostenlose Klingeltöne – die öffentlich-rechtlichen Rundfunkanbieter nutzen die Möglichkeiten der Digitalisierung und der Präsentation auf eigenen Homepages, um ihr Rundfunkprogramm umfassend darzubieten.
Die Judikatur des Bundesverfassungsgerichts stellt jedoch keine Legitimation für ein unbegrenztes Wachstum der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten dar. Insbesondere vor dem Hintergrund der Gebührenfinanzierung der Rundfunkanstalten kann die Rechtmäßigkeit der deutlich gestiegenen Präsenz der Öffentlich-rechtlichen im Internet nicht ohne weiteres bejaht werden. Da sich der öffentlich-rechtliche Rundfunkauftrag aus der Verfassung selbst ergibt, muss auch Art. 5 Abs. 1 S. 2 GG Prüfungsmaßstab für diese Online-Aktivitäten sein.
2.Forschungsstand
Der rechtswissenschaftliche Streit rund um die Frage, ob die aus Art. 5 Abs. 1 S. 2 GG entwickelte Dogmatik auch für den Bereich des Internets gelten solle, verläuft grundsätzlich in drei verschiedenen Argumentationslinien. Ein Teil der Literatur sieht in der Onlinekommunikation lediglich die Ausformung von Individualkommunikation, weshalb hier die (massenkommunikative) Rundfunkfreiheit des Grundgesetzes überhaupt nicht einschlägig sei, sondern vielmehr der Schutzbereichder Meinungsfreiheit aus Art. 5 Abs. 1 S. 1 GG eröffnet sein müsse.[28]Insofern wird vertreten, das Verhalten im Netz müsse mehr durch die abwehrrechtliche Komponente der Meinungsfreiheit als durch eine institutionalisierte Rundfunkfreiheit im Internet grundrechtlich geschützt werden.
Die Gegenposition dazu hält die verfassungsrechtlichen Merkmale des Rundfunkbegriffs hingegen auch im World Wide Web für anwendbar und spricht sich insofern auch für eine Rundfunkmäßigkeit der Internetkommunikation aus.[29]Pluralismus und Vielfalt der Meinungen könnten in dieser Lesart auch im Internet bestimmten Gefahren und Einengungen ausgesetzt sein, weshalb die dienende Rundfunkfreiheit auch auf den Onlinebereich ausgedehnt werden müsse.[30]
Eine dritte Gruppe in der Literatur unternimmt hingegen den Versuch, sich von diesem Streit zu lösen. In Abkehr von der Rundfunkdogmatik des Bundesverfassungsgerichts versucht sie, Rundfunk lediglich als eine Unterkategorie der Meinungsfreiheit zu klassifizieren. Art. 5 Abs. 1 GG solle als eineinheitlichesKommunikationsgrundrecht neu konstituiert werden. In der Konsequenz lehnen die Vertreter dieser Ansicht eine gebührenfinanzierte öffentlich-rechtliche Rundfunkveranstaltung, wie sie aktuell existiert, ab. Sie plädieren hingegen für ein marktorientiertes Modell mit einem Legitimierungsvorbehalt für öffentlich-rechtliche Rundfunkangebote im Falle von offensichtlichen Vielfaltsdefiziten.[31]
3.Gang der Untersuchung
Die öffentlich-rechtlichen Rundfunkangebote finden in einem verfassungsrechtlichen und einfachgesetzlichen Ordnungsrahmen statt. Wenn die Rundfunkanstalten nun, wie angedeutet, ihre Angebote über den klassischen Rundfunk hinaus auf den Online-Bereich erweitern, so ist die Frage nach der Zulässigkeit dieser Entwicklung durchaus berechtigt. Ihre Existenz und Finanzierung verdanken die Rundfunkanstalten einem verfassungsrechtlichen Auftrag, der sie verpflichtet, die Meinungsvielfalt im Rundfunk zu sichern. Dieser Auftrag begründet sich aus der besonderen Suggestivkraft des Rundfunks und der demokratischen Funktion der Meinungsbildung. Wird das Rundfunkangebot auf das Internet erweitert, ist zunächst der Frage nachzugehen, ob dies vom Rundfunkauftrag und von der Rundfunkfreiheit umfasst ist. Dieser Problemstellung will vorliegenderBeitragnachgehen. Die zentralen Fragestellungen lauten daher:Was ist der öffentlich-rechtliche Rundfunkauftrag? Ist der verfassungsrechtliche Rundfunkbegriff auf die Internetkommunikation anwendbar? Kann ein öffentlich-rechtlicher Rundfunkauftrag für das Internet legitimiert werden? Besitzt die Internetkommunikation eine eigene Suggestivkraft? Worin liegen die Grenzen für öffentlich-rechtliche Rundfunkangebote im Online-Bereich?
Um dieser komplizierten Gemengelage nachzugehen, lohnt es sich, die Entwicklungslinien und die Legitimierung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks in Deutschland nachzuzeichnen. Darauf aufbauend können dann Rückschlüsse für die Onlineaktivitäten der Rundfunkanstalten gezogen werden und die Frage nach der Zulässigkeit dieser Angebote beantwortet werden. Zu diesem Zweck teilt sich die vorliegendeUntersuchungin zwei Teile. Der allgemeine Teil A wird im Anschluss an diese Einleitung die historischen Wurzeln des öffentlich-rechtlichen Rundfunksin Deutschland erörtern (A. II.) und hierbei insbesondere auf die frühen Weichenstellungen in der Weimarer Republik eingehen und ebenso die in der Bundesrepublik entwickelte Judikatur des Bundesverfassungsgerichts einordnen. Aufbauend auf diese Grundlegungen wird danach das verfassungsrechtliche Gefüge der deutschen dualen Rundfunkordnung untersucht (A. III.). Die hierbei entwickelten Grundsätze des Rundfunkauftrags und der Entwicklungsgarantie sind unmittelbare Anknüpfungspunkte für den Besonderen Teil B derUntersuchung. Dieser Teil widmet sich speziell der rechtswissenschaftlichen Bewertung der öffentlich-rechtlichen Onlineangebote. Dabei ist zuvörderst zu prüfen, ob der verfassungsrechtliche Rundfunkbegriff überhaupt auf die für das Internet spezifische Kommunikation übertragen werden kann (B. I.) bzw. für welche Fälle er gilt. Daraufhin wird geprüft, ob die einschlägigen rundfunkmäßigen Onlineangebote der Rundfunkanstalten ebenso von der Rundfunkordnung legitimiert sind (B. II.). Dabei wird insbesondere der Frage nachgegangen, ob sich ein Rundfunkauftrag nach Art. 5 Abs. 1 S. 2 GG auch für das Internet erkennen lässt. Die hieraus gewonnenen Erkenntnisse sollen in einem letzten Schritt auf die verschiedenen tatsächlichen Onlineangebote der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten angewandt werden und die jeweilige Zulässigkeit untersucht werden (B.III.). Daraufhin endet die Untersuchung mit der Schussbetrachtungder zentralen Ergebnisse dieses Beitrages(B.IV.).
II.Historische Entwicklung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks in Deutschland
Ein Blick auf die historischen Ursprünge des Rundfunks in Deutschland kann jene Entwicklungslinien aufzeigen, die sich bis heute auf die „Sondersituation“ der Rundfunkordnung auswirken. Das Rundfunkrecht ist besonders geprägt von seinen Anfängen in der Weimarer Republik und durch den Missbrauch währendder Zeitdes Nationalsozialismus.
1.Anfänge des Rundfunkrechts
Das Rundfunkrecht ist ein vergleichbar junges Rechtsgebiet. Erst 1887 entdeckte der Physiker Heinrich Hertz die Funkübertragung durch elektromagnetische Schwingungen. Zunächst für den Seefunk genutzt, kam dem Rundfunk erstmals im Ersten Weltkrieg eine größere Bedeutung zu.[32]Es war in den Anfangsjahren der Weimarer Republik die Deutsche Reichspost gewesen, auf deren Betreiben ein allgemeiner Rundfunk errichtet werden sollte.
Das alleinige Recht, Telegrafenanlagen zu errichten und zu verwalten bestand, ausschließlich für das Reich, bereits seit dem Telegrafengesetz vom 06. April 1892.[33]Telegrafenanlagen konnten gemäß § 1Telegrafengesetznur durch die Reichspost errichtet werden. Es bestanden jedoch Ausnahmen durch § 3, die es auch Privaten erlaubten, ohne Genehmigung eigene Anlagen aufzustellen. Sowohl die Verwaltungshoheit der Reichspost als auch die Ausnahmen der Genehmigungen galten aufgrund der damaligen Technik zunächst nur für die terrestrische Telegrafie per Kabel. Durch die technische Möglichkeit der drahtlosen Übermittlung durch den Funk (Funktelegrafie) musste auch das Telegrafengesetz angepasst werden.[34]Dies geschah durch die „Funkgesetznovelle“ vom 07. März 1908[35]. Hierdurch wurden auch die Ausnahmen der Genehmigungen für Private gestrichen und der körperlose Funk grundsätzlich unter Genehmigungsvorbehalt durch das Reich gestellt.[36]
2.Weimarer Republik
Nachdem sich bereits der Rundfunk in Großbritannien und in den Vereinigten Staaten großer Beliebtheit bei der Bevölkerung erfreute, entstand auch in Deutschland der Wille nach einem allgemein angebotenen Rundfunkprogramm. Die Deutsche Reichspost behielt dabei allein aufgrund ihres Verwaltungsmonopols eine zentrale Rolle. Der damals für ein Rundfunkprogramm zu betreibende finanzielle Aufwand stellte die Reichpost jedoch vor Probleme, weshalb sie sich gezwungen sah, auch Private einzubinden.[37]Ruft man sich die politischen und gesellschaftlichen Wirren der Anfangszeit der Weimarer Republik vor Augen[38], so wird verständlich, dass die Reichspost den Einfluss von politischen oder wirtschaftlichen Interessengruppen auf den Rundfunk verhindern wollte. Die Kooperation sollte daher von Beginn an unter staatlicher Kontrolle stattfinden; die Reichspost wollte den Rundfunk und somit die Hörer des Rundfunks von Umsturzversuchen und von politischem Parteienstreit fernhalten[39]; der Reichsinnenminister wollte den Rundfunk nicht „irgendwelche[n] Privatgesellschaften, deren Einstellung zur jeweiligen Reichsregierung zweifelnd und schwankend ist“ überlassen.[40]
Die erste von Schallplatten abgespielte Musikstunde wurde am 29. Oktober 1923 durch das BerlinerVoxhausüber den Rundfunk übertragen. Das Reichsinnenministerium unterstützte seit Ende 1923 die beiden privaten Funkhäuser „Drahtloser Dienst AG“ und die „Deutsche Stunde“. Waren es im Dezember 1923 noch 467 registrierte Hörer[41]stiegt diese Zahl auf 10.000 im April 1924 und auf 2,8 Millionen im Jahr 1929.[42]Die Rundfunkwirtschaft wuchs in den wenigen Jahren der Weimarer Republik bedeutend an: bis 1929 waren 1585 feste und 38.000 freie Mitarbeiter im Rundfunk beschäftigt, es wurden ganze Chöre und Orchester unterhalten.[43]Gleichwohl fanden sich die Hörer trotz der weiten Verbreitung des Rundfunks vornehmlich in den Städten.
Bis zur Rundfunkordnung von 1926 war die Rundfunkwirtschaft ein kaum reguliertes Feld. Die einzigen umfangreichen Genehmigungen waren an die „Deutsche Stunde“ und die „Dragag“ durch die Reichspost erteilt worden. Gleichwohl hatten sich über das gesamte Reichsgebiet neue Regionalgesellschaften gegründet.[44]Das Bestreben der jungen privaten Rundfunkgesellschaften, sich in einem eigenen „Reichsrundfunkverband“, einem eingetragenen Verein, zu organisieren, wurde von der Reichsebene versucht zu unterbinden.[45]Mit dem Druckmittel, notfalls keine weiteren Konzessionen zu erteilen, zwang die Reichspost die Rundfunkgesellschaften, sogenannte „Ausführungsverträge“ zu den Genehmigungen zu unterzeichnen.[46]Bedingung dieser Verträge war es zum einen, dass 51 v. H. der Aktienanteile der Rundfunkgesellschaften in die Hand der Reichspost übertragen wurden und zum anderen, dass alle Rundfunkgesellschaften der Dachgesellschaft „Reichs-Rundfunk-Gesellschaft“ beizutreten hatten.[47]Auf diese Weise verschaffte sich das Reich eine beherrschende Stellung über die Rundfunkgesellschaften.[48]
Da die Länder auch zur Zeit der Weimarer Reichsverfassung die Kulturhoheit innehatten, mussten die Reichspost sowie das mittlerweile im Rundfunk stark engagierte Reichsinnenministerium einsehen, dass eine Beteiligung der Länder an der Programmgestaltung und am wirtschaftlichen Erfolg nicht zu umgehen war.[49]Neben Württemberg und Bayern betonte besonders Preußen seine kulturhoheitlichen Forderungen gegenüber dem Reich.[50]Die rundfunkpolitischen Ziele der staatlichen Kontrolle und der Länderbeteiligung wurden Ende 1926 mit der ersten Rundfunkordnung[51]erreicht. Hierdurch wurde ein „Überwachungsausschuss“ für jede Rundfunkgesellschaft eingerichtet, der aus je einem Vertreter des Reiches und zwei Vertretern des entsprechenden Landes zusammengesetzt war. Der Überwachungsausschuss übte eine umfassende Vorabkontrolle über die Programmsendungen aus. Überdies wurde die Veranstaltung von „Nachrichten- und Vortragsdiensten“ unter bestimmte „Richtlinien“ gestellt, die eine Parteilichkeit der Nachrichten verbot.
Die Reform der Rundfunkordnung von 1932 schuf schließlich eine komplette Verstaatlichung der Rundfunkwirtschaft in Deutschland.[52]Die Reichs-Rundfunk-Gesellschaft sowie die Regionalgesellschaften wurden allesamt verstaatlicht und jeweils in die Form einer GmbH umgewandelt, deren Anteile zu 51 v. H. in der Hand des Reiches, 49 v. H. bei den Ländern lagen. Die staatliche Aufsicht über den Rundfunk wurde durch „Rundfunkkommissare“ ausgeübt, die Entscheidungen über Personalfragen und Programmsendungen treffen konnten. Zusätzlich war die Programmgestaltung dem Einfluss von staatlichen Programmbeiräten ausgesetzt.[53]Damit wurde zum Ende der Weimarer Republik der Rundfunk, von dem sich die Reichspost aufgrund der finanziellen Hürden ferngehalten hatte und der stattdessen durch private Rundfunkgesellschaften errichtet wurde, nicht einmal zehn Jahre nach der ersten Rundfunksendung doch komplett verstaatlicht. Die Begründung hierfür bot von Beginn an „die staatspolitische Notwendigkeit, Maßnahmen zu treffen, um eine politisch oder kulturellmißbräuchlicheAusnutzung der rundfunktechnischen Möglichkeiten zu verhindern.“[54]
3.Nationalsozialismus
Ein Merkmal der nationalsozialistischen Herrschaft war die Fähigkeit, große Teile der Bevölkerung massenhaft zu mobilisieren und zu beeinflussen. Das zur Machtübernahme durch die Nationalsozialisten noch sehrjungeMedium Rundfunk bot sich hierfür bestens an. Dementsprechend wichtig war es dem neuen Regime, sich die Rundfunkordnung für die eigenen politischen Zwecke anzueignen.[55]Die erst ein Jahr zuvor reformierte Rundfunkordnung, die den Rundfunk bereits unter staatliche Kontrolle gestellt hatte, musste von den Nationalsozialisten nur geringfügig angepasst werden. Ein erster Schritt war die „Verordnung über die Aufgaben des Reichsministeriums für Aufklärung und Propaganda“[56], durch die jene Aufgabenbereiche des Rundfunks dem Reichsinnenministerium und der Reichspost entzogen und in den Geschäftsbereich des Reichspropagandaministeriums überführt wurden.[57]Bereits zuvor wurde auf Druck des Reichsinnenministeriums unter Wilhelm Frick der Grundsatz der Unparteilichkeit der Rundfunksendungen gegen den Einspruch einiger Länder aufgegeben.[58]Anschließend wurden oppositionelle und jüdische Rundfunkmitarbeiter entlassen[59]und im Zuge der allgemeinen Zentralisierung Deutschlands mussten die Länder ihre Beteiligung von 49 Prozent der Anteile an den Regionalgesellschaften an die Reichsrundfunkgesellschaft verkaufen.[60]Schließlich wurde mit der Verordnung vom 01. November 1933 die „Reichsrundfunkkammer“ eingerichtet – eine nationalsozialistische Berufskammer, deren Mitgliedschaft die Voraussetzung für eine berufliche Tätigkeit im Rundfunkbereich war.[61]Der Nationalsozialismus nutze die Verführbarkeit der neuen technischen Möglichkeiten durch den Rundfunk von Beginn an aus und kehrte die in der Weimarer Republik aufgestellten Prinzipien der staatlich kontrollierten Unparteilichkeit des Rundfunks um in einen Staatsrundfunk, der ganz im Auftrag der nationalsozialistischen Regierungs- und Parteimeinung stand.
4.Grundlegungen für die Rundfunkordnung der Bundesrepublik
Nicht nur die negativen Erfahrungen des Missbrauchs des Rundfunks durch den Nationalsozialismus haben die Ausgestaltung des Rundfunkwesens in der Bundesrepublik Deutschland stark beeinflusst. Auch manche Weichenstellungen der Weimarer Republik wirken sich bis heute auf den Rundfunk aus. Dabei ist zunächst das Verständnis des Rundfunks als „öffentliche Aufgabe“ zu nennen, das im Gegensatz zur privatwirtschaftlich organisierten Presse steht. Dieses Verständnis sollte, wie nachfolgend gezeigt wird, bereits während der Besatzungszeit und in den Anfangsjahren der Bundesrepublik seine Auswirkungen zeigen. Zum zweiten ist die historische Trennung der Rundfunkkompetenzen zwischen der rundfunktechnischen und der rundfunkinhaltlichen Seite auch im Grundgesetz wiederzufinden. Drittens kann als deutliche Reaktion auf den Missbrauch im Nationalsozialismus das Prinzip der „Staatsfreiheit“ des Rundfunks benannt werden. Hier folgte die Bundesrepublik bewusst nicht den Konzeptionen des staatlichen Einflusses der Weimarer Republik und des Nationalsozialismus.[62]
Die Neuausrichtung des Rundfunks nach 1945 war, und das sollte betont werden, das Ergebnis der Besatzungspolitik der Alliierten. Es gab hierbei zunächst keine einheitliche Linie aller Alliierten, weshalb in den einzelnen Zonen eigene Regelungen galten. Vornehmlich in der britischen Zone wurde das Konzept eines nicht staatlichen, aber öffentlich-rechtlich betriebenen Rundfunks umgesetzt. Weder staatlichen noch privaten Interessen sollte der Rundfunk, nach dem Vorbild der BBC, ausgesetzt sein.[63]Die amerikanische Zone setzte auf eine dezentrale Ausgestaltung des Rundfunks, die wirtschaftliche Lage ermöglichte es jedoch nicht, einen rein privatrechtlich organisierten Rundfunk der amerikanischen Tradition entsprechend einzuführen, weshalb auch hier ein öffentlich-rechtlicher Ansatz verfolgt wurde.[64]Seine Rechtsform fand der öffentlich-rechtliche Rundfunk nunmehr in der Anstalt des öffentlichen Rechts.[65]Dadurch wurde eine Konstellation für den Rundfunk geschaffen, die einerseits einem öffentlichen Zweck dient, gleichzeitig aber Autonomie und Selbstverwaltungsrechte schafft, die eine Unabhängigkeit der Rundfunkveranstalter von staatlichen Behörden ermöglichte.[66]
Die deutsche Post sah sich durch die alliierte Rundfunkkonzeption übergangen, betonte ihre aus der Weimarer Republik stammende und nun wieder auflebende Funkhoheit und versuchte, wieder im Rundfunk mitzubestimmen. Die Alliierten lehnten dies jedoch gegen den deutschen Widerstand ab. Schon im Jahr 1947 wurde durch Befehl vom 21. November des Militärgouverneurs in der amerikanischen Zone die Beteiligung der deutschen Post am Rundfunk verboten.[67]Ausnahmen bestanden nur, soweit die deutsche Post im Auftrag der Landesregierungen die Rundfunkgebühren erhob und die Kabelverbindungen sowie den Entstörungsdienst verwaltete.[68]Hierbei zeigte sich erneut die Aufteilung der Materie des Rundfunkrechts in eine inhaltliche und eine technische Seite. Konsequenterweise enteigneten die Alliierten die Postsender und übertrugen das Vermögen auf die neugegründeten Rundfunkanstalten.[69]
III.Verfassungsrechtliche Grundlegungen der Rundfunkordnung
Die Antwort, die das Grundgesetz mit seinem subjektivrechtlichen Grundrechtskatalog dem Machtmissbrauch während des Nationalsozialismus entgegensetzt[70], hat auch für das Rundfunkwesen wesentliche Bedeutung. Gleichwohl muss aber betont werden, dass bereits vor dem 23. Mai 1949 Entwicklungen im Rundfunk eingeleitet worden waren, die durch Art. 5 Abs. 1 S. 2 GG nicht aufgehoben wurden. Der Wiederaufbau des Rundfunks in den westlichen Besatzungszonen in der Rechtsform der öffentlich-rechtlichen Anstalt und unter dem Privileg der begrenzten staatlichen Aufsicht, wurde beibehalten.
Trotz der knappen Formulierung des Grundgesetzes, „die Freiheit der Berichterstattung durch den Rundfunk“ werde „gewährleistet“, hat sich eine im Vergleich zu anderen Grundrechten erstaunlich breit aufgestellte Dogmatik der Rundfunkfreiheit entwickelt. Ein Grund dafür liegt in der soeben aufgezeigten historischen Entstehung des Rundfunks und in seinem allzu schnellen Missbrauch durch die staatlichen Interessen. Doch darüber hinaus spielt besonders das Bundesverfassungsgericht eine tragende Rolle bei der Formulierung der Rundfunkordnung in der Bundesrepublik. In mittlerweile 14 Rundfunkentscheidungen hat das Bundesverfassungsgericht zu allen Teilfragen des Rundfunkrechts Stellung bezogen und dabei stets Freiheit und Ordnung des Rundfunks ausdifferenziert. In diesem Kapitel wird die Rundfunkrechtsdogmatik der dualen Rundfunkordnung in Deutschland untersucht und die einschlägige Rechtsprechung berücksichtigt. Von den Ergebnissen dieses Kapitels ausgehend kann anschließend geprüft werden, ob die Dogmatik auch für den vergleichsweise jungen Onlinebereich Geltung erlangen kann.
1.Kompetenzaufteilung im Rundfunkrecht
Der bereits aus der Weimarer Zeit stammende Konflikt um die Gesetzgebungs- und Verwaltungskompetenz für den Rundfunkbereich war zu Beginn der Bundesrepublik noch immer nicht gelöst.[71]Das Grundgesetz wies in Art. 73 Nr. 7 a.F. die Ge