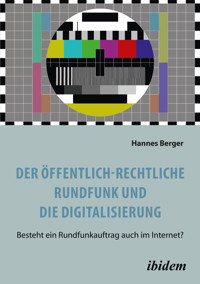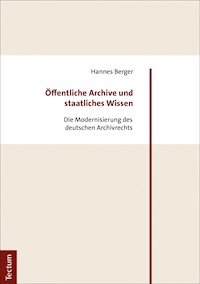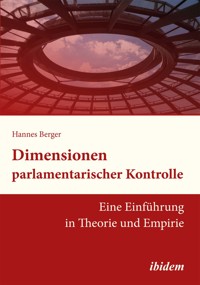
16,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ibidem
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Hannes Berger gibt eine systematische Einführung in die politikwissenschaftliche und rechtswissenschaftliche Erforschung der parlamentarischen Kontrolle. Der Band bietet erstmals eine Heranführung an verschiedene Theoriestränge, die sich explizit mit diesem Bereich des Parlamentarismus beschäftigen. Weiterhin legt Berger beispielhafte empirische Analysen der verschiedenen Dimensionen der Kontrolle – Fragerechte, Misstrauensvotum, Kontrolle der Außenpolitik, Kontrolle der Bundeswehr und weitere – vor. Zusätzlich diskutiert er aktuelle Problemlagen wie die Beteiligung an europäischer Politik, die Kontrolle von Rüstungsexporten oder der Geheimdienste durch den Deutschen Bundestag. Das Buch richtet sich an Politikwissenschaftler und Juristen, aber auch an Journalisten und Akteure der Politikberatung.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2014
Ähnliche
ibidem-Verlag, Stuttgart
Vorwort
Mit Hannah Arendt gesprochen, ist grundlegendes Element der menschlichen Bedingung das Arbeiten und Herstellen. Doch erst das Sprechen und Handeln begründen das Politische. Das Sprechen bedingt den Grundgedanken desParlamentes. Parlamentarismus, das ist Debatte, These und Antithese, Austausch und Streit, Repräsentation und Legitimation. Das Wort Parlament stammt nicht von ungefähr vom französischenparlerab.Dass parlamentarische Kontrolle, das Thema des vorliegenden Bandes, zu großen Teilen durch Sprache stattfindet, sprich Frage und Antwort, Unterredung und Informierung, unbenommen ob im großen Plenum oder im vertraulichen Kreis, ist selbstredend.
Bei einem Vorhaben wie diesem, nämlichdie Absicht,den Facettenreichtum eines Zusammenspiels mehrererpolitischerKonstrukte und Systemevon Staatsorganenfestzuhalten,steht man, so scheint es, vor einer undurchsichtigen und schwer überschaubaren Gemengelage.In Zeitenwiederkehrendheraufbeschworener Krisen, diezum Teileuropaweit um sich greifen undin deren Verlauf schnelleadministrative Entscheidungen getroffen werden müssen, kann selbiger Umstand(eben dieser Krise)nicht zum Argument genommen werden, institutionelleRechteundparlamentarische Herrschaftskontrollen zuum- undübergehen. Teilweise in atemberaubendem Tempomüssen höchstrichterliche Entscheidungen die Parlamentsrechte stärken und für neue Bereiche formulieren und dadurch das feine Gleichgewicht zwischen denpolitischenGewalten austarieren.Dabei zeigten die Richter indenroten Roben mehrfach, unbeeindruckt des medialen und Zeitdruckes,dass trotz Krisensituationen
„[a]uch in einem System intergouvernementalen Regierens […] die gewählten Abgeordneten des Deutschen Bundestages als Repräsentanten des Volkes die Kontrolle übergrundlegende […]Entscheidungen behalten [müssen].“[1]
Diese Entwicklung ist besonders für Mitentscheidungskompetenzen des Deutschen Bundestages in Verflechtung mit der Europapolitik der Deutschen Bundesregierung beeindruckend.Wenn Politik zunehmend global stattfindet, Entscheidungen intergouvernementalund supranationalausgehandelt werden, liegt die Gefahr nahe, dass Politik auch zunehmend nur zu Exekutivpolitik wird. In einem filigranen Gebilde, wie demdes bundesdeutschen Grundgesetzes kann diese Entwicklung nur schädlich sein, weshalblegislative Kräfte auf eben diesenKontrollverlustein wachendes Auge haben sollten.Der vorliegende Band kannnur als eine Einführung in die verschiedenen Dimensionen dieser Kontrolle gelten und würde den Anspruch auf eine Vollständigkeit nie zu erheben wagen, zu eng ist die Verzahnung im politischen System Deutschlands. Und doch bietet bereits eine solche Einführung Einblicke in verschiedenste Politikfelder, greift das ständige Ringen zwischen dem einerseitigen Anspruch des direkt legitimierten Parlamentes und andererseits dem Bereich der exekutiven Eigenverantwortlichkeit auf.
Wo erhebt das Parlament eine machtvolle Kontrolle? Wo besteht eine Notwendigkeit der Geheimhaltung? Und ab wann ist eine nicht gegebene Kontrollmöglichkeit nicht mehr vertretbar, gar kritikwürdig?
Es geht also umeine der Hauptfunktionen des Parlamentarismus: Kontrolle. Kontrolle lebt von Information, von Legitimation und von einer wirkungsmächtigen Normierung der Instrumente. Dieser Beitrag versteht sich als eineHandreichungzurTheorie und Ausgestaltung der Dimensionen bundesdeutscher parlamentarischer Kontrolle, stets im Sinne einer kritischen Betrachtungsweise.Dabei soll parlamentarische Kontrolle aus den unterschiedlichen wissenschaftlichen Disziplinen der Rechtswissenschaft, der Politikwissenschaft und der Philosophie Illumination erfahren, und diese disziplinären Stränge zu einemaufgearbeiteten Ganzengereicht werden.Aktuelle Entwicklungslinien, wie die zunehmend in die Kritik geratene Rüstungsexportpolitik, die europäischen Fiskalpolitiken und die darauf folgenden Reaktionen durch die deutsche höchste Justiz, oder aber die internationalen Geheimdienstaffären werden aus parlamentarischer Sphäre begutachtet.
Erfurt im Herbst 2013
Inhaltsverzeichnis
Abkürzungsverzeichnis
APuZAus Politik und Zeitgeschichte
AWGAußenwirtschaftsgesetz
AWVAußenwirtschaftsverordnung
BSRBundessicherheitsrat
BVerfGBundesverfassungsgericht
BVerwGBundesverwaltungsgericht
DVBlDeutsche Verwaltungsblätter
EFSFEuropäische Finanzstabilisierungsfazilität
ESMEuropäischer Stabilitätsmechanismus
EUZBBGGesetz über die Zusammenarbeit von Bundesregierung und Bundestag in Angelegenheiten der Europäischen Union
GGOGemeinsame Geschäftsordnung der Bundesministerien
GSPGesammelte Politische Schriften Max Webers
GeschOBTGeschäftsordnung des Bundestages
IbidIbidem (lat. ebenda)
JgJahrgang
KrWaffKontrGKriegswaffenkontrollgesetz
NJWNeue Juristische Woche
NVwZNeue Zeitschrift für Verwaltungsrecht
ParlBGParlamentsbeteiligungsgesetz
PKGrParlamentarisches Kontrollgremium
PKKParlamentarische Kontrollkommission
PUAG
1Einleitung
DerLektüre dieses Buchesseien zweiGrundthesenvorangestellt.Da die Bundesrepublik Deutschlandein parlamentarisches Regierungssystembesitzt, in dem sich die Regierung mittelbar, das Parlament unmittelbar durch die Wahl des Souveräns, dem Volk, ableitet, führt diesedirekte Legitimation desBundestages mithinzu einer gesteigerten Verantwortung. Dieser Verantwortungmuss der Bundestag nachkommen und er kann dies indes nur erreichen, indem er zeigt, dass er die Geschicke des Staates, das Wohlder Allgemeinheitund letztlich auchdieStaats-Gewalt effektiv zu lenken vermag.Die erste These, der dieses Buch nachzugehen gedenkt, lautet daher:
IDer Deutsche Bundestag als direkt legitimiertes Staatsorgan muss die Fähigkeit besitzen und ausüben, allesStaatshandeln effektiv zu beeinflussen und zu führen.
Die mittelbar legitimierte, aus dem Parlament hervorgehende Regierung ist gleichsam die Spitze der ausführenden Gewalt und Verwaltung des Staates.Weil die Regierung ihre Legitimation, mithin also ihre Fähigkeit zur Herrschaft nur übertragen bekommen hat, und nicht originär aus sich selbst heraus bilden kann,ist die Regierung einer erheblichen Verantwortlichkeit fürihreAusübung staatlicher Tätigkeit, also für ihre Ausformung der Herrschaft,unterworfen, die sie gegenüber dem Parlament und letztlich dem Souverän, dem Volk,beweisen muss. Gleichsam bedarf die Exekutive aber eines gewissen freien Spielraumes, um die Hoheitsbefugnisse auch wirkungsvoll ausüben zu können.Daraus abgeleitet ergibt sich die zweite These, die hier untersucht werden wird:
IIDie Bundesregierungals indirekt legitimiertes Organund Spitze der Exekutive musszugleichverantwortlichgegenüber dem Parlamentsein, als aucheigene Bereiche des Handelns, dieder Legislativeunzugänglichsindund frei von Einfluss bleibenmüssen, besitzen.
In dieses Spannungsverhältnis von staatsleitender Prärogative des Parlamentes und der Eigenständigkeit der Regierung fällt die Parlamentarische Kontrolle. Dies wird insbesondere, aber nicht ausschließlich,bei der Überwachung der Geheimdienste offenkundig. Geheimschutz im Rechtsstaat – zwischen transparenter Demokratie und notweniger(effektiver) exekutiver Geheimhaltung.
Um die beidenGrundgedankenauf ihren Gehalt zuüberprüfen, wird dieser Band den Bereich der bundesdeutschen parlamentarischen Kontrolle in seinen verschiedenen Facetten betrachten. Dabei ist es das Ziel, sowohl rechtswissenschaftlichen, als auch politikwissenschaftlichen, empirischenArgumentationenzu folgen. Dieses Buch soll zugleich die Ausformungen der parlamentarischen Kontrolle darstellen und Stärken dieser bewerten. Da die vorzustellenden Prozesse vielfach durch Verfassungsrecht und Geschäftsordnungs- und Prozessrecht formalisiert sind, bietet sich eine Darstellung in beiden wissenschaftlichen Disziplinen an. Denn die Kontrolle über die Regierung ist weder rein rechtlich, noch bloß politisch zu bewerten, da an eben jenem Schmelzpunkt zwischen Legislative und Exekutive Recht und Politik aufeinandertreffen und sich gegenseitig bedingen.
Zunächst wird das Institutionengefüge, in dem sich dieser Band für seine Untersuchungen bewegt,vertieft in Kapitel 2 untersucht. Der Band geht grundsätzlich deduktiv vor und stellt zu diesem Zwecke in Kapitel 3unter anderemdie verschiedenen theoretischen Ansätze der Gewaltenteilung, der Parlamentsrechte, derKorollartheorie,derWesentlichkeitstheorie oder der Prinzipal-Agenten Theorie vor. Ausgehend von diesem gedanklichen Überbau geht der Band ab Kapitel 4 über in eine rechtliche und empirische Darstellung und Bewertung der einzelnen, dem Deutschen Bundestag zustehenden Kontrollmittel und Möglichkeiten. Dabei werden in Kapitel 4 die allgemeinen Interpellations- und Fragerechteuntersucht und hinsichtlich ihrer unterschiedlichen Nutzung zwischen Parlamentsmehrheit und Parlamentsminderheit dargestellt. In Kapitel 5erfährt Instrument des konstruktiven Misstrauensvotums Betrachtung,woran sichin Kapitel 6die Kontrollrechte in der Außenpolitikanschließen. Für den Komplex der Außenpolitik unterteilt sich das Kapitel zunächst in einen allgemeinen Teil, um dann in den Sonderfällen derEuropapolitik,sowieimsensiblen Bereich der Kontrolle der Bundeswehreingehender Fragen aufzuwerfen.Kapitel 7analysiertund bewertetdas defizitäre System deutscherRüstungsexporteund die Rolle der Organe Bundesregierung und Bundestag innerhalb dieses Systems. Und Kapitel 8untersucht abschließend die Spannungen zwischen Parlamentsverantwortung und Geheimnisschutz bei der parlamentarischen Kontrolle der Geheimdienste.Kapitel 9schließt mit der Frage ab, was Herrschaft sei und fällt ein zusammenfassendes Urteil über die Betrachtungen dieses Bandes.
2EineVerortung der parlamentarische Kontrolle im Institutionengefüge
2.1Eine etymologische Annäherung
Nähert man sich dem Begriff derKontrolleetymologisch, stößt man zunächst auf die Bedeutungsinhalte voneinerÜberwachung im Sinne einer Überprüfung/Prüfung, in einem zweiten Schritt aufÜberwachung im Sinne einer Beaufsichtigungund in einem dritten Schritt verbindet sichKontrolleals Beherrschungmit Macht und Gewalt.[2]Diesekurze und grobe Einteilung isttiefergehender, als dies zunächst anmuten mag; sie weist bereits auf eine später hier vorzunehmende Abgrenzung verschiedener Kontrollarten hin. Wenn von Überwachung im Sinne einer Überprüfung die Rede ist, so deutet diese Überprüfungauf einenbereits abgeschlossenenVorgang hin, dem nun, nach seiner Beendigung, eine Bewertung und Prüfungzuteilwird. Hingegen, spricht man von Überwachung im Duktus einer Beaufsichtigung, weistder zweiteBedeutungsinhalt vielmehr auf eine Bewertung einesnoch laufendenProzesses hin, der noch nicht abgeschlossen ist, den die zu kontrollierende Stelle mithin noch beeinflussen, Fehlentwicklungen umsteuern und ihre Vorstellungen einbringen kann.Die dritte sprachliche Dimension von Kontrolle mit der Verbindung hin zu Gewalt und Machtist exakt der Bereich, sofern es um das Politische geht, den dieses Buchzubeleuchtensichzum Ziel gesetzt hat. Wie weit reicht die Macht des Deutschen Bundestages, bis zu welchen Grenzen kann und muss er bestimmen?
Seine Wortherkunft hat Kontrolle ursprünglichimLateinischen, mit der Zusammensetzung aus dem Präfixcontra(gegen) und dem Substantivrotulus(Rad/Rädchen).Über das Französische entwickelte sich daraus der Begriffcontre-rôle, was so viel wie ein überprüfendes Gegenregister, ein Zweitregistergegenüber dem Originaldarstellte, mithin also eine prüfende doppelte Buchführung.[3]Wiederum im 18. Jahrhundert in der Schreibweisecontrôleentwickelte sich das Wort in seiner heutigen Bedeutung.[4]Im angloamerikanischen Raum wird das Pendant„to control“aber vielmehr als Steuerung von Dingen und Prozessen verstanden und durch das Substantiv der„supervision“mit Bedeutung der Aufsicht sowie„scrutiny“und„surveillance“,im Sinne der Überwachung, ergänzt.
Tatsache ist, dass die deutsche Bedeutung der Kontrolle eine umfassende ist. Wie kann sie nun in das Gefüge der Staatsgewalten eingeordnet werden, deren Beziehung beleuchtetund ihre Spuren in den rechtlichen Ausgestaltungen bewertet werden?
2.2Die Kontrolle als Teil der Parlamentsfunktionen
In einem Institutionen- und Funktionengeflecht, wie es die föderale Bundesrepublik Deutschland inmitten der supranationalen und intergouvernementalen Europäischen Union ist, stellt sich die Frage nach der Funktion des Bundesdeutschen Parlamentes. Folgt man den klassischen Katalogen eines Walter Bagehots oder John Stuart Mill, so lassen sich vier Grundtypen von Parlamentsfunktionenin einer Demokratie ausmachen.[5]
Wahlfunktion
Das Parlament wählt und beruft die Regierung ab, entscheidet über die Besetzung anderer Verfassungsorgane und rekrutiert das höhere politische Personal. Diese Rekrutierungsfunktion muss jedoch immer auch im funktionalen Teilsystem der Parteien verstanden werden. Parlamentarisches System und Parteiensystem greifen hier ineinander.
Gesetzgebungsfunktion
Die Gesetzgebungsfunktion ist originärste, demokratischste Aufgabe des Parlaments und fußt ursprünglich auf dem Budgetrecht der Parlamente in konstitutionellen Monarchien.Sie ist Kernstück der Gewaltenteilungslehre.Das Parlament ist derlegislateur, und hat einzig als dieser die Macht, Recht zu setzen, was in formalisierten Verfahren stattfindet undstets durch die Repräsentation des Volkes zudiesem rückgekoppelt ist und dadurchLegitimität schafft.
Kontrollfunktion
Das Parlament hat es zur Aufgabe, im Sinne der Gewaltenteilung und der Gewaltenverschränkung die Regierung und ihre Verwaltung zu überwachen und zu bewerten, Kritik zu üben und aus Missständen im Rahmen der parlamentarischen Rechte Konsequenzen (bspw. meinungsäußernde Parlamentsbeschlüsse, Enqueteuntersuchungen, Misstrauensvoten, und der gleichen mehr) zu ziehen. Einer dem Parlament verantwortliche Regierung, die von dessen Vertrauenabhängig ist, erfährt auf diesem Wegein starkesPendant.
Repräsentations- und Kommunikationsfunktion
Ebenso hat ein Parlament als Volksvertretung repräsentative Aufgaben. Es muss das Wahlvolk in sich wiederspiegeln und sowohl Regierungsauftrag, als auch politische Meinungen und Interessen aufnehmen und für den Souverän umsetzen. Im Umgekehrten muss das Parlament die Rückmeldung an das Wahlvolk abgeben, Regierungs- und Parlamentsentscheidungen und Willensbildungsprozesse publik machen und erklären.
Die parlamentarische Kontrolle ist dieser knappen Übersicht nach eine der vier Hauptfunktionen eines Parlamentes. Dabei sind die erwähnten Teilfunktionen schwerlich so schematisch voneinander abzugrenzen, wie es soeben vorgenommen wurde. Vielmehr gibt es auch hier erhebliche Überschneidungen. Ein konstruktives Misstrauensvotum des Deutschen Bundestages betrifft sowohl die Kontrollfunktion, als auch die Wahlfunktion. Und die Haushaltsgesetzgebung durch den Bundestag betrifft bei weitem nicht allein die Gesetzgebungsfunktion, sondern baut gleichsam erhebliches Kontrollpotential auf, da durch die Aufstellung des Haushaltsplanesein jedes Vorhaben der Bundesregierung auf den Prüfstand kommt und im Haushaltsausschuss abgeändert werden könnte.
2.3Gewaltenteilung, Gewaltenmonismus, Gewaltenverschränkung?
Das Grundgesetz bekennt sich in Art. 20 II S. 2; 1 III und 70 ff. grundsätzlich zum Ordnungsprinzip der Gewaltenteilung.[6]Dementsprechend ergibt sich die Verneinung eines Gewaltenmonismus, der vorrangigen Stellung als eine führende Kompetenz- und Kontrollinstanz einer der drei Gewalten.[7]Mithin kann auch das Parlament diese Vormachtstellung nicht besitzen, umesmit John Locke zu sagen, müssen die Gesetze, die das Parlament macht auf für dieses gelten, weshalb es klüger ist, die Gesetze von anderen umsetzen zu lassen, als von denen, die sie selbst verabschiedeten.Der Gewaltenteilungsgrundsatz als„tragendes Organisations- und Funktionsprinzip“[8]hat bedeutenden Einfluss auf Entscheidungsstrukturen, Entscheidungsbefugnisse und auch die Kontrolle dieser Befugnisse durch die jeweilig anderen Gewalten. Dieses System der„checks and balances“betrifft im besonderen Maße das Verhältnis zwischen Deutschem Bundestag und der Bundesregierung.
„Bei diesem Dualismus teilen sich die beiden Machtträger in die Funktionen der Gestaltung der politischen Grundentscheidung und der Ausführung dieser Entscheidung im Wege der Gesetzgebung. Da sie beide außerdem wechselseitigen Beschränkungen und gegenseitigen Kontrollen unterliegen –Interorgankontrollen –ist auch die politische Kontrolle unter sie verteilt“[9]
Eine sogleich in einigen (Kern-)Bereichen eigenständige, als in anderen Bereichen der parlamentarischen Kontrolle unterworfene Regierung ist ein zwingendes Merkmal für ein parlamentarisches Regierungssystem.[10]
Die Bundesregierung und zusammen mit ihr die parlamentarische Regierungsmehrheit, aus der sie hervorgeht, entsprechen dem Zentrum der staatlichen Leitungsebene. Die Regierung ist dabei der gestaltende Teil. Im Sinne des Grundgesetzes ist sie als ausführende Gewalt[11], also umfassend an Gesetzesausführung, politischer Führungs- und ebenso Verwaltungstätigkeit, zu verstehen.
Der Bundestag als die Gesetzgebende Gewalt hat dabei weitreichende Mitsprache- und Kontrollrechte, wie dieser Beitrag im Weiteren zeigen wird. Jedoch kann, entsprechen dieser engen Verzahnung der Organe, der Kontrollrechte und dem Verbot des Gewaltenmonismus, von der Bundesregierung mitnichten als ein bloß ausführendes Hilfsorgan des Bundestages gesprochen werden. Der Exekutive sind klare Bereiche der Eigenverantwortung anvertraut[12], welche aus logischen Gründen nur, oder am effektivsten, durch sie, die Bundesregierung, ausgeführt werden können..
Wie zuvor festgestellt, geht die Regierung in parlamentarischen Systemen westlicher Prägung, besser gesprochen parlamentarischen Regierungssystemen, aus der Parlamentsmehrheit hervor, gestützt durch die im Parlament gebildete Mehrheit zumeist koalierender Fraktionen. Die Regierung kann daher, im Idealfall, auf Vertrauen und Unterstützung ihrer parlamentarischen Fraktion(en) bauen, diese wiederum setzen ihr Vertrauen in die Regierung. Den oppositionellen Fraktionen kommt daher die Aufgabe der Kontrolle zu, weniger dem Parlament im Gesamten.[13]Dieser als„Neuer Dualismus“[14]geprägte Umstand ist dem alten Dualismus zwischen gesamten Parlament und Regierung gewichen, welcher in konstitutionellen Monarchien das Verhältnis zwischen beiden Organen bestimmte.
Um der Opposition eine wirksame Kontrolle der Regierungsarbeit zu ermöglichen, benötigt sie ausreichende und umfassende Informationen über die Arbeit der Regierung und derer Vorhaben und Absichten.„In der Verfassungswirklichkeit besteht auf dem Informationssektor keine auch nur annähernde Gleichgewichtslage zwischen beiden Staatsorganen. Vielmehr wird eine permanente Informationskrise des Parlaments konstatiert.“[15]Dieser Tatsache entgegenzuwirken, sind dem Bundestag zahlreiche Rechte auf Informationsbeschaffung zur Hand gereicht.
2.4Der Kernbereich exekutiver Eigenverantwortlichkeit
Dem Informationsdrang des Parlamentes ist die Regierung, ob ihrer Informationsvormacht, zum Nachgeben gezwungen. Doch war es fraglich, wie weit das Fragerecht der Abgeordneten reiche. Erstreckt es sich bis auf die internen Protokolle und vorbereitendenPapiere der Regierung, aufSitzungsprotokolle des Kabinetts,interne Überlegungen, Abstimmungsergebnisse, Vorbehalte,die Außenpolitik?
Das Bundesverfassungsgericht entwickelte zur Antwort den Kernbereich exekutiver Eigenverantwortlichkeit, der in der geschlossenen Sphäre der Regierung zu finden ist und dessen Vertraulichkeit unangetastet von parlamentarischen Informationsrechten bleibt. Interne Beratungen der Regierung bleiben verschlossen, ebenso wie Überlegungen und Planungen. Bezweckt werden soll durch diese Eigenverantwortlichkeit, dass die Regierung, die ein eigenständiges Verfassungsorgan und nicht bloß bestelltes Hilfsorgan des Bundestages ist, in ihrer Sinnfindung frei ist, ohne sich bereits in einem anfänglichen Stadium einer permanenten Kontrolle ausgesetzt zu fühlen. Das freie Debattieren und Anstellen von Überlegungen wird damit gewährleistet und ein„nicht ausforschbare[r] Initiativ-, Beratungs-, und Handlungsspielraum“[16]der Regierungsollgarantiertsein. Zur Auslegung des unbestimmten Rechtsbegriffes des Kernbereiches exekutiver Eigenverantwortlichkeit unterscheidet das BVerfG zwischen noch laufenden und bereits abgeschlossenen Vorgängen. Die noch laufenden Vorgänge sind dem Informationsinteresse des Bundestages grundsätzlich entzogen. Über abgeschlossene Vorgänge, beendete Sinnfindung im Entscheidungsprozess des Kabinettshingegen ist grundsätzlich den Abgeordneten auf Anfrage hineine Beantwortung Pflicht der Bundesregierung. Die Regierung kann sich hier nur in einer Abwägung zwischen Informationsrechtdes Parlamentes einerseitsund Gefahr für die Einengung und Beeinträchtigungihrer eigenenFunktionsfähigkeit und Eigenverantwortlichkeitandererseitsauf den Kernbereich berufen.[17]Das Begehren nach Auskunft findetdannseine Grenze in der Eigenständigkeit der Exekutive. Wenn also die Beantwortung der Anfragen die tiefsten Interna der Regierung offenlegen würden und die Bundesregierung als Staatsorgan an sich in ihrer Arbeitsfunktion betroffen und beeinträchtigt wäre, dann hätte das Informationsrecht des Parlamentes das Nachsehen. Gleiches gilt für Umstände,in denendieBeantwortung der Anfrage der Parlamentarier,eine Bedrohung für das Staatswesen bei Veröffentlichung mit sich ziehen würde.Denn diese Beantwortung findet auf der öffentlichen Bühne des Bundestages statt. Staatsgeheimnisse und sensible Informationen auf diesem Weg zu unterbreiten böte ein zu großes Risiko und wäre schlechthin unklug.
In einer späteren Entscheidung erweiterte das BVerfG das Konzept des exekutiven Eigenbereiches auch auf grundsätzliche Bereiche des auswärtigen Politik. Währendzwardem Wortlaut des Artikel 59 GG folgend dieauch der Bundestagzwingend mitzuwirken hat und zu beteiligen istan völkerrechtlichen Verträgen, die der Bund, also in Praxis durch die Regierung und ihre außenpolitischen Einrichtungen wie dem Außenminister, Botschafter, Staatssekretäre, Vertretungen und Konsulate in den Ländern der Welt, schließt,ergibt sich daraus noch keineswegsein umfassender Parlamentsvorbehalt.[18]
„Art. 59 Abs. 2 Satz 1 GG[verleiht]den gesetzgebenden Körperschaften keineInitiativ-, Gestaltungs- oder Kontrollbefugnis im Bereich der auswärtigen Beziehungen. Der Vorschrift kann auch nicht entnommen werden, daß immer dann,wenn ein Handeln der Bundesregierung im völkerrechtlichen Verkehr die politischen Beziehungen der Bundesrepublik Deutschland regle oder Gegenstände derBundesgesetzgebung betreffe, die Form eines der gesetzgeberischen Zustimmung bedürftigen Vertrages gewählt werden müsse“[19].
Wir sehen also, dass der Regierung ein Handlungsspielraum in der Außenpolitik eingeräumt und geschützt wird, der umfassend ist. Vergegenwärtigen wir uns: Aller diplomatischer Dienst in den Ländern, jegliche informellen Gespräche der Regierungsmitglieder oder Regierungsvertreter mit denen anderer Staaten, ungeschriebene Abmachungen, interne Debatten, Wirtschaftsabkommen – sofern sie nicht unter gesetzliche Vorbehalte gestellt sind – Regierungskonsultationen, gemeinsame Veranstaltungen, Krisentreffen und andere, sind der Regierung für ihren Bereich allein überlassen und geben dem Bundestag kein Recht„auf Initiative, Gestaltung und Kontrolle“.Nur für die Fälle, in denen internationale Abkommen mittels eines völkerrechtlichen Vertrages geschlossen werden, oder aber auf europäischer Ebene die Europaverträge geändert werden, muss der Bundestag in einem gesetzgeberischen Akt der Zustimmung beteiligt werden. Dies ergibt sich aus den Artikeln 23 und 59 GG und wird in Kapitel 6 über die parlamentarische Kontrolle der Außenpolitiktiefgehend dargestellt.Ein allumfassender Parlamentsvorbehaltaber, der auch einen Einfluss des Parlamentes auf alle diplomatischen Beziehungen in all ihren verschiedenen Formen[20]böte,bleibt, ob dem Gewaltenteilungsgrundsatz der bundesdeutschen Demokratie, inexistent.
2.5Über die Qualität einer Opposition
Bisher wurden bereits verschiedene Kontrollinstrumente des Parlamentesangerissen, und immer wenn es um deren Erörterung geht, ist ein Augenmerk auf dieVoraussetzungengeheftet, die es benötigt, umdas Instrument einzusetzen. Das Rechtsinstitut derRegierungsbefragung (schriftlich / mündlich) beispielsweise kannvon jedem Abgeordneten als Einzelner eingesetzt werden, hier liegt die Hürde also sehr niedrig, was sich durch die hohen Zahlen der Anfragen, wie in Kapitel 4 analysiert wird,auch bestätigt hat. Das Misstrauensvotum mit gleichzeitiger Wahl eines neuen Kanzlers hingegen braucht gar die Mehrheit aller Mitglieder des Bundestages, um zu gelingen, hier liegt folglich eine weitaus höhere Hürde, die vor einem häufigen Einsatz zurückschrecken lässt. Wie ebenfalls festgestellt wurde, ist parlamentarische Kontrolle eine Aufgabe hauptsächlich der Opposition. Da sich diese von Wahlperiode zu Wahlperiode unterschiedlich gestaltet, ist es interessant zu fragen: Wann ist eine Opposition wirksam, wann hat sie die Voraussetzungen, echte Kontrolle auszuüben?
Natürlich, sobald eine Oppositionaus einem Abgeordnetenbesteht, kann dieser seinemündlichenFragerechtenach § 105 GeschOBTgeltend machen. Ebenso steht ihm bereits als Einzelner das Recht auf Antrag einer Organstreitigkeit vor dem Bundesverfassungsgericht zu, da er gemäß Art. 93 I Nr. 1 GG i.V.m. § 63 BVerfGG als Teil des Bundesorganes Bundestag zählt. Doch schon in den spiegelbildlich besetzten Ausschüssen des Bundestages kann diesereinzelne Parlamentarierunter Umständen nicht berücksichtigtwerden. Eine Opposition, diefünf von Hundertder Abgeordnetenmandate des Bundestages erlangt hat, bekommt gleichsam die Möglichkeit, den Fraktionsstatus zu erreichen.
Der Fraktionsstatus ist gemäß § 76 I Geschäftsordnung Bundestag grundsätzlich nötig, um eigene Vorlagen, wie Gesetzesentwürfe, Beschlussempfehlungen, und andere einzureichen.Erst der Fraktionsstatus ermöglicht es,Kleine undGroße Anfragen an die Regierung zu stellen.Gleichsamist es einer Fraktion möglich, das ordentliche Zustimmungsverfahren zu Auslandseinsätzen der Bundeswehr im Bundestag zu erzwingen und somit das vereinfachte Zustimmungsverfahren zu verhindern.
Aber erst eine Opposition, die über ein Viertel der Mandate verfügt, kann die wirklichen Kontrollinstrumente einsetzen. Abfünfundzwanzigvon Hundertder Abgeordnetensitze kann eine Opposition das konstruktive Misstrauensvotum erheben (§ 97 I GeschOBT), einen Untersuchungsausschuss im Bundestag erzwingen (Art. 44 GG), eine abstrakte Normenkontrolle vor dem Bundesverfassungsgericht anstrengen, um ein ihr missliebiges und in ihren Augen verfassungswidriges Gesetz prüfen zu lassen (Art. 93 I Nr. 2 GG i.V.m. § 76 I BVerfGG). Besonders diese drei letzten Instrumente sind besonders wirkmächtig, führen sie schließlich im äußersten Fall zum Sturz einer Regierung, zur Nichtigkeit eines Gesetzes und zur – die Medienwirksamkeitsei nicht zu unterschätzen– öffentlichen Untersuchung und politischen Beurteilung von Skandalen und behördlichem, exekutiven Verhalten.Der Zahl der fünfundzwanzig von Hundert kommt hier entscheidender Charakter zu. Es kann die These aufgestellt werden:Je kleiner die Opposition im Parlament, desto schwächer ist ihre parlamentarische Kontrollmacht.
Selbstverständlich ist die Sitzverteilung einer Opposition von einem Abgeordneten oder von einer Opposition, die 5 % der Mandate erhielt nur theoretischer Natur, zumindest in pluralistischen Gesellschaften mit freien Wahlen und einem parlamentarischen Regierungssystem. Doch eine Opposition die unter die Anforderung eines Viertels der Bundestagsmitglieder fällt, ist keineswegs undenkbar. Nach Wahlentscheidungen, die zu einer großen Koalition führen, kann es durchaus geschehen, dass die Regierungskoalition zunächst über diebenötigte Zweidrittelmehrheit für Verfassungsänderungen verfügt, oder aber über noch mehr Stimmen,was dieOpposition unter ein Viertel der Mitglieder schrumpfen ließe.
Die Bundestagswahl 1965 brachte der Union einen Stimmenanteil von 47,6 % der Mandate ein, der SPD 39,3%und der FDP 9,5%. Weitere Parteien zogen nicht in den Bundestag ein. Zunächst bildeten Union und FDP eine Regierung, die jedoch im Herbst 1966 zerfiel und die Union mit der SPD für die restliche Zeit der Legislaturperiode eine Große Koalition bildete. Dies bedeutete im Umkehrschluss, dass die FDP mit ihren 9,5 % der Stimmen, was 50 von 518 Sitzen entsprach, die einzige Opposition bildete. Ihr war es demnach auch nur eingeschränkt möglich, parlamentarisch die Regierung zu kontrollieren. Untersuchungsausschüsse oder abstrakte Normenkontrollen waren ihr verwehrt. Auch nach der Bundestagswahl vom 22. September 2013 wäre im Falle einer Regierungsbildung durch Union und SPD eine solche Situation denkbar. Hier entfielen von 631 Sitzen 311 auf die Union (49,28 % der Sitze), 193 auf die SPD (30,58 % der Sitze), 64 auf Die Linke (10,14 % der Sitze) und 63 auf Bündnis 90/Die Grünen (9,98 % der Sitze). Eine Opposition aus den Gründen und Die Linke im 18. Deutschen Bundestag besäßezusammengenommen 20,12 % der Abgeordnetensitze und weniger als das nötige Viertelvom Hundert. Im Falle einer dritten großen Koalition wäre auch im 18. Bundestag die Opposition in ihrer parlamentarischen Kontrolltätigkeit eingeschränkt.Die aufgestellte These lässt sich insoweit bejahen, dass in Zeiten großer Koalitionen die Opposition in Gefahr gerät nur einen Teil der Kontrollinstrumente des Parlamentes zu nutzen und damit einhergehend eine qualitativ schwächere Kontrolle auf die Regierung ausübt.Erst eine Opposition, die über mehr als 25 von Hundert der Abgeordnetensitze verfügt, kann eine tatsächliche Kontrolleauf erbieten, ist auch qualitativ Opponent, im Sinne des Wortes, ist also qualitative Opposition.
3Theorieder parlamentarischen Kontrolle
Über diebeherrschenden,legitimierendenundmachtpolitischenUmstände von Kontrolle im Rahmen eines Parlamentarismus;eines demokratischen und repräsentativen, und nicht zuletzt eben parlamentarisch ausgestalteten Staatswesensfinden sich seit Jahrhunderten philosophische, rechtswissenschaftliche und politikwissenschaftliche Theorieansätze. Die klassischen Theorien und Kontrollbegriffe werden hier nunebenso wie moderne Ansätzevorgestellt.
3.1Legalität und das Prinzip der gleichen Chance bei Carl Schmitt
Begonnen werden soll allerdings mit einer Abgrenzung, einer Ablehnung wenn man so willvon all dessen, was dieser Band unter einer parlamentarischen Kontrolle und einer qualitativen Opposition verstehen will, indem das Legitimitäts- und Staatsverständnis des umstrittensten deutschen Juristen des zwanzigsten Jahrhunderts,Carl Schmitt, untersucht wird. Anhand dessen kann klar verdeutlicht werden, in welcheRichtung parlamentarische Kontrolle zu stoßen versucht, wo sie anzusetzen vermag und weshalb sie, in einem pluralistischen Staats- und Gesellschaftssystem, wie der Bundesrepublik Deutschland in unserer Zeit,notwendig ist.
Carl Schmitt, der abweichend der aristotelischen Typologie der Staatswesen, abseits der Demokratie den Begriff desparlamentarischen Gesetzgebungsstaateskreierte, geht von einemabweichendenDemokratiemodell aus, als esdiesheutegedachtwird. Für Schmitt ist die Wahl der parlamentarischen Repräsentation, also des Parlaments, nichtim Sinne einer spiegelbildlichen Abbildung der unterschiedlichen Gesellschaftsinteressen – artikuliert durch die verschiedenen Parteien –gedacht, sondern viel mehrbegründet er sein Staatsverständnis auf der Annahme, dass„