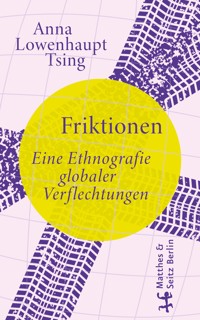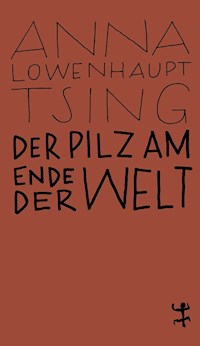
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Matthes & Seitz Berlin Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Das erste neue Leben, das sich nach der nuklearen Katastrophe in Hiroshima wieder regte, war ein Pilz. Ein Matsutake, der auf den verseuchten Trümmern der Stadt wuchs – einer der wertvollsten Speisepilze Asiens, der nicht nur in Japan, wo er Spitzenpreise aufruft, vorkommt, sondern auf der gesamten Nordhalbkugel verbreitet ist. Dieser stark riechende Pilz wächst bevorzugt auf von der Industrialisierung verwüsten und ruinierten Böden und ist nicht kultivierbar. In ihrem faszinierenden kaleidoskopischen Essay geht die Anthropologin Anna Lowenhaupt-Tsing den Spuren dieses Pilzes sowie seiner biologischen und kulturellen Verbreitung nach und begibt sich damit auch auf die Suche nach den Möglichkeiten von Leben in einer vom Menschen zerstörten Umwelt. Sie erzählt Geschichten von Pilzsammlern, Wissenschaftlern und Matsutake-Händlern und öffnet einen neuen und ungewohnten Blick auf unsere kapitalistische Gegenwart. Denn eigentlicher Gegenstand ihrer preisgekrönten und in viele Sprachen übersetzten Erzählung ist die Ökologie des Matsutake, das Beziehungsgeflecht um den Pilz herum, als pars pro toto des Lebens auf den Ruinen des Kapitalismus, das ein Leben in Beziehungen sein – oder aber nicht sein wird.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 523
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Anna Lowenhaupt Tsing
Der Pilz am Ende der Welt
Über das Leben in den Ruinendes Kapitalismus
Aus dem amerikanischen Englischvon Dirk Höfer
Inhalt
Ergiebige Verflechtungen
Prolog. Herbstaroma
Teil I
Was ist noch übrig?
1. Die Kunst der Wahrnehmung
2. Kontamination als Kollaboration
3. Probleme mit der Größenordnung
Zwischenspiel. Riechen
Teil II
Nach dem Fortschritt: Verwertungsakkumulation
4. Randständige Strukturen
5. Open Ticket, Oregon
6. Kriegsgeschichten
7. Was ist mit dem Staat? Zwei Versionen asiatischstämmiger Amerikaner
8. Zwischen Dollar und Yen
9. Von der Gabe zur Ware – und zurück
10. Verwertungsrhythmen: Business in der Zerstörung
Zwischenspiel. Spurensuche
Teil III
Gestörte Anfänge, unbeabsichtigte Gestaltung
11. Das Leben des Waldes
12. Geschichte
13. Wiedererstehung
14. Glückliche Fügung
15. Ruin
16. Wissenschaft als Übersetzung
17. Fliegende Sporen
Zwischenspiel. Tanzen
Teil IV
Inmitten der Dinge
18. Matsutake-Kreuzritter: Warten auf den Fungus
19. Aktivposten
20. Kein richtiges Ende: Menschen, denen ich begegnet bin
Epilog. Der Weg der Sporen
Anmerkungen
Dank
Ergiebige Verflechtungen
Seit der Aufklärung haben uns die westlichen Philosophen von einer Natur gesprochen, die großartig und universell, aber auch passiv und mechanisch ist. Natur lieferte die Kulisse und war Quelle für die moralische Intentionalität des Menschen, der sie zugleich zu zähmen und zu beherrschen wusste. Man überließ es den Fabulierern, den nichtwestlichen, den nicht der Zivilisation verbundenen Geschichtenerzählern, uns an das muntere Tun aller Lebewesen zu erinnern, ob sie nun Menschen waren oder nicht.
Etliche Ereignisse haben dazu beigetragen, diese Arbeitsteilung auszuhöhlen. Erstens: Die Bestrebungen, die Natur zu zähmen und zu beherrschen, haben ein derartiges Unheil angerichtet, dass es nun fraglich ist, ob das Leben auf der Erde überhaupt weiterbestehen kann. Zweitens: Verwicklungen zwischen den Arten, die einst in das Reich der Fabeln gehörten, sind nun Stoff ernsthafter Erörterungen von Biologen und Ökologen, die darlegen, dass für das Leben ein Zusammenspiel von zahlreichen Lebensformen erforderlich ist. Der Mensch kann nicht überleben, wenn er auf allem anderen herumtrampelt. Drittens: Überall auf der Welt haben Frauen und Männer der Forderung Nachdruck verliehen, auch ihnen müsse der dem Menschen zugesprochene Status zugebilligt werden. Unsere zügellose Präsenz untergräbt die moralische, von christlicher Männlichkeit geprägte Intentionalität des Menschen, die ihn von der Natur abspaltete.
Es ist nun an der Zeit, neue Mittel zu finden, mit denen sich auch jenseits zivilisatorischer Grundprinzipien wahre Geschichten erzählen lassen. Wenn man auf die Trennung von Mensch und Natur verzichtet, können alle Kreaturen wieder am Leben teilhaben und Frauen und Männer können sich ohne die Zwänge einer allzu eng gefassten Rationalität Ausdruck verschaffen. Sobald derartige Geschichten nicht länger in nächtlichem Flüstern erzählt werden müssen, erhalten sie die Chance, als ebenso wahr wie märchenhaft zu erscheinen. Wie sonst sollten wir erklären können, dass trotz des Unheils, das wir angerichtet haben, überhaupt noch etwas am Leben ist?
Dieses Buch liefert solche wahren Geschichten, indem es sich auf die Spuren eines Pilzes begibt, auf die Spuren des Matsutake. Anders als in gelehrten Bücher üblich, folgt ein Getümmel kurzer Kapitel. Sie sollten sein wie Pilze, die nach dem Regen aufschießen: in übertriebener Fülle, nach Erkundung gierend, immer zu zahlreich. Die Kapitel bilden ein offenes Gefüge, keine logische Maschine; ihr Arrangement verweist auf das Sovielmehr, das da draußen noch existiert. Sie sind verheddert und unterbrechen einander und ahmen damit die Flickenhaftigkeit der Welt nach, die ich zu beschreiben suche. Einen weiteren Erzählstrang machen die Fotografien aus, die neben dem Text herlaufen, ohne ihn direkt zu illustrieren. Ich verwende die Bilder nicht so sehr, um einen Eindruck von den behandelten Szenen zu vermitteln, sondern um das Gesagte atmosphärisch zu verdeutlichen.
Wenn wir von »erster Natur« sprechen, sind darunter die (auch den Menschen betreffenden) ökologischen Beziehungen zu verstehen, »zweite Natur« bezieht sich auf die durch den Kapitalismus verursachten Umweltveränderungen. Diese von der üblichen Auffassung abweichende Verwendung stammt aus Williams Cronons Nature’s Metropolis.1 In vorliegendem Buch wird zudem noch eine »dritte Natur« eingeführt, die all das bezeichnet, was trotz der Verheerungen des Kapitalismus am Leben zu bleiben vermag. Damit wir diese dritte Natur überhaupt wahrnehmen können, müssen wir die Annahme, die Zukunft läge nur in einer Richtung, und zwar voraus, über Bord werfen. Wie virtuelle Teilchen in einem Quantenfeld tauchen verschiedene Zukünfte in und aus einem Möglichkeitsfeld auf; die dritte Natur entsteht in einer solchen zeitlichen Polyfonie. Die Fortschrittserzählungen haben uns blind gemacht. Um etwas über die Welt in Erfahrung zu bringen, ohne auf sie Bezug nehmen zu müssen, versucht das Buch, offene Gefüge miteinander verflochtener Lebensformen zu skizzieren, gehen diese doch Verbindungen ein, die durch mannigfache zeitliche Rhythmen hindurch koordiniert sind. Das formale Experiment entspricht den Erörterungen, die ich hier unterbreite.
Das Buch basiert auf Feldstudien, die zwischen 2004 und 2011 in den Vereinigten Staaten, Japan, Kanada, China und Finnland jeweils zur Matsutake-Saison stattgefunden haben, und beruht auf Gesprächen mit Wissenschaftlern, Forstleuten und Matsutake-Händlern in den genannten Ländern sowie in Dänemark, Schweden und der Türkei. Möglicherweise ist meine persönliche Matsutake-Wanderung noch nicht am Ende: Weitere Vorkommen winken noch an so fernen Orten wie Marokko, Korea oder Bhutan. Ich hoffe, dass die Leser in den folgenden Kapiteln etwas von dem »Pilzfieber« mitbekommen, das ich erlebt habe.
Unter dem Waldboden erstrecken sich Netze und Stränge von Pilzstrukturen, die Wurzeln und Mineralböden miteinander verbinden, lange bevor sie Pilzkörper ausbilden. Bücher gehen aus ähnlich verborgenen Geflechten der Zusammenarbeit hervor. Eine Personenliste ist unangemessen, und so möchte ich lieber damit beginnen, das gemeinschaftliche Engagement zu würdigen, das dieses Buch ermöglicht hat. Anders als in der Ethnografie heutzutage üblich, waren die Forschungen, auf denen dieses Buch basiert, von experimenteller Zusammenarbeit geprägt. Darüber hinaus gingen die Fragen, auf die ich eine Antwort finden wollte, aus intensiven Diskussionen hervor, bei denen ich nur eine Teilnehmerin unter vielen war.
Das Buch ist aus der Arbeit der Matsutake Worlds Research Group hervorgegangen, zu der Timothy Choy, Lieba Faier, Elaine Gan, Michael Hathaway, Miyako Inoue, Shiho Satsuka und ich selbst gehören. Die Ethnografie war in der Geschichte der Anthropologie meist eine Soloperformance; unsere Gruppe hat sich zusammengefunden, um sich in einer neuen, permanent in der Zusammenarbeit erfolgenden Anthropologie zu erproben. In der Ethnografie kommt es darauf an zu lernen, wie man zusammen mit anderen Informanten über eine Situation nachdenkt. Forschungskategorien entwickeln sich im Zuge der Forschung, nicht im Voraus. Wie vermag man diese Methode einzusetzen, wenn man mit verschiedenen Forschern arbeitet und dabei jeder von einem anderen lokalen Wissen lernt? Anstatt wie in den harten Wissenschaften unseren Gegenstand am Anfang zu definieren, waren wir entschlossen, unsere Forschungsziele aus der Zusammenarbeit erwachsen zu lassen. Dieser Herausforderung haben wir uns gestellt, indem wir verschiedene Formen des Forschens, der Analyse und des Schreibens ausprobierten.
Mit vorliegendem Buch startet eine kleine Reihe über Matsutake-Welten; Michael Hathaway und Shiho Satsuka werden die nächsten Bände vorlegen. Man kann es sich als eine Abenteuergeschichte vorstellen, in der sich das Geschehen von einem Buch zum nächsten entfaltet. Unsere Neugier auf Matsutake-Welten kann nicht in einen Band gezwängt oder durch eine Stimme ausgedrückt werden. Andere Genres, darunter Essays und Artikel, gesellen sich unseren Büchern hinzu.2 Die Arbeit des Teams zusammen mit der Filmemacherin Sara Dosa hat Elaine Gan und mich dazu veranlasst, eine Website zu entwerfen, matsutakeworlds.org, ein Ort für Geschichten von Sammlern, Wissenschaftlern, Händlern und Forstleuten aus mehreren Kontinenten. Die künstlerisch-wissenschaftliche Praxis Elaine Gans war Inspiration zu weiterer Zusammenarbeit.3 Auch Sara Dosas Film The Last Season bildet Teil dieses Dialogs.4
Die Matsutake-Forschung führt nicht nur über fachdisziplinäres Wissen hinaus; sie findet zudem an Orten statt, an denen vielfältige Sprachen, Geschichten, Ökologien und kulturelle Traditionen an der Formung der Welt teilhaben. Faier, Inoue und Satsuka sind Wissenschaftler aus Japan, Choy und Hathaway aus China. Ich sollte in der Gruppe für Südostasien zuständig sein und im pazifischen Nordwesten der Vereinigten Staaten mit Sammlern aus Laos und Kambodscha arbeiten. Es stellte sich jedoch heraus, dass ich Hilfe brauchte. Die Zusammenarbeit mit Hjorleifur Jonsson und die Mitwirkung von Lue Vang und David Pheng sind für meine Forschung über in den USA lebende Menschen aus Südostasien unabdingbar gewesen.5 Eric Jones, Kathryn Lynch und Rebecca McLain aus dem Institute for Culture and Ecology in Portland haben mich dazu gebracht, mich mit der Pilzwelt auseinandersetzen, und sind wunderbare Kollegen geblieben. Die Bekanntschaft mit Beverly Brown war eine Inspiration. Amy Peterson hat mich in die japanisch-amerikanische Matsutake-Gemeinschaft eingeführt. Von Sue Hilton habe ich mir die Kiefern erklären lassen. In Yunnan hat sich Luo Wen-hong unserem Team angeschlossen, und in Kyoto erwies sich Noburo Ishikawa als außergewöhnlicher Führer und Kollege. Bei meinem Aufenthalt in Finnland war Eira-Maija Savonen eine großartige Organisatorin. All diese Reisen haben mir die Wichtigkeit des Zusammenarbeitens bewusstgemacht.
UNGREIFBARES LEBEN, OREGON
In einem ruinierten Industriewald sprießen Matsutake-Hüte aus dem Boden.
Prolog
Herbstaroma
Die Höhen von Takamatsu, voll aufschirmender Pilze
die groß werden, gedeihen –
das Wunder herbstlicher Aromen.
— Aus dem Man’yōshū, einer japanischen Gedichtsammlung aus dem achten Jahrhundert.1
Was tun, wenn einem die Welt in Stücke geht? Ich gehe spazieren, und wenn ich sehr viel Glück habe, finde ich Pilze. Pilze werfen mich auf meine Sinne zurück, nicht einfach – wie bei Blumen – durch ihre ausgelassenen Farben und Düfte, sondern weil sie so unerwartet aufschießen und mich an das Glück erinnern, einfach da zu sein. Dann weiß ich wieder, dass es noch Freuden gibt inmitten der Schrecken der Unbestimmtheit.
Schrecken, das ist klar, gibt es zuhauf, und nicht nur für mich. Das Weltklima spielt völlig verrückt und der industrielle Fortschritt hat sich als weit tödlicher für das Leben auf Erden erwiesen, als man es sich noch vor einem Jahrhundert vorzustellen wagte. Die Wirtschaft ist keine Quelle des Wachstums oder des Optimismus mehr; jeder einzelne Arbeitsplatz kann mit der nächsten Wirtschaftskrise verloren gehen. Dabei ist es nicht nur so, dass wir schon die nächsten Desaster befürchten müssen – wir müssen auch ohne Erzählungen zurechtkommen, die uns sagen könnten, wo es langgeht und auch, warum gerade dort entlang. Prekär leben zu müssen, schien einst das Schicksal von den vom Glück weniger Begünstigten zu sein. Heute sieht alles danach aus, dass sich keiner mehr in völliger Sicherheit wiegen kann – selbst wenn im Moment unsere Taschen noch prall gefüllt sind. Anders als zur Mitte des zwanzigsten Jahrhunderts, als sich Dichter und Philosophen auf der nördlichen Hemisphäre durch ein Übermaß an Stabilität eingeengt fühlten, sehen sich heute im Norden wie im Süden viele von uns mit einer Situation konfrontiert, in der die Schwierigkeiten kein Ende nehmen wollen.
Das vorliegende Buch erzählt von meinen Reisen mit den Pilzen, Reisen, auf denen ich die Unbestimmtheit und die prekären Bedingungen, will heißen, ein Leben ohne das Versprechen der Stabilität erkundet habe. Ich habe gelesen, dass 1991, beim Zusammenbruch der Sowjetunion, Tausende, die in Sibirien plötzlich ohne staatliche Sicherheiten dastanden, in die Wälder liefen, um Pilze zu sammeln.2 Dabei handelte es sich natürlich nicht um jene Pilze, denen ich hier folge, aber in ihnen zeigt sich, worum es mir geht: Das unkontrollierte Leben der Pilze ist ein Geschenk – und eine Orientierung –, wenn die Kontrolle, die wir über die Welt zu haben meinen, versagt.
Auch wenn ich Ihnen keine Pilze anbieten kann, hoffe ich doch, Sie kosten mit mir das »herbstliche Aroma«, das in dem am Anfang stehenden Gedicht gepriesen wird. Es ist der Duft der Matsutake, einer Gruppe wohlriechender wild wachsender Pilze, die in Japan hochgeschätzt sind. Matsutake sind die geliebten Boten der Herbstsaison. Ihr Duft evoziert jene Traurigkeit, die mit dem Verlust der sommerlichen Leichtigkeit und Fülle einhergeht, beschwört aber auch die geschärfte Intensität und das erhöhte Empfindungsvermögen des Herbstes. Eine solche Empfänglichkeit ist geboten, wenn die sommerliche Leichtigkeit des globalen Fortschritts zu Ende geht: Das herbstliche Aroma führt mich in jenes gewöhnliche Leben, das ohne Garantien auskommen muss. Mein Buch ist keine Kritik am Traum der Modernisierung und des Fortschritts, der dem zwanzigsten Jahrhundert die Aussicht auf Stabilität bescherte; zahlreiche Analytiker haben diese Träume bereits vor mir seziert. Ich möchte vielmehr zum Thema machen, was es für die Vorstellungskraft bedeutet, ohne jene orientierenden Erzählungen leben zu müssen, die uns einst glauben ließen, wir als Gesellschaft wüssten, wo es langgeht. Wenn wir uns der Attraktion des Matsutake nicht verschließen, kann uns dieser Pilz zu einer Neugier verleiten, die mir in prekären Zeiten als unumgängliche Voraussetzung für ein gemeinschaftliches Überleben erscheint.
In einem radikalen Pamphlet wurde diese Herausforderung wie folgt formuliert:
Das Gespenst, das viele nicht sehen wollen, ist eine einfache Einsicht – die Welt wird nicht »gerettet« werden. (…) Wenn wir nicht an eine weltweite revolutionäre Zukunft glauben, müssen wir (wie es ja tatsächlich stets der Fall war) in der Gegenwart leben.3
Als 1945 Hiroshima durch eine Atombombe zerstört wurde, war das erste Lebewesen, das in der verheerten Landschaft wieder aus dem Boden kam, angeblich ein Matsutake.4
Mit der Beherrschung des Atoms erreichte der Menschheitstraum von der Beherrschung der Natur seinen Höhepunkt. Mit der Bombe auf Hiroshima begann dieser Traum zu zerplatzen und alles änderte sich. Plötzlich wurde uns bewusst, dass die Menschen die Lebensgrundlage des Planeten zerstören konnten – absichtlich oder nicht. Ein Bewusstsein, das noch zunahm, als wir von Dingen wie Umweltverschmutzung, Massenaussterben oder Klimawandel erfuhren. Die aktuelle Prekarität hängt zur Hälfte vom Schicksal der Erde ab: Mit welchem Ausmaß an Zerstörungen durch den Menschen können wir leben? Ungeachtet der Rede von Nachhaltigkeit müssen wir uns fragen, welche Chance wir haben, unseren Nachfahren, und damit sind alle Arten von Lebewesen gemeint, eine bewohnbare Umwelt zu hinterlassen.
Auch der zweite entscheidende Grund für unsere heute prekäre Lage hängt mit der Hiroshima-Bombe zusammen: die überraschenden Widersprüche der Nachkriegsentwicklung. Nach dem Krieg schien die von amerikanischen Bomben gestützte Modernisierung das Versprechen einer glänzenden Zukunft abzugeben. Jeder sollte davon profitieren. Aber heute? Auf der einen Seite ist kein Ort der Welt von der globalen politischen Ökonomie, die aus dem Apparat der Nachkriegsentwicklung hervorgegangen ist, unberührt geblieben. Auf der anderen Seite scheinen wir, obzwar die Entwicklungsversprechen noch immer winken, über keine Mittel mehr zu verfügen, sie umzusetzen. Die Modernisierung sollte die Welt – die kommunistische wie die kapitalistische – mit Jobs versehen, und nicht einfach irgendwelchen Jobs, sondern »regulären Beschäftigungen« mit festen Löhnen und Vorsorgeleistungen. Solche Jobs sind heute selten geworden; die meisten Menschen haben nur ein eher unregelmäßiges Auskommen. Die Ironie unserer Zeit besteht also darin, dass jeder vom Kapitalismus abhängt, aber fast keiner noch eine, wie es einmal genannt wurde, »feste Arbeit« hat.
Wenn man in prekären Verhältnissen lebt, genügt es nicht, nur jene zu schmähen, die sie uns eingebrockt haben (obgleich ich bestimmt nichts dagegen habe). Wir könnten etwa unseren Blick wandern lassen, um diese seltsame neue Welt in Augenschein zu nehmen, und wir könnten unsere Fantasie bemühen, damit wir ihre Umrisse begreifen. Pilze können uns dabei helfen. Da Matsutake so gerne in verheerten Landstrichen wachsen, bieten sie uns Gelegenheit, die Ruine zu erkunden, zu der unsere Heimat geworden ist.
Matsutake sind Wildpilze, die vornehmlich in Wäldern vorkommen, die von Menschen gestört wurden. Wie Ratten, Waschbären und Kakerlaken sind sie in der Lage, es mit menschengemachten Umweltverheerungen aller Art aufzunehmen. Sie sind jedoch keine Schädlinge und gelten als wertvolle Delikatesse – zumindest in Japan, wo sie hohe Preise erzielen, die sie zeitweilig zu den teuersten Pilzen der Erde machten. Matsutake besitzen die Fähigkeit, Bäumen Nährstoffe zuzuführen, und begünstigen somit das Wachstum von Wäldern dort, wo es eigentlich aussichtslos erscheint. Der Pilz führt uns vor Augen, wie in gestörten Umgebungen Koexistenz möglich ist. Auch wenn dies keine Ausrede für weitere Zerstörungen sein kann, kündet er von einem gemeinschaftlichen Überleben.
Der Matsutake wirft überdies ein Licht auf die Risse in der Weltwirtschaft. In den vergangenen dreißig Jahren ist der Pilz zu einer global gehandelten Ware geworden, die in Wäldern überall auf der Nordhalbkugel gesammelt und dann frisch nach Japan transportiert wird. Viele Matsutake-Sucher stammen aus vertriebenen oder entrechteten kulturellen Minderheiten. Im pazifischen Nordwesten der USA zum Beispiel sind die meisten professionellen Sammler Flüchtlinge aus Laos und Kambodscha. In den Gegenden, in denen der Pilz gesammelt wird, trägt er aufgrund seines hohen Preises entscheidend zum Lebensunterhalt bei und sorgt darüber hinaus für eine kulturelle Wiederbelebung.
Allerdings hat das Geschäft mit dem Matsutake kaum mit den Entwicklungsträumen des zwanzigsten Jahrhunderts zu tun. Die meisten Pilzsucher, mit denen ich gesprochen habe, haben fürchterliche Geschichten von Vertreibung und Verlust zu erzählen. Professionelles Sammeln sorgt bei jenen, die keine andere Möglichkeit haben, ihren Lebensunterhalt zu bestreiten, für ein besseres Auskommen als allgemein üblich. Doch welche Ökonomie steckt dahinter? Pilzsucher arbeiten auf sich allein gestellt; es gibt keine Firmen, die sie beschäftigen. Es gibt keine festen Löhne und keine Vorsorgeleistungen. Die Sammler verkaufen lediglich die Pilze, die sie finden können. In manchen Jahren gibt es keine Pilze, sodass sie sehen müssen, wo sie bleiben. Professionelles Sammeln von Wildpilzen ist ein gutes Beispiel für eine prekäre Lebensführung. Ich verbinde im vorliegenden Buch die Geschichten prekärer Lebensverhältnisse mit denen prekärer Lebenswelten, indem ich den Handel und die Ökologie des Matsutake-Pilzes verfolge. Dabei habe ich es stets mit einer Art Flickwerk zu tun, mit einem Mosaik aus miteinander verflochtenen Lebensweisen, deren jede wiederum sich zu einem Mosaik zeitlicher Rhythmen und räumlicher Segmente öffnet. Ich behaupte, dass wir dies – nämlich die Situation der Welt – nur wahrnehmen können, wenn wir die aktuelle Prekarität als einen Zustand anerkennen, der die gesamte Erde betrifft. Solange in den maßgeblichen Analysen von einer Wachstumsannahme ausgegangen wird, werden die Experten die Heterogenität von Raum und Zeit nicht verstehen, selbst dort nicht, wo sie für gewöhnliche Beteiligte und Beobachter auf der Hand liegt. Theorien, die sich mit Heterogenität befassen, stecken allerdings noch in den Kinderschuhen. Wir müssen Fantasie walten lassen, um die flickwerkartige Unberechenbarkeit der aktuellen Lage einschätzen zu können. Das Buch möchte diesen Prozess begleiten – anhand von Pilzen.
Zum Handel: Der zeitgenössische Handel funktioniert innerhalb der Zwänge und Möglichkeiten des Kapitalismus. Doch im zwanzigsten Jahrhundert, in den Fußstapfen von Marx, haben die Theoretiker des Kapitalismus den Fortschritt auf eine Weise internalisiert, dass sie nur eine einzige mächtige Strömung wahrgenommen und alles Übrige ignoriert haben. Hier möchte das Buch aufzeigen, welche Möglichkeiten es gibt, den Kapitalismus unter Verzicht auf diese lähmende Sicht der Dinge zu durchleuchten. Mit einer großen Aufmerksamkeit für die Welt in all ihrer Prekarität soll die Frage verbunden werden, auf welche Weise Reichtum akkumuliert wird. Wie könnte ein Kapitalismus ohne Fortschrittsannahme aussehen? Möglicherweise wie eine Art Flickwerk: Die Akkumulation von Reichtum ist möglich, weil an unerwarteten Stellen produzierter Wert für das Kapital in Besitz genommen wird.
Zur Ökologie: Die Annahme, dass der menschliche Fortschritt gleichbedeutend ist mit einer zunehmenden Beherrschung der Natur, hat insbesondere bei den Geisteswissenschaftlern dazu geführt, in der Natur einen romantischen Ort der Antimoderne zu sehen.5 Aber für die Wissenschaftler des zwanzigsten Jahrhunderts spielte der Fortschrittsgedanke auch unbewusst bei der Untersuchung von Landschaften eine Rolle. So rutschten Expansionsthesen in die Konzepte der Populationsbiologie. Neue Entwicklungen in der Ökologie machen indes, indem man artenübergreifende Interaktionen und Störungschroniken einführt, einen völlig anderen Denkansatz möglich. In dieser Zeit abgeschwächter Erwartungen suche ich nach störungsbasierten Ökologien, in denen mitunter zahlreiche Arten ohne Harmonie, aber auch ohne Eroberungsversuche zusammenleben.
Zwar lehne ich es ab, Ökonomie und Ökologie jeweils aufeinander zu reduzieren, aber es gibt eine Verbindung zwischen Ökonomie und Umwelt, die von vornherein einzuführen mir wichtig erscheint: die Geschichte einer Akkumulation von Reichtum, bei der aus Menschen oder Nichtmenschen Investitionsquellen gemacht werden. Diese Geschichte hat Investoren dazu veranlasst, Menschen wie Dinge der Entfremdung anheimzugeben, das heißt, mit der Eigenschaft auszustatten, für sich allein zu stehen, als ob die Verflechtungen des Lebens keine Rolle spielten.6 Durch Entfremdung werden Menschen und Dinge zu beweglichen Gütern. Sie können mittels jeder Entfernung trotzenden Transporten aus ihren Lebenswelten herausgenommen werden, um anderswo mit anderen Gütern, die aus anderen Lebenswelten stammen, getauscht zu werden.7 Ein Prozess, der entfremdet, unterscheidet sich deutlich von dem Vorgang, andere als Teil einer Lebenswelt zu gebrauchen – zum Beispiel, um sie zu essen oder selbst als Nahrung zu dienen. In diesem Fall bleiben von mehreren Arten bestimmte Lebensräume an Ort und Stelle. Entfremdung umgeht die Verflechtungen des Lebensraums. Der Entfremdungstraum veranlasst zu Landschaftsveränderungen, bei denen nur ein einziges isoliertes Wirtschaftsgut zählt; alles andere wird entweder zu Unkraut oder Ausschuss. An solchen Orten erscheint die Rücksichtnahme auf die Verflechtungen des Lebensraums ineffizient und womöglich archaisch. Wenn dieses einzige Gut irgendwann nicht mehr produziert werden kann, wird der Ort aufgegeben. Das Holz ist gefällt; das Öl ist versiegt; der Ackerboden lässt keine Feldfrüchte mehr gedeihen. Die Suche nach Wirtschaftsgütern wird andernorts fortgesetzt. So produziert die für die Entfremdung vorgenommene Vereinfachung Ruinen: Orte, die nach der Güterproduktion aufgegeben worden sind.
Diese ruinierten Brachen finden sich heute in allen Landschaften der Welt. Obwohl sie für tot erklärt wurden, können sie doch Leben aufweisen; Gebiete, die aufgegeben wurden, bringen mitunter neues artenreiches und multikulturelles Leben hervor. Angesichts der weltweiten prekären Lage bleibt uns nichts anderes übrig, als in diesen Ruinen nach Leben zu suchen.
Die Neugier zu wecken, wird der erste Schritt sein. Die Knoten und Rhythmen des Flickwerks harren, unbelastet von den Vereinfachungen der Fortschrittserzählungen, der Erkundung. Matsutake sind ein guter Anfang: So viel ich auch lerne, sie überraschen mich immer wieder.
Das ist kein Buch über Japan, aber der Leser sollte etwas über die Bedeutung des Matsutake in Japan wissen.8 In japanischen Schriftquellen erscheint der Matsutake zum ersten Mal in dem Gedicht aus dem achten Jahrhundert, das diesen Prolog eröffnete. Schon damals wird sein Aroma als Künder des Herbstes gepriesen. In dem Gebiet um Nara und Kyoto, wo man in den Bergen die Wälder gefällt hatte, um Holz für den Bau von Tempeln und die Eisenverhüttung zu gewinnen, breitete sich der Pilz aus. In der Tat erlaubte es der Eingriff des Menschen, das Tricholoma matsutake in Japan heimisch wurde. Das liegt daran, dass sein häufigster Wirt die japanische Rotfichte (Pinus densiflora) ist, die, um zu keimen, Sonnenlicht und mineralischen Boden braucht, der nach der Abholzung durch den Menschen zurückbleibt. Wenn die Wälder in Japan wieder ungehindert durch menschliche Eingriffe wachsen können, verschatten die Laubbäume früher oder später die Kiefern und verhindern ihre weitere Keimung.
Mit der Verbreitung der Rotkiefer aufgrund der fortschreitenden Entwaldung wurde der Matsutake, liebevoll dargereicht in einer Schachtel aus Farn, zu einem hochgeschätzten Geschenk. Die Adligen wurden damit beehrt. Während der Edo-Zeit (1603–1868) kamen auch begüterte Nichtadlige, etwa städtische Kaufleute, in den Genuss des Pilzes. Als Künder des Herbstes fand er Eingang in die Zeremonien anlässlich der vier Jahreszeiten. Ausflüge, auf denen er gesammelt wurde, waren ein herbstliches Äquivalent zu den Kirschblütenfesten im Frühling. Der Matsutake wurde zu einem beliebten Gegenstand der Poesie.
Zur Abendstunde läutet die Tempelglocke im Zedernwald
Unten im Tal weht das Aroma des Herbstes.
— Akemi Tachibana (1812–1868)
Wie oft in der japanischen Naturlyrik bauen jahreszeitliche Verweise eine Stimmung auf. Der Matsutake gesellte sich älteren Symbolen für die Herbstsaison wie dem röhrenden Hirsch oder dem Erntemond hinzu. Die sich ankündigende Dürftigkeit des Winters verlieh dem Herbst eine Aura von Einsamkeit, fast am Rande zur Nostalgie, und das oben zitierte Gedicht zeugt von dieser Stimmung. Matsutake war ein Vergnügen der Elite: Er bezeichnete das Privileg, in einer für die verfeinerten Sinne kunstvoll rekonstruierten Natur zu leben.10 Deshalb hatte auch niemand etwas einzuwenden, wenn Bauern mitunter im Vorfeld der von der Elite unternommenen Ausflüge Matsutake »pflanzten« (das heißt, sie steckten die Pilze kunstvoll in den Boden, wenn es gerade keine natürlichen Matsutake-Vorkommen gab). Der Matsutake ist zum Element einer idealen Jahreszeitenabfolge geworden, das nicht nur in der Lyrik, sondern auch in allen anderen Künsten, von der Teezeremonie bis zum Theater, wertgeschätzt wird.
Die Wolke zieht vorbei, verschwindet,
und ich rieche das Aroma des Pilzes.
— Koi Nagata (1900–1997)11
Die Edo-Zeit ging mit der Meiji-Restauration und Japans rapider Modernisierung zu Ende. Die Entwaldung ging noch rascher vonstatten und schuf Raum für die Rotkiefer und den Matsutake. In der Gegend um Kyoto wurde matsutake gar zu einem Sammelbegriff für »Pilz«. Mitte der 1950er-Jahre allerdings änderte sich die Lage des zu Beginn des zwanzigsten Jahrhunderts weit verbreiteten Matsutake. Bauernwälder wurden abgeholzt und wichen Baumplantagen, wurden für neue Vorstädte eingeebnet oder von Bauern, die in die Städte zogen, aufgegeben. Feuerholz und Holzkohle wurden durch fossile Brennstoffe ersetzt. Die Bauern nutzten die verbleibenden Waldflächen nicht mehr, welche in der Folge zu dichten Laubwäldern aufwuchsen. Hügelland, das einst von Matsutake-Pilzen überzogen war, war für die Kieferngemeinschaften nun zu schattig geworden. Schließlich wurde den Bäumen mit einem invasiven Fadenwurm der Garaus gemacht. Mitte der 1970er-Jahre war der Matsutake überall in Japan selten geworden.
Zur gleichen Zeit jedoch entwickelte sich die japanische Wirtschaft rapide, und die Nachfrage nach Matsutake-Pilzen als ausnehmend teurem Geschenk, das als Vergünstigung vergeben oder zur Bestechung eingesetzt wurde, wuchs. Die Preise schossen in den Himmel. Nun gewann an Bedeutung, dass der Edelpilz auch in anderen Teilen der Welt gedieh. Im Ausland lebende oder reisende Japaner begannen damit, Matsutake nach Japan zu schicken. Als dann Importeure auftauchten, die den internationalen Matsutake-Handel auf den Weg brachten, drängten auch Sammler in das Geschäft, die bisher keine Beziehung zu Japan hatten. Anfangs sah es so aus, als würde es eine ganze Palette von Farbvarianten und Arten geben, die berechtigterweise für Matsutake gehalten werden konnten – denn sie besaßen den typischen Geruch. Als der Matsutake in den Wäldern der nördlichen Hemisphäre plötzlich Aufmerksamkeit erfuhr, wurden auch immer mehr wissenschaftliche Namen in die Welt gesetzt. Erst in den letzten zwanzig Jahren hat sich die Namensgebung konsolidiert. In Eurasien gehören die meisten Matsutake der Art Tricholoma matsutake an.12 In Nordamerika findet sich diese Art nur im Osten und in den Bergen Mexikos. Im Westen des Kontinents wird der dort heimische Matsutake einer anderen Art, Tricholoma magnivelare, zugerechnet.13 Auch weil die Dynamiken der Artenbildung noch immer unklar sind, halten einige Wissenschaftler den Oberbegriff Matsutake als Bezeichnung des aromatischen Pilzes für weit geeigneter.14 Wenn es nicht um Klassifikationsfragen geht, folge ich im Allgemeinen dieser Praxis.
Die Japaner haben einen Weg gefunden, Matsutake aus verschiedenen Teilen der Welt einzustufen, und die Rangfolge schlägt sich in den Preisen nieder. Die Augen für solche Qualitätsstufen wurden mir erst geöffnet, als mir ein japanischer Importeur erklärte: »Matsutake sind wie Menschen. Matsutake aus Amerika sind weiß, weil die Leute dort weiß sind. Chinesische Pilze sind schwarz, weil die Leute schwarz sind. Die Japaner und die japanischen Pilze liegen schön dazwischen.« Nicht jeder verwendet die gleichen Rangabstufungen, aber dieses krasse Beispiel steht stellvertretend für die vielen Klassifikations- und Bewertungsweisen, die den weltweiten Handel strukturieren.
Inzwischen zeigen sich die Menschen in Japan besorgt über den Verlust der Bauernwälder, von denen doch von Frühlingsblumen bis zum Herbstlaub so viel jahreszeitliche Schönheit ausging. Seit den 1970er-Jahren haben sich Freiwillige zusammengefunden, um die Waldgebiete wieder in ihren alten Zustand zu versetzen. Da es diesen Gruppen mit ihrer Arbeit nicht nur um eine passive ästhetische Wirkung geht, suchten sie nach Möglichkeiten, die wiederhergestellten Waldflächen dem Lebensunterhalt der Menschen zugutekommen zu lassen. Der hohe Marktpreis des Matsutake machte ihn zu einem idealen Erzeugnis der restituierten Bauernwälder. Und damit komme ich zur Prekarität zurück und zum Leben inmitten des Unheils, das wir angerichtet haben. Das Leben scheint aus allen Nähten zu platzen, überbordend vor japanischer Ästhetik und Ökogeschichten, aber auch vor internationalen Beziehungen und kapitalistischen Handelsgepflogenheiten. Das alles ist Stoff für die nun folgenden Geschichten. Würdigen wir, bevor ich damit beginne, noch einmal den Pilz.
Oh, Matsutake
Die Erregung, bevor man ihn findet.
— Yamaguchi Sodo (1642–1716)15
DIE ZEIT BESCHWÖREN, YUNNAN
Zuschauen, wie der Boss spielt.
Teil I
Was ist noch übrig?
Es war gerade noch hell an diesem Abend, als ich merkte, dass ich mich in einem unbekannten Wald verirrt hatte. Es war das erste Mal, dass ich mich in den Kaskaden Oregons auf die Suche nach Matsutake-Pilzen – und Matsutake-Sammlern – gemacht hatte. Etwas früher an diesem Nachmittag war ich auf das »große Lager« gestoßen, das die Forstverwaltung für Pilzsammler eingerichtet hat, aber alle Pflücker waren in den umliegenden Waldgebieten unterwegs. Also hatte ich beschlossen, selbst auf Pilzsuche zu gehen, solange ich auf ihre Rückkehr wartete.
Einen Wald, der weniger vielversprechend für Pilze war, hätte ich mir nicht vorstellen können. Der Boden war trocken und steinig, und außer den dünnen Stangen der Drehkiefern gedieh hier nichts. Kaum eine Pflanze, die in Bodennähe wuchs, nicht einmal Gras, und als ich die Erde in die Hand nahm, schnitten mir scharfe Bimssteinscherben in die Finger. Im Laufe des Nachmittags fand ich zwei »Kupferhüte«, schmierige Pilze mit einem orangen Anflug und mehligem Geruch.1 Sonst nichts. Schlimmer noch, ich hatte die Orientierung verloren. Wo ich auch hinging, sah der Wald gleich aus. Ich hatte nicht die geringste Ahnung, in welcher Richtung mein Auto stand. Da ich nicht vorgehabt hatte, mich längere Zeit hier draußen aufzuhalten, hatte ich nichts dabei, und ich wusste, ich würde bald Durst und Hunger bekommen – und dass es kalt werden würde.
Ich stolperte durch den Wald und stieß schließlich auf einen Forstweg. Aber in welche Richtung sollte ich ihm folgen? Die Sonne ging langsam unter, während ich dahinstapfte. Nachdem ich weniger als eine halbe Meile gelaufen war, tauchte ein Pickup auf. In ihm befanden sich ein junger Mann mit fröhlichem Gesicht und ein runzliger alter Greis, die mir anboten, mich mitzunehmen. Der Jüngere stellte sich als Kao vor. Er sei, sagte er, wie sein Onkel ein Mien aus dem laotischen Bergland, der in den 1980er-Jahren aus einem thailändischen Flüchtlingslager in die Vereinigten Staaten gekommen sei. In Sacramento, Kalifornien, wo sie inzwischen lebten, waren sie Nachbarn. Nach Oregon waren sie gekommen, um Pilze zu sammeln. Sie nahmen mich in ihr Lager mit. Der junge Mann ging Wasser holen und fuhr mit seinen Plastikkanistern zu einem etwas entfernt liegenden Wassertank. Der Ältere sprach kein Englisch, aber es stellte sich heraus, dass er wie ich ein bisschen Mandarin verstand. Als wir radebrechend unsere Sätze austauschten, zog er eine aus einem PVC-Rohr gefertigte Bong hervor und zündete seinen Tabak an.
Es dämmerte schon, als Kao mit dem Wasser zurückkam. Trotzdem winkte er mich heran, um mit ihm Pilze suchen zu gehen. Ganz in der Nähe würde es welche geben. In der aufziehenden Dunkelheit kraxelten wir unweit des Lagers einen steinigen Hügel hinauf. Ich sah nur Erde und ein paar dürre Kiefern. Neben mir stand Kao mit Korb und Stock, stocherte in dem völlig brachliegenden Erdreich herum und zog einen dicken Knubbel hervor. Wie war das möglich? Da war doch absolut nichts – und dann hatte er ihn gefunden.
Kao reichte mir den Pilz. Zum ersten Mal nahm ich den Geruch wahr. Zunächst kein besonders angenehmer Geruch. Nicht wie bei einer Blume oder einem Essen, bei dem einem das Wasser im Munde zusammenläuft. Der Geruch ist verstörend. Es soll Leute geben, die sich nicht mit ihm anfreunden können. Er ist schwer zu beschreiben. Manche vergleichen ihn mit Modergeruch, für andere ist er die reinste Offenbarung – das Herbstaroma. Bei meinem ersten Schnüffeln war ich … perplex.
Ich war nicht nur wegen des Geruchs überrascht. Was hatten Angehörige der Mien, japanische Feinschmeckerpilze und ich in einem abgewirtschafteten Industriewald in Oregon zu suchen? Ich lebte schon so lange in den Vereinigten Staaten, ohne auch nur einmal von all diesen Dingen gehört zu haben. Das Mien-Lager versetzte mich zurück in die Zeit meiner Feldforschung in Südostasien; die Pilze kitzelten mein Interesse an japanischer Ästhetik und Küche hervor. Der kaputte Wald hingegen schien aus einem Science-Fiction-Albtraum zu stammen. Für meinen mangelhaften gesunden Menschenverstand war dies alles wie durch ein Wunder aus der Zeit gefallen, am falschen Ort – wie etwas, das einer Märchenerzählung entsprungen schien. Ich war aufgerüttelt und fasziniert; ich konnte nicht aufhören, meiner Neugier zu folgen.
DIE ZEIT BESCHWÖREN, PRÄFEKTUR KYOTO
Mr. Imotos Landkarte der Wiederbelebung. Hier sein Matsutake-Berg: Eine Zeitmaschine mit verschiedenen Jahreszeiten, Historien und Hoffnungen.
Kapitel 1
Die Kunst der Wahrnehmung
Ich schlage nicht vor, in die Steinzeit zurückzukehren. Meine Absicht ist weder reaktionär noch konservativ, sondern schlicht subversiv. Die utopische Vorstellungskraft sitzt offenbar in der Falle, wie der Kapitalismus, die Industrie und die gesamte Menschheit, sie sitzt in einer Einbahnstraßenzukunft, die nur Wachstum kennt. Ich versuche lediglich darüber nachzudenken, wie die Kuh vom Eis zu holen ist.
— Ursula K. Le Guin1
In den Jahren 1908 und 1909 wetteiferten zwei Eisenbahnunternehmer miteinander, entlang des Deschutes River in Oregon eine Bahnlinie zu verlegen.2 Ihr Ziel war es, als Erste eine Verbindung zwischen den Wäldern der östlichen Kaskaden mit ihren himmelstrebenden Ponderosa-Kiefern (auch: Gelbkiefern) und den Holzumschlagplätzen Portlands zu schaffen. 1910 endete das hitzige Rennen mit dem Übereinkommen, den Transport gemeinsam zu bewerkstelligen. Kiefernstämme aus der Region rollten nun en masse zu weit entfernten Märkten. Mit den Sägewerken kamen neue Siedler; Ortschaften schossen aus dem Boden, als immer mehr Holzarbeiter kamen. In den 1930er-Jahren war Oregon zum größten Holzproduzenten der Nation aufgestiegen.
Diese Geschichte müssen wir kennen. Es ist die Geschichte der Pioniere, des Fortschritts und der Umwandlung von »leerem« Raum in Gebiete industriell genutzter Rohstoffquellen.
1989 wurde ein Fleckenkauz aus Plastik in effigie an einem Oregon-Holz-Transporter gehenkt.3 Umweltaktivisten hatten deutlich gemacht, dass der rücksichtslose Holzeinschlag die Wälder des Pazifischen Nordwestens zerstörte. »Der Fleckenkauz war wie der Kanarienvogel in den Kohlebergwerken«, erklärte einer ihrer Sprecher, »er stand symbolisch für ein Ökosystem, das kurz vor dem Zusammenbruch war.«4 Als ein Bundesrichter die Abholzung von Altbestand stoppte, um Lebensraum für die Eule zu erhalten, gerieten die Holzfäller in Rage; aber wie viele Holzfäller gab es überhaupt noch? Mit der Mechanisierung der Holzverarbeitung und dem Verschwinden hochwertigen Holzes nahmen die Arbeitsplätze im Holzgewerbe rapide ab. 1989 hatten bereits zahlreiche Sägewerke dicht gemacht. Die Holzunternehmen zogen in andere Gebiete.5 Die östlichen Kaskaden, einst für ihren Holzreichtum bekannt, bestanden nun aus kahlgeschlagenen Wäldern, und einstige Holzfällersiedlungen wurden von Gebüsch überwachsen.
Diese Geschichte müssen wir kennen. Die industrielle Transformation stellte sich als leeres Versprechen heraus, mit der Folge, dass Lebensgrundlagen verloren gingen und zerstörte Landschaften zurückblieben. Und doch: Dokumente wie diese sind nicht genug. Lassen wir die Geschichte im Zerfall enden, verlieren wir alle Hoffnung – oder wir lenken unsere Aufmerksamkeit auf andere Stätten von Versprechen und Ruin, Versprechen und Ruin.
Was entsteht, wenn der industrielle Ruf nach Versprechen und Ruin verklungen ist, in den beschädigten Landschaften? In den vom Kahlschlag heimgesuchten Wäldern Oregons hatte um 1989 etwas anderes seinen Anfang genommen: der Handel mit Wildpilzen. Dies geschah von Anfang an im Zusammenhang mit Zerstörungen überall auf der Welt. Durch die Tschernobyl-Katastrophe von 1986 sind Europas Pilze kontaminiert worden, und auf der Suche nach Nachschub kamen die Händler in den Pazifischen Nordwesten. Als Japan damit begann, Matsutake für viel Geld zu importieren – zur gleichen Zeit, als sich arbeitslose Flüchtlinge aus Indochina in Kalifornien ansiedelten –, lief das Geschäft heiß. Auf der Suche nach dem neuen »weißen Gold« fielen Tausende im Pazifischen Nordwesten ein. Dies geschah mitten in einem Kampf um die Wälder, in dem man sich zwischen Arbeitsplätzen oder Umwelt zu entscheiden hatte, doch keine der Parteien nahm Notiz von den Pilzgängern. Auf Arbeitsrecht spezialisierte Anwälte hatten nur Arbeitsverträge für gesunde weiße Männer im Sinn; die Sammler – versehrte weiße Veteranen, Flüchtlinge aus Asien, amerikanische Ureinwohner und Latinos ohne Papiere – waren unsichtbare Eindringlinge. Umweltschützer kämpften darum, Störungen durch den Menschen aus den Wäldern fernzuhalten; Tausende, die in die Wälder ausschwärmten, wären, hätte man sie denn bemerkt, wohl kaum willkommen gewesen. Tatsächlich wurden sie aber so gut wie nicht wahrgenommen. Höchstens hier und da kamen angesichts der vielen Asiaten Ängste vor einer Invasion auf: Journalisten sorgten sich, dass es zu Gewaltausbrüchen kommen könnte.6
Jetzt, nach den ersten Jahren eines neuen Jahrtausends, scheint der Zielkonflikt zwischen Jobs und Umwelt weniger überzeugend. Ob mit oder ohne Umweltschutz, in den Vereinigten Staaten gibt es heute weniger »Jobs«, auf die die Definition des zwanzigsten Jahrhunderts passt. Im Übrigen sieht es eher danach aus, als ob die Umweltzerstörung uns alle umbringen könnte, Jobs hin oder her. Wir haben uns mit dem Problem herumzuschlagen, wie wir trotz der ökonomischen und ökologischen Verheerungen leben sollen. Weder gibt es Fortschrittserzählungen noch solche des Niedergangs, die uns erklären würden, wie ein gemeinsames Überleben bewerkstelligt werden könnte. Es ist also an der Zeit, dem Sammeln von Pilzen Beachtung zu schenken. Nicht, dass uns das retten würde – aber es dürfte unserer Fantasie auf die Sprünge helfen.
Geologen haben damit begonnen, unsere Zeit als Anthropozän zu bezeichnen, und meinen damit eine Epoche, in der die Störungen durch den Menschen alle anderen geologischen Kräfte übersteigen. Der Begriff ist noch neu zu der Zeit, als ich dieses Buch schreibe, und noch voller verheißungsvoller Widersprüche. Auch wenn der Name von manchen so ausgelegt wird, dass sie darin den Triumph des Menschen sehen, scheint doch eher das Gegenteil der Fall zu sein: Planlos und ohne Absicht haben die Menschen auf unserem Planeten ein Chaos angerichtet.7 Dieses Chaos ist darüber hinaus und trotz des Wortteils »anthropos« (Mensch) nicht das Resultat unserer artspezifischen Biologie. Die überzeugendste zeitliche Abgrenzung des Anthropozäns beginnt nicht etwa mit dem Auftreten unserer Art, sondern mit der Heraufkunft des modernen Kapitalismus, der weiträumige Zerstörungen von Landschaften und Ökosystemen nach sich gezogen hat. Diese Zäsur macht das »anthropos« allerdings zu einem noch größeren Problem. Wenn wir über den Menschen seit dem Aufkommen des Kapitalismus nachdenken, verstricken wir uns rasch in Ideen, die mit dem Fortschrittsgedanken und mit der Verbreitung von Entfremdungstechniken zu tun haben, durch die sowohl der Mensch selbst als auch andere Arten in Ressourcen umgewandelt werden. Derartige Techniken haben den Menschen von seinen kontrollierten Identitäten abgespalten und die Notwendigkeit eines gemeinschaftlichen Überlebens verdunkelt. Der Begriff des Anthropozäns beschwört diese Bestrebungen, die man zusammengenommen als moderne menschliche Einbildung bezeichnen könnte, und schürt zugleich die Hoffnung, dass wir sie irgendwie aufgeben könnten. Sind wir imstande, in diesem menschengemachten System zu leben und es zugleich zu überwinden?
Dies ist ein Dilemma, das mich innehalten lässt, bevor ich mich daranmache, Pilze und Pilzsammler zu beschreiben. Die moderne menschliche Einbildung wird eine Geschichte über Pilze für nicht mehr als eine dekorative Fußnote halten. Das »anthropos« blockiert die Aufmerksamkeit gegenüber Landschaften als Flickwerk, multipler Zeitlichkeit und veränderlichen Gefügen von Menschen und Nichtmenschen – all die entscheidenden Aspekte gemeinschaftlichen Überlebens. Um also das Pilzsammeln zu einer lohnenden Geschichte ausspinnen zu können, muss ich zunächst das Werk dieses »anthropos« beschreiben und das Terrain erkunden, das anzuerkennen es sich weigert.
Man sollte sich tatsächlich fragen, was noch übrig ist. Angesichts der Effizienz, mit der natürliche Landschaften von Staats wegen oder durch den Kapitalismus zerstört wurden, ist es nicht selbstverständlich, dass heute überhaupt noch etwas am Leben ist, das nicht von den Plänen der genannten Akteure vereinnahmt worden wäre. Für eine Antwort darauf gilt es, die ausgefransten Ränder in den Blick zu nehmen. Was führt die Mien und den Matsutake-Pilz in Oregon zusammen? Scheinbar triviale Fragestellungen wie diese können das Unterste zuoberst kehren und unvorhersehbare Begegnungen ins Zentrum der Betrachtungen rücken.
Jeden Tag hören wir in den Nachrichten von prekären Lagen. Die Leute verlieren ihre Arbeit oder sind wütend, weil sie nie welche hatten. Gorillas und Flussdelfine stehen kurz vor dem Aussterben. Steigende Meeresspiegel überfluten ganze pazifische Eilande. Meistens betrachten wir solche Prekaritäten als Ausnahmen im Getriebe der Welt. Als das, was aus dem System »fällt«. Was aber, wenn, wie ich behaupte, die Prekarität die Grundbedingung unserer Zeit ist – oder, um es anders zu sagen, was, wenn unsere Zeit reif ist, diese Prekarität zu spüren? Was wenn Prekarität, Unbestimmtheit und das sogenannte Triviale im Zentrum jener Systematik stehen, nach der wir suchen?
Prekarität ist ein Zustand, in dem man anderen gegenüber anfällig ist. Unvorhersehbare Begegnungen verändern uns; wir haben keine Kontrolle mehr, nicht einmal über uns selbst. Nicht mehr in der Lage, uns auf eine stabile Gemeinschaftsstruktur zu beziehen, finden wir uns in veränderlichen Gefügen wieder, die uns und unsere Gegenüber umformen. Wir können uns nicht auf den Status quo verlassen; alles ist im Fluss – auch unsere Fähigkeit zu überleben. Mit Prekarität zu denken verändert die gesellschaftliche Analyse. Eine prekäre Welt ist eine Welt ohne Teleologie. Unbestimmtheit, die ungeplante Natur der Zeit, flößt Angst ein, aber wenn man die Prekarität ins Zentrum des Denkens rückt, wird evident, dass es gerade die Unbestimmtheit ist, die das Leben möglich macht.
Dies alles klingt nur aus einem einzigen Grund merkwürdig, deshalb nämlich, weil die meisten mit dem Traum der Modernisierung und des Fortschritts aufgewachsen sind. Durch Voreinstellungen wie diese werden jene Komponenten der Gegenwart ausgeblendet, die einen Weg in die Zukunft weisen könnten. Der Rest ist trivial; er »fällt« aus der Geschichte heraus. Ich kann mir Ihre Entgegnung vorstellen: »Fortschritt? Das ist eine Idee aus dem neunzehnten Jahrhundert.« Der Begriff des Fortschritts, insofern er auf einen allgemeinen Zustand verweist, ist selten geworden. Sogar der im zwanzigsten Jahrhundert geläufige Begriff der Modernisierung klingt mittlerweile veraltet. Die in beiden Begriffen eingeschriebene Annahme jedoch, dass sich die Dinge verbessern, begleitet uns überall. Jeden Tag befassen wir uns mit den entsprechenden Kategorien: Demokratie, Wachstum, Wissenschaft, Hoffnung. Warum erwarten wir sonst, dass die Wirtschaft wächst und die Wissenschaft fortschreitet? Selbst dort, wo sich unsere Geschichtstheorien nicht explizit auf Entwicklung beziehen, sind sie in diesen Kategorien gefangen. So auch unsere eigenen Träume. Zugegeben, es fällt mir schwer, das Folgende überhaupt auszusprechen: Für uns alle könnte es kein glückliches Ende nehmen. Warum dann überhaupt noch morgens aufstehen?
Der Fortschrittsgedanke unterliegt auch allgemein akzeptierten Annahmen dessen, was das Menschsein ausmacht. Wieder und wieder wird uns eingebläut, dass der Mensch sich von allen übrigen Lebewesen dadurch unterscheidet, dass er nach vorne schaut und andere, von Tag zu Tag lebende Arten deshalb von uns abhängig seien – auch wenn dies durch Begriffe wie Tätigkeit, Bewusstsein und Intention verdeckt wird. Solange wir glauben, dass der Mensch durch den Fortschritt gemacht wird, sind auch nichtmenschliche Wesen außerstande, diesem gedanklichen Bezugssystem zu entkommen.
Fortschritt ist ein Vorwärtsmarschieren, das fremde Zeitformen in seinen Takt hineinzieht. Ohne diesen treibenden Rhythmus wären wir vielleicht imstande, andere Muster wahrzunehmen. Durch jahreszeitliche Wachstumsimpulse, lebenslange Fortpflanzungszyklen und geografische Verbreitungsmuster gestaltet jedes Lebewesen die Welt immer wieder um. Auch innerhalb einer Art gibt es mannigfaltige, die Zeitabläufe formende Unternehmungen, da die Organismen einander in Anspruch nehmen und die Landschaftsformung koordinieren. (Das Wiederaufwachsen der gerodeten Kaskaden und die Radioökologie Hiroshimas führen uns eine artenübergreifende Formung der Zeit vor Augen.) Die Neugier, für die ich mich starkmache, folgt solchen mannigfachen Zeitlichkeiten und impft die Beschreibung und die Fantasie mit neuem Leben. Dabei geht es nicht bloß um Empirie, bei der die Welt ihre eigenen Kategorien erfindet. Gerade weil wir nicht wissen, wohin wir gehen, sind wir in der Lage, nach jenen Dingen Ausschau zu halten, die, da sie der Zeitachse des Fortschritts nicht entsprochen haben, stets übergangen worden sind.
Wenden wir uns noch einmal den bereits erwähnten Momenten in der Geschichte Oregons zu. Zunächst ging es um die Eisenbahn – ein Moment, der vom Fortschritt erzählte und in die Zukunft führte: Die Eisenbahnen haben unser Schicksal umgeformt. Der zweite Moment ist schon eine Unterbrechung und deutet auf eine Geschichte, in der die Zerstörung der Wälder eine Rolle spielt. Mit dem ersten allerdings teilt er die Annahme, dass die Metapher des Fortschritts im Erfolg wie im Scheitern zur Erkenntnis der Welt ausreicht. Die Erzählung des Niedergangs bietet keinen Rest, keinen Überschuss, nichts, was dem Fortschritt entrinnen würde. Sogar in den Geschichten der Zerstörung hat der Fortschritt noch Kontrolle über uns.
Doch die moderne menschliche Einbildung ist nicht das Einzige, was Welten baut: Wir sind von zahlreichen welterzeugenden Bestrebungen umgeben, ob menschlicher oder nichtmenschlicher Natur.8 Welterzeugende Bestrebungen entstehen aus der Praxis des Lebens; und diese Bestrebungen verändern unseren Planeten. Um sie im Schatten des in dem Begriff Anthropozän enthaltenen »anthropos« erkennen zu können, müssen wir unsere Aufmerksamkeit umlenken. Viele vorindustrielle Lebensweisen, vom stöbernden Sammeln bis zum Stehlen, bestehen auch heute noch; neue, darunter auch professionelles Pilzsammeln, treten hinzu. Wir aber vernachlässigen sie, da sie nicht Teil des Fortschritts sind. Auch diese Weisen, das Leben zu bestreiten, bilden Welten – und sie zeigen uns, dass wir lieber umher- als nach vorne schauen sollten.
Welterzeugung ist nicht nur dem Menschen vorbehalten. Und nicht nur Biber gestalten Bäche um, indem sie Dämme, Kanäle und Baue erstellen; tatsächlich schaffen sämtliche Organismen ein ökologisches Lebensumfeld und verändern den Boden, die Luft und das Wasser. Ohne die Fähigkeit, sich funktionierende Lebensräume einzurichten, würden die Arten aussterben. Dabei verändert jeder Organismus die Welt aller anderen Organismen. Bakterien erzeugten unsere Sauerstoffatmosphäre und die Pflanzen tragen zu ihrer Erhaltung bei. Pflanzen können an Land leben, weil Pilze ihnen den Boden bereiteten, indem sie Gestein zersetzten. Wie diese Beispiele darlegen, können sich welterzeugende Bestrebungen überlappen und Raum für mehr als nur eine Art bieten. Auch die Menschen sind in artenübergreifende Welterzeugungsprozesse verwickelt. Für die ersten Menschen war das Feuer nicht nur ein Element zum Kochen, sondern auch zum Abbrennen von Landschaften, wodurch sie das Wachstum essbarer Knollen sowie von Gräsern förderten, die wiederum Jagdwild anlockten. Der Mensch gestaltet Welten, in denen viele Arten gedeihen können, wenn seine Lebensarrangements Raum für andere Arten schaffen. Das ist nicht nur eine Sache des Ackerbaus, der Viehhaltung und des Umgangs mit Haustieren. Kiefern wachsen zusammen mit ihren symbiotischen Pilzen häufig besonders gut in Landschaften, die von Menschen abgebrannt worden sind. Kiefern und Pilze wirken zusammen, um von hellen offenen Flächen und bloßliegenden Mineralböden zu profitieren. Menschen, Kiefern und Pilze bilden lebende Arrangements für sich selbst und zugleich für andere: artenübergreifende Welten.
Im zwanzigsten Jahrhundert hat die Wissenschaft die moderne menschliche Einbildung noch weitergetrieben und sich gegen unsere Fähigkeit verschworen, die divergierenden, vielschichtigen und miteinander verbundenen Vorhaben wahrzunehmen, die zur Welterzeugung führen. Gebannt von der zunehmenden Dominanz bestimmter Lebensweisen über andere, vergaßen die Wissenschaftler zu fragen, was sonst noch so vor sich geht. Jetzt, da die Fortschrittserzählungen an Wirkung verlieren, wird es möglich, die Dinge aus einer anderen Perspektive zu betrachten.
Das Konzept des Gefüges (assemblage) ist hilfreich. Die Ökologen haben sich diesem Begriff zugewandt, um die mitunter starren und eng umgrenzten Konnotationen der ökologischen »Gemeinschaft« zu umgehen. Die Frage, wie sich die verschiedenen Arten in einem Arten-Gefüge – wenn überhaupt – gegenseitig beeinflussen, ist nie letztgültig zu entscheiden. Manche behindern (oder fressen) einander; andere arbeiten zusammen, um zu überleben; wieder andere befinden sich einfach zufällig am gleichen Ort. Gefüge sind offene Ansammlungen. Der Begriff gestattet es, nach gemeinschaftlichen Wirkungen zu fragen, ohne sie vorauszusetzen. Gefüge lassen uns möglichen Geschichtsprozessen beiwohnen. Mir geht es jedoch nicht nur um Organismen im Sinne von sich versammelnden Elementen. Vielmehr möchte ich begreifen, wie Lebensweisen – und nichtlebende Seinsweisen – zusammenkommen. Wie menschliche Seinsweisen wandeln sich auch nichtmenschliche Seinsweisen im Lauf der Geschichte. Was die Lebewesen anbelangt, ist die Artenidentität ein Anfang, aber sie reicht nicht aus: Seinsweisen sind emergente Effekte von Begegnungen. Das wird deutlich, wenn man über Menschen nachdenkt. Auf Pilzsuche zu gehen ist eine Lebensweise; es ist aber kein allen Menschen gemeinsames Charakteristikum. Das gilt auch für andere Arten. Kiefern finden Pilze, die ihnen helfen, menschengemachte offene Flächen in Beschlag zu nehmen. Gefüge versammeln nicht nur verschiedene Lebensweisen – sie bringen sie hervor. In Gefügen zu denken lässt uns fragen: Wie können Ansammlungen zu »Ereignissen« werden, das heißt, mehr werden als die Summe ihrer Teile? Wenn Geschichte ohne Fortschritt unbestimmt ist und in viele Richtungen geht, können uns dann Gefüge die ihr innewohnenden Möglichkeiten aufzeigen?
In Gefügen entwickeln sich Muster absichtsloser Koordination. Um solche Muster wahrnehmen zu können, muss man das Zusammenspiel zeitlicher Rhythmen und Größenordnungen in den sich ansammelnden, divergierenden Lebensweisen beobachten. Überraschenderweise zeigt sich damit eine Methode, die sowohl der politischen Ökonomie als auch der Umweltforschung neue Impulse zu geben vermag. Gefüge binden die politische Ökonomie in die Umweltforschung ein – und das nicht nur im Hinblick auf den Menschen. Großflächig angebaute Nutzpflanzen haben ein anderes Leben als ihre unkultivierten Geschwister; Zugpferde und Jagdrösser gehören der gleichen Art an, nicht aber der gleichen Lebensweise. Gefüge können sich nicht vor dem Kapital und dem Staat verbergen; sie sind Orte, an denen zu beobachten ist, wie politische Ökonomie funktioniert. Wenn der Kapitalismus keine Teleologie hat, müssen wir verstehen, was wie zusammenläuft – nicht nur als Vorgefertigtes, sondern auch im einfachen Nebeneinander.
Autoren gebrauchen den Begriff des Gefüges in verschiedenen Bedeutungen.9 Die Charakterisierung »polyfonisch« mag meine Variante erklären helfen. Mit Polyfonie wird Musik bezeichnet, in der selbstständige Melodien miteinander verwoben sind. In der westlichen Musik sind das Madrigal und die Fuge Beispiele für Polyfonie. Weil diese Formen durch eine Musik verdrängt wurden, in der ein einheitlicher Rhythmus und einförmige Melodien die Komposition zusammenhalten, wirken sie für viele moderne Hörer fremd und archaisch. In der klassischen Musik, die an die Stelle der barocken trat, war Einheitlichkeit das Ziel; das ist »Fortschritt« in genau der Bedeutung, wie ich sie erörtert habe: eine vereinheitlichende Koordination der Zeit. Im Rock ’n’ Roll des zwanzigsten Jahrhunderts erreichte diese Einheitlichkeit die Form eines starken Beats, der den Herzschlag des Hörers andeutet. Wir sind es gewohnt, Musik mit einer einzigen Perspektive zu hören. Als ich das erste Mal mit polyfoner Musik in Berührung kam, war das eine Höroffenbarung. Ich war gezwungen, verschiedene, simultan ablaufende Melodien voneinander zu unterscheiden und zugleich auf die harmonischen und dissonanten Momente zu achten, die aus ihrem Zusammenspiel hervorgingen. Genau diese Art der Wahrnehmung ist nötig, will man die verschiedenen zeitlichen Rhythmen und Trajektorien eines Gefüges würdigen.
Für musikalisch weniger Interessierte könnte es hilfreich sein, sich das polyfonische Gefüge am Beispiel des Ackerbaus vorzustellen. Seit den ersten Anpflanzungen zielte der kommerzielle Landbau darauf ab, eine bestimmte Feldfrucht zu vereinzeln und auf ihre zeitgleiche Reifung hinzuarbeiten, um eine koordinierte Ernte zu ermöglichen. Beim Wanderfeldbau, wie ich ihn im indonesischen Borneo studiert habe, wachsen viele Pflanzenarten zusammen auf einem Feld, und sie besitzen ziemlich unterschiedliche Bearbeitungs- und Erntezeiten. Reis, Bananen, Taro, Süßkartoffeln, Zuckerrohr, Palmen und Obstbäume stehen durcheinander. Die Bauern müssen auf die unterschiedlichen Reifezeiten der einzelnen Pflanzen achtgeben. In diesen Rhythmen äußert sich die Beziehung der Pflanzen zu den Ernten der Menschen. Wenn wir weitere Beziehungen hinzunehmen, zum Beispiel zu bestäubenden Insekten oder zu anderen Pflanzen, vervielfachen sich die Rhythmen. Das polyfone Gefüge besteht aus den versammelten Rhythmen, die aus welterzeugenden Bestrebungen resultieren, gleich ob menschlichen oder nichtmenschlichen Ursprungs.
Das polyfone Gefüge versetzt uns auch in das unerforschte Terrain der modernen politischen Ökonomie. Fabrikarbeit ist ein Beispiel koordinierter Fortschrittszeit. Doch die Lieferkette ist von polyfonen Rhythmen durchsetzt. Man halte sich etwa die von Nellie Chu untersuchte kleine chinesische Kleiderfabrik vor Augen. Wie ihre vielen Wettbewerber auch, war diese Teil mehrerer Lieferketten und wechselte ständig zwischen Aufträgen für einschlägige örtliche Boutiquen, Imitationen internationaler Marken und Standardproduktionen, die erst später einer Marke zugeschlagen wurden.10 Jeder dieser Aufträge erforderte unterschiedliche Fertigungsstandards, Materialien und Arbeitsschritte. Die Arbeit der Fabrik bestand darin, die industrielle Koordination den komplexen Rhythmen der Lieferketten anzupassen. Wenn wir die Fabrik verlassen und das Sammeln eines unkalkulierbaren wild wachsenden Produkts beobachten, vervielfachen sich die Rhythmen. Je weiter wir in die Randgebiete der kapitalistischen Produktion wandern, desto mehr wird die Koordination zwischen polyfonen Gefügen und industriellen Prozessen zur Voraussetzung für den Profit.
Wie die letzten Beispiele deutlich machen, ist es kein abgehobenes Bedürfnis, die Fortschrittsrhythmen zu verlassen, um polyfone Gefüge zu beobachten. Der Fortschritt war eine tolle Sache: Stets war noch etwas Besseres in Sicht. Fortschritt schenkte uns die »progressiven« politischen Anliegen, mit denen ich aufwuchs. Ich wüsste nicht, wie ich ohne die Idee des Fortschritts über Gerechtigkeit nachdenken sollte. Das Problem bestand darin, dass der Fortschritt keinen Sinn mehr zu machen schien. Immer mehr von uns schauten eines Tages auf und stellten fest, dass der Kaiser keine Kleider trägt. Das ist das Dilemma, das neue Wahrnehmungsinstrumente so wichtig macht.11 Das Leben auf der Erde steht tatsächlich auf dem Spiel. Kapitel 2 wendet sich den Dilemmas zu, die aus dem gemeinschaftlichen Überleben erwachsen.
DIE ZEIT BESCHWÖREN, YUNNAN
Der auf die Weste dieses Yi-Marktbesuchers aufgestickte Matsutake steht für Reichtum und Wohlergehen. Auf der Weste sind die (Yi-)Ethnizität und die (Pilz-)Art kodiert. So erschließen sich diese Größen einem Moment des Handelns in den veränderlichen Geschichten der Begegnung.
Kapitel 2
Kontamination als Kollaboration
Ich hätte mir jemanden gewünscht, der mir gesagt hätte, dass alles gut wird. Aber da war niemand.
— Mai Neng Moua, »Along the Way to Mekong«
Wie wird eine Ansammlung zum »Ereignis«, das heißt, größer als die Summe ihrer Teile? Eine Antwort ist: Kontamination, Verunreinigung. Wir sind durch unsere Begegnungen kontaminiert; sie ändern, was wir sind, indem wir anderen Platz einräumen. Aus der Tatsache, dass welterzeugende Bestrebungen durch Kontamination verändert werden, könnten gemeinsame Welten – und neue Richtungen – erwachsen.1 Jeder trägt eine Geschichte der Verunreinigung in sich; Reinheit ist keine Option. Mit der Prekarität zu rechnen lohnt sich insofern, als sie uns daran erinnert, dass sich den Umständen anzupassen das Überleben sichern kann.
Was aber ist Überleben? In den in Amerika verbreiteten Fantasien heißt überleben, sich selbst zu schützen, indem man die anderen bekämpft. Das »Überleben«, wie es in US-amerikanischen Fernsehserien oder auch Alien-Geschichten propagiert wird, ist ein Synonym für Eroberung und Expansion. Ich möchte den Ausdruck nicht auf diese Weise gebrauchen. Seien Sie bitte offen, wenn ich ihn abweichend verwende. Ich behaupte, dass es, um am Leben zu bleiben, lebensfähiger Formen des Zusammenwirkens, der Kollaboration bedarf – und zwar für jede Art. Kollaboration heißt, trotz der Unterschiede zusammenzuwirken, was letztlich zur Kontamination führt. Ohne Kollaboration sterben wir alle.
Die landläufigen Fantasien sind längst nicht das ganze Problem: Mit dem Überleben gemäß dem Motto »Einer gegen alle« haben sich auch Wissenschaftler abgegeben und sich das Überleben als Optimierung individueller Vorteile gedacht – ob »Individuen« nun Arten, Populationen, Organismen oder Gene sind, ob es sich um Menschen oder anderes handelt. Man schaue sich nur die für das zwanzigste Jahrhundert prägenden Zwillingswissenschaften an, die neoklassische Ökonomie und die Populationsgenetik. Beide Disziplinen gewannen Anfang des zwanzigsten Jahrhunderts an Macht mit Formeln, die kühn genug waren, das moderne Wissen umzukrempeln. Mit der Populationsgenetik kam es in der Biologie zur »modernen Synthese«, die die Evolutionstheorie und die Genetik miteinander verschmolz. Die neoklassische Theorie baute die Wirtschaftspolitik um und schuf die moderne Ökonomie nach ihren Vorstellungen. Zwar hatten die Experten der beiden Disziplinen wenig miteinander zu tun, doch beide Wissenschaftsbereiche arbeiteten an ähnlichen Rahmenbedingungen. In deren Zentrum steht jeweils der eigenständige individuelle Akteur, dem daran gelegen ist, seinen persönlichen Vorteil in Sachen Fortpflanzung oder Reichtum zu vergrößern. Richard Dawkins’ »egoistisches Gen« verdeutlicht diese Vorstellung, die sich auf alle möglichen Größenordnungen des Lebens anwenden lässt: Sie beschreibt die Fähigkeit der Gene (bzw. der Organismen oder Populationen), auf den eigenen Vorteil zu schauen, eine Fähigkeit, die die Evolution vorantreibt.2 Ähnlich besteht das Leben des Homo oeconomicus aus einer Reihe von Entscheidungen, die ihm zum eigenen Vorteil gereichen.
Die Idee der Eigenständigkeit verursachte eine Explosion neuer Erkenntnisse. In Begriffen der Eigenständigkeit und demnach des Eigeninteresses der Individuen (gleich welcher Größenordnung) zu denken, ermöglichte es, die Kontamination, das heißt, die Verwandlung durch Begegnung, außer Acht zu lassen. Individuen, die autark sind, werden durch Zusammenstöße mit anderen nicht verwandelt. Sie benutzen Begegnungen, um sich größere Vorteile zu verschaffen, erfahren dabei aber keine Veränderung. Um diese unwandelbaren Individuen im Auge zu behalten, braucht es keine Kunst der Wahrnehmung. Ein »Standard«-Individuum reicht als analytische Einheit aus; es steht für alle anderen. So wird es möglich, Erkenntnis allein durch Logik zu organisieren. Wenn es keine transformierenden Begegnungen gibt, kann die Mathematik an die Stelle der Naturgeschichte und der Ethnografie treten. Diese Vereinfachung war so fruchtbar und ließ die genannten Zwillingswissenschaften so machtvoll werden, dass die ersichtliche Falschheit der Ursprungsprämisse mehr und mehr in Vergessenheit geriet.3 Ökonomie und Ökologie wurden somit zu Bereichen, in denen die Algorithmen des Fortschritts im Sinne von Expansion zur Entfaltung kamen.
Anhand des Problems prekären Überlebens können wir sehen, was falsch läuft. Prekarität ist ein Zustand, in dem wir unsere Verletzlichkeit gegenüber anderen anerkennen. Um zu überleben, benötigen wir Hilfe, und Hilfe bedeutet immer, den Dienst eines anderen, ob gewollt oder nicht, zu beanspruchen. Wenn ich mir den Knöchel verstauche, kann ein kräftiger Stock beim Gehen helfen, ich mache ihn mir gewissermaßen dienstbar. Ich bin nun eine Begegnung in Bewegung, Frau-und-Stock. Ich kann mir kaum eine Herausforderung vorstellen, mit der ich konfrontiert sein könnte, ohne dabei auf die Hilfe anderer, Menschen oder Nichtmenschen, zurückzugreifen. Dass uns – wider alles bessere Wissen – die Fantasie vorgaukelt, jeder für sich und allein überleben zu können, ist nur Ausdruck eines uns nicht bewussten Privilegs.
Wenn das Überleben immer auch von anderen abhängt, ist es zwangsläufig der Unbestimmtheit von Veränderungen unterworfen, die zwischen dem »Selbst und den anderen« stattfinden. Wir verändern uns durch Kollaboration sowohl innerhalb unserer Art als auch zwischen den Arten. In solchen Transformationen und nicht in den Entscheidungsbäumen autarker Individuen ereignen sich die Dinge, die für das Leben auf der Erde entscheidend sind. Anstatt nur die Expansions- und Eroberungsstrategien unbeirrbarer Individuen zu betrachten, müssen wir nach Geschichten Ausschau halten, die sich durch Kontamination entwickeln. Wie also kann eine Ansammlung zu einem »Ereignis« werden?
Kollaboration ist Arbeit über Unterschiede hinweg. Dabei handelt es sich allerdings nicht um die unschuldige Diversität autarker Evolutionslinien. Die Evolution unseres »Selbst« ist bereits von Zusammenstößen verunreinigt, von den Geschichten unserer Begegnungen; wir sind immer schon mit anderen verquickt, bevor wir eine neue Kollaboration anfangen. Schlimmer noch, wir sind mit Projekten verquickt, die uns den meisten Schaden zufügen. Die Diversität, die uns überhaupt erst gestattet, Kollaborationen einzugehen, entsteht aus Geschichten von Auslöschung, Imperialismus und allem Übrigen. Erst Kontamination macht Diversität.
Dieser Umstand verändert unsere Sichtweise auf das Funktionieren von Namen, einschließlich solcher für Ethnien und Arten. Wenn Kategorien instabil sind, müssen wir beobachten, wie sie sich aus Begegnungen entwickeln. Kategorien Namen zu verleihen, sollte dazu verpflichten, den Gefügen, in denen diese Kategorien einen zeitweiligen Halt gewinnen, nachzugehen.4 Nur wenn dies festgestellt ist, kann ich zurückkehren und davon berichten, wie ich Angehörigen der Mien und Matsutake-Pilzen in einem Wald in den Kaskaden begegnet bin. Was bedeutet es, »Mien« oder auch »Wald« zu sein? Diese Identitäten, die aus dem Ruin und seinen Transformationskräften resultierten, drangen in unsere Begegnungen ein, auch wenn sie bereits durch neue Kollaborationen verändert waren.
In Oregon werden viele Wälder vom United States Forest Service verwaltet, dessen Ziel es ist, die Wälder als nationale Ressource zu erhalten. Doch der Erhaltungszustand der Landschaft wurde durch eine hundertjährige Geschichte des Holzeinschlags und der Unterdrückung von Waldbränden hoffnungslos durcheinandergebracht. Wälder werden durch Kontamination erschaffen und dabei transformiert. Deshalb ist neben der Beobachtung auch das Zählen erforderlich, will man eine Landschaft kennenlernen.
Als sich im frühen zwanzigsten Jahrhundert die US-Forstverwaltung formierte, spielten Oregons Wälder eine Schlüsselrolle. Damals arbeiteten Forstbeamte daran, eine Praxis des Waldschutzes zu finden, die auch die Holzbarone unterstützen würden.5 Der Brandschutz war dabei der größte gemeinsame Nenner: In dieser Hinsicht waren sich Holzfäller wie Forstleute einig. Unterdessen waren die Holzfäller darauf aus, die Ponderosa-Kiefern zu schlagen, von denen die weißen Pioniere in den östlichen Kaskaden so fasziniert waren. In den 1980ern dann waren die großen Ponderosa-Vorkommen gefällt. Dabei stellte sich heraus, dass sie sich ohne die periodischen Waldbrände, die die Forstverwaltung unterdrückt hatte, nicht fortpflanzen konnten. Fichten dagegen und schüttere Drehkiefern gediehen unter den Brandschutzmaßnahmen prächtig – zumindest, wenn man mit Gedeihen die Ausbreitung immer dichterer und leichter entflammbarer Dickichte aus lebenden, abgestorbenen und absterbenden Bäumen versteht.6 Mehrere Jahrzehnte lang bestand die Aufgabe der Forstverwaltung in dem Vorhaben, zum einen die Ponderosa-Kiefern wieder anzusiedeln und zum anderen die leicht entflammbaren Fichten- und Drehkiefern-Dickichte auszudünnen, zu roden oder anderweitig unter Kontrolle zu bringen. Ponderosa-Kiefern, Fichten und Drehkiefern, die sich aufgrund menschlicher Eingriffe entwickelten, sind seither Geschöpfe kontaminierter Diversität.
Überraschenderweise entstand in dieser verheerten Industrielandschaft ein neuer Wert: Matsutake. Matsutake reifen besonders gut unter ausgewachsenen Drehkiefern, und wegen der Brandbekämpfung gibt es in den östlichen Kaskaden Unmengen davon. Da die Ponderosa-Kiefern gefällt und die Waldbrände eingedämmt wurden, haben sich die Drehkiefern ausgebreitet, und obwohl sie leicht Feuer fangen, erreichen sie aufgrund des Brandschutzes ein relativ hohes Alter. Oregons Matsutake wachsen nur in Drehkiefernbeständen, die ein von Waldbränden ungestörtes, vierzig bis fünfzig Jahre währendes Wachstum hinter sich haben.7 Das reiche Matsutake-Vorkommen ist historisch gesehen eine noch junge Kreation: kontaminierte Diversität.
Und was machen Bergvölker aus Südostasien in Oregon? Als ich erst einmal begriffen hatte, dass sich in den Wäldern fast jeder aus explizit »ethnischen« Gründen aufhielt, wurde es für mich vordringlich, herauszufinden, was diese ethnische Zugehörigkeit bedeutete. Ich musste wissen, wodurch Gemeinschaften veranlasst wurden, die Pilzjagd auf ihre Agenda zu setzen. So folgte ich den Ethnien, die man mir nannte. Die Sammler müssen wie die Wälder nicht nur zahlenmäßig erfasst, sondern auch in ihrem Werdegang gewürdigt werden. Aber fast alle US-amerikanischen Untersuchungen zu südostasiatischen Flüchtlingen ignorieren die Besonderheiten der ethnischen Gruppierungen. Transformation durch Kollaboration, im Ergebnis schlimm oder nicht, ist die conditio humana.