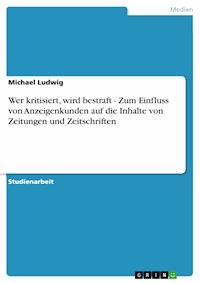36,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: GRIN Verlag
- Sprache: Deutsch
Magisterarbeit aus dem Jahr 2009 im Fachbereich Medien / Kommunikation - Printmedien, Presse, Note: 1,1, Technische Universität Dresden (Institut für Kommunikationswissenschaft), Sprache: Deutsch, Abstract: Umfang, Inhalt und Bewertung der Berichterstattung über den Deutschen Presserat und den Pressekodex stehen im Zentrum dieser Arbeit. Der Presserat übernimmt in Deutschland die Selbstkontrolle der Presse. Für eine wirkungsvolle Tätigkeit ist er auf die öffentliche Bekanntmachung seiner Arbeit angewiesen, die in erster Line durch die Presse selbst erfolgen muss. Untersucht wird die gesamte Berichterstattung in fünf überregionalen Tageszeitungen und vier Fachzeitschriften von 2003 bis 2007. Für die Aufbereitung des umfangreichen Untersuchungsmaterials wurde die Methode der „Simulierten Datenbankabfrage“ entwickelt. Nach quantitativ-inhaltsanalytischer Untersuchung von 708 Beiträgen bleibt festzustellen, dass eine kontinuierliche Berichterstattung über den Presserat und den Pressekodex vor allem in Fachzeitschriften erfolgt. Insgesamt erscheint der Presserat in der großen Mehrzahl der Beiträge in der Rolle des Kontrolleurs, der Missstände beheben und Beschwerden bearbeiten soll. Diskurse über die Presseselbstkontrolle selbst sind selten. Auffällig: Die Berichterstattung über den Presserat thematisiert ähnliche Problemstellen im Journalismus wie der Presserat in seiner Beschwerdearbeit erkennt – also die publizistische Unabhängigkeit, das Wahrheitsgebot und der Persönlichkeitsschutz. Der Grundton in der Berichterstattung ist eindeutig positiv, dennoch ist zum Teil eine deutlich vernehmbare Kritik an einzelnen Aspekten der Institution Presserat und des Pressekodex festzustellen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2010
Ähnliche
Page 1
Page 5
Der Presserat in der Presse iv
Abkürzungen
BDZV Bund Deutscher Zeitungsverleger DJU Deutsche Journalisten Union DJV Deutscher Journalisten Verband FAZ Frankfurter Allgemeine Zeitung FSF Freiwillige Selbstkontrolle Fernsehen FPS Verein zur Förderung der publizistischen Selbstkontrolle FR Frankfurter Rundschau GG Grundgesetz ICR Intercoder-Reliabilität MMM M - Menschen Machen Medien NCC National News Council nr Netzwerk Recherche PCC Press Complaints Commission PON Pressens Opinionsnämnd SZ Süddeutsche Zeitung taz Die Tageszeitung WAZ Westdeutsche Allgemeine Zeitung VDZ Verband Deutscher Zeitschriftenverleger
Page 6
Der Presserat in der Presse 1
Einleitung 1
„Es gehört zur Allgemeinbildung zu wissen, daß man sich gegen regelwidrige Berichterstattung der Printmedien beim Deutschen Presserat beschweren kann“ (Stürner, 1999: 105). Ob diese Feststellung des Juristen Stürner zutrifft, darf bezweifelt werden. Allerdings führt sie zum Thema dieser Arbeit, einer Untersuchung der Berichterstattung über den Deutschen Presserat. Zwar kann das Ergebnis keine Antworten zum Umfang der Allgemeinbildung liefern, doch klärt es in diesem speziellen Fall über eine notwendige Voraussetzung auf. Denn die Öffentlichkeit ist auf eine kontinuierliche Berichterstattung über den Presserat angewiesen, um Kenntnis von seiner Existenz, seiner Tätigkeit und der Beschwerdemöglichkeit zu erlangen. Eine solche Berichterstattung sollte auch im Interesse der Presse selbst sein. Denn der Deutsche Presserat ist die Standesorganisation der Presse und erfüllt zwei Aufgaben. Zum einen arbeitet er als Interessenvertretung und tritt Einschränkungen der Pressefreiheit entgegen. Zum anderen will er das Ansehen der Presse wahren und Missständen im Journalismus entgegenwirken. In dieser Funktion übernimmt er die Selbstkontrolle des Berufsstandes, die der Staat aufgrund der verfassungsrechtlich garantierten Presse- und Meinungsfreiheit nicht ausüben kann. Im Pressekodex hat der Presserat sechzehn Leitregeln für guten Journalismus formuliert, die eine berufsethische Idealvorstellung formen und bei Beschwerden über die Presse als Grundlage einer Verhandlung dienen. Eine Beschwerde über einen Missstand in der Presse kann jeder Bürger einreichen. Erkennt der Presserat eine Verletzung der Grundsätze, stehen ihm verschiedene Sanktionsformen zur Verfügung. Allen Sanktionen gemeinsam ist, dass sie nur auf einer moralisch-symbolischen Ebene wirken. Im Gegensatz zum Urteil eines Gerichts sind die Entscheidungen des Presserats nicht bindend. Vielmehr können die Sanktionen des Presserats ihre Kraft erst in der Öffentlichkeit entfalten, wenn sie zu einer „moralischen Empörung“ (Eisermann, 1997: 243) über den Verstoß führen.
Die Möglichkeit, Verstöße gegen die publizistischen Normen zu kennzeichnen und der Öffentlichkeit zu verkünden, gilt als zentrales Instrument des Presserats bei der Selbstkontrolle (Bermes, 1991: 297). Das setzt bei den Kontrollierten Akzeptanz auf zwei Ebenen voraus: Erstens müssen Sie bei einem Regelverstoß die Sanktion akzeptieren und im Falle einer Rüge auch publizieren. Zweitens müssen sie die Tätigkeit des Presserats publizistisch begleiten, denn erst durch die Berichterstattung über den Presserat und seine Spruchpraxis erschaffen sie die Legitimation, die eine Selbstkontrolleinrichtung braucht, um von den Beschäftigten als normgebend akzeptiert und von den Rezipienten als wirkungsvoll eingestuft zu werden.
Page 7
Der Presserat in der Presse 2
Denn das Bild des Journalisten in der Öffentlichkeit hängt entscheidend von der Beachtung des Standesrechts ab (Löffler & Ricker, 2005: 256f).
Die Gründe für eine Berichterstattung über den Presserat sind vielfältig: Anlass kann eine Rüge bieten, der ein Verstoß gegen den Pressekodex voraus ging. Die gerügte Publikation zeigt durch den Abdruck Einsicht, von der Rüge nicht betroffene Medien offenbaren damit ihre Unterstützung für die Presseselbstkontrolle und tragen zu einer öffentlichen Beachtung bei. Einem ähnlichen Zweck dient eine rügenunabhängige Berichterstattung, die zu einer fortlaufenden Anpassung von journalistischen Normen und gesellschaftlichen Erwartungen beitragen kann. Die Häufigkeit der Berichterstattung, ihre Themen und die Bewertung können als Indikator für die Akzeptanz des Presserats in der Presse gelten. In der wissenschaftlichen Literatur ist der Presserat seit vielen Jahren ein regelmäßiges Studienobjekt. Dabei ist eine große Anzahl von Arbeiten auffällig, die auf eine Verbesserung seiner Effektivität dringen und dafür praktische Vorschläge bieten.1Auch steht er im Zentrum verschiedener juristischer Studien aktuellen Datums, die einzelne Standesregeln des Pressekodex den geltenden rechtlichen Normen gegenüberstellen oder die Selbstkontrolle in einem internationalen Kontext vergleichen.2Ein grundsätzlicher Mangel war jedoch lange an empirischen Daten festzustellen. Wenn Autoren auf die geringe Relevanz des Presserats in der Branche hinwiesen, dann fehlte es dabei häufig an aussagekräftigen Forschungsergebnissen. Seit rund fünf Jahren untersucht die kommunikationswissenschaftliche Forschung diesen Bereich intensiver und kann erste interessante Ergebnisse vorweisen. Eine Möglichkeit, über die Relevanz der Selbstkontrollinstitution Auskunft zu geben, ist eine Befragung der Kontrollierten. Reinemann (2008) und Fischer (2006) interviewten Journalisten zu ihrer Meinung über den Presserat. Baerns und Feldschow (2004) befragten Chefredakteure zum Wissen über das Trennungsgebot und lieferten damit auch Erkenntnisse über das Ansehen des Presserats. Über die Kenntnisse der Öffentlichkeit zum Presserat liegen weitaus weniger Daten vor. Nur Kepplinger & Glaab (2007) untersuchten einen kleinen Ausschnitt, indem sie Personen, die beim Presserat eine Beschwerde eingereicht hatten, nach ihrer Motivation befragten. Sehr wenig Datenmaterial liegt bislang auch über die Berichterstattung in der Presse über den Deutschen Presserat und den Pressekodex vor. Zwar erfasst der Deutsche Presserat (2008b) in seiner jährlichen Statistik die Zahl der öffentlichen Rügen, das betrof-
1vgl. dazu insbesondere Brosda, Leif, Schicha & Haller (2004), Eisermann (1997), Pöttcker (2002, 2005), Reinemann
(2008) und Wiedemann (1992).
2 vgl. dazu insbesondere Dietrich (2002), Gottzmann (2005), Münch (2001), Schwetzler (2005), Soehring (1999), Suhr
(1998) und Wallenhorst (2007).
Page 8
Der Presserat in der Presse 3
fene Medium und die erfolgte Veröffentlichung. Es steht jedoch zu erwarten, dass dies nur einen Bruchteil der tatsächlichen Veröffentlichungen ausmacht.Ziele und Fragestellung 1.1
Diese Arbeit möchte die Berichterstattung über den Presserat untersuchen. Ausgehend von dem Gedanken, dass die Presseselbstkontrolle auf Publizität angewiesen ist und die Presse diese auch erbringt, kann eine Analyse der Berichterstattung über den Presserat Erkenntnisse auf zwei Ebenen erbringen: Erstens ermittelt die Untersuchung, welche In-formationen in welchem Umfang und mit welcher Bewertung die Öffentlichkeit erreichen. Zweitens können die Ergebnisse als Hinweis auf die Wertschätzung innerhalb der Profession über den Presserat gelten. Damit leistet die Untersuchung einen Beitrag zu der wissenschaftlichen, politischen und fachöffentlichen Diskussion über die Presseselbstkontrolle. Weiterhin erhält der Presserat eine systematische Analyse der Berichterstattung, die er zur Optimierung der eigenen Tätigkeit einsetzen kann.3
Aufgrund des bislang mangelhaften Wissens über die Berichterstattung wird eine thematisch breite Herangehensweise gewählt, bei der nicht Hypothesen den Forschungsablauf strukturieren, sondern Forschungsfragen das Erkenntnisinteresse leiten. Objekte der Untersuchung sind zum einen fünf überregionale Tageszeitungen. Diese Publikationen erfüllen eine meinungsbildende Funktion und besitzen einen guten Ruf bei der Berichterstattung über medienrelevante Themen. Zum anderen sind in der Untersuchung vier Medienfachzeitschriften vertreten, die primär ein journalistisches Publikum ansprechen und dabei auch die Tätigkeit des Presserats publizistisch begleiten. Forschungsleitend für die Untersuchung sind drei Fragen: Forschungsfrage 1:
In welchem Umfang berichten Fachzeitschriften und überregionale Tageszeitungen über den Presserat und den Pressekodex?
Damit die Öffentlichkeit den Presserat als Selbstkontrollorganisation wahrnehmen kann, ist die Berichterstattung über seine Tätigkeit erforderlich. Gegenstand dieser Frage ist daher, ob eine solche stattfindet, in welchem Umfang und mit welcher Konstanz sie erfolgt und ob Unterschiede zwischen den einzelnen Medien festzustellen sind.
3 Ich möchte an dieser Stelle dem Presserat für die großzügige Unterstützung bei der Untersuchung danken.
Page 9
Der Presserat in der Presse 4
Forschungsfrage 2:
Welche inhaltlichen Schwerpunkte sind bei der Berichterstattung über den Presserat und den Pressekodex in Fachzeitschriften und überregionalen Tageszeitungen zu erkennen?
Die Analyse des Inhalts der Berichterstattung zeigt, welche Aufgaben, Regeln und Entscheidungen des Presserats die Öffentlichkeit erreichen. Sie ermittelt weiterhin dominante Themenaspekte in der öffentlichen Diskussion über den Presserat. Von besonderem Interesse ist auch, inwieweit die Themenbereiche der Berichterstattung mit den Themenbereichen der Spruchpraxis des Presserats übereinstimmen.
Forschungsfrage 3:
Welcher Tenor und welche Bewertungen sind in der Berichterstattung über den Presserat und den Pressekodex in Fachzeitschriften und überregionalen Tageszeitungen zu erkennen?
Wertungen in der Berichterstattung können auf mehreren Ebenen entstehen. Erstens bezeichnet der Tenor den Grundton, der in einem Beitrag zu erkennen ist. Unabhängig davon kann zweitens eine positive oder negative Bewertung des Presserats oder des Pressekodex erfolgen, abhängig vom Kontext der Darstellung. Drittens nehmen Aussagen zu einzelnen Themenaspekten in der Regel eine Bewertung des jeweiligen Teilbereichs vor.
Aufbau der Arbeit 1.2
Die Arbeit ist in zwei Teile gegliedert. Der erste Teil führt in das Thema der Presseselbstkontrolle ein und diskutiert in drei Kapiteln die theoretischen Grundlagen sowie den Stand der wissenschaftlichen Forschung. Aus einer breiten Perspektive nähert sich das erste Kapitel dem Thema der Selbstkontrolle. Dabei stehen die rechtlichen Rahmenbedingungen und die Grundlagen des Standesrechts im Mittelpunkt, bevor eine Einordnung des Presserats in einen nationalen und internationalen Kontext erfolgt. Im zweiten Kapitel verengt sich der Blickwinkel und fokussiert auf den Deutschen Presserat und seinen Pressekodex. Die Grundlage für die spätere empirische Untersuchung bildet eine Darstellung der Aufgaben
Page 10
Der Presserat in der Presse 5
des Presserats und der Regeln des Pressekodex. Dazu zählt auch eine detaillierte Betrachtung des Beschwerdeverfahrens sowie eine Auswertung der Spruchpraxis der vergangenen Jahre. Im dritten Kapitel weitet sich die Perspektive wieder, um die Tätigkeit des Presserats in den gesellschaftlichen Kontext einzuordnen. Dabei werden die Möglichkeiten der Berichterstattung diskutiert und empirische Befunde zur Wahrnehmung des Presserats präsentiert. Eine Vorstellung der dominanten Themen aus der öffentlichen Debatte um die Presseselbstkontrolle runden das dritte Kapitel ab.
Der zweite, empirische Teil der Arbeit beginnt mit einer Vorstellung der ausgewählten Methode. Da das Material aus verschiedenen Quellen stammt, wurde die Methode der „simulierten Datenbankabfrage“ entwickelt. Die Erläuterungen zur Auswahl und Beschaffung der Untersuchungseinheiten fallen daher umfangreich aus. Erklärungen zur Entstehung und Überprüfung des Erhebungsinstruments runden die methodische Einführung ab. Die Ergebnisse der Untersuchung werden ausführlich dargelegt und im Fazit vor dem Hintergrund der theoretischen Überlegungen im ersten Teil eingeordnet. Damit liefert das abschließende Kapitel kompakte Antworten auf die drei Forschungsfragen.
Page 11
Der Presserat in der Presse 6
Presseregulierung in Deutschland 2
Wenn Helmut Kohl „Kloakenjournalismus“ diagnostiziert, Oskar Lafontaine vom „Schweinejournalismus“ spricht und Wolfgang Clement den „Kampagnenjournalismus“ rügt, dann schwingt neben der direkten Kritik die indirekte Forderung nach einer restriktiveren Pressekontrolle in Deutschland mit. Als Ministerpräsident des Saarlandes konnte Lafontaine mit der SPD-Mehrheit das Landespressegesetz ändern und ein strengeres Recht auf Gegendarstellung durchsetzen - und war über diese Änderung nicht unglücklich. Doch solche Möglichkeit der Einflussnahme haben nur wenige (Lex Lafontaine, 2000). Sie war auch nicht von langer Dauer, denn die nächste Regierung nahm die Regelung im März 2000 zurück. Ohnehin zweifelten Presserechtler an der Verfassungsmäßigkeit dieser „Lex Lafontaine“. Vorgaben an die Presse und ihrer Kontrolle unterliegen in Deutschland strengen Regeln. Diese basieren auf einer rechtlichen und einer moralischen Komponente. Rechtsnormen geben der Presse4aufgrund der grundgesetzlich garantierten Pressefreiheit nur ein Mindestmaß an Einschränkungen vor. Daneben existieren weitere Richtlinien, die auf allgemeinen Moralvorstellungen basieren und durch selbstauferlegte Regeln das Standesethos der Journalisten formen. Das daraus resultierende Standesrecht bildet das „strukturelle Gegenstück zur zugestandenen Autonomie“ (Saxer, 1984: 22) und ist „als freiwilliger Akt das Korrelat zur Freiheit [nach Art. 5 GG, Anm. d. Verf.]“ (Wilke, 1989: 184). Viele Berufe, die eine von der Gesellschaft nachgefragte Funktion erfüllen, haben solche geschriebenen und ungeschriebenen Vorgaben, denen allerdings keine Gesetzeskraft zueigen ist: Dem Arzt ist das Wohlergehen des Patienten das höchste Gut, dem Rechtsanwalt der optimale Prozessverlauf für seinen Mandanten (Pöttker, 2000: 376ff). Demnach stellen Standesregeln, aufgestellt und überwacht durch eine Organisation der Selbstkontrolle, eine natürliche Ergänzung des bestehenden Rechts dar, „weil sie nicht nur festlegen was „rechtens“ ist, sondern darüber hinaus ein berufsethisches Verhalten fordern, das dem Ansehen des Berufsstandes in der Öffentlichkeit und damit auch seinen beruflichen, wirtschaftlichen und sonstigen Interessen dient“ (Löffler, 2006: 1079).
Bevor im folgenden Herkunft und Bedeutung des Standesrechts erörtert werden, ist eine Schärfung des Begriffs nötig. Löffler (1971: 16ff) unterscheidet zwischen dem Standesrecht im weiteren und engeren Sinne. Das Standesrecht im weiteren Sinne umfasst sowohl die gesetzlichen Regelungen wie auch die Standesregeln. Dagegen bezeichnet das Standesrecht im engeren Sinn die Summe der geschriebenen und ungeschriebenen nicht-staatlichen Ver-
4Der Begriff Presse wird in dieser Arbeit als Sammelbegriff für Zeitungen und Zeitschriften verstanden. In Wortver-
bindungen wie der Pressefreiheit ist er in einem erweiterten Sinn für die Gesamtheit der Massenmedien zu verstehen.
Page 12
Der Presserat in der Presse 7
haltensregeln, die ein verantwortungsvoller Publizist einhalten sollte. Um eine präzise und trennscharfe Unterscheidung zu den gesetzlichen Vorgaben zu erhalten, wird das Standesrecht im weiteren Verlauf im engeren Begriffsverständnis verwendet.Presseregulierung aus rechtlicher Perspektive 2.1
Das deutsche Grundgesetz zählt die Pressefreiheit zu den Grundrechten.5Diese Einstufung basiert auf der Rolle der Presse für eine freie Gesellschaft. Die Presse ist eines ihrer herausragenden Merkmale und führt eine für den demokratischen Rechtsstaat konstituierende Rolle aus. In einer repräsentativen Demokratie schafft erst die Presse die notwendige Verbindung zwischen Volk und Regierung (Löffler & Ricker, 2005: 37ff).
Auf Grundlage von Artikel 5 GG besitzt die Presse eine privilegierte Stellung in Deutsch-land, aus der eine institutionelle Bestandsgarantie und ein Abwehrrecht gegenüber staatlichen Eingriffen entsteht. Die privilegierte Stellung kommt zustande, weil die Presse eine öffentliche Aufgabe wahrnimmt. Diese Aufgabe umfasst eine informierende und eine kontrollierende Funktion. In der informierenden Funktion vermittelt die Presse Informationen und Meinungen. Damit trägt sie entscheidend zum Prozess der öffentlichen Meinungsbildung bei. In der kontrollierenden Funktion überwacht und kritisiert die Presse staatliche Machtausübung und verhindert im Idealfall Machtmissbrauch. Da sie in dieser Rolle die drei konstitutionellen Gewalten Legislative, Exekutive und Judikative beobachtet, ist auch von der „Vierten Gewalt“6die Rede - wenngleich für diese Position keine demokratische Legitimierung erfolgt, wie sie bei den drei anderen Gewalten erforderlich ist (vgl. Löffler et al., 2005: 15ff; Wiedemann, 1992: 9ff).
Das Bundesverfassungsgericht präzisierte die Pressefreiheit als eine „dienende“ Freiheit. Die Freiheit soll die Informations- und Kritikfunktion der Presse ermöglichen, nicht jedoch die individuelle Verwirklichung einzelner Presseorgane legitimieren (Funiok, 2007: 15f). Denn neben der öffentlichen Aufgabe verfolgt die Presse dieselben Interessen wie jedes andere Wirtschaftsunternehmen: Profit. Auf dem Rezipientenmarkt erfüllt die Presse ihre öffentliche Aufgabe. Entscheidend dabei ist die publizistische Qualität mit Merkmalen wie Aktualität, sachlicher Richtigkeit, Meinungsvielfalt, Relevanz und kommunikativem Erfolg (Mast, 2004: 161). Auf dem Anzeigenmarkt dagegen ist die ökonomische Qualität entschei-
5„Jeder hat das Recht, seine Meinung in Wort, Schrift und Bild frei zu äußern und zu verbreiten und sich aus allge-
mein zugänglichen Quellen ungehindert zu unterrichten. Die Pressefreiheit und die Freiheit der Berichterstattung durch
Rundfunk und Film werden gewährleistet. Eine Zensur findet nicht statt.“ (Art. 5, Abs. 1 GG).
6 Zum Begriff der „Vierten Gewalt“ vgl. Altmeppen & Löffelholz (1998).
Page 13
Der Presserat in der Presse 8
dend. Gut ist dabei, was den individuellen Anforderungen des Nachfragers entspricht (Pieler, 2000: 349f). Da diese Interessen nicht zwangsläufig deckungsgleich sind, können Konflikte entstehen. Es ist dieser Dualismus von öffentlichen und privaten Interessen, der Weischenberg (2004: 171) von der „eingebauten Schizophrenie“ unseres Mediensystems sprechen lässt. Neben weiteren Bestimmungen in der Verfassung7nehmen noch andere Rechtsquellen Einfluss auf die Presse. Auf Bundesebene bestand bis 2006 die Möglichkeit einer Rahmengesetzgebung. Im Zuge der Föderalismusreform wurde die Zuständigkeit auf die Bundesländer übertragen (Der Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien, 2008a: 37f). Das Presserecht im engeren Sinne bilden die Landespressegesetze, die umfassende Regelungen zur Presseordnung, etwa das Recht auf Gegendarstellung, beinhalten. Zum Presserecht in einem weiteren Sinne gehören zudem Rechtsquellen des Bundes, denn die durch das Grundgesetz garantierte Pressefreiheit sieht Einschränkungen vor (Art. 5, Abs. 2 GG). Demnach bilden allgemeine Gesetze, gesetzliche Bestimmungen zum Schutze der Jugend und dem Recht der persönlichen Ehre Schranken für die Pressefreiheit. Die Pressefreiheit muss hinter anderen Regelungen zurücktreten, wenn das schutzwürdige Interesse von gleichwertigem oder höherem Rang ist und verletzt werden würde. Zu diesen schutzwürdigen Interessen zählen Individual- (z.B. Ehr-, Persönlichkeits- und Abbildungsschutz) sowie Gemeinschaftsinteressen (z.B. öffentliche Sicherheit, Frieden) (vgl. Branahl, 2006: 74ff).8Einer solchen Regel, die auf dem beständigen Abwägen verschiedener Rechtsnormen basiert, sind Konflikte immanent. Denn die Presse wird bei Erfüllung ihrer öffentlichen Aufgabe immer wieder mit berechtigten Interessen Dritter kollidieren, sei es bei der Beschaffung, Selektion oder Wiedergabe von Informationen. Allerdings stoßen die gesetzlichen Vorgaben für eine weiterreichende Regulierung der Presse an die Grenzen des Grundgesetzes und sind damit „verfassungsrechtlich gewollte Steuerungsdefizite“ (Calliess, 2002: 465). Denn eine zu starke rechtliche Reglementierung würde die Medien in der Ausübung ihrer öffentlichen Aufgabe behindern (Stapf, 2005: 16f). Der Staat muss versuchen, organisatorische Rahmenbedingungen zu schaffen, um die erwünschten Ziele zu ermöglichen (Branahl, 1992: 241). Eine Alternative zu einer staatlichen Regelung ist die Selbstregulierung. Sie kommt zum Einsatz, „wenn die Steuerungsaufgaben des Staates und das grundrechtlich gewollte [...] Steu-
7Dazu zählen Art. 18 (Möglichkeiten der Verwirkung der Pressefreiheit), Art. 19, Abs. 2 (Garantie des Wesensgehalts
der Pressefreiheit), Art. 75, Abs. 1 (Aufteilung der Gesetzgebungskompetenz beim Presserecht zwischen Bund und Län-
dern) und Art. 79, Abs. 3 (Sicherung der Pressefreiheit auch für den Fall einer Verfassungsänderung).
8 Die einzelnen Konfliktfelder sind Gegenstand mehrerer aktueller Arbeiten aus juristischer Perspektive. Besondere
Bedeutung kommt dabei dem Persönlichkeitsschutz zu, wie die Untersuchungen von Münch (2001), Schwetzler (2005)
und Wallenhorst (2007) zeigen.
Page 14
Der Presserat in der Presse 9
erungsdefizit in der Gesellschaft aufeinanderstoßen“ (Calliess, 2002: 465). In einem solchen Fall kann der Staat auf seinen Regulierungs- und Steuerungsanspruch verzichten und ihn an eine nichtstaatliche Institution delegieren. Es kommt zurSelbst-Regulierungbei Übereinstimmung von Kontrolleur und Kontrolliertem. Dieses Konzept kommt in Deutschland bei der Presse mit dem Presserat und in weiteren Medien- und Telekommunikationsbereichen zur Anwendung.
Die Selbstverwaltung ist weiterhin von der Selbstkontrolle abzugrenzen. Häufig werden beide Begriffe synonym verwendet. Dabei ist die Selbstkontrolle als ein Teilbereich der Selbstverwaltung zu verstehen. Die Abgrenzung erfolgt über die Funktionen, die eine staatsferne Regulierungsinstitution übernimmt. Roßnagel (2006: 299) weist der Selbstregulierung nur eine legislative Funktion zu, während die Selbstkontrolle zudem exekutive und judikative Aufgaben wahrnimmt. Selbstkontrolle bezeichnet demnach eine Selbstregulierung, die zudem präventiv und repressiv arbeitet (Suhr, 1998: 21). Eine griffige Definition liefert Puppis (2007: 60, Herv. im Org.), demzufolge Selbstkontrolle beschreibt, „dass anstelle des Staatesprivate Akteure Regeln für ihre Branche setzen, deren Einhaltung durchsetzen und Regelverstöße sanktionieren.“Wie noch zu zeigen sein wird, gehört der Presserat zur Gruppe der Selbstkon-trollorganisationen (vgl. Kap. 3.2). Dabei ist seine Tätigkeit konform zu der grundgesetzlich verbrieften Pressefreiheit (vgl. Scholz, 1981: 350).
In den letzten Jahren etablierte sich außerdem das Konzept der Co-Regulierung. Es beschreibt die gemeinsame Kontrolle gesellschaftlicher Bereiche durch den Staat und einen privaten Akteur (Schulz, 2006: 169f). Im Bereich des Redaktionsdatenschutzes praktiziert der Presserat die Co-Regulierung (vgl. Rosenhayn, 2003). Ein weiteres Beispiel ist die Freiwillige Selbstkontrolle Fernsehen (FSF), die durch Anerkennung im Jugendmedienstaatsvertrag von einer staatsfernen Institution der Selbstregulierung zu einem Organ der Co-Regulierung wurde (Kleinsteuber, 2006: 189).Presseregulierung aus moralischer Perspektive 2.2
Die Rechtspflichten stellen für die Presse eine Steuerungsressource von außen dar. Daneben gelten innere Steuerungsressourcen in Form von Standesregeln (Funiok, 2002: 31ff). Da die Landespressegesetze einen Standeszwang für die publizistisch Tätigen ausdrücklich ablehnen (Branahl, 2006: 71), besitzen die Standesregeln nur eine moralische Verbindlichkeit. Solche Regeln unterscheiden demnach nicht zwischen erlaubt und nicht erlaubt, sondern zwischen gut und schlecht. Da allerdings der Presserat als Organisation der Selbstkontrolle über die Einhaltung der Standesregeln wacht, sind sie weder Rechtsnorm noch ethisches Prinzip ohne
Page 15
Der Presserat in der Presse 10
Geltungsanspruch, sie sind vielmehr ein Teil unserer Sittenordnung und damit zwischen Recht und Moral verortet (Löffler, 1971: 16ff).
Die Standesregeln resultieren aus einem Widerspruch zwischen allgemeiner Moral und dem Berufsethos der Journalisten. Moral erhebt einen universellen Geltungsanspruch innerhalb einer Gesellschaft und gibt Verhaltensregeln vor. „In Form eines Katalogs materialer Norm- und Wertvorstellungen regelt sie die Bedürfnisbefriedigung einer menschlichen Gemeinschaft und bestimmt deren Pflichten“ (Prechtl & Burkard, 1999: 379). Demnach bezeichnet Moral die Gesamtheit an sittlichen Verhaltensregulativen, die Menschen in einer Gesellschaft als richtiges Handeln betrachten. Die wissenschaftliche Beschäftigung mit Moral ist die Ethik (Funiok, 2002: 38). Moralvorstellungen sind in der Regel abhängig von Kulturkreis und Epoche. In Deutschland ist die Gleichberechtigung von Mann und Frau gesellschaftlich akzeptiert und gesetzlich festgeschrieben. Ein Verstoß dagegen führt zu sozialer Ausgrenzung oder Ächtung und kann in einer rechtlichen Sanktion münden. Weder war das immer so, noch trifft das auf alle Kulturkreise in der heutigen Zeit zu. Was wir aus unserer moralischen Perspektive verurteilen, gilt in einem anderen Kulturkreis oder galt in einer anderen Epoche womöglich als moralisch richtig.
Das Berufsethos richtet sich nur an Mitglieder einer bestimmten Berufsgruppe. Im Gegensatz zur Moral erhebt es keinen universellen Geltungsanspruch innerhalb einer Gesellschaft. Vielmehr orientiert es sich an der speziellen Aufgabe der jeweiligen Berufsgruppe. Für den Journalismus lautet diese Aufgabe das Erzeugen von Öffentlichkeit. Drei Grundelemente des journalistischen Berufsethos hat Pöttker (1999: 220ff) wie folgt aufgeschlüsselt: Erstens Offenheit im Sinne von unvoreingenommener Recherche und wahrhaftiger Berichterstattung über die Ereignisse im gesellschaftlichen System. Zweitens die Grundpflicht zum Publizieren über alle Ereignisse, die für die Gesellschaft von Interesse sind. Drittens professionelle Qualitätskriterien, auf deren Basis eine Auswahl der zu vermittelnden Ereignisse erfolgen kann. Über das Berufsethos der Journalisten klären Studien auf, die das berufliche Selbstverständnis untersuchen (vgl. Weischenberg, Malik & Scholl, 2006). Zwischen Moral und Berufsethos können Widersprüche entstehen. Bekannte Konfliktbereiche im Spannungsfeld von Presse und Gesellschaft sind besonders die Persönlichkeitsrechte und die journalistischen Arbeitsmethoden. So gilt es in unserem Kulturkreis als un-moralisch, unter falscher Identität aufzutreten. Für den investigativen Journalismus ist das aber eine bekannte Rechercheform (Ludwig, 2007: 179ff). Es entsteht ein Konflikt zwischen dem journalistischen Berufsethos mit dem Grundelement des Publizierens und der allgemei-