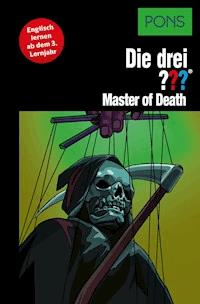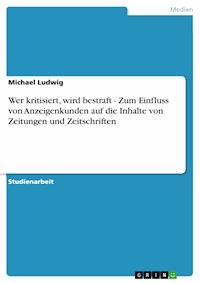
Wer kritisiert, wird bestraft - Zum Einfluss von Anzeigenkunden auf die Inhalte von Zeitungen und Zeitschriften E-Book
Michael Ludwig
0,00 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: GRIN Verlag
- Sprache: Deutsch
Studienarbeit aus dem Jahr 2006 im Fachbereich Medien / Kommunikation - Journalismus, Publizistik, Note: 1,0, Technische Universität Dresden (Institut für Kommunikationswissenschaft), Veranstaltung: International vergleichende Journalismusforschung, Sprache: Deutsch, Abstract: Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit dem Spannungsfeld zwischen Anzeigenkunden, Zeitungen und Zeitschriften sowie dem Leser. Sie zeigt die Verflechtungen zwischen Medien und Wirtschaft, die zu einer Aufweichung der journalistischen Ziele aus wirtschaftlichen Motiven führen können und immer wieder führen. Dazu sondiert zuerst eine Zusammenfassung der wirtschaftlichen Situation der Printmedien deren Marktlage. Daraufhin bereitet eine Betrachtung der Motive für eine Einflussnahme auf die Berichterstattung die Grundlage für die Erörterung der verschiedenen Einflussformen, die Anzeigenkunden bei Printmedien suchen und die ihnen einzelne Medien offerieren. Da der Medienmarkt ein besonderer ist – wie noch zu zeigen sein wird – unterliegt er speziellen Schutzmaßnahmen von verschiedenen Seiten. Diese Schranken und deren Effizienz sind Inhalt des letzten Kapitels.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2006
Ähnliche
Page 1
TU Dresden
Philosophische Fakultät
Institut für Kommunikationswissenschaft
Hauptseminar: International vergleichende Journalismusforschung
Michael Ludwig
HF Kommunikationswissenschaft (8)
NF Neuere und Neueste Geschichte (8)
NF Soziologie (4)
Page 3
1. Einleitung
„6 Flaschen Bier + 1 Tüte Erdnuß-Flips + 1 Deutschland-Fahne nur 99 Cent!“. Dieses WM-Highlight versprach am 7.6.2006 nicht die Beilage des lokalen Lebensmitteldiscounters, sondern der Aufmacher der „Bild“-Zeitung. Eine leicht bekleidete Fußballgöttin schwenkte dazu die Deutschlandfahne, zwanzig Zeilen Text und ein weiterer Artikel im Innenteil erläuterten den Weg zum Fan-Paket. Der führte in den nächsten Lidl-Supermarkt, wo es im Tausch gegen 99 Cent und die Coupon-Ecke aus der „Bild“ die Fanausstattung gab. Der Fußballfan dankt, der medienkritische Leser dagegen grübelt: Verdrängen Bier und Knabbereien politische und wirtschaftliche Themen von der Agenda. Sogar Problembär Bruno schaffte es an diesem Tage nicht auf den Titel des Boulevardblattes. Und fehlt dem Aufmacher nicht der Zusatz „Anzeige“, denn diese Kennzeichnung ist für schwer erkennbare werbliche Darstellungen vorgeschrieben, um Schleichwerbung zu verhindern. „Die Tageszeitung“ fragte am Folgetag Branchenexperten und erhielt unterschiedliche Antworten: Der Springer-Verlag sah seine Berichterstattung in Einklang mit geltendem Recht und eigenen Richtlinien. Der Geschäftsführer des Zen-tralverbandes der deutschen Werbewirtschaft (ZAW) dagegen erkannte in dem Titel ein Verkaufsangebot, das dem durchschnittlichen Leser nicht sofort ersichtlich ist. Der Vertreter des Bundesverbandes der Verbraucherzentralen stufte den Fall als unlautere Werbung ein (vgl. o.V. 2006). Der Fall landete beim Deutschen Presserat, der zwar zwei Tage später drei Pressemedien öffentlich wegen Schleichwerbung rügte, jedoch nicht die „Bild“ wegen deren Titelgeschichte (vgl. Presserat 2006a). Am 21.7.2006 berichtete die Presseabteilung des Springer-Verlags von der Einstellung des Verfahrens; der Presserat hatte die Aktion als eine zulässige Aktion des Eigenmarketings interpretiert (vgl. Springer 2006).
Der vorliegende Fall scheint damit geklärt, offen aber bleibt das Verhältnis von Anzeigenkunden und Pressemedien sowie der Einfluss der Werbenden auf die Inhalte. Eine wichtige Frage, denn der Käufer einer Zeitung oder Zeitschrift setzt vor allem eines voraus: Eine Berichterstattung, die keinesfalls ungenannt den Interessen Dritter Rechnung trägt, sondern sachgerecht erfolgt.1
1Sachgerecht meint in diesem Zusammenhang eine Information, die „den Lesern […] hilft, sich
in ihrer Umwelt zurechtzufinden, d.h. Ihnen die Möglichkeit gibt, sich sowohl in den eigenen An-gelegenheiten als auch in Fragen von allgemeiner Bedeutung auf rationale Weise eine eigene
Meinung zu bilden und die erforderlichen Entscheidungen auf einer rationalen Grundlage zu
treffen“ (Branahl 1997:71).