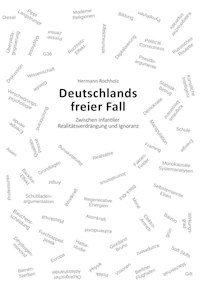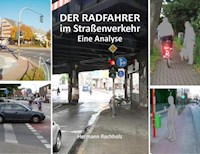
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: epubli
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
Ziel dieses Sachbuches ist zunächst die Analyse des Verkehrs-Systems, um mit den Ergebnissen ein möglichst reibungs- und unfallfreies Miteinander der Verkehrsteilnehmer zu gewährleisten. Es behandelt den Widerspruch des angeblich "sicheren Radfahrens" mit der Verkehrswegeführung und teilweise geltenden Regeln und Richtlinien. An Hand von drastischen Beispielen wird die Realität dargestellt. Die Analyse zeigt, dass in allen Bereichen (StVO, Rechtsprechung, Pressedarstellungen, ... ) Widersprüche vorhanden sind. Beim Schreiben des Buches musste der Autor sogar feststellen, dass Gesetze fehlerhaft sind bzw. in gewissen Situationen die Gefährdung der Radfahrer ignoriert. Wie der Ton in öffentlichen Diskussionen über dieses Thema meist zeigt, wird hauptsächlich durch eine mangelhafte Verkehrsführung bzw. die Berichterstattung die verschiedenen Verkehrsgruppen gegeneinander aufgewiegelt: Während die Presse die Sicherheit von Radwegen proklamiert und KFZ-Fahrer anhand dieser Berichterstattung (logischerweise) verlangen, dass Radwege benutzt werden müssen, sehen Radfahrer viele Radwege völlig anders, weil sie sich durch diese gefährdet fühlen. Diese Gefährdungen werden anhand von Beispielen dargelegt. Mann kann dieses Buch also als Handbuch darüber verstehen, wie man es nicht macht. Ampeln mitten auf Radwegen, Busfahrpläne nur vom Radweg aus abzulesen, für Autofahrer gültige Schilder, die vom Autofahrer nur im Rückspiegel(!) zu erkennen sind oder auch hundertfach gestellte Werbe- oder Wahlplakate auf Radwegen. Es gibt in dieser Beziehung nichts, was es nicht gibt.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 208
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Hermann Rochholz
Der Radfahrer im Straßenverkehr
Eine Analyse
epubli
1. Auflage 03/2021 (1 Auflage gedrucktes Buch 1/2019)
Texte und Einband:
© Dr.-Ing. Hermann Rochholz
Schöne Aussicht 8
35630 Ehringshausen
Textsatz: LaTeX/LibreOffice Writer
Skizzen: LibreOffice Draw
epub-Konverter: Calibre
Vorrede
Diverse tausend Kilometer mit dem Fahrrad innerhalb von Großstädten stellen die Grundlage für dieses Buch dar. Viele Kilometer auf Landstraßen kamen hinzu. Alles mögliche und für unmöglich Gehaltene passierte dabei. Meist auf Radwegen.
Gleichzeitig wird gebetsmühlenartig wiederholt, dass man unbedingt Radwege benutzen müsse, weil sie so sicher seien. Eigenartig: Hat mich doch mal ein Polizeiauto, weil diesem beim Wenden die Straßenbreite nicht ausreichte, in München fast von genau einem solchen gefegt.
Parallel dazu findet auf Internetforen ein Krieg zwischen Autofahrern, Fußgängern und Radfahrern statt. Die Emotionen, die einer neutralen Bewertung im Wege stehen, schlagen hoch. Öffentlich-rechtliche Sender gießen Öl ins Feuer, indem sie Dokumentationen mit dem Titel „Radler, Raser, Rambos“ ausstrahlen. Demonstrativ maßregelten in diesem Beitrag Polizisten eine Rentnerin, die mit Schrittgeschwindigkeit einen Zebrastreifen befuhr. Ob diese Rentnerin in das Schema „Raser“ oder „Rambo“ passen sollte, ließ der Redakteur offen. An entspanntes Radfahren war in den Wochen nach der Ausstrahlung allerdings nicht mehr zu denken: Sie artete in eine „Maßregelungsorgie“ mancher Autofahrer aus. Es wurde gehupt, gepöbelt und geschnitten.
Dabei werden Strafanzeigen von Radfahrern, gegen die Autos oder Busse nachgewiesener Weise ihr Blech einsetzten, meist „aufgrund mangelnden öffentlichen Interesses“ eingestellt bzw. nicht einmal von der Polizei aufgenommen, was nicht zur Deeskalation beiträgt.
Insbesondere, wenn Dinge passieren, die für unmöglich gehalten werden, sollte man nach Ursachen suchen. Dies ist Ziel dieses Buches: Es ist großenteils eine Ansammlung von Widersprüchen und somit auch Negativ-Beispielen: Ampeln, die mittig auf Radwegen stehen. Sie „glauben“ es nicht? Ein Blick auf den Einband genügt. Wenn eine Ampel in der Mitte einer Straße errichtet worden wäre, ginge Spott durch alle sozialen Netzwerke. Hier – keine Reaktion. Warum?
Man kann sogar zeigen, dass Gesetze in einigen Situationen zumindest fragwürdig sind: Es existieren Radwege-Schilder, deren Gültigkeit nur im Rückspiegel von Autos zu erkennen ist. Dass Autofahrer über solche Regelungen verärgert sind, kann man auch als Radfahrer nachvollziehen. Radfahrer haben diese Schilder aber nicht aufgestellt. Das waren Personen, die Auto fahren.
Auch sind linke Radwege nachts mit Blendung verbunden. Das Auffahren auf diese wird durch Schilder angeordnet, die oft nur links stehen und leicht abgedeckt werden können. Ob sie gültig sind – ich bin kein Jurist. Es wird offiziell eine rechtliche Grauzone aufrechterhalten.
Ob Radfahren hip, modern oder „angesagt“ ist, spielt keine Rolle. Die Zahl der Radfahrer wird zunehmen, denn die Energiekosten steigen und das Durchschnittseinkommen der Bevölkerung nimmt ab. Das Fahrrad ist auf Mittelstrecken das effizienteste Fahrzeug. Seit einigen Jahren etablieren sich deshalb auch Elektroräder immer mehr.
Dies ist kein Buch, in dem Autofahrer „gebasht“ werden sollen. Auch das Verhalten von Radfahrern wird kritisiert. Primär geht es darum, Systeme in Frage zu stellen, unter denen auch Autofahrer indirekt leiden. Dies haben sie aber offensichtlich nicht realisiert. Zumal es einfacher ist, Feindbilder aufrecht zu erhalten, als bestehende Systeme zu kritisieren.
Über dieses Buch
Ohne Bilder würde man einige Dinge nicht „glauben“. Aber mit Ausnahme des Fahrplan ablesenden Passanten (vgl. Einband) ist kein einziges Bild „gestellt“. Die Bildqualität einiger weniger Fotografien ist mäßig, was aber für den Inhalt irrelevant ist. Da das Material für dieses Buch von einer einzelnen Person über Jahre gesammelt wurde, kann nicht alles „neu“ sein. Aktuell ist es dennoch, denn Beispiele zeigen, dass die Verkehrssituation auf Radwegen eher schlimmer wird. Dabei handelt es sich um einen schleichenden Prozess.
Dies soll ein Sachbuch sein, das darstellt, dass es schwierig ist, sich als Radfahrer im Straßenverkehr zu bewegen. Ein Buch dieser Art schreibt man, da man sich engagiert, was mit Emotionen verbunden ist. Ich hoffe, dass es mir gelang, trotzdem alles neutral darzustellen.
Diesbezüglich danke ich auch meinen zwei Querlesern, davon insbesondere Michael Artmann für seine sehr wertvollen Hinweise und Kritiken.
Vorwort
Abb. 1.1: Radweg, bis 2003 benutzungspflichtig (Norderstedt)
Auf vielen Wegen in deutschen Großstädten mit dem Fahrrad erlebte ich eigenartige oder gefährliche Situationen. Dabei bewegte ich mich zügig, aber im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften (sofern dies möglich war). Diese Vorkommnisse bilden die Grundlage für eine Analyse dieser Situationen. Deshalb wird im Wesentlichen der Verkehr innerhalb geschlossener Ortschaften betrachtet, zumal dort Fahrräder am häufigsten eingesetzt werden.
Einem Nichtradfahrer die Schwierigkeiten eines Radfahrers klarzumachen ist schwierig. Beispielsweise nimmt ein Kfz-Fahrer (oder auch Fußgänger) von Blättern überdeckte Längsrillen nicht wahr. Ein erfahrener Radfahrer registriert sie: Insbesondere nasse Blätter haben eine Konsistenz ähnlich wie Schmierseife und es ist klar, dass dies für einspurige Verkehrsmittel eine Gefährdung darstellen kann. Fakten dieser Art werden exemplarisch dargestellt. Beispielsweise ist in ein bis zum Jahr 2003 benutzungspflichtiger Radweg dargestellt.
Die Benutzungspflicht (mehr dazu später) wurde zwar aufgehoben,1 aber die Ausweisung als Radweg war noch nie korrekt, was (denke ich) offensichtlich ist. Wie kann es sein, dass jemand diesen Radweg als „benutzungspflichtig“ deklariert, obwohl sofort zu erkennen ist, dass dieser viel zu schmal ist: Die Radwegbreite sollte 1,5 m sein, die reale Breite beträgt ca. 50 cm (der Faktor 3). Zudem weiß jeder, dass sich ein Fahrrad in Kurven legen muss und man als Radfahrer wahrscheinlich den hinteren schief stehenden Baum touchiert.
Vorgehensweise in diesem Buch
Zu Beginn werden die Grundlagen des Radfahrens im Verkehr dargelegt. Dazu werden die physikalischen Grundlagen erläutert. Um die Fakten verständlicher zu gestalten, werden Vergleiche mit Kraftfahrzeugen angestellt. In den meisten Fällen funktionieren diese relativ gut.
Diese Vergleiche sollen dazu beitragen, im Verkehr mehr Toleranz walten zu lassen. Manche Dinge können auf den ersten Blick kleinlich klingen. Aber schon das erste Bild zeigt, dass diese Grundlagen fehlen oder ignoriert werden. Auch der Einband dieses Buches gibt hierzu Hinweise. Die Intention dieses Buches ist es weiterhin, alle Aspekte der Bewegung auf einem Fahrrad zu erfassen.
Zusätzlich wird dargestellt, dass Dinge, die häufig als „irrelevant“ abgetan werden, mehr Auswirkungen haben können, als ein Nichtradfahrer denkt. Final zeigen diese „Nahezu-Belanglosigkeiten“, mit wie viel Kleinkram sich Radfahrer herumärgern und gefährden lassen müssen. Wobei das „Herumärgern“ auch darin bestehen kann, sich das Fahrrad beschädigen zu müssen.
Im Vergleich mit Kraftfahrzeugen (Kfz) werden Berechnungen durchgeführt. Damit wird evaluiert, welche Auswirkungen sie auf das System des Fahrradfahrers im Verkehr haben.
Zielgruppe
Zielgruppe dieses Buches sind:
Radfahrer, die auf Fallen hingewiesen werden und denen vielleicht Unannehmlichkeiten erspart werden.
Kfz-Fahrer, die hoffentlich erkennen, dass es Radfahrer manchmal nicht so einfach haben, wie sie glauben und Radwege in den meisten Fällen nicht der Weisheit letzter Schluss sind.
Die Presse, die durch teilweise inkompetente Berichterstattung Radfahrer und Kfz-Fahrer regelrecht gegeneinander aufhetzt.
Juristen, die bei dem einen oder anderen Sachverhalt feststellen, dass ihre Juristerei der Physik widerspricht. Was einer vernünftigen Rechtsprechung nicht förderlich sein kann.
Straßenplaner und Personen, die Baugenehmigungen erteilen. Diese werden hoffentlich dazu angehalten, Radfahrer in ihrer Planung und Ausführung zu berücksichtigen.
Polizisten. Auch bei der Exekutive scheinen bei einigen Individuen Tendenzen vorhanden zu sein, Verkehrsteilnehmer unterschiedlich zu behandeln.
Hinweis: In jeder Personengruppe, auch bei Radfahrern, existieren Individuen, die sich über geltende Regeln, Gesetze und Richtlinien hinwegsetzen. Dieses Buch soll keinen Freispruch einer Gruppe darstellen. Radfahrer dieser Art, die Kfz-Fahrer nerven, gefährden nämlich in anderen Situationen Radfahrer. Die Individuen sind meist identisch.
Der Kfz-Fahrer wird kritisch bemerken: „Da gibt es doch viele, die beispielsweise beim Abbiegen keine Handzeichen machen, was aber Vorschrift ist“. Fakt ist, dass bei Beachtung dieser Regel häufig ein Sturz einprogrammiert wäre: Denn insbesondere im Abbiege- bzw. Kreuzungsbereich ist der Fahrbahnbelag des Radweges oder die Verkehrsführung so uneben, dass Radfahrer beide Hände aus Selbstschutzgründen am Lenker lassen müssen.
Für die Instandhaltung von Radwegen wird als Letztes Geld ausgegeben. Zusätzlich ist der Aufbau (also die Lagen der Fahrbahn übereinander) von Radwegen billiger und deshalb einfacher als der von Straßen. Daraus resultiert, dass Fahrbahnschäden (bspw. Wurzeln) häufiger sind und früher auftreten. Durch Wurzeln beschädigte Straßen sind ist im Gegensatz dazu selten.
Auch die Presse verhält sich nicht neutral: Die Neueröffnung von Radwegen zieht bspw. in Lokalblättern meist ein Presseecho nach sich. Die Presse berichtet dabei, wie toll der neue Radweg sei. Dabei ist das „toll“ lediglich damit verbunden, dass der Radweg korrekt angelegt wurde. Bei einer Straße für Kfz ist dies eine Selbstverständlichkeit. Diese unvollständige Information des Lesers geschieht wahrscheinlich nicht vorsätzlich. Es zeigt sich hier jedoch, dass der Presse als Teil der Öffentlichkeit Fachwissen fehlt und dadurch eine neutrale, sachlich korrekte Berichterstattung nicht möglich ist. Da Städte und Gemeinden stolz darauf sind, geschätzt 25 % der Radwege korrekt anzulegen, wird dem Leser des Lokalblattes dies genau so vermittelt. Zudem eine Pressemitteilung „Fünfundzwanzig Prozent der Radwege in der Kommune XXX entsprechen mittlerweile den geltenden Regeln und Richtlinien“ der Karriere des Journalisten ein Ende bereiten würde.
1Nachdem juristische Mittel angedroht wurden
Rahmenbedingungen des Radfahrens
Zuerst wird gezeigt, in welchem Rahmen „Radfahren“ stattfindet.2 Ein Beispiel: Ein Fahrrad ist ein einspuriges Fahrzeug. Somit kann es im Stand oder bei schlechter Fahrbahn (Längsrillen, ...) umfallen. Ein Kfz ist zweispurig. Bei diesem ist ein Umfallen im Stand oder durch Längsrillen nicht möglich.
Viele Rahmenbedingungen sind offensichtlich. Sie werden aber bisweilen missachtet, nicht zur Kenntnis genommen oder ignoriert. Dies, da es besser in die persönliche Weltanschauung passt. Die ausführliche Thematisierung dieser „Kognitiven Dissonanz“ führt in diesem Buch zu weit. Sie besteht darin, dass man häufig nur das wahrnimmt, was man wahrnehmen will.
Geschwindigkeit
Eine Geschwindigkeitsanzeige im Kfz ist vorgeschrieben („Tacho“). Aus rechtlichen Gründen muss dieser eine zu hohe Geschwindigkeit anzeigen. Bis etwa 110 km/h beträgt diese Differenz etwa 4-5 km/h. Ein separates GPS gibt genauere Auskunft. Ein GPS ist exakt und ein gut kalibrierter Fahrradtacho nahezu exakt. Bei diesem wird über den Radumfang und über die Umdrehungsgeschwindigkeit der Räder die Geschwindigkeit ermittelt.
Bei Berechnungen, in der die Geschwindigkeit vorkommt, (vgl. Kapitel ) muss man als Einheit m/s verwenden. Diese kann man errechnen, indem man den Wert in km/h durch 3,6 dividiert.
Fahrräder
Beim Fahrrad handelt es sich um ein bodengebundenes Fahrzeug, das durch einen Radfahrer bewegt wird.
Fahrräder lassen sich grob in folgende Typen einteilen:
Stadträder, die relativ solide gebaut und mit einer kompletten Dynamo-Lichtanlage und Schutzblechen ausgestattet sind. Mittlerweile ist ein Großteil wieder gefedert, nachdem Federungen über 50 Jahre fast völlig verschwunden waren. Häufig sind sie billig (Diebstahlgefahr) und sind somit häufig defekt. Dies leider oft an Licht- und Bremsanlage.
Rennräder, meist licht- und schutzblechlos, leicht und verhältnismäßig empfindlich, besonders, was die Bereifung betrifft. Sie können durchaus mit 40 km/h bewegt werden. Aufgrund der schlechten Verkehrswege sind sie nur selten im Stadtverkehr anzutreffen.
Mountainbikesoder deren Derivate, meist auch licht- und schutzblechlos, im Gewicht zwischen Renn- und Stadtrad und am solidesten. Mittlerweile sind fast alle gefedert. Weiterhin haben viele mittlerweile Scheibenbremsen.
Liegeräder, z.T. mit Verkleidung. Hier gibt es die unterschiedlichsten Konzepte. Auf Geschwindigkeit getrimmt können sie schneller als Rennräder werden.3 Sie sind selten im Stadtverkehr anzutreffen.
Elektrorädersetzen sich immer mehr durch. Zulassungsfreie Elektroräder erhalten bis zu 25 km/h elektrische Antriebsunterstützung. Leider wird häufig die Bremsanlage nicht auf das erhöhte Gewicht angepasst.
Sondertypen, die man nicht zuordnen kann. Hierunter zählen beispielsweise Tandems, Dreiräder, Lastenräder (die momentan in Verbindung mit Elektroantrieb einen Boom erleben), verschiedene oft individuelle Behindertenräder und so weiter.
Juristisch existieren verschiedene Auffassungen, was Fahrradfahren eigentlich bedeutet, wie zum Beispiel, ob das Treten notwendig ist.
Einsatzbereich
Das Fahrrad ist im Normalgebrauch ein Kurz- bis Mittelstreckenfahrzeug, mit dem vor allem Strecken von 1 bis 6 Kilometer zurückgelegt werden. Daher liegt das Haupteinsatzgebiet von Fahrrädern im städtischen Bereich. Dort sind Fahrräder ein sehr effizientes Verkehrsmittel, da sie von allen Fortbewegungsmitteln am wenigsten Energie pro Strecke benötigen und ihr Rollwiderstand am geringsten ist. Der Transport größerer Lasten gelingt am besten mit Lastenrädern.
Dadurch, dass innerstädtisch mit Fahrrädern die meisten Strecken zurückgelegt werden, treten dort die meisten Kontaktpunkte und Konflikte zwischen ihnen und anderen Verkehrsteilnehmern auf.
Abmessungen
Ein Fahrrad ist ein einspuriges Fahrzeug. Die Lenkerbreite beträgt im Allgemeinen zwischen 45 und 60 Zentimetern. Die Höhe eines Fahrrades mit Fahrer beträgt in etwa 1,60 m, abhängig von der Sitzposition. Der Schwerpunkt liegt bei einer Körpergröße von 1,80 m in einer Höhe von etwa 1,20 m, der Radstand (d.h. der Abstand von Vorderradzu Hinterradachse) beträgt 1,0 bis 1,15 m. Die Länge eines Fahrrades beträgt 1,70 bis 1,85 m.
Die Breite von Kindertransportanhängern beträgt ca. 70 cm (einsitzig) bis ca. 93 cm (zweisitzig). Hier taucht der erste Widerspruch auf, denn der in gezeigte ehemalige Radweg kann bei der Breite von 50 Zentimetern nicht mit Radanhänger benutzt werden.
Lenkung und Kurven
Ein Fahrrad wird durch Schwerpunktverlagerung gelenkt. Um eine Rechtskurve zu fahren, muss der Schwerpunkt rechts vom Fahrrad zu liegen kommen. Um dies zu erreichen, ist zunächst eine Lenkbewegung nach links notwendig. Erst dann kann die Kurve durchfahren werden. Daraus resultiert, dass Richtungswechsel mit einem Fahrrad langsamer als mit einem Kfz zu bewerkstelligen sind, denn bei diesem genügt ein Lenkradausschlag nach rechts, um eine Kurve nach rechts zu fahren.
Ein Fahrrad fährt immer leichte Schlangenlinien im Zentimeterbereich. Sie sind systemimmanent und lassen sich nicht verhindern.4 Dabei werden die Schlangenlinien umso größer, je langsamer die Geschwindigkeit wird. Dies, da schnell drehende Räder durch die Kreiselkräfte das Fahrrad stabilisieren. Das heißt, dass bergauffahrende Fahrräder mehr Platz benötigen als bergabfahrende. Und Räder mit schweren Laufrädern besser geradeaus fahren als mit leichten Laufrädern.
Deshalb sind bei der Berechnung der benötigten Breite für einen Verkehrsweg einige Zentimeter zu addieren.
Wird ein geradeaus fahrendes Fahrrad seitlich touchiert, so kommt der Schwerpunkt ohne den „Gegenlenkausschlag“ seitlich zu liegen. Dadurch liegt das Fahrrad vom Zeitpunkt der Berührung automatisch in einer Kurve.
Beim Durchfahren der Kurve liegt das Fahrrad schräg und benötigt mehr Platz als beim Geradeaus-Fahren. Das Hinterrad läuft in einem etwas kleineren Kurvenradius als das Vorderrad. Bei zu starker Schräglage bzw. bei zu wenig Haftung der Reifen auf dem Untergrund „fliegt man aus der Kurve“. Das bedeutet, dass zunächst das Vorderrad die Bodenhaftung verliert und das Fahrrad dann auf die Seite fällt.
Unebenheiten quer zur Fortbewegungsrichtung
Unebenheiten quer zur Fahrtrichtung sind für den Fahrkomfort von ausschlaggebender Bedeutung. Der Radstand eines Fahrrades beträgt etwa 1,10 m und der Schwerpunkt liegt etwa in einer Höhe von 1,2 m. Durch den geringeren Radstand wird der Radfahrer durch Unebenheiten deshalb mehr durchgeschüttelt als der Autofahrer, da der Schwerpunkt mehr ausgelenkt wird.
Historische Fahrräder waren wegen schlechter Fahrbahnen oft gefedert. Federungen verschwanden mit besseren Straßen und luftgefüllten Reifen. Mittlerweile sind wieder mehr gefederte Fahrräder unterwegs.
Längsrillen und schräge Kanten
Rillen parallel zur Fahrtrichtung gefährden Zweiradfahrer. Das kennt jeder Radfahrer, der schon einmal in Straßenbahnschienen stecken blieb. Liegen Längskanten zusätzlich in Kurven, ist dies deutlich gefährlicher.5
Motorräder werden bisweilen auf Autobahnen vor „Längsrillen“ gewarnt und meist ist dort eine Geschwindigkeitsbegrenzung eingeführt.
Wahrnehmung des Verkehrszustandes
Ein Verkehrsteilnehmer muss angemessen auf Verkehrssituationen reagieren. Dies geschieht mit seinen Sinnen. Hier ist das Gehör, aber hauptsächlich die optische Wahrnehmung zu nennen.
Abb. 2.1: Abstand des vordersten Teil des Fahrrades zum Auge
Beide Wahrnehmungen sind quasi unmittelbar, d.h. verzögerungslos. Im Kopf müssen die Wahrnehmungen noch umgesetzt werden, um auf spezielle Situationen zu reagieren. Die Wahrnehmung ist weder durch einen geräuschdämmenden Käfig noch durch die Streben, in die Scheiben montiert sind, eingeschränkt.
Bereifung
Reifen vermitteln den Kontakt zwischen Fahrzeug und Fahrbahn. Blockiert ein Rad, ist die Haftung zwischen Fahrzeug und Fahrbahn nicht ausreichend. Weiterhin federn Reifen Fahrbahnunebenheiten ab.
Reifendimensionen
Ein Kennwert einer Fahrradbereifung ist die Reifenbreite bzw. der Reifenquerschnitt. Die Breite und die Höhe der Bereifung liegen im Mittelwert bei Stadträdern bei etwa 1 1/2 Zoll, was ca. 40 mm entspricht.
Ultraschmale Rennrad-Bereifungen mit einer Breite von unter 20 mm sind in der heutigen Zeit „out“. Vor 30 Jahren versprach man sich von diesen eine Verringerung des Rollwiderstandes.6 Reifen von Mountainbikes haben i. Allg. eine Breite von 2 Zoll, was 50 mm entspricht.
Die Dimensionen sind in zweierlei Hinsicht von Interesse:
Reifenprofil
Eine häufig erörterte Fragen bei Fahrrädern ist, wie wichtig das Profil ist. Bei unverschmutztem Straßenbelag erweist es sich als sinnvoll, den Automobilrennsport zum Vergleich zu nehmen: Bei diesem werden möglichst profillose Reifen („Slicks“) benutzt, sofern es nicht nass ist. Für Feuchtigkeit gibt es „Intermediates“ mit wenig Profil und erst bei Regen werden Regenreifen verwendet. Profillose Reifen sind für einen perfekten Straßenbelag ohne Verschmutzung die beste Wahl.
Um Aquaplaning, also das Aufschwimmen auf Wasser, zu begegnen, werden profilierte Reifen verwendet. Dies kann aber bei Fahrrädern prinzipiell nicht auftreten.
Auf einer idealen Straße ist somit ein Reifenprofil eigentlich irrelevant.
Ein dickerer Gummi erhöht die Lebensdauer, aber auch den Rollwiderstand. Profilierte Reifen mit Mittelsteg können lästig sein, da der Mittelsteg durch in Fahrtrichtung laufende Rillen geführt wird. Der Radfahrer „eiert“ herum, insbesondere, wenn die Reifen mit hohem Druck gefahren werden. Bei verschmutzter Straße, Schnee und im Gelände erweist sich eine Profilierung der Bereifung natürlich als notwendig.
Seitliche Erkennbarkeit des Fahrrades
Es sind Reifen oder Felgen mit reflektierenden Seitenwänden erhältlich. Dies ist an Stelle von Seitenreflektoren, die in die Speichen geklemmt werden und leicht kaputt gehen, zulässig und sinnvoll. Auch reflektierende Speichensticks sind mittlerweile erlaubt.
Bremsen
Bei jedem Fahrzeug sind zwei voneinander unabhängige Bremsen vorgeschrieben (vgl. auch Kapitel ), um bei Ausfall einer Bremse eine Bremsung zu ermöglichen. Bei Bremsen muss man die „Dosierbarkeit“ erwähnen, die bei Seilzug betätigten Bremsen im Allgemeinen schlechter als bei hydraulischen Bremsen ist, die an Stelle des Bremszuges eine Bremsflüssigkeit verwenden. Der Anhalteweg bei einer Bremsung setzt sich, genau wie beim Kfz, aus Reaktions- und Bremsweg zusammen.
Minimaler Bremsweg
Noch vor 30 Jahren waren Fahrradbremsen verhältnismäßig schlecht. Dies hat sich durch die Einführung der Mountainbikes, die gute Bremsen benötigen, verbessert.
Bei einer sehr starken Bremsung kann das Vorderrad blockieren, wodurch entweder das Vorderrad durchrutscht oder ein Überschlag des Radfahrers stattfindet.
Abb. 2.2: Begrenzung der Verzögerung durch Überschlaggefahr.
Bei Fahrrädern findet im normalen Fahrbetrieb ein Überschlag statt. Die erreichbare Bremswirkung ist umso geringer, je steiler die in undeingezeichnete Linie steht.
Ist das Hinterrad angehoben, ist die Hinterradbremse wirkungslos. Eine Verringerung des Bremsweges ist beim Fahrrad möglich, indem
das Gewicht vor der Bremsung nach hinten verlagert wird (vgl. ) und den Winkel der Linie ändert. Dies erfordert allerdings einiges an Übung und ist konstruktionsbedingt nicht bei jedem Fahrrad möglich. Analog dazu ist bei Tandems und niedrigen Liegerädern eine höhere Bremskraft möglich, da bei diesen die Räder weiter auseinander liegen und der Schwerpunkt tiefer bzw. weiter hinten liegt.
Abb. 2.3: Reduktion der Überschlaggefahr beim Bremsen.
Bei glatter oder glitschiger Straße kann das Vorderrad aber durchrutschen, da die Haftung zwischen Reifen und Straße niedriger ist.
Felgenbremsen stellen von der Funktionsweise her Scheibenbremsen dar. Leider sind sie nässeempfindlicher als Scheibenbremsen.
Bremsweg bei Nässe
In der Autofahrstunde lernt man, dass sich der Bremsweg bei Nässe verlängert, da die Haftung zwischen Reifen und Fahrbahn verringert ist. Bei Felgenbremsen wird die Haftung zwischen Gummi und Felge geringer und so erhöht sich auch beim Fahrrad der Bremsweg.
Bei Scheibenbremsen erhöht sich der Bremsweg normalerweise bei Nässe gegenüber trockener Straße nicht, da deren Bremskraft relativ feuchtigkeitsunabhängig ist und das Limit der Bremsleistung der Überschlag ist und nicht die Haftung zwischen Reifen und Fahrbahn.
Beleuchtung
Die Zulassung der Beleuchtungsanlage für den deutschen Straßenverkehr wird durch das Zeichen „K∼“ auf Front- und Rückscheinwerfer angezeigt. Der Scheinwerfer muss so eingestellt sein, dass entgegenkommende Fahrer (Auto und Fahrrad) nicht geblendet werden.
Früher war beim Fahrrad der vordere Scheinwerfer eines Fahrrades mit einer Glühbirne von 2,4 Watt Leistungsaufnahme ausgestattet. Außerdem war die Benutzung von Dynamos vorgeschrieben. Die Beleuchtung war schlecht und die Birnen brannten häufig durch. Die neue Akku- und LED-Technik hat diesen Zustand deutlich verbessert. LED-Beleuchtungen benötigen so wenig Strom, dass Batterien bzw. Akkus sinnvoll werden und nicht permanent leer sind. Dazu benötigen sie eine Batteriestandsanzeige. Weiterhin sind LEDs nicht gegen Erschütterungen anfällig und sorgen für eine gleichmäßige Ausleuchtung.
Dass LEDs „so gut wie keinen Strom“ benötigen entspricht nicht den Tatsachen. Vielfahrer sollten darauf achten, dass die Batterien oder Akkus nicht zu klein geraten bzw. die Akkus rechtzeitig aufladen.
Fahrtrichtungsanzeiger
Bei einem Fahrrad wird eine beabsichtigte Fahrtrichtungsänderung über
„Handzeichen“ angezeigt. Der Nachteil ist, dass man eine Hand vom Lenker nehmen muss, was die Verkehrssicherheit beeinträchtigen kann. Dies trifft dann zu, wenn der Verkehrsweg vor dem Abbiegevorgang uneben ist oder der Radfahrer vor dem Abbiegen Kurven fahren muss. In diesen Fällen lassen sich Handzeichen als Fahrtrichtungsanzeiger nicht empfehlen, sofern man sich nicht selbst gefährden will.
Geräusch
Ein Radfahrer ist wie ein Fußgänger geräuschmäßig ungeschützt. Um sich bemerkbar zu machen, ist eine Fahrradklingel vorgeschrieben. Laute Laufradklingeln sind verboten.
Für schwerere Fahrzeuge sind niedrigere Frequenzen („tiefer Ton“) vorgeschrieben, während für kleinere Fahrzeug höhere Frequenzen („hoher Ton“) vorgeschrieben sind. Als Einheit des Lärms wird „Dezibel“ verwendet (dB). Dieses Maß ist logarithmisch aufgetragen. Eine Erhöhung um 3 dB entspricht einer Verdoppelung der Lautstärke. Also sind 76 dB 4 mal so laut wie 70 dB.
In der Literatur wird für die „Schmerzschwelle“ des Gehörs ein Wert von 120 dB bis 140 dB angegeben. Der Wert schwankt, da Lärm, wie jede andere Empfindung, subjektiv ist. Einen Hinweis darauf, dass zu viel Lautstärke weh tun kann, geben kleine Kinder, die anfangen zu weinen oder sich die Ohren zuzuhalten, wenn etwas zu viel Lärm macht.
Automobile geben ihr Geräusch relativ gleichmäßig ab, d.h. beim Herannahen werden sie lauter und dann wieder leiser. Motorräder haben eine andere Geräuschcharakteristik, da die Abrollgeräusche der Reifen geringer ausfallen. Sie geben die Laustärke vornehmlich nach hinten ab. Somit kann man sich auf diese schlechter einstellen, da sie häufig erst dann laut werden, wenn sie an einem Radfahrer vorbeigefahren sind. Dies ist auf Landstraßen für Radfahrer unangenehm.
Radfahrer selbst bewegen sich leise, womit sie häufig nicht akustisch wahrgenommen werden (können). Fußgänger erschrecken häufig, wenn sie von diesen überholt werden. Deshalb ist es bisweilen sinnvoll, wenn man sich in einigen Metern Abstand rechtzeitig vor dem Passieren von Fußgängern bemerkbar macht.
Kfz-Fahrer sitzen in einer abgeschlossenen, geräuschdämmenden Kapsel. Motorradfahrer tragen einen geräuschdämmenden Helm.
Der Umweltaspekt
Obwohl in diesem Buch der Schwerpunkt nicht auf der Umwelt liegt, sollte erwähnt werden, dass Fahrräder weitgehend schadstofffrei sind, wenn man von den Schadstoffen bei Herstellung, Schmierung und Entsorgung absieht. Sie haben wenig Parkplatzprobleme (man benötigt wenig Zeit, um einen Parkplatz zu finden) und außerdem sind sie de facto lärmfrei. Ein Fakt, der sie bei Fußgängern unbeliebt macht, da diese oft erst im letzten Moment Radfahrer wahrnehmen.
Kraftfahrzeuge
In den folgenden Kapiteln werden die Eigenschaften von Kraftfahrzeugen aufgezeigt. Dies, um einen Vergleich auch für Nichtradfahrer möglich zu machen.
Abmessung
In Abbildung ist die Seitenansicht eines Fahrzeuges der „Golf-Klasse“ dargestellt. Die Länge dieser Karosserie eines Mittelklassewagens beträgt etwa 4.40 m, die Breite etwa 1,70 m plus Spiegel, also etwa 1,80 m. Ein Automobil besitzt einen Radstand von ca. 3 m. Die Höhe des Schwerpunktes liegt deutlich tiefer als 1 m. Bei einem Meter Höhe liegt ungefähr die Unterkante der Seitenfenster.
Abb. 2.4: Ungefähre Abmessungen eines Kfz der Golf-Klasse
Wahrnehmung des Verkehrszustandes
Der Augpunkt des Fahrers liegt etwa in der Mitte des Fahrzeuges ca. 2 m von der vorderen Stoßstange entfernt. Dieser ist in Abbildung mit einem schwarzen Dreieck markiert. Der Abstand zwischen dem vordersten Punkt des Fahrzeuges und den Augen des Fahrers ist durch die Motorhaube größer als bei Fahrrädern.
Kurven
Ein Kfz neigt sich in einer Kurve nach außen. Die Hinterräder fahren in einem kleineren Radius als die Vorderräder.
Auswirkungen von Unebenheiten und Kanten
Ein Kfz ist gefedert. Mit einem Radstand von etwa 3 m und einem niedrigeren Schwerpunkt als ein Fahrrad „nicken“ sie weniger. Auch hier gilt, dass ein größerer Radstand einen besseren Fahrkomfort bietet.
Profilierung der Bereifung
Ein ausreichendes Profil ist wegen der Aquaplaninggefahr, die ab etwa 80 km/h auftritt, vorgeschrieben.
Bei Aquaplaning schwimmt der Reifen auf dem Wasser auf, eine Kontrolle des Fahrzeuges wird unmöglich. Bei Nässe erhöht sich bei Kfz der Bremsweg, da durch Wasser die Haftung zwischen Straße und Reifen verringert wird.
Beleuchtung
Bei Kfz sind Halogenlampen zur Fahrbahnbeleuchtung noch üblich. Diese nehmen pro Stück etwa 55 Watt Leistung auf und haben laut Norm knapp 1100 Lumen Lichtleistung. Insgesamt stehen also 110 Watt und fast 2200 Lumen zur Straßenbeleuchtung zur Verfügung.
Mittlerweile sind Kfz-Rücklichter und Bremslichter mit Leuchtdioden ausgestattet. LED-Lampen haben bei Bremslichtern den Vorteil, dass sie eine Zehntelsekunde schneller „zünden“. Dies erscheint gering, für den Hintermann bringt sie aber beispielsweise bei 100 km/h (28 m/s) einen Bremswegvorteil von fast 3 m(!). Außerdem gehen Dioden fast nie kaputt, was einen weiteren Sicherheitsvorteil bringt.7
Anhalteweg
Der Anhalteweg setzt sich aus Reaktions- und Bremsweg zusammen. Beim Bremsen wird das Gewicht auf das Vorderrad verlagert. Bei Vollbr
Abb. 2.5: Keine Limitierung des Kfz-Bremsweges durch Überschlaggefahr.
emsungen blockieren beim Kfz die Reifen. Bei den meisten Autos ist ein ABS (AntiBlockierSystem) eingebaut, das ein Blockieren der Räder verhindert und das Kfz während der Bremsung lenkbar hält. Die
Linie in zeigt einen im Vergleich zum Fahrrad deutlich flacheren Winkel zur Straße. Hier kann kein Überschlag stattfinden, sofern die Haftkräfte nicht mehrfach so hoch wie die Gewichtskraft ist.8