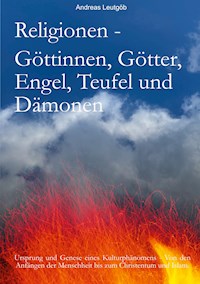Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Immanuel Kant gilt als „der“ Philosoph im deutschen Sprachraum schlechthin. Seine Impulse zum Völkerbund, die Gedanken zum Weltbürgertum sowie sein Anstoß zu den Menschenrechten werden als Meilensteine einer humaneren Gesellschaft betrachtet. Weniger beachtet werden seine naturphilosophischen und anthropologischen Schriften. Seine Entwürfe zur Rassentheorie, die im angloamerikanischen Raum schon längere Zeit zu Kontroversen führen, beginnen nun auch im deutschen Sprachraum rezipiert zu werden. Kant ist der Erfinder eines wissenschaftlichen Rassenbegriffs, dessen Konzept der unveränderlichen, hierarchisch gegliederten Rassen, der Blutsmischung entspringt und in der Hautfarbe ihren Ausdruck findet. Wie und ob sich diese Theorien mit Kants Moralphilosophie, und seiner politischen Philosophie vereinbaren lassen, soll diese Arbeit zeigen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 214
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
DANK
EINLEITUNG
IMMANUEL KANTS LEBEN UND WERK
1.1. Kants Leben
1.2. Kants Werke
1.2.1 Die philosophischen Hauptwerke Kants
1.2.2 Kants naturphilosophische Werke
1.2.3 Kants Rezeption der anthropologischen Schriften
KANTS WIDERSPRUCH ZWISCHEN MORAL, RECHT UND ANTHROPOLOGIE?
2.1. Kants praktische Philosophie
2.2. Kants politische Philosophie
2.3. Kants anthropologische Gesinnung
2.4. Kant als Erfinder der Rasse?
KANTS THEORIE DER RASSE
3.1. Frühe anthropologische Überlegungen
3.2. Die Temperamentenlehre
3.3. Hintergründe zur Rassentheorie
3.4. Zentrale Themen der Rassentheorie
3.4.1 Gründe für die Entstehung der Rasse
3.5. Der Streit um den Rassenbegriff und ihre Protagonisten
3.5.1 Johann Friedrich Blumenbach
3.5.2 Johann Daniel Metzger
3.5.3 Georg Forster
3.6 Der teleologische Hintergrund der Rassentheorie
3.6.1 Teleologie in Bezug zur Rasse und Varietät
3.6.2 Physische Geografie und Anthropologie als Bestimmungsgrund des menschlichen Schicksals
DEUTUNGEN DER KANTISCHEN RASSENTHEORIE
4.1. Menschenrechte und Staat
4.2. Kants vorkritische Phase als Entschuldigung?
4.3. Bernasconi’s Konsistenzprobleme von Moral und Rasse
4.4. Racial Liberalism von Charles Mills
4.5. Kleingeld’s Kosmopolitismus und die Aufhebung der Rassenunterschiede
4.6. Larrimore’s Schicksal des Menschen
JUDEN, ZEITGEIST UND DIE FOLGEN
5.1. Kants Antijudaismus und Antisemitismus
5.2. Kant ein Opfer des Zeitgeistes?
5.3. Kants Folgen der Rasse für die Neuzeit
SCHLUSS
AUSBLICK ZUR LÖSUNG DER VERNUNFTPROBLEMATIK
ANHANG
Literaturverzeichnis
Siglen Immanuel Kant
Andere Autoren
Abstract
DANK
Besonders bedanken möchte ich mich bei meiner Frau, die es mir ermöglichte das Studium der Philosophie im fortgeschrittenen Alter zu ermöglichen. Ihre Geduld, ihr Verständnis, ihr wacher, scharfsinniger Geist und vor allem ihre Liebe waren mir ein Quell der Inspiration und der Motivation auch in schwierigen Zeiten weiterzumachen.
Auch meine Studienfreude, Gerhard Marcus BA und Anton Kitzmüller BA, möchte ich erwähnen, da sie es immer wieder verstanden, mich so anzuspornen, um noch tiefer in die Materie einzutauchen. Auch ihre Freundschaft, beschert mir noch heute anregende und schöne Stunden.
Univ. Prof. Dr. Kurt Zeidler und Univ. Prof. Dr. Gerhard Gotz gilt mein Dank, weil sie mir die Lehren Immanuel Kants intensiv und verständlich aufbereiteten, um sie weiterzugeben. Einen speziellen Dank verdient Univ. Prof. i. R. Dr. Alfred Pfabigan, der mich bei der vorliegenden Master-Arbeit unterstützte und auch den Mut förderte, bei Wiederständen zu diesem Thema, nicht aufzugeben und darüberhinaus, nach Fertigstellung des Manuskripts, mir empfahl sie zu veröffentlichen. Außerdem verstand er es immer wieder, neue Betrachtungsweisen in mir zu wecken, um nicht einseitig, polemisch oder tendenziös zu werden.
Einleitung
Immanuel Kant gilt als einer der wichtigsten Philosophen der Neuzeit, der vor allem mit seiner Erkenntnistheorie und der damit einhergehenden Zerschlagung der Metaphysik, im 18. Jahrhundert, für Furore sorgte. Seine Theorie war neuzeitlich, modern und außergewöhnlich ausgefeilt. Die Theorie der Urteilskraft wurde und wird immer noch vielbeachtet, weil sie eine Ästhetik formulierte, die so noch nicht gedacht wurde. Seine Moralphilosophie galt lange als herausragend, obwohl er die Metaphysik durch die Hintertür wieder einführte. Ihre Schlussfolgerungen beeinflussten, nach deutschen Philosophen, das Grundgesetz Deutschlands und die UNO-Charta.
Aber Kant war tatsächlich vielmehr ein Philosoph, der sich immer der Naturmetaphysik verbunden fühlte, die durch einen Intellectus Archetypus und dem Reich der Zwecke verbürgt waren. Seine Moralphilosophie, ebenso seine politische Philosophie, sollte die Menschheit zur Vollkommenheit führen, die aus seiner Sicht in der Abwehr der Neigungen und der Favorisierung der Vernunft lag. Dabei unterlag Kant selbst einer der größten Begierden; nämlich der Triebfeder des Wissens. Sie trieb ihn an, in alle Bereiche der Erkenntnis vorzustoßen und auch Wege zu beschreiten, die nicht empirisch gesichert waren, sondern durch Hörensagen und Vermutungen überliefert wurden. Dies trifft im Besonderen für Kants anthropologische Schriften zu, die uns einen Philosophen präsentieren, der uns außerordentlich verstört. Wir dürfen aber nicht den Fehler machen, aus unserer heutigen Perspektive zu urteilen, denn das Wissen zu jener Zeit war noch sehr unvollständig und auch allen anderen Denkern unterliefen Fehlschlüsse, aufgrund mangelnder empirischer Daten. So war zu jener Zeit der Großteil der Naturforscher der Meinung, dass es unterschiedliche Rassen gab, die sich intellektuell und moralisch unterschieden. Dies war jedoch keine Erscheinung, die nur das 18. Jahrhundert betraf, sondern wurde durch die Renaissance vorbereitet, welche das antike Schönheitsideal überhöhte und im Anschluss daran, sich die Meinung durchsetzte, dass man das Innere des Menschen durch das Äußere erkennen könne.
Kant wird besonders im deutschen Sprachraum, vor allem mit der Moralphilosophie, Erkenntnistheorie und der Ästhetik in Verbindung gebracht. Diese Schriften werden ausführlich rezipiert, wogegen Kants anthropologische Schriften unterschlagen werden. Werden Sie erwähnt, so stuft man diese bestenfalls als unwichtig und strukturierend ein oder behauptet, sie würden keinen Einfluss auf seine Moralphilosophie haben. Dies macht es notwendig, auf eine Vielzahl von Sekundärliteraturen zurückzugreifen, die sich dieser Kantrezeption, aus guten Gründen, entgegenstellt. Aber selbst diese Literatur ist nicht einheitlich, da die Aussagen Kants dermaßen stark von seinen moral- und rechtsphilosophischen Ansichten abweichen, dass dadurch eine einheitliche Interpretation kaum möglich scheint. Entweder hat Kant bewusst farbige Menschen als Unterpersonen diskreditiert und seine Moralphilosophie ist nur gedacht für die weiße Bevölkerung Nordeuropas oder er plappert nur unreflektiert Vorurteile seiner Zeit nach. Diese Einschätzung ist allerdings gegen den philosophischen Mainstream gerichtet und daher ist es unumgänglich, Kants entwürdigende Aussagen zu zitieren und die Hintergründe aus vielerlei Blickwinkeln zu betrachten.
Am Beginn der Arbeit werde ich mich mit Kant, seinem Leben und seinen wichtigsten Werken nur insoweit beschäftigen, als sie zur gesamten Arbeit erhellend beitragen, bzw. auch um dem Phänomen Kant Rechnung zu tragen.
Der zweite Teil beschäftigt sich mit Kants scheinbar antagonistischer Einstellung, die sich aus seiner praktischen, politischen und anthropologischen Gesinnung ergibt. Außerdem zeigt sich, dass Kant der Erste war, der eine wissenschaftliche Rassentheorie vortrug, obwohl das im deutschen Sprachraum gerne unterschlagen oder sogar zurückgewiesen wird, gestützt auf die Aussagen von Philosophen, Kulturanthropologen und Pädagogen.
Der zentrale Teil dieser Arbeit beschäftigt sich mit den insgesamt sechs Schriften, die Kant verfertigte zum Thema der Rasse. Er las von 1755/56 bis 1797 die Vorlesungen mit Namen „Physische Geographie“, die er 1772 aufteilt in einen geographischen und anthropologischen Teil. Kant geht von einer Stammrasse aus, die nicht mehr existiert und von der die weiße Rasse, von brünetter Farbe, die Vorzüglichste ist. Im Anschluss daran, die Reihenfolge ändert sich, schlossen sich die Amerikaner (amerikanische Ureinwohner) mit ihrer kupferroten Farbe an, gefolgt von den Schwarzen und zuletzt die mit ihrer olivgelben Farbe. Die Unterscheidung der Rasse wird durch die Hautfarbe, das Temperament und die Körperflüssigkeiten angezeigt, hervorgebracht durch die Keime, ausgebildet aufgrund der Fürsorge der Natur, wonach die Farbe zur schnellen Unterscheidung dient. Die drei Merkmale äußern sich sowohl intellektuell als auch moralisch, wobei der Charakter durch die Hautfarbe sofort erkennbar ist. Kant greift bei manchen Erklärungen auch auf antike Vorstellungen zurück, wie die Temperamentenlehre, die aus der Elementarlehre der Vorsokratiker entspringt. In welch starkem wissenschaftlichen Kontext, seine Abhandlungen eingebettet sind zeigen auch die Kontroversen und Briefwechsel, die Kant mit einigen berühmten Protagonisten seiner Zeit führt.
Die Theorie der Rasse darf aber nicht losgelöst betrachtet werden, sondern sie ist vor dem Hintergrund seines teleologischen Verständnisses zu betrachten. Die verschiedenen Rassen dienen letztlich dazu, die Menschheit insgesamt zu vervollkommnen, dass dabei die zukünftige Menschheit nur von weißer Hautfarbe ist, erscheint aus heutiger Sicht weniger ansprechend.
Der vierte Teil dieser Arbeit ist den Deutungen der Rassentheorie gewidmet, die fast ausnahmslos von einer teleologischen Ausrichtung ausgehen. Aber auch hier gibt es unterschiedliche Lösungsansätze, in denen einerseits, die Moralphilosophie mit der Anthropologie als unvereinbar erscheint und andererseits, sie durchaus als kohärent einzustufen ist.
Hauptsächlich werden hier Philosophen des angelsächsischen Raumes zu Wort kommen, da vor allem hier Kritik an Kant laut wird. Aber auch im deutschen Sprachraum mehren sich die Stimmen, die Anstoß nehmen, Kant als Säulenheiligen zu betrachten. Nicht beschäftigt habe ich mich mit Autoren, die es ablehnen, die Theorie der Rasse als unwichtig einzustufen, da die Aussagen Kants, zur Teleologie, eindeutig eine andere Sichtweise darlegen. Würde man nämlich Kants naturmetaphysische Ansprüche ernst nehmen, so ergibt sich durchaus ein kohärentes Bild, das sich zu einem Ganzen fügen wird.
Das letzte Kapitel beschäftigt sich noch kurz mit einigen offenen Fragen, die aufgrund der eingeschränkten Platzverhältnisse dieser Arbeit, hier zu kurz kamen. Das Problem des Judentums und die Ablehnung durch Kant, die auch bei Kant nicht rassisch begründet wird und das Problem der Deutung, ob Kant nun ein Rassist war oder nicht.
Ausdrücklich distanzieren möchte ich mich von jeglicher Polemik, die in dieser Schrift, manchmal aus Gründen der Zitationsgenauigkeit, auftritt. Es geht mir darum, die Stimmen der Protagonisten, so genau als möglich, wiederzugeben, um auch auf das gefährliche Potential, das in Kants Werken schlummert, hinzuweisen. Der Begriff der Vernunft ist bei ihm nämlich zweideutig: Einerseits wird er als a priorische Bedingung der menschlichen Natur gedeutet, andererseits ist er die Voraussetzung menschlicher Moralfähigkeit. Das Problem ist, und das zieht sich durch die gesamte Anthropologie Kants und damit dieser Schrift, den farbigen Rassen fehlt es an Vernunft, wobei ich mich hier ausdrücklich gegen Kant stelle. Eine Auflösung dieses Konfliktes ist jedoch nicht in Sicht.
Kenner der Materie Kants, die sich nur für den Rassismus-Vorwurf interessieren, können ruhigen Gewissens das erste Kapitel übergehen, da es sich hier um grundsätzliche Daten zu Kants Leben und seinen Werken handelt.
1. Immanuel Kants Leben und Werk
Immanuel Kant richtet sein Leben auf die Wissenschaft aus, in der er Großes vollbringen will. Heinrich Heine verführt das zur polemischen Aussage: „ … Er hatte weder Leben noch Geschichte.“1 Abseits des Strebens nach Wissen gibt es tatsächlich kaum interessante Wegpunkte in Kants Leben. Da es sich hier nicht um eine Biografie handelt, werden nur die prägnantesten Aspekte von Kants Leben beleuchtet.
1.1. Kants Leben
Immanuel Kant wird am 22. April 1724 in Königsberg, als Viertes von elf Kindern geboren, und verstirbt ebenso dort am 12. Februar 1804 mit den letzten Worten „Es ist gut“2. Sein Vater ist Riemermeister und nicht Sattlermeister wie Ernst Borowski noch überliefert. Vermutlich kommt es zur Fehlüberlieferung, weil Cant, die Vorfahren stammen aus Schottland, in der Sattlergasse wohnt. Seine Mutter tauft den Jungen auf Emanuel, aus dem Immanuel (hebr.: mit uns ist Gott) abgeleitet wird. Die Gründe für die Namensabänderung sind unbekannt. Der Name ist auch ein Zeichen für die besonders fromme Familienauffassung der Eltern, die pietistischen Kreisen zugehören. „Der Vater forderte Arbeit und Ehrlichkeit, besonders Vermeidung jeder Lüge; - die Mutter auch noch die Heiligkeit dazu.“3 Immanuel Kant verwendet das „K“ in seinem Namen früh und wird sowohl zu Hause als auch in der Schule pietistisch erzogen. Die Verhältnisse in denen der junge Immanuel aufwächst sind bescheiden, wenn nicht gar ärmlich.
Die Verbindung zu den Eltern ist respektvoll, wobei er die Mutter besonders liebt, die er bereits im Alter von 13 Jahren verliert, den Vater begräbt er mit 22; zu seinen Geschwistern hat er ein eher distanziertes Verhältnis. Mit einer seiner Schwestern spricht er 25 Jahre lang nichts, obwohl sie am gleichen Ort wohnt und dennoch unterstützt er auch seine Familie finanziell, so gut es ihm als Bediensteten des Reichs möglich ist.4 Er selbst bleibt unverheiratet.
Kant beginnt 1732 seine Ausbildung am Fridericianum, einer pietistische Gelehrtenschule, die vor allem von Religionsstunden und Gottesdiensten dominiert wird und offensichtlich dazu beiträgt, dass er die kirchlichen Institutionen abzulehnen beginnt. 1740 immatrikuliert er an der Universität in Königsberg. Kant fühlt sich besonders von Prof. M. Knutzen intellektuell angezogen, von dem er das vorkritische, naturphilosophische und metaphysische Programm übernimmt.5
Nach seiner Promovierung und Habilitierung 1755 arbeitet Kant als erfolgreicher Privatdozent und anerkannter philosophischer Autor, bis er 1765 die Stelle als Subbibliothekar erhält, mit 62 Talern Jahresgehalt. 1770 spricht man Kant das Ordinariat für Logik und Metaphysik zu, indes er zuvor Rufe von Jena und Erlangen, 1769, ablehnt. Er liest vor allem neben seiner Berufung naturwissenschaftliche Fächer, Mathematik, Ethik, Pädagogik, Naturrecht und Theologie. Besonders erfolgreich sind seine Vorlesungen über „Physische Geographie" und „Anthropologie", die er ab 1755/56 hält, unter anderem auch, weil er unterhaltsam vorzutragen vermag. Dies mag auch daran liegen, dass er selbst ein großes Interesse an dieser Thematik hat, wie Jachmann überliefert: „Am meisten aber studierte er die Schriften, welche uns mit der Erde und ihren Bewohnern bekannt machen, und es ist gewiß keine Reisebeschreibung vorhanden, welche Kant nicht gelesen und in sein Gedächtnis aufgefaßt haben sollte.“6 So sehr Kant also die Reiseliteratur liebt, so wenig findet er selbst daran Gefallen, zu verreisen. Nach Angaben des Biografen Jachmann hat er Königsberg nie verlassen, obwohl das nicht ganz gesichert ist. Jachmann beurteilt das nicht als Mangel, da er meint, Kant hätte hier Menschen aus allen Ständen und in den verschiedensten Lebenssituationen kennengelernt. Zu bemerken ist jedoch, dass Königsberg als zweitgrößte Stadt Preußens, geografisch etwas abseits der Weltpolitik liegt und zur Zeit Kants 55.000 Einwohner umfasst. Zwar ist sie Regierungssitz und eine bedeutende Handelsstadt, aber die Hauptstadt Berlin wird während dieser Zeit von ca. 150.000 Menschen bewohnt. Königsberg wird von drei Bevölkerungsschichten gekennzeichnet: das bevorzugte Militär, freies Bürgertum, aufgeteilt in Großbürgertum und Handwerkerzünften und die hohe Beamtenschaft, die aus Gelehrten, Verlegern und lutherischen Theologen bestand.7
Da Kant sein Leben der Wissenschaft verschreibt, ordnet er dieses dem Streben nach Erkenntnis unter. Aber es gibt ein Ideal außerhalb seiner Forschungen, welches ihm wichtig ist; das der Freundschaft. Wenn es auch nicht erreichbar ist, so sollte ein Maximum der guten Gesinnung erzielt werden (MS 06, 469). Der innigste Freund ist der englische Kaufmann Green, den Kant bei einem Spaziergang im „Dänhofschen Garten“ kennenlernt. Als dieser 1786 verstirbt, verzichtet Kant auf Abendgesellschaften und gemeinsame Abendessen bis zu seinem Tod. Er steht um 5 Uhr auf, arbeitet bis zu den Vorlesungen, die um 7 oder 8 Uhr beginnen, und um 13 Uhr begibt er sich zum Mittagstisch mit einigen Freunden, darunter sich Bankdirektoren, Schriftsteller, Ärzte, Juristen, Theologen und Handelsleute befinden. Er ist hochgeschätzt, weil er ein „ … warmer, herzlicher, teilnehmender Freund …“8 ist. Nach dem Essen steht ein Spaziergang von einer Stunde an. Im Anschluss arbeitet er bis 10 Uhr abends, worauf er zu Bett geht. So verläuft fast jeder Tag Kants.
Kants Schaffenskraft beginnt, ab Mitte der 1780er Jahre, abzunehmen. Schon von Geburt an ist Kant schwächlich und er neigt auch zeitlebens zur Hypochondrie und Melancholie. Sein elegischer Zustand wird aber heute der weltlichen Unordnung des 18. Jahrhunderts zugeschrieben.9 Er beklagt erstmals, Anfang der 1790er Jahre, eine Abnahme seiner Leistungsfähigkeit, woraufhin er seine Vortragsstunden reduziert. 1798 beginnt auch sein Geist nachzulassen, bis er in den letzten Jahren an seniler Demenz leidet. Am 12. Februar 1804 verstirbt er im Beisein seines Freundes Wasianski, seiner Schwester und einiger Anderer.10
1.2. Kants Werke
Immanuel Kant gehört mit Nietzsche zu den meistzitierten Philosophen der Neuzeit. Besonders berühmt ist er wegen seiner drei großen Kritiken: „Kritik der reinen Vernunft“ 1781, „Kritik der praktischen Vernunft“ 1788 und der „Kritik der Urteilskraft“ von 1790. Seine Leistungen, die Erkenntnistheorie betreffend, sind herausragend, die Dekonstruktion der Metaphysik erschüttert das 18. Jahrhundert, seine Moralphilosophie versöhnt die Welt wieder mit ihm und mit Gott und seine „Kritik der Urteilskraft“, begründet eine neue Ästhetik, welche das Schöne und Erhabene präzisiert.
1.2.1 Die philosophischen Hauptwerke Kants
Kant gilt als ein „ … Titan der Geisteswelt“11, wie Manfred Geier in der Kurzbeschreibung feststellt. „Er will Rationalismus und Empirismus überwinden, Denken und Erfahrung, Verstand und sinnliche Anschauung zur Einheit bringen.“12
In der „Kritik der reinen Vernunft“ (1. Ausgabe 1781, 2. Ausgabe 1788) wird die Erkenntnis auf mögliche Erfahrung und bloßen Schein begrenzt und sämtliche Schlussfolgerungen über Seele, Welt und Gott, wären dann Ideen aber reine Spekulation. Metaphysik als Wissenschaft ist damit unmöglich. Diese Schrift wird folglich zum Wendepunkt der philosophischen Geschichte und eines der, bis in die Gegenwart am meisten zitierten, Werke, besonders bei Denkern, die der Subjektivität und der Vernunft das Primat zugestehen möchten.
Mit der „Kritik der praktischen Vernunft“ (1785) versucht er nun die Metaphysik, die erkenntnistheoretisch nicht begründet werden kann, durch die Postulate Seele, Welt und Gott zu fundieren. Wenn sie auch nicht begründet werden können, so dürfen wir sie annehmen. Sittliches Sollen und Handeln können daher nur durch die praktische Vernunft begründet werden. Ihre Gesetze sollen allgemeingültig sein und aus apriorischer Vernunft hergeleitet werden. Voraussetzung ist dabei, die Selbstgesetzgebung eines autonomen Willens. Die Allgemeingültigkeit einer Ethik kann aber nicht empirisch, sondern nur formal hergestellt werden. Universalisierbar wird die Moralphilosophie durch den kategorischen Imperativ. Sie muss aber auch materiell werden, durch das sittliche Handeln, sonst würde die Ethik nur in der theoretischen Betrachtung verbleiben. Der formale Charakter der kantischen Ethik wird als „Pflichtenethik“ verstanden, die aber als autonom, als von der eigenen Vernunft verordnete Pflicht einzuschätzen ist und nicht als heteronome Pflicht verstanden werden darf. Die Gesetze, die sich aus dem formalen Charakter ergeben, erschließen nun die Postulate der praktischen Vernunft, die in der „Kritik der reinen Vernunft“ als Vernunftideen bezeichnet werden. Kants Moral und auch sein Glaube werden zum Vernunftglauben, ohne den Sittlichkeit begründungslos bleibt.
1790 legt Kant die „Kritik der Urteilskraft“ vor. Nachdem er die theoretische Vernunft und die praktische Vernunft demonstriert hat, wird ihm klar, dass die Brückenkonstruktion, die beide Vernunftvermögen verbinden soll, fehlt. Es ist die Verbindung „zwischen dem notwendigen Naturmenschen der Erscheinungswelt und der Freiheit sittlichen Handelns in der übersinnlichen Welt … “13, also der Vermittlung von Vernunft und Verstand. Die Urteilskraft ist das Vermögen, das Besondere das im Allgemeinen enthalten ist, zu denken. Sie wird unterteilt in die ästhetische und die teleologische Urteilskraft. Einerseits begründet Kant damit eine ästhetische Theorie, die wiederum nur durch die Vernunft reflexiv erkannt werden kann und andererseits versucht er eine naturmetaphysische Begründung zu liefern, die Welt als gesetzmäßig zu denken, wenn wir das auch nicht beweisen können. Die Urteilskraft ist vor allem wegen der Theorie des Schönen und Erhabenen ein immer noch hochgeschätztes Werk.
Die Ethik Kants hat ungeheuren Einfluss auf die Geistesgeschichte bis ins 20. Jahrhundert hinein. Wenn sie zwar spekulativer Natur ist, so prägt sie, gerade durch ihre christliche Basis, seit über 200 Jahren das Denken der Philosophen. Auch der Einfluss der praktischen Schriften Kants, zu denen auch die „Grundlegung zur Metaphysik der Sitten“ gehört, ist 230 Jahre später immer noch stark spürbar.
1.2.2 Kants naturphilosophische Werke
Kant ist vom Anfang bis zum Ende primär Naturphilosoph. Dies wird besonders deutlich in seinen Werken und die nachfolgenden Überlegungen unterstreichen das. Robert Bernasconi macht deutlich, dass Kant die Teleologie bemüht, um rein mechanistische Naturkonzepte abzuwehren.14 Folgende Aussage von Kant zeigt das nachdrücklich: „Diese Fürsorge der Natur, ihr Geschöpf durch versteckte innere Vorkehrungen auf allerlei künftige Umstände auszurüsten, damit es sich erhalte und der Verschiedenheit des Klima oder des Bodens angemessen sei, ist bewundernswürdig …“ (VvRM 02, 434-16). Vor diesem Hintergrund ist auch zu erklären, warum Kant eine besondere Affinität zur physischen Geographie und zur Anthropologie hat. Ihn interessiert in erster Linie eine Metaphysik der Natur, die er aber nicht mehr vervollständigen konnte.
Viel zu wenig werden aber die naturphilosophischen Werke Kants beachtet, nicht nur deshalb, weil die wissenschaftlichen Erkenntnisse mittlerweile als veraltet zu betrachten sind, sondern auch weil sie Unbehagen bereiten. So lautete seine erste Schrift 1747 „Die Gedanken von der wahren Schätzung der lebendigen Schätze“, die sich mit dem Streit zwischen Descartes und Leibniz auseinandersetzt. 1755 schreibt er die „Allgemeine Naturgeschichte und Theorie des Himmels“, die sich mit der Gravitationstheorie von Newton beschäftigt. Das große Erdbeben von Lissabon, aus dem Jahre 1755 veranlasst ihn, „Von den Ursachen der Erderschütterungen bei Gelegenheit des Unglück, welches die westlichen Länder von Europa gegen das Ende des vorigen Jahres betroffen hat“, 1756, zu veröffentlichen. Im Anschluss an diese naturphilosophischen Thesen beschäftigt sich Kant nun mit der Frage, wie Metaphysik als Wissenschaft möglich ist, was ihn zeitlebens umtreiben wird. 1765 erscheint „Beobachtungen über das Gefühl des Schönen und Erhabenen“. Sie ist eine Vorarbeit zur Moralphilosophie und zur Kritik der theologischen Urteilskraft. Aber er beginnt sich auch mit der Geschlechterfolge zu beschäftigen und verwendet erstmals den Begriff „Race“ (GSE 02, 237-36). Diese Arbeit ist jedoch noch keine systematische Rassenschrift. Die legt er erst 1775 vor, als Ankündigung für seine bevorstehenden Vorlesungsreihen der „Physischen Geografie“ und zwar unter dem Titel „Von den verschiedenen Racen der Menschen“. Mark Larrimore ist der Ansicht, Kant glaubt, ein Gesetz der menschlichen Abstammung entdeckt zu haben und die physische Geographie, als Wissenschaft etablieren zu können.15 Reinhard Brandt verweist ebenso auf die wissenschaftlichen Ambitionen Kants16, wie sich in einem Brief von ihm an Marcus Herz, aus dem Jahre 1773, zeigt: „Ich lese in diesem Winter zum zweyten mal ein collegium privatum der Anthropologie welches ich jetzt zu einer ordentlichen academischen disciplin zu machen gedenke“ (Br 10, 145-27). Kant veröffentlicht in dieser ersten Rassenschrift seine gedanklichen Überlegungen zur Herkunft von Rassen und ihren Hierarchisierungen. Diese Schrift wird jedenfalls ein Anlass zu einem Streitthema, das sich bis zum Ende des 18. Jahrhunderts zwischen Blumenbach, Metzger, Forster, Soemmering und Herder hinzog. Dies veranlasst dann auch Kant, 1785 „Bestimmung des Begriffs einer Menschenrace“ herauszugeben. Nach weiteren massiven Einwänden, besonders von Forster, erscheint „Über den Gebrauch teleologischer Prinzipien in der Philosophie“, 1788. Kant zitiert unter anderem Sprengel’s Beiträge zur Völker und Länderkunde.17 Im Jahr 1798 veröffentlicht Kant seine letzte Schrift aus seiner naturphilosophischen Reihe, die „Anthropologie in pragmatischer Hinsicht“. Sie ist eine überarbeitete Vorlesungsschrift, deren Konzept seit 1757 existiert und ständig korrigiert und erweitert wird.18
Wie oben bereits angedeutet, sind die naturphilosophischen Thesen heute nicht mehr aktuell. Vor allem aber zeigen die „Rassenschriften“ einen Philosophen, den man, aus heutiger Perspektive, lieber unterschlagen möchte. Im folgenden Kapitel werden die Werke, die sich mit den rassentheoretischen Unterscheidungen Kants beschäftigen, genauer untersucht.
1.2.3 Kants Rezeption der anthropologischen Schriften
Kants Gesinnung wird von Geier wiedergegeben mit „liebevoller, größter Dankbarkeit und Hochachtung“.19 Sowohl Jacobi, von Geier zitiert, als auch Wasianski, gestehen ihm edle Gesinnung und strengsten moralischen Lebenswandel zu.20 Umso mehr verwundern die Aussagen Kants zur Frage der Rasse, den Juden und den Frauen, die er in seinen anthropologischen Vorlesungen und in einigen Aufsätzen zur Sprache bringt.
Kants anthropologische Schriften und hier im Besonderen die Aufsätze, welche das Thema der Rasse zum Inhalt haben, sind vermutlich auch deswegen weniger bekannt, weil erst der Holocaust und die Befreiung der Schwarzen, den Blick vieler Denker auf dieses Thema richten. Aber genau diese Ereignisse führen auch in Verbindung mit Kants Rassentheorie dazu, die Textstellen zu verschweigen. Gudrun Hentges ist der Ansicht, dass:
Kants Beitrag zur Entwicklung einer Rassentheorie im deutschen Sprachraum entweder eine nur geringe Bedeutung beigemessen [wird], oder aber die von ihm vorgenommene Kategorisierung wird dem Bereich der physischen - und damit angeblich harmlosen, da lediglich körperliche Merkmale berücksichtigenden - Anthropologie zugeordnet.21
Auch Reinhard Brandt bemerkt, dass zur „Anthropologie in pragmatischer Hinsicht“, keine namhafte Studie seit der Erscheinung seines Werks vorgelegt wurde und ein Preisausschreiben aus dem Jahre 1931, zu diesem Thema, ohne Ergebnis bleibt.22
Das Problem liegt offensichtlich darin, dass Kants Moralphilosophie, seine politische Philosophie und seine anthropologischen Schriften, sich einer kohärenten Deutung zu entziehen scheinen. Stellt man die Denkinhalte den anthropologischen Schriften gegenüber, so gibt es immer Einwände, von welcher Seite auch immer. Will man Kant aber ernst nehmen, so muss man sich seine vier Fragen vor Augen halten:
1) Was kann ich wissen? 2) Was soll ich Thun? 3) Was darf ich hoffen? 4) Was ist der Mensch? Die erste Frage beantwortet die Metaphysik, die Zweite die Moral, die Dritte die Religion und die Vierte die Anthropologie. Im Grunde könnte man aber alles dieses zur Anthropologie rechnen, weil sich die ersten Fragen auf die Letzte beziehen (Log 09, 25-3).
Kants Rat wird aber offensichtlich nicht so richtig ernst genommen. Johannes Hirschberger „Geschichte der Philosophie Band II: Neuzeit und Gegenwart“ erwähnt die Anthropologie nur einmal, ohne näher darauf einzugehen. Aber auch die Geschichtsschreibungen von Windelband, Vorländer und Eisler bringen Kant und Rassismus nicht in Zusammenhang. Das „Historisches Wörterbuch der Philosophie“ liefert einen Eintrag zum Thema Rasse und gibt hier wenigstens die wichtigsten Teilnehmer des Diskurses, wie Kant, Buffon oder Blumenbach an und verweist auf das „problematische Potential“. Das Kohlhammer Urban Taschenbuch „Philosophie des 17. und 18. Jahrhunderts“ von Emerich Coreth und Harald Schöndorf, 2008, verweist nur kurz auf die „Anthropologie in pragmatischer Hinsicht“, die aus Sicht der Autoren kaum diesem Anliegen entspricht, weil sie keine philosophische Anthropologie ist. Die Rassenschriften werden nicht erwähnt. In „Geschichte der Philosophie in Text und Darstellung. Deutscher Idealismus“ aus dem Reclam Verlag, 2004, findet sich nicht einmal der Begriff der Anthropologie. Bei Manfred Geier findet sich überhaupt kein Hinweis auf Kants Rassentheorien. In dem Buch „Kant in der Diskussion der Moderne“ aus dem Suhrkamp Verlag von 1996 kommt der Ausdruck Rasse oder Rassismus in Verbindung mit Kant überhaupt nicht vor, obwohl gerade in der neueren Debatte, Rassismus immer noch ein großes Thema ist. Michel Foucault verweist in seinem Buch „Einführung in Kants Anthropologie“, Suhrkamp 2010, ebenso wenig auf die Rassentheorie Kants. Im Kant-Handbuch von Irrlitz wird zwar darauf eingegangen, jedoch ist der Autor folgender Ansicht: „Das universalistische Prinzip in Kants Ethik und Rechtstheorie wird vom Rassenbegriff nicht beeinträchtigt.“23 Wie sich zeigen wird, ist das keinesfalls zutreffend.
Erst in der neueren Philosophie-Literatur, im deutschsprachigen Raum, widmet sich Monika Firla und Bettina Stangneth dem Phänomen der Rasse bei Kant. Ebenso Gudrun Hentges, Professorin für Politikwissenschaft, die Philosophie studierte, desgleichen Manfred Kappeler, Professor für Sozialpädagogik, werden hier zu Wort kommen. Im angelsächsischen Raum ist der Diskurs doch etwas breiter und gleichzeitig, aus meiner Sicht, tiefer angelegt. Das dürfte auf den nicht so hohen Stellenwert Kants, in Übersee und der daher geringeren Scheu ihn zu kritisieren, zurückzuführen sein. Emanuel Chukwudi Eze, Mark Larrimore, Robert Bernasconi, Pauline Kleingeld und Charles W. Mills sind die bekanntesten Speerspitzen in dieser Diskussion. Es scheint, wie Robert Bernasconi urteilt, tatsächlich das Konzept der Rasse und der Zusammenhang mit Immanuel Kant in den letzten fünfzig Jahren verlorengegangen zu sein.24
1 Heinrich Heine: Zur Geschichte der Religion und Philosophie in Deutschland. Stuttgart 1997. 94.
2 E. A. Ch. Wasianski: Immanuel Kant in seinen letzten Lebensjahren. Darmstadt 2012, 267.
3 Ludwig Ernst Borowski: Darstellung des Lebens und Charakters Immanuel Kants. Darmstadt 2012, 11.
4 Reinhold Bernhard Jachmann: