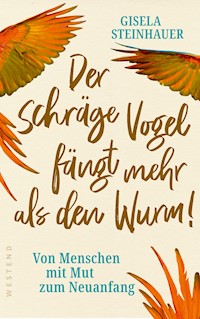
14,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Westend Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Wovon hängt es eigentlich ab, ob wir Lebensbejaher, Lebensverneiner oder gar Lebensvertrödler werden? Und was passiert, wenn das Leben plötzlich seine Richtung ändert. Die beliebte und bekannte Radiomoderatorin Gisela Steinhauer ist diesen Fragen nachgegangen und hat auf ihren Reisen um die Welt mit vielen außergewöhnlichen Menschen gesprochen. In ihrem Buch begegnen wir u.a. dem Schamanen Uli Gottwald, dem Regenwald-Ritter Sir Hugo, der Wüstenführerin Juta Brasch, der Hilfswerkgründerin Lea Wyler oder dem Bestatter Fritz Roth. Menschen, die uns nur noch oder endlich wieder staunen lassen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 304
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Ebook Edition
Gisela Steinhauer Nina Horaczek
Der schräge Vogel fängt mehr als den Wurm
Von Menschen mit Mut zum Neuanfang
Mehr über unsere Autoren und Bücher:
www.westendverlag.de
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Verlags unzulässig.
Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
ISBN 978-3-86489-839-6
© Westend Verlag GmbH, Frankfurt/Main 2021,
Umschlaggestaltung: Buchgut, Berlin
Satz und Datenkonvertierung: Publikations Atelier, Dreieich
Inhalt
Vorwort
Wann entscheidet sich, ob man ein Lebensbejaher, ein Lebensverneiner oder ein Lebensvertrödler wird? Wovon hängt es ab, ob ich das Leben als kostbare Leihgabe oder als drückende Last sehe? Oder ganz grundsätzlich: Was soll ich überhaupt mit diesem Leben anfangen, um das ich nicht gebeten habe? Die Frage klingt vielleicht merkwürdig, unbequem, aber sie ist unabweisbar, wenn man am Ende nicht dastehen und sagen will: Mein Leben? Aus Dummheit versemmelt!
Über eine sehr lange Zeit wusste ich selber nicht, was ich wollte und welchen Sinn die ganze Veranstaltung »Leben« haben könnte. Dabei war die Grundausstattung hervorragend.
Ich wuchs in einem Drei-Generationen-Haus auf. Im Erdgeschoss: vier kleine Zimmer, Küche, Bad, Eltern. Die weibliche Führungskraft bestand zu 100 Prozent aus Herz, mein Vater zu 100 Prozent aus Reiselust. Meine Mutter behauptete hartnäckig, dass Papa von »Zigeunern und Marketenderinnen« abstamme, während mein Vater die Familie meiner Mutter als rheinische Katholiken kennenlernte, die feierten, dass es nur so krachte, und den Dauerzustand der Erbsünde mit drei »Gegrüßet seist du, Maria« aus dem Beichtstuhl fegten.
Im ersten Stock wohnten meine Großeltern väterlicherseits. Meine Oma war äußerst fidel, fit im Fechten, erstklassig beim Skat und eine begeisterte Karnevalistin, die mit ihren Geschwistern an Weiberfastnacht gerne einen draufmachte. Mein Opa hingegen, Schreinermeister mit Atemnot – aber die Ernte 23 immer griffbereit am Ohr –, schloss an den Karnevalstagen die Werkstatt und unternahm pfeifende (das lag an der Lunge) Spaziergänge auf der Aachener Karlshöhe.
Im zweiten Stock konnten wir vier Kinder uns austoben. Lautstärke: Oft über dem Pegel. Wir teilten alles, auch die Windpocken. Als Jüngste profitierte ich sehr davon, dass mir die älteren Schwestern Steine aus dem Weg räumten: Bahn frei für die Disco ab zwölf Jahren (aber nur in den Sommerferien und nur in Begleitung der Geschwister!), freie Fahrt für Karnevalsfeten in Kneipen ab 14 (aber nur bis zur Unkenntlichkeit verkleidet und mit doppeltem Geleitschutz!), Urlaube an der Nordsee ab 16 ohne Eltern (aber nur mit den älteren Freunden!).
In unseren Zimmern bogen sich die Bücherregale, auf denen auch noch die Schallplattenalben Platz finden mussten, denn Zuhören war meine Passion. Ich konnte noch lange nicht lesen, da war ich schon in der Lage, den Arm unseres kleinen grauen Plattenspielers zu bedienen, die Nadel korrekt auf die erste Rille zu platzieren und mir mithilfe von Hans Paetsch den »kleinen Muck« oder »Kalif Storch« ins Kinderzimmer zu holen. Hans Paetsch, damals der Märchenonkel der Nation, lullte mich mit seiner Stimme wohlig ein und ist für mich einer der größten Hörspiel- und Synchronsprecher. Später als Journalistin hätte ich ihn gerne getroffen, zumal er am gleichen Tag Geburtstag hatte wie ich. Ich hörte beim Zimmeraufräumen die Langspielplatte »Pünktchen und Anton«, erzählt von Erich Kästner, so oft, dass ich noch heute den Anfang auswendig aufsagen kann. Ich hörte die Ariola-Kinderschallplatten mit dem »Froschkönig« und »Märchen aus 1001 Nacht«, samtig-dunkel vorgelesen von Annette von Aretin. Schöne Stimmen begleiteten mich durch meine Kindheit, auch die warme Stimme meiner Mutter. Wenn sie für uns backte, saß ich bei ihr auf einem Holzschemel an die Küchenwand gelehnt, baumelte mit den Beinen, beobachtete, wie sie den buttrig-schweren Teig für Marmorkuchen in dunkelbraun und hellbeige teilte, hoffte auf die Quirlstange mit Dunkelbraun zum Abschlecken und hörte zu, während Mama von ihrer Kindheit erzählte, auf einem Dorf in der Jülicher Börde, wo für sie nichts richtig schön gewesen war, weil sie sich um ihre acht Geschwister kümmern musste.
Wenn es keinen Kuchen gab, aß ich beim Lesen bergeweise Nuss-Schokolade, und noch heute lege ich mich in düsteren Stunden mit dem zerfledderten Takatukaland aufs Sofa, freue mich über die vergilbten Seiten mit den braunen Flecken und träume mich zurück ins Kinderparadies.
Die Großeltern brachten uns Radfahren und Canasta bei; sie hatten als Erste einen Farbfernseher, in dem wir Indianerüberfälle in bunt sehen konnten, und sie waren die ersten Rentner, die in Can Picafort auf Mallorca überwinterten. Wenn wir erkältet waren, bekamen wir heißen Rotwein mit Zucker und Eigelb oder wurden mit Klosterfrau Melissengeist abgeschossen. Wenn Oma uns mit der glühenden Brennschere Locken ondulierte, stank die ganze Bude nach verbrannten Haaren. Wenn Opa in der Waschküche Hühner schlachtete, roch der Keller nach Blut und wir Kinder schlichen uns nach dem finalen »Gaak« hinunter, um die letzten Blutspuren, die der Wasserschlauch nicht erwischt hatte, im Kanal versickern zu sehen.
Unsere Lebensweise, drei Generationen unter einem Dach, darunter zwei ganz normale Ehepaare, nicht geschieden, wurde im Laufe der Jahre zum Auslaufmodell, ist inzwischen aber wieder stärker nachgefragt, weil den Leuten zu viel Scheidung, Patchwork- und Regenbogenfamilie auch nicht mehr passt.
Mein Fundament fürs Leben war also im Prinzip fabelhaft, nur merkte ich das nicht immer. Ich war oft unwirsch, langweilte mich schnell, wenn wieder ein Buch ausgelesen und das nächste noch nicht in Sicht war. Ständig war ich auf der Suche nach – ja wonach eigentlich? Abwechslung. Highlights. Extremen. Neuen Eindrücken. Erkenntnissen. Leitbildern. Ich war gierig nach Neuem, nach dem Unbekannten. Aus einem ausgeprägten Freiheitsdrang heraus schloss ich mich weder festen Cliquen noch Vereinen an. Ich feierte mal mit denen, mal mit diesen, mochte auch die schrägen Vögel und die Unangepassten und fühlte mich in den Kreisen der Lacoste-Pullunder genauso wohl wie bei den Parka-Trägern, die meistens nach Moschus oder Patschuli rochen.
Mein größtes Talent? Zuhören können. Mein zweitgrößtes? Gerne fragen. Ich werde hellwach, wenn Menschen gut erzählen können: Kurioses, Fremdes, Erschreckendes. Und es drängt mich, immer weiter nachzufragen, Menschen zu ergründen, merkwürdige Handlungen zu verstehen, verrückte Ideen zu begreifen, mitzufühlen und mich in andere hineinzuversetzen.
Nebenbei: Das alles könnte ich jetzt auch konsequent gendern, aber ich mag diese Großes-Binnen-I-Verrenkungen nicht so gerne und konnte bisher noch nicht davon überzeugt werden, dass Gender-Sternchen Einfluss auf unseren Umgang miteinander haben. Mögliche Lösung: Ich respektiere drollige Sprechpausen, liebe Gender*Innen, und ihr respektiert meine Art zu sprechen.
Wo war ich?
Ach ja: Zuhören und fragen. Das rettete mich aus meiner Planlosigkeit und wurde mein Beruf. In 30 Jahren habe ich für zahlreiche Medien einige Tausend Menschen interviewt – die kurzen Drei-Minüter fürs Radio jetzt mal nicht mitgezählt – und das Verblüffende war: Je mehr Leute und Lebensentwürfe ich kennenlernte, desto mehr dehnte sich mein Fassungsvermögen aus. Ich erfuhr, was alles möglich und lebbar ist. Ich lernte, dass Einsamkeit für den einen eine Qual, für den anderen Glück bedeuten kann; dass Geld dem einen wichtig, dem anderen völlig egal ist; dass sich fast alles von sehr vielen Seiten betrachten lässt. Das hat mich vorsichtig gemacht. Oft saß ich im Staun-Modus vor meinen Gesprächspartnern, hörte gebannt zu und vergaß, zu urteilen. Ganz sicher, vorschnell zu urteilen.
Von denen, über die ich am meisten gestaunt habe, erzähle ich hier. Ich habe sie in diesem Buch zusammengebracht, weil ich der festen Überzeugung bin, dass der eine oder die andere darunter ist, der oder die vielleicht eine Stütze beim Nachdenken über die Grundfragen sein könnte.
Am Ende werden Sie unter anderem einem Schreiner aus Bochum-Stiepel begegnet sein, der zum Ritter geschlagen wurde; Sie werden die Enkelin vom Bambi-Erfinder Felix Salten kennen, die in Nepal ein Hilfswerk gründete; Sie werden einen U-Boot-Kommandanten getroffen haben, der Schamane wurde; eine Wüstenführerin, die vorher Bembel getöpfert hat, und einen Kunstfälscher, bei dem selbst die Oma nicht echt war. Auch er hat mich tief beeindruckt.
»I am here and my monk is with me.« Der Mönch, der das Eingangsmantra zur Meditation sang, sah aus wie Danny DeVito in Safran. Ein kleiner Mann mit glattrasiertem Schädel, rundem Mondgesicht und eindringlichen dunkelbraunen Augen. Von meinem bordeauxfarbenen Kissen aus verfolgte ich aber vor allem Dannys nackte braune Füße, denn ich saß im Schneidersitz, den Kopf gebeugt, um nachdenken zu können. »Iamhereandmymonkiswithme« leierte Danny.
Die Entscheidung zur Ayurvedakur auf Sri Lanka war genau richtig gewesen. Ölmassagen, bittere Naturmedizin, scharfes Gemüse unter Palmen am Indischen Ozean – noch nie hatte ich mich in so kurzer Zeit so gut erholt.
»Iamhereandmymonkiswithme.« Mönch Danny vom Bentota-Fluss schlurfte bei 35 Grad über den blank gewienerten Betonboden der Dachterrasse, und sein Körpergeruch mischte sich mit dem Duft der süß-herben Räucherstäbchen und des Kokosöls, das eine kleine Flamme vor den drei Mini-Buddhas nährte.
Mir tat das Kreuz weh. Schneidersitz ist nicht meine Spezialität, wie Sitzen überhaupt. Nichts macht mich nervöser, als still zu sitzen, am allerschlimmsten ist es in Konferenzen.
Konferenzen hatte ich in den letzten Monaten beim Radio so oft erlebt, dass ich schon immer ganz hibbelig wurde, wenn es auf 10.00 Uhr zuging, wenn sich die Türen öffneten und viele Kreative an den Konferenztisch traten: Die blitzschnellen Leute vom Sport, menschgewordene Bundesligatabellen, die alle Ergebnisse seit der Erfindung des Fußballs auf dem Schirm hatten; die Wirtschafts-Experten – »Ich erklär euch den Dax später mal ausführlich« – oder die Kolleginnen von der Kultur, die hoffnungsvoll in die Runde fragten: »Sollen wir was zur Neuinszenierung von Così fan tutte machen?« Oft antwortete die Runde: »Och nö. Lass uns lieber eine Höreraktion planen.«
Die Arbeit als Moderatorin für die unterschiedlichsten ARD-Sender und Redaktionen war grandios. Die Stimmung überall fabelhaft. Der Input riesig. Ich arbeitete schnell, gern und viel. Aber zweimal im Jahr große Pause war auch nett.
Danny DeVito, der Buddhist, der im gleichmäßigen Schritt an der Stirnseite des Raumes hin- und herging, hatte uns ermahnt, während der Meditation nicht an die Vergangenheit und nicht an die Zukunft zu denken.
Die Erste, die mir beim absichtslosen Nicht-an-die-Vergangenheit-Denken in den Sinn kam, war Lea Wyler.
Bambi, Bordsteinschwalben und ein tibetischer Lama
»Wenn ihr mir nicht erlaubt, Schauspielerin zu werden, stürze ich mich in die Limmat!«
Schon als Kind hatte Lea Wyler erstens einen ausgeprägten Hang zum Dramatischen und zweitens keine andere Wahl: Ihr Großvater, Felix Salten, war der Erfinder vom scheuen Rehlein Bambi, stand aber gleichzeitig im Ruf, der Verfasser der pikanten Lebensgeschichte von Josefine Mutzenbacher zu sein, »einer Frau voller Lust und Begierde«, wie es im Wien der Kaiserzeit hieß. Lea fühlte sich dem niedlichen Reh so nahe wie der lasterhaften Prostituierten. Sie wollte auf die Bühne, egal ob als unschuldiges Kitz im Weihnachtsmärchen oder als verruchtes Weib.
Ich war auf sie aufmerksam geworden, als ich einen Fotoband über »Frauenräume« durchgeblättert hatte. Darin Porträts von Frauen, die außergewöhnlich waren und sich auch außergewöhnlich eingerichtet hatten: Über Lea Wylers Bett mit einer gold-grün-blau-roten Patchworkdecke spannte sich ein Baldachin aus feinsten Tüchern und Saris, darunter befand sich ein Wandbehang aus Tibet. In ihrem Arbeitszimmer stand hier und da eine Klangschale, es gab Wimpel, Gebetsfähnchen, Räucherwerk und Buddha-Statuen. Im Wohnzimmer-Blumenkübel hockte ein nepalesisches Pärchen aus Holz und blickte sich verliebt an. Auf dem dunkelbraunen Schreibtisch wartete ein Riesenstapel Papier darauf, abgearbeitet zu werden.
Als wir uns in ihrem Elternhaus in Zürich trafen, hatte sie sich soeben von dieser Einrichtung getrennt. Denn sie war gerade in einer Aufräumphase ihres Lebens.
»Ich hatte plötzlich das Bedürfnis, meine Wurzeln zu spüren«, sagt Lea und schüttelt mir am Eingang herzlich die Hand. Sie verliert nicht viel Zeit mit Förmlichkeiten, bietet mir in der Küche voller unausgepackter oder noch nicht eingepackter Kisten einen Kaffee an. Schnell sind wir beim »Du«.
Ich betrachte sie genauer. Schwarze, leicht gewellte, kinnlange Haare, vom Pony bis zur Nase eindeutig Kleopatra, gespielt von Liz Taylor. Leas Augen funkeln so sehr, dass sie ihr etwas Schalkhaftes geben. Wenn sie lacht, lachen vor allem die Augen. Die Lippen sind voll, das Kinn flieht, die Rundungen zeugen von allzeitiger Genussbereitschaft.
Lea führte mich durch das große Haus – eine Baustelle, auf der die Holzfußböden abgeschliffen wurden – zu ihren Anfängen. Mit jedem Möbelstück war eine Anekdote verbunden, an jeden Teppich waren Erinnerungen geknüpft. Wir standen vor dem riesigen Schreibtisch ihres Vaters, um uns herum Bücherregale aus braunem Holz, braune Wandschränke mit Messingknöpfen, Kerzenständer, Leuchter, Menoras, gerahmte Familienfotos. Es sah aus wie in einer Theaterkulisse.
Leas Mutter, Anna Katharina Rehmann-Salten, eine österreichische Schauspielerin, hatte in Wien unter Max Reinhardt gespielt und war mit dem Schweizer Schauspieler Hans Rehmann verheiratet gewesen. Nach dessen Tod heiratete sie 1944 den Anwalt Veit Wyler, einen überzeugten Zionisten. Während des Naziterrors hatte er jüdischen Familien aus Deutschland Schweizer Pässe besorgt. Das Paar bekam zwei Töchter. Lea wurde 1946 geboren. »Wie mein Großvater Felix Salten konnte meine Mutter wunderbar Geschichten erzählen. Eigentlich spielte sie meiner Schwester Judith und mir die Geschichten vor.«
Die Wylers waren gläubige Juden. Am Schabbat mussten die Kinder in der Bibel lesen und den Text ins Hebräische übersetzen. Aber die Familie führte auch ein großes offenes Haus mit regelmäßigen Besuchen von berühmten Künstlern und Kreativen, Friedrich Dürrenmatt zum Beispiel, Wissenschaftlern und Schauspielern; Abende mit viel Wein und Philosophie. In Lea wuchs der Wunsch, in den großen Theatern der Welt aufzutreten.
»Meine Eltern waren sehr großzügig und lebten ihre zupackende ›Hands-on‹-Mentalität mit viel Herz und Humor. Bei uns tauchten auch die Clochards auf. Sie kamen aus dem Wald am Sonnenberg die Straße herunter um die Ecke. Ich erinnere mich an einen alten Mann mit zauseligem Bart, der mitten im Winter an unserer Tür klingelte und fragte: ›Haben Sie etwas im Garten zu arbeiten?‹« Auch solche Leute wurden bei Wylers nicht nur aufgenommen, sondern wie geehrte Gäste behandelt. Sie saßen mit am Tisch und verließen ihn mit vollen Bäuchen:
»Es läuteten gebückte Menschen an der Tür. Aber wenn sie gingen, lächelten sie und schienen drei Zentimeter gewachsen zu sein. Meine Eltern haben jedem geholfen; mein Vater meinte immer, das Schicksal habe sie schon genug geschlagen.«
Wir stiegen die Treppe hoch, vorbei an weiteren Stühlen, Sesseln, Kisten – work in progress bis ins Dach. Auch dort Bücher, Ordner, Papiere, Gerümpel. Das muss sie alles noch streichen lassen, dachte ich, und nebenher ihr Leben ordnen. Wie schafft sie das? Ob sie möglicherweise wie ich alles am liebsten gleichzeitig macht? Auf Tausende Zettel Notizen kritzelt und To-do-Listen erstellt, die sie dann nicht mehr findet? Oder ist sie von der Klarsichthüllen-Fraktion? Jeder Vorgang bekommt sein eigenes gelochtes Plastikmäntelchen und damit nichts verrutscht, wird das Ganze im Leitz abgeheftet? Mein Blick fiel auf eine verbeulte Schreibtischlampe, Art déco. »Ist die schön«, sagte ich. »Möchtest du sie haben?«, fragte Lea und ergänzte: »Die ist von meinem Opa.« Ob ich eine Art-déco-Lampe von Felix Salten wolle? Das hatte sie jetzt nicht wirklich gefragt? Doch, hatte sie. Seither steht die Lampe, so verbeult wie sie war, auf meinem Schreibtisch in Berlin und erinnert mich an einen Schriftsteller von Weltruf und seine Enkelin mit Hollywoodambitionen.
Lea blieb der Sprung in die Limmat erspart; sie durfte Schauspielerin werden. Aber bevor sie die Schauspielschule in England besuchte, wollte sie für ein Jahr in einen Kibbuz. »Auf keinen Fall in der Schweiz bleiben, heiraten, Kinder kriegen.«
Wir stiegen hinunter ins Erdgeschoss, räumten im Wohnzimmer ein paar Kartons zur Seite, schoben zwei Sessel zusammen und zeichneten das Interview auf.
Nach der Matura beschloss Lea als Mitglied des »Israelitischen Jugendbunds« nach Israel auszuwandern. Veit Wyler, der die Zeitung Das neue Israel herausgab, war eng befreundet mit Israels Außenministerin und späteren Ministerpräsidentin Golda Meir und hatte sie gebeten, auf seine jüngste Tochter aufzupassen. Wieder so eine Geschichte, die ganz en passant erzählt wurde. Was hätte ich darum gegeben, Golda Meir kennenzulernen, die erste und bisher einzige Frau an der Spitze Israels. Die Kettenraucherin mit der kleinen Perlenkette, ewig in Wollstrümpfen und Khaki-Kleidern, von der Israels Staatsgründer Ben Gurion gesagt haben soll: »Der einzige Mann in meinem Kabinett ist Golda Meir.« Lea schlug zu ihr eine sehr persönliche Brücke.
»Ich fühlte mich wie eine Freiheitskämpferin. Ich dachte, ich sei meinem Volk etwas schuldig, und war der festen Überzeugung, dass alle nur darauf warteten, mit mir ihr Land aufzubauen.« Aber niemand wollte die Freiheitskämpferin Lea Wyler haben. Deshalb zog sie zunächst nach Haifa zu ihrer Schwester, dann in einen Kibbuz, um Ivrit zu lernen, die wiederbelebte Sprache des jüdischen Volkes.
Im Juni 1967 brach der Sechstagekrieg aus. Mit einer überraschenden Offensive gegen Ägypten, Syrien und Jordanien wollte Israel einem befürchteten Angriff der arabischen Staaten zuvorkommen.
Wylers waren außer sich vor Angst um ihre Tochter und riefen bei Golda Meir an. Die Außenministerin kümmerte sich trotz aller Kriegshektik und internationaler Spannungen um Lea und beschwor sie, unverzüglich in die sichere Schweiz zurückzukehren. Die aber weigerte sich:
»Mein Platz ist hier! Ich will meinem Land dienen. So wie du es tust. Und all die anderen!«
»Ich passe auf dich auf und werde dich verstecken«, wetterte Golda.
»Ich will nicht versteckt werden, ich will kämpfen.« Sirenengeheul unterbrach ihren Streit.
Außer Lea waren alle im Luftschutzkeller. »Ich will nicht versteckt werden, ich will an die Front!«
Lea hatte sich in den Kopf gesetzt, in den Süden des Landes zu fahren, um mit den anderen zu kämpfen. Sie stand als Tramperin »trottelig allein am Straßenrand im Minirock mit tiefem Dekolleté« und wartete auf eine Mitfahrgelegenheit. »Der Einzige, der hielt, war ein Lastwagen. Vorne voll besetzt mit gut aussehenden, braun gebrannten Soldaten. Hinten ein Anhänger, auf dem eine Rakete befestigt war.« Wie Münchhausen auf der Kanonenkugel setzte sich Lea rittlings auf die Rakete, umarmte das Geschoss und fand die ganze Sache wunderbar abenteuerlich.
Und ich? Verbeugte mich in Gedanken vor dieser filmreifen Leistung. Denn ich habe durchaus einen Hang zur Theatralik. Wenn wir in den Sommerferien für sechs Wochen nach Zeeland fuhren, spazierte ich durchs ganze Haus, verabschiedete mich mit einem Kopfnicken von meinen Puppen, warf den Blumen im Garten Kusshände zu und rief »Tschüss Schaukel, tschüss Weiher, tschüss Salamander!« Den Hasen, von dem ich mich hätte verabschieden können, hatten wir zu Tode gestreichelt und zu viel Twist mit ihm getanzt (beim Hasentwist nimmt man den Hasen an den Vorderläufen hoch und bewegt diese im 4/4 Takt schwungvoll von links nach rechts. Aus Liebe zum Tier wurde der Tanz bereits Ende der 60er-Jahre bei uns nicht weiter tradiert). Unter lauter Verbeugungen nahm ich also Abschied vom Haus, um dann nach drei Stunden Fahrt den Strand der holländischen Nordsee zu begrüßen und mich im Sand zu mehlen, während Papa unter reger Teilnahme der anderen Camper meine Geschwister anschnauzte und schimpfend das Vorzelt aufbaute, dessen Stangen von Jahr zu Jahr weniger wurden.
Die Vorstellung von Lea als Freiheitskämpferin auf der Rakete gefiel mir außerordentlich. Wie sie da als einzige Frau unter einem Trupp verschwitzter Soldaten durch die Hitze fuhr, um sich dem Feind entgegenzustellen, fest davon überzeugt, von großem militärischen Nutzen zu sein, das hat alles, was ein Drama braucht. Nur war es leider kein Theaterstück, sondern Realität.
»Die Sirenen heulten, wir sprangen vom Truck ab, warfen uns in den Graben«, erzählte Lea. Aber nichts geschah. Kein Angriff. Niemand wurde verletzt. Alle Mann (und Lea!) wieder rauf auf den Lastwagen. Der setzte seine Fahrt fort.
Am nächsten Kibbuz wurde sie abgeladen, »aber auch die hatten nicht auf mich gewartet«. Also weiter. Abermals an die Straße gestellt, in der Hoffnung auf eine weitere Chance. »Der Nächste, der hielt, war ein Kühlwagen. Darin lauter Eis und eine halbe Kuh, an die ich mich klammerte, während wir bei 40 Grad Mittagsglut durch die Wüste rumpelten.« Immerhin blieb die junge Frau so gut konserviert.
Endlich gelangte sie zu einem Kibbuz, wo sie bei der Orangenernte helfen konnte. Allein unter Frauen, denn die Männer waren alle im Krieg. »Ich war 21, hatte keine Ahnung und keine Angst und fand alles in diesem Kibbuz aufregend.« Die Ernte wurde eingebracht, der Krieg gewonnen.
Am Ende ihres Jahres in Israel kehrte Lea zurück nach England und machte ihre Ausbildung an der Schauspielschule. Sie spielte an Theatern in England, der Schweiz und wieder in Israel, aber nur hier fühlte sie sich wirklich zu Hause. Hier wollte sie bleiben, bezog eine Wohnung, bekam ihren Traumjob: »Das beste Theater am Ort, das Haifa Municipal Theatre, bot mir eine Stelle an. Drei Hauptrollen auf Hebräisch.«
Doch dann kam der Anruf, der ihr Leben veränderte: Veit sagte ihr, dass ihre Mutter an Krebs erkrankt sei. »Ich überlegte keine Sekunde, rief im Theater an, bat die Kollegin, die Stelle für mich freizuhalten, und flog zurück nach Zürich.«
Anderthalb Jahre dauerte das Sterben, ein langer Todeskampf, bei dem Lea nichts anderes tun konnte, als sich zu kümmern und ohnmächtig zuzusehen, wie sich ihre Mutter dem Tod entgegenquälte. Als die Mutter endlich erlöst wurde, brach eine Welt zusammen. »Wenn du jemanden so liebst, ist alles andere nicht mehr wichtig. Ich wusste ja nichts vom Tod und war nicht darauf vorbereitet, dass meine Mutter sterblich war.«
An dieser Stelle entstand eine lange Pause in unserem Interview. Wir schwiegen einfach. Lea schaute aus dem Fenster. Ich dachte daran, wie ich nach dem Unfalltod meiner Mutter regelrecht versteinert gewesen war. Ich hatte einfach nicht sprechen können und es qualvoll gefunden, mit Freunden oder Verwandten reden zu müssen, die Anteil nahmen und mich trösten wollten. In Zeiten großen Kummers bin ich am liebsten alleine und vergrabe mich.
Irgendwann beendete Lea die Pause. Der Tod ihrer Mutter sollte sich als tiefe persönliche Zäsur erweisen, als der Beginn düsterer, schwerer Wochen und Monate. »Die Trauer griff nach allem und breitete sich vollständig aus.« Lea brach die Kontakte zu ihren Freunden ab, verweigerte Essen und Trinken. Hängte die Theaterkostüme und den Traum vom Hollywoodstar an den Nagel und versank in Depressionen. »Ich konnte nicht akzeptieren, dass ich dem Tod gegenüber so machtlos gewesen war. Ich fand keinen Ausweg aus dem Tunnel, sollte ins Sanatorium für psychisch Kranke eingeliefert werden.«
Inmitten aller Verzweiflung, unruhiger Nächte, ergebnisloser Grübeleien erinnerte sie sich eines Tages an den tibetischen Meditationsmeister und Arzt Akong Tulku Rinpoche, den sie vor vielen Jahren kennengelernt hatte. Lama Rinpoche hatte in den 60er-Jahren in Schottland das erste tibetisch-buddhistische Kloster Europas gegründet. Seine Anhänger waren begeistert von seiner Energie, seinen Heilmethoden, seiner Ausstrahlung.
Leas Pilgerreise mit Lama Rinpoche 1979 nach Indien und Nepal veränderte alles. »Diese Reise mit ihm war sehr bestimmend für den Rest meines Lebens. Ich wollte in seiner Gegenwart sein, da war jemand, der die Tiefen der menschlichen Seele verstand. Ich konnte all diese Sprüche nicht mehr hören: Lea, die Trauer geht vorüber. Lea, du bist ja noch jung. Alle diese Banalitäten, die ja wahr sind, sagte er nicht. Er führte mich mit Rückgrat durch die Phase.«
Jeder der Mitreisenden musste zu seinen Reisekosten eine Spende in derselben Höhe einbringen. Lea hatte kein Geld, keine Stelle, keine Zukunft, nichts. Wollte aber unbedingt mit. Die Schauspielerin jobbte als Übersetzerin und Synchronsprecherin. Als sie losfuhren, hatte sie das Geld für die Indienreise beisammen. »Für die Reise in ein anderes Leben.«
Rinpoche führte sie nach Bodhgaya, an den Ort, wo Buddha erleuchtet wurde. »Ein Kraftplatz. Aber da waren auch unendlich viele Bettler.« Millionen Menschen pilgern jedes Jahr nach Bodhgaya. »Es war so absurd: Drinnen beteten wir um Erleuchtung, und draußen hoffte eine kilometerlange Schlange von Bettlern auf ein paar Almosen.«
Statt weiter im Mahabodhi-Tempel zu meditieren, konzentrierte sich Lea auf die Bettler. »Ich ging die Straße entlang und kaufte Brot. Plötzlich kamen alle auf mich zugestürmt. Sie zerrten an mir, riefen mir zu, ihnen das Brot zu geben. Diese Menschen hatten wirklich Hunger.« Lea musste mit ansehen, wie sich ein Kind, eine alte Frau und ein Hund um ein Stück Brot stritten. Der Hund gewann, und Lea schämte sich für das Chaos, das sie angerichtet hatte.
»Weißt du, ich kenne Hunger nur von all den Diäten, die ich gemacht habe; ich weiß, wie das ist, wenn man den ganzen Tag ans Essen denkt, aber dieser Hunger in Indien hatte ja völlig andere Ursachen und Dimensionen.«
»Was war denn die Folge dieser Reise?«, fragte ich.
»Ich wollte mein Leben mit Sinn füllen. Ich hatte die Wahl: entweder in Antidepressiva und Selbstmitleid zu versinken oder etwas zu tun, was anderen hilft.«
Noch in Indien nahmen ihre Pläne Gestalt an. Als die Pilgergruppe Nepal erreichte, war das Hilfswerk Rokpa so gut wie gegründet.
»Wir gingen durch eine Gassenküche in Kathmandu, als mir plötzlich das Theaterstück einfiel, das meine Mutter geschrieben und mit meiner kleinen Schwester und mir aufgeführt hatte: ›Meine Kinder sind es‹, eine Erzählung über ein Kinderdorf mit lauter Waisen in Israel.«
Lea spielte den Jungen Uri, die Hauptrolle. Natürlich. Einen Straßenjungen aus Tunis, löchrige Hose, zerfetztes, schmuddeliges T-Shirt, wilder Typ. »Ich hatte die Geschichte von dem Straßenjungen ganz vergessen, bis ich auf die Straßenjungen in Nepal traf und plötzlich kam mir Uri in den Sinn, und ich verstand, warum ich den so gut gespielt hatte.«
Ein Jahr später gründete Lea Wyler mit Lama Rinpoche Rokpa und begann damit, in Nepal Kinder von der Straße zu holen. Ihr Anspruch? Helfen. Etwas von dem Guten zurückgeben, das sie bekommen hatte.
Veit Wyler arbeitete in seinem Anwaltsbüro die Statuten aus, während Lea Leuten auf die Nerven ging. Sie sammelte Geld, wo immer es ging, sprach nicht mehr über Mode, Schönheit, Theater, sondern nur noch über Rokpa.
»Rokpa bedeutet Hilfe oder Freund. Als ich anfing, waren alle passenden Namen schon vergeben, da habe ich einen tibetischen Namen gewählt, der gut im Ohr klingt.«
Sie sammelte und sammelte, verlor dabei alte Freunde, fand neue. Unternehmer unterstützten sie, Medienschaffende, unzählige Privatspender. Irgendwann hatte sie die erste Million zusammen.
Nach dem Interview freundeten wir uns an. Ich durfte mit Lea die Ostertage im Berghaus der Wylers in Celerina, Graubünden, verbringen; durfte in ihrem früheren Kinderzimmer – rundherum duftendes Zirbenholz – schlafen und erkundete die Landschaft. Während ich wandern ging, arbeitete Lea für Rokpa. Abends trafen wir uns zum Raclette; morgens besorgte ich Brötchen und Butter-Gipfeli. Für das Geld, das ich für Engadiner Nusstorte ausgab, hätte die Suppenküche in Kathmandu eine Woche lang ihre Gäste versorgen können, aber es war herrlich, mit Lea auf dem Sofa zu lümmeln, den Weihnachtsfilm »Tatsächlich Liebe« zu schauen und die Rundungen aufzufüllen.
Für mich hat Lea Maßstäbe gesetzt, wenn es darum geht, in Krisenzeiten die Nabelschau zu überwinden und den Blick auf größere Zusammenhänge zu lenken; auch andere Menschen ins Auge zu fassen. Einfach einmal die Perspektive zu wechseln, wenn ich auf der Stelle trete, hilft fast immer.
Heute war ich auf der Homepage von Rokpa. Unfassbar, was Lea in 40 Jahren auf die Beine gestellt hat: Tausende Projekte in Tibet, Nepal, Afrika. Die Klassiker: Schulen und Krankenstationen. Dazu ein Kinderhaus, ein Gästehaus, Unterrichtsräume für Frauen-Workshops, Nähkurse, Ausbildung im Hotelfach. Dann habe ich mir die Videos angesehen: Lea mit Hammer und Meißel auf der Rokpa-Baustelle; Lea bei der Vorbereitung zum Rokpa-Benefizkonzert mit dem Harfenisten Andreas Vollenweider; Lea on stage beim Spendensammeln. Lea Wyler ist noch immer eine fabelhafte Schauspielerin mit einer großartigen Bühnenpräsenz und überzeugenden Auftritten. 2019 war sie mit den Straßenkindern auf Europatournee mit einem Theaterstück über Rokpa – in der Rolle ihres Lebens.
»Iamhereandmymonkiswithme«, singsangte Danny vom Bentota-Fluss. Warum hatte ich es eigentlich wieder einmal so weit kommen lassen, dass die Bereifung runter war und ich nur noch auf den Felgen fuhr? Wie schaffen es andere, ihre Jahresenergie so zu verteilen, dass für jeden Monat gleich viel Strom bleibt und sie deshalb ganz entspannt am Ende Silvester feiern? Ich kenne keine Dämmerung, sondern bin entweder hellwach oder kippe völlig erschlagen ins Bett.
Von diesen Extremen wollte ich mich durch Ayurveda kurieren lassen, denn Ziel der flutschigen Heilmethode ist es, den Menschen ins harmonische Gleichgewicht zu bringen. Mit Hilfe von wohltuendem, warmem Öl. Sehr viel Öl. Dass die Frisur nach jeder Anwendung im Eimer war und die Sommerkleider nach der Kur entsorgt werden mussten, wusste ich bei meiner Ankunft noch nicht.
Zur Begrüßung gab es im Resort ein kühles Fruchtgetränk mit Strohhalm und dekorativem Gebamsel, dann war auch schon Sprechstunde mit Vermessung: Größe, Gewicht, Blutdruck, Puls; ein Blick in die Augen und zack! sollte klar sein, welches der drei Doshas, also Lebensenergien, in meinem Organismus die Nummer eins war.
Zur Orientierung: Der Vata-Typ ist begeisterungsfähig und lebhaft, mag keine Kälte, geht schnell und hat Probleme mit der Verdauung; Pitta-Menschen denken präzise, neigen zu Perfektionismus, sind eigenwillig, ungeduldig, können viel essen und erfreuen sich eines regelmäßigen Stuhlganges; Kaphas haben ein ausgeglichenes Gemüt, arbeiten geruhsam, bestechen durch ein ausgezeichnetes Langzeitgedächtnis und wissen, weshalb Pippin der Jüngere nach dem Aquitanien-Feldzug 742 Krach mit seinem Bruder bekam; Kaphas können immer und überall tief und fest schlafen und sind kaum aus der Fassung zu bringen. Bei mir diagnostizierte der Ayurveda-Arzt eine Fifty-Fifty-Mischung aus Vata und Pitta, verschrieb mir einen Sud, den ich abends vor dem Schlafengehen trinken sollte, und schickte mich durch den Palmengarten mit den großen Steinbuddhas zur ersten Ölung in den Behandlungstrakt.
Es roch fantastisch nach einer herb-süßen Duftnote in dem kleinen Raum, der ganz in Orange gehalten war. An den vier Ecken der Behandlungsbank lagen Hibiskusblüten, und zwei athletische junge Männer in grünen Polohemden warteten darauf, meine verspannten Muskeln in Öl zu tauchen und synchron durchzuwalken. So muss sich ein Salatblatt fühlen, wenn es mit Omega 3 veredelt wird. Obwohl mir kein Fitzelchen Kapha attestiert worden war, döste ich sofort ein und träumte mich weg.
So wie das von nun an auch bei jeder Meditation mit Danny passierte. Es war mir unmöglich, seinen Anweisungen zu folgen und an nichts zu denken. Langsam schob sich Sir Hugo ins Bild.
Sir Hugo - der Ritter aus dem Regenwald
»Berghuser’s Kemenade« stand auf dem Bronzeschild vor seinem Anwesen in Papua-Neuguinea. Ein freundlicher Willkommensgruß.
Hugo Berghüser stammte aus Bochum-Stiepel, sah mit seinem weißen, gezwirbelten Bart aus wie Kaiser Wilhelm II, und sammelte in der Kellerbar seines Hauses in Port Moresby Fahnen aus den Pazifik-Kriegen, die nach Jahren im feuchtwarmen Tropenklima schlaff und fadenscheinig von den Standarten hingen. In seinem Wohnzimmer hielt er einen toten Tiger, im Garten zwei lebendige Krokodile und im Teich eine stattliche Anzahl von Ochsenfröschen, die nachts einen Heidenlärm machten.
Als ich ihn kennenlernte, gab er mir gar nicht erst die Hand, sondern wirbelte mich durch die Luft und rief: »Kleine, auf dich hab ich mein Leben lang gewartet.« Ich war leicht verwirrt, fand die Art der Begrüßung aber durchaus originell und fühlte mich sofort wohl. Später sollte sich herausstellen, dass Hugo für Luftnummern jeglicher Art bekannt, beliebt, manchmal berüchtigt war.
Es war ein kleiner Ruhrgebiets-Kotten, in dem der Mann mit den buschigen schwarzen Augenbrauen als letztes von fünf Kindern im Oktober 1935 zur Welt kam. Im Garten wurde Gemüse gezogen, in den Ställen grunzten Schweine, im Hof scharrten Hühner. Dorfleben im Pott.
»Vater starb früh, Mutter zog die fünf Kinder alleine auf und als Kind habe ich always hart gearbeitet«, erzählt Hugo in seinem Deutsch-Englischen-Südsee-Mix und beißt ins Würstchen.
Nach sechs Jahren Schule und einer Schreinerlehre hielt ihn nichts mehr in Deutschland. »Handwerker werden überall gebraucht, und einem deutschen Schreiner macht so schnell keiner was vor.«
Mit 22 fasste er den Entschluss auszuwandern. Er bestieg im März 1958 in Bremerhaven ein Schiff, das ihn ans andere Ende der Welt bringen sollte. 1 288 Passagiere waren an Bord der Skaubryn. »1 800 Pfund hatte ich für die Überfahrt nach Australien zusammen, but wir hatten ’nen Schiffsbrand, die Skaubryn ging unter, alle wurden gerettet.«
Keine Panik. Kein Drama. Hugo reportiert – nach Ruhrgebietsart – cool und sachlich. Abenteureralltag eben. Hugo und die anderen Passagiere in ihren Rettungsbooten wurden von der City of Sidney aufgenommen, später dann von der Roma ins australischeMelbourne gebracht.
Worüber andere stundenlang schwadroniert hätten, das fasst Hugo in 30 Sekunden zusammen. Ein bisschen dunkelgelber Senf bleibt an seinen Schnurrbartspitzen hängen.
Ich traf ihn mehrfach. Zunächst als ich für das Hilfswerk MISSIO unterwegs war, dann fürs Radio, später drehten wir für die WDR-Serie Menschen hautnah eine Reportage über Sir Hugo, den Ritter aus dem Regenwald. Bei jeder Begegnung imponierte er mir mehr, weil er zupackte, statt sich zu beklagen. Weil er nicht darauf wartete, dass er versorgt wurde, sondern sein Leben selbst in die Hand nahm. Und weil ihm völlig egal war, was andere über ihn dachten und erzählten.
Als Modellschreiner hatte sich der Schiffbrüchige zunächst in Melbourne versucht, stieß dann zu Goldgräbern und Opalsuchern in Canberra und wählte schließlich den Südseestaat Papua-Neuguinea, damals noch unter australischem Protektorat, zur neuen Heimat. »Für die Australier war ich eher ein Mensch dritter Klasse, der schlechtes Englisch mit hartem Akzent sprach und nicht dazugehörte. Die Papua New Guinees haben mich sehr freundlich aufgenommen.«
Hugo arbeitete als Polier auf den Baustellen der Hauptstadt Port Moresby, Pot Mosbi,





























