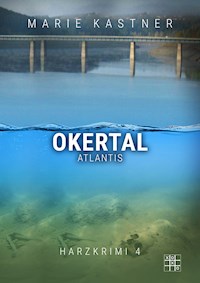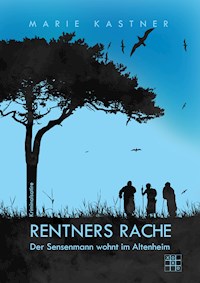Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: XOXO-Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Im Nordosten Rumäniens liegt ein kleines Waldstück, in dem seit Menschengedenken Mysteriöses geschieht. Menschen und Tiere verschwinden spurlos, seltsame Lichter und Naturphänomene werden beobachtet und metallene Objekte scheinen aus dem Nichts aufzutauchen. Während die Bevölkerung der Gegend respektvoll auf Abstand bleibt, werden Ufologen und Abenteurer aus aller Welt magisch angezogen. Im Sommer 2016 macht sich eine bayrische Gruppe aus Adrenalinjunkies auf den Weg nach Siebenbürgen ... Jenes im Buch beschriebene Waldstück, welches den Namen eines Schäfers trägt, der mitsamt seinen 200 Schafen dort verschwunden sein soll, gibt es wirklich. Es befindet sich in der Nähe der Stadt Klausenburg (Cluj-Napoca).
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 413
Veröffentlichungsjahr: 2020
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Der Schreckenswald des Hoia Baciu
Ein haarsträubender Horrorthriller von
Marie Kastner
XOXO Verlag
Impressum
Bibliografische Information durch die Deutsche Nationalbibliothek: Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://www.d-nb.de abrufbar.
Print-ISBN: 978-3-96752-024-8
E-Book-ISBN: 978-3-96752-524-3
Copyright (2019) XOXO Verlag Umschlaggestaltung: Grit Richter
© Ulrich Guse, Art Fine Grafic Design, Orihuela (Costa)
© Fotos/Grafiken: Lizenz von www.dreamstime.com
Buchsatz: Alfons Th. Seeboth
Rechtlicher Hinweis:
Sämtliche Personen, Orte und Begebenheiten rund um diesen Roman sind, abgesehen freilich von real existierenden Ortschaften, frei erfunden. Dasselbe gilt bezüglich der beschriebenen Vorgänge bei Behörden sowie anderen Institutionen oder Firmen. Eventuelle Ähnlichkeiten mit lebenden oder verstorbenen Menschen sowie deren Vereinigungen sind von der Autorin nicht beabsichtigt und wären daher rein zufällig. Selbstverständlich gilt letzteres nicht für ›Öffentliche Personen‹ aus der Politik.
Hergestellt in Bremen, Germany (EU)
XOXO Verlag
ein IMPRINT der EISERMANN MEDIA GMBH
Gröpelinger Heerstr. 149
28237 Bremen
Kapitel 1
Spurlos
Nordostrumänien, 11. August 1623
Ein sonniger Augustnachmittag neigte sich allmählich dem Ende zu. Der längliche Schatten eines schwarz verkohlten Baumgerippes erstreckte sich schon bis zum Feldweg, was dem dreiundfünfzigjährigen Schäfer Hoia als deutliches Zeichen diente, mit seiner Schafherde allmählich den Heimweg anzutreten.
Im vergangenen Frühjahr hatte ein Blitz in diese einsam in der Landschaft aufragende Pappel eingeschlagen. Seither erinnerten deren traurige Überreste den Schäfer tagtäglich an die Vergänglichkeit des Lebens. Durch einen einzigen Schlag des Schicksals konnte alles aus und vorbei sein, deswegen galt es, das Dasein in jedem einzelnen Augenblick in vollen Zügen zu genießen. Und das tat Hoia fürwahr, er liebte seinen Beruf und das bescheidene Leben in der freien Natur über alles.
Schon Hoias Vater und Großvater waren hier, am nordwestlichen Rande der Stadt Cluj-Napoca[Fußnote 1], diesem angesehenen Gewerbe nachgegangen, und so hatte er selbst das edle Handwerk des Schafscherens schon als Junge erlernt. Die ruhigen, genügsamen Mitglieder der Familie Baciu waren im Dorf von jeher sehr angesehen und beliebt, denn sie galten trotz ihrer Armut als freigiebige, gastfreundliche Menschen.
Wer Hoia oder seine Angehörigen jedoch bestehlen oder ausnutzen wollte, besaß schlechte Karten. Bei aller Gutmütigkeit gab es Grenzen, die niemand überschreiten durfte. Der sonst so nette Kerl konnte, wenn man ihn nur lange genug triezte, zum absoluten Berserker werden. Diese unschöne Erfahrung hatten gewalttätige Männer diverser Zigeunerclans in den vergangenen Jahren bereits machen müssen; seither vermieden sie Zusammenstöße mit ihm, umgingen meistens sogar das ganze Dorf, um sich anderswo nach unbedarften Opfern für Nepperei und Diebstahl umzusehen. Unter anderem deswegen schätzte man ihn in der Dorfgemeinschaft über die Maßen.
Zufrieden aufseufzend, beschirmte der vierschrötige Ungar seine Augen mit der Rechten gegen die tief stehende Sonne, um nach dem Leitschaf zu suchen. Dieses rupfte gerade mit Begeisterung saftige Kräuter am Waldrand, und er wollte es noch ein Weilchen gewähren lassen. In verschiedenen Stimmlagen blökend, scharte sich die restliche Herde rund um das Tier.
Hoia ignorierte das unwirsche Knurren seines Magens und setzte sich lächelnd in die farbenfrohe Wildblumenwiese, um gemächlich an seinem Stock weiter zu schnitzen. Auf den treuen Hirtenhund Marius konnte er sich blind verlassen, der würde die Herde schon zusammenhalten. Wie immer.
Höchstens ein halbes Stündchen noch, dann wollte er sich in Richtung des Dorfes aufmachen. Sobald die Sonne hinter dem Horizont versank, musste er das Revier für die Geschöpfe der Nacht freigeben. Dann nämlich wagten sich Rehe, Füchse und allerlei Kleingetier aus dem Dickicht, hungrige Wölfe trieben ihr Unwesen in Wald und Flur. Alles und Jedes hatte eben auf dieser Welt seine Zeit. Hoia respektierte das ohne zu murren.
Ja, er konnte mit seinem Leben rundum zufrieden sein. Seine Frau war unter Garantie gerade dabei, einen ihrer schmackhaften Eintöpfe vorzubereiten. Vielleicht zauberte sie Gulasch mit viel Paprika und Zwiebeln, so wie er es liebte. Bei der bloßen Vorstellung an diese deftige Köstlichkeit lief ihm unwillkürlich das Wasser im Mund zusammen. Der Magen meldete sich wieder, zwickte und zwackte voller Vorfreude.
Eventuell könnte er nachher zum Abendessen bereits seine beiden erwachsenen Söhne begrüßen, die heute auf dem allwöchentlichen Markt in der Stadt Rohwolle verkauft hatten, sinnierte er lächelnd. Hoffentlich waren sie dabei erfolgreich gewesen und brachten ein paar Geldstücke mit. Der einunddreißigjährige Valeriu war als Schäfer bereits früh in die Fußstapfen seines Vaters getreten, während der um zwei Jahre jüngere Radu auf der Westseite der prosperierenden Stadt, drüben in Floreşti, eine kleine Schmiede besaß. Dennoch war er zu jeder Tagesund Nachtzeit zuverlässig zur Stelle, wenn Hoia nach ihm rief.
Sein drittes Kind, eine zarte Tochter namens Mia, war leider schon in ihrem ersten Lebensjahr an einem Fieber verstorben. Das war vor vierzehn Jahren gewesen. Er wollte dennoch nicht klagen, denn seine beiden wohlgeratenen Nachkommen und drei Enkelkinder trösteten ihn seither über diesen Verlust hinweg. Der Tod gehörte nun mal untrennbar zum Leben, dessen war er sich bei aller Trauer bewusst.
Etwas Seltsames riss den Schäfer abrupt aus seinen sentimentalen Gedankengängen. Dabei handelte es sich allerdings um kein Geräusch – eher um das Gegenteil davon.
Es war totenstill. Bis auf das Summen der Fliegen und Honigbienen, die den Schäfer umschwirrten, drang kein Laut an Hoias Ohren. Alarmiert blickte er auf, suchte am Rande jenes lichten kleinen Waldstücks, welches er seit der Jugend wie seine Westentasche kannte, nach seiner Herde.
Aber da war nichts. Kein einziges Schaf, kein Hund. Er runzelte erstaunt die Stirn, kratzte sich erst einmal nachdenklich am kahlen Hinterkopf. So schnell ließ er sich grundsätzlich nicht aus der Ruhe bringen.
Narrten ihn womöglich bloß seine Augen? In letzter Zeit sah er nicht mehr so gut wie früher. Aber nein … die Umrisse der Bäume vermochte er ganz klar zu erkennen, somit konnte eine Sehschwäche wohl kaum die Ursache für das plötzliche Verschwinden seiner kompletten Herde sein.
Seit er sich zum Schnitzen hingesetzt hatte, waren allerhöchstens fünf bis zehn Minuten vergangen. Und wieso hätten die Schafe überhaupt in diesen Wald laufen sollen? Sowas war bislang noch nie vorgekommen, schon weil dort der Bodenbewuchs nicht viel Nahrhaftes zum Knabbern hergab.
›Könnten sie sich erschreckt haben und davongelaufen sein?‹ Manchmal trieben ungezogene Zigeunerjungen in dieser Gegend ihr Unwesen. Es half alles nichts, er würde auf der Stelle nachsehen gehen müssen. Stöhnend rappelte er sich hoch.
Mit jedem Schritt, der ihn näher an den Waldrand trug, wurde die Sache mysteriöser. Es schien, als habe die Natur den Atem angehalten, als sei die Zeit selbst stehengeblieben. Es herrschte völlige Windstille. Sogar die Vögel waren verstummt, der Himmel wirkte wie leergefegt.
Hoia begann aus sämtlichen Poren zu schwitzen, beschleunigte beunruhigt seinen Gang. Noch immer keine Spur von seinen Schafen. Seine Rufe und Pfiffe verhallten ungehört.
Er erreichte keuchend die ersten Bäume. War es möglich, dass der Wald heute erheblich düsterer wirkte als sonst? Er schüttelte den Kopf, schalt sich einen einfältigen Narren.
Höchstwahrscheinlich war das fahrende Volk an solchen trügerischen Wahrnehmungen schuld, denn dieses war nach seiner Ansicht für zahllose Mythen und Legenden verantwortlich, die sich um diesen Landstrich rankten. Man raunte sich hinter vorgehaltener Hand haarsträubende Geschichten über böse Geister zu, die angeblich mit grünen Laternen nach verirrten Lebenden suchten, um sie für immer in ihren Bann zu ziehen. Männer wie Frauen mieden das kleine Waldstück wie die Pest. Die meisten wagten es nicht einmal, in seine Richtung zu blicken.
Ammenmärchen. Nichts als saublöde Ammenmärchen, die ihm jetzt diese Trugbilder bescherten. Von einem blutrünstigen Vlad in Transsylvanien bis hin zum sogenannten Lacul Dracului im Locvei-Gebirge – es gab Unmengen an unheimlichen Sagen in diesem verwunschenen Land und sehr häufig kamen angebliche Machenschaften des Teufels darin vor. Diese Geschichten waren höchstens zum Erschrecken von Frauen und kleinen Kindern geeignet, doch er, ein ausgewachsener, breitschultriger Hüne, würde sich hiervon bestimmt nicht ängstigen lassen.
Es reichte schon, dass seine sonst recht bodenständige Frau es sich jedes Jahr in der ersten Märzhälfte nicht nehmen ließ, eine rotweiße Mărţişor[Fußnote 2]-Schnur samt silbernem Schneeglöckchenanhänger als Talisman im Ausschnitt zu tragen. Auch dieser beliebte Brauch gründete auf einer uralten Sage. Immerhin, sie sah damit zum Anbeißen aus.
»Ach, albernes Zeug!«, schimpfte Hoia, wischte sich mit dem Hemdsärmel Schweißperlen von der Stirn, trat beherzt zwischen zwei jungen Birken hindurch … und ward nicht mehr gesehen.
*
Die dralle Mirela rannte schon zum fünften Mal nach draußen, um besorgt nach ihrem Gatten und den Schafen zu sehen. Inzwischen war die Nacht hereingebrochen. Irgendwo in der Ferne schrie ein Käuzchen. Valeriu versuchte nach Kräften, seine höchst nervöse Mutter zu beruhigen.
»Jetzt mach dir mal keine Sorgen. Vater kann bestens auf sich aufpassen, wie du weißt. Bestimmt hat ihn einer der Nachbarn um Hilfe gebeten – oder ein Schaf hat sich verirrt und er muss es erst suchen gehen. Niemals würde er einen seiner Schützlinge da draußen alleine zurücklassen.
Möglicherweise sind auf dem Rückweg Lämmchen geboren, so wie letztes Jahr einmal, erinnerst du dich? In einem solchen Fall muss er ein Weilchen warten, bis er die Herde weitertreiben kann. Die Jungtiere wären sonst noch zu schwach. Komm, lass uns schon einmal essen. Es gibt viel zu erzählen und wir haben heute gute Geschäfte gemacht.«
Behutsam packte der drahtige junge Mann seine widerspenstige Mutter an beiden Schultern, drehte sie mit sanfter Gewalt zu sich um und sah ihr tief in die verweinten Augen. »Der kommt bald zurück. Ich bin mir da vollkommen sicher.«
»Ich fühle aber in meinem Leib, dass hier etwas nicht stimmt! Meine Verbindung zu Hoia ist nach all den Jahren noch so innig wie am ersten Tag, auch wenn wir gelegentlich erbittert streiten. Du kannst es dir ruhig für deine eigene Ehe merken, Valeriu. Das einzige Gift, das die Leidenschaft zwischen Mann und Frau tatsächlich abtöten kann, ist Gleichgültigkeit. Und dein Vater ist mir alles andere als gleichgültig«, protestierte Mirela, verschränkte trotzig die Arme vor der Brust.
»Ihr dürft euch gerne schon die Teller füllen, wenn ihr Hunger habt – aber ich bleibe hier stehen und werde erst beruhigt sein, wenn ich Hoias Laterne am Horizont erkennen kann.«
Seufzend setzte sich Valeriu zu seinem Bruder an den groben Holztisch zurück, zuckte ratlos mit den Schultern. »Was denkst du?«, raunte er Radu hinter vorgehaltener Hand zu.
»Ehrlich gesagt … ich weiß es nicht. Es könnte ja tatsächlich sein, dass Vater am Wald auf Räuber getroffen ist, sich ein Bein gebrochen hat oder schon wieder in tätliche Streitigkeiten mit einer gewissen Sippe geriet. Ich schlage also vor, dass wir ihn suchen gehen – aber zuerst muss ich einen Happen essen, sonst fehlt mir die Kraft für eine Nachtwanderung. War ein überaus anstrengender Tag heute.«
»Gut … in Ordnung, das klingt recht vernünftig. Hoffentlich ist Vater zurück, bis wir nachher die Löffel beiseitelegen. Mir ist heute nämlich ebenfalls nicht nach einem weiteren Fußmarsch zumute. Außerdem werden schließlich auch wir beide zu Hause erwartet.«
Schweigend löffelten die Brüder ihren Gemüseeintopf, behielten hierbei ihre Mutter im Blick. Diese stand noch immer vollkommen bewegungslos im Türrahmen der Holzhütte. Die Fransen ihres um die Schultern gelegten Wolltuches bebten gelegentlich, vermutlich weinte sie leise vor sich hin.
Eine Stunde später war der Schäfer noch immer nicht zurückgekehrt. Zu allem Überfluss kündigte sich ein Wärmegewitter an, in der Ferne zuckten die ersten Blitze. Wind kam auf. Der Wipfel einer neben dem Geräteschuppen stehenden alten Kiefer wurde von auffrischenden Böen ordentlich durchgeschüttelt.
»Glaubt ihr mir nun allmählich, dass da etwas faul sein muss? Ich halte das Warten nicht mehr aus, möchte etwas unternehmen. Am besten, ich gehe zu den Nachbarn hinüber und frage nach, ob Toma ihn auf seinem Weg ins Dorf unterwegs gesehen hat. Der kommt auch immer erst kurz vor Einbruch der Dunkelheit zurück«, schluchzte Mirela. Sie griff fahrig nach einer der beiden Laternen, die neben der Tür an einem schmiedeeisernen Haken hingen und den Vorplatz der bescheidenen Behausung erhellten.
»Nein, du bleibst hier!«, widersprach Valeriu selbstbewusst. Er nahm ihr die Laterne aus der Hand.
»Eine Frau sollte um diese Tageszeit niemals alleine draußen unterwegs sein. Unser Haus steht zu abgelegen, du müsstest zu weit laufen. Man weiß nie, welches Gesindel sich im Schutze der Nacht herumtreibt und üble Absichten hegt. Außerdem fürchtest du dich vor Gewittern und man kann bereits Donnergrollen hören. Das Unwetter kommt schnell näher. Möchtest du etwa auch noch verloren gehen? Wir beiden Männer werden das erledigen. Jemand muss schließlich hier die Stellung halten, falls er inzwischen doch daheim auftauchen sollte.
Zuerst befragen Radu und ich die Nachbarn. Sollte niemand Vater gesehen haben, laufen wir anschließend auf dem üblichen Weg zum Wald hinüber und suchen nach ihm. Dort war er doch zuletzt mit seiner Herde?«
Mirela nickte, ließ resigniert ihr Kinn sinken. Radu fand, dass sie plötzlich um Jahre gealtert wirkte.
»Nehmt euch bloß vor Wölfen in acht«, mahnte sie mit rauer Stimme. »Es sind einige in der Gegend gesehen worden!«
»Die tun uns doch nichts! Um diese Jahreszeit finden sie im Wald genügend zum Fressen, da legen sie sich wohl kaum mit Menschen an«, winkte Radu grinsend ab. Niemals hätte er in Anwesenheit seines großen Bruders zugegeben, dass ihm gelb leuchtende Wolfsaugen schon einige schlaflose Nächte bereitet hatten. Aber hier ging es um seinen Vater, also musste er seine Ängste vor den Schrecknissen der Finsternis ignorieren.
Während sich die Söhne des Schäfers auf den Weg machten, kniete Mirela mit gefalteten Händen vor ihrem kleinen Hausaltar nieder und betete inbrünstig zu Maria, der Schutzheiligen aller Frauen. »Ich wüsste doch nicht, was ich in einer Zukunft ohne meinen Hoia anfangen sollte. Beschütze uns alle, Mutter Gottes, wir sind anständige Menschen. Bitte mach, dass mich mein ungutes Gefühl wenigstens dieses eine Mal trügt. Lass meine Familie wohlbehalten zu mir zurückkehren.«
Ein besonders lauter Donnerschlag ließ sie zusammenzucken, dann zog das Unwetter ab.
Die Mitternachtsstunde war längst vorbei, als die Baciu-Söhne mit wirrem Haar und verstörtem Blick ihr Elternhaus erreichten. Beide waren tropfnass, die Kleidung schlammverschmiert. Auf dem morastigen Boden glitt man leicht aus.
Schon von weitem hatte Mirela die tanzenden Lichtpunkte gezählt und auf drei sich nähernde Laternen gehofft. Aber so sehr sie sich die Augen auch aus dem Kopf starrte, es waren und blieben nur zwei. Die dunkelhaarige Frau wurde kreidebleich.
Valeriu und Radu nahmen ihre Mutter in die Mitte, denn ihr versagten die Knie. »Wohin … wo kann er bloß abgeblieben sein? Habt ihr denn gar nichts gefunden, auch keines der Tiere?«, hauchte sie tonlos.
Die Brüder geleiteten sie fürsorglich zu einer Bank im Inneren der Hütte, deren Sitzfläche weich mit einem schwarz gescheckten Schaffell gepolstert war, und ließen sich erschöpft neben sie fallen. Valeriu zog stöhnend die schweren Stiefel aus, betastete seine schmerzenden Zehen. Es verbreitete sich augenblicklich ein muffiger Geruch im Raum, der stark an verwesenden Käse erinnerte. An anderen Tagen hätte Mirela ihn dafür gerügt, doch nicht heute.
»Nichts, einfach gar nichts. Keinerlei Spur von Vater, ebenso wenig von der Herde. Niemand hat ihn seit dem frühen Nachmittag mehr gesehen. Wir haben sogar kurz im Wäldchen nachgeschaut, aber dort ist es in der Nacht bei abnehmendem Mond derart finster und dunstig, dass man die Hand vor Augen nicht erkennen kann. Richtig unheimlich war es da drinnen, ganz so, als würde eine dunkle Nebelwand das Licht der Laternen verschlucken.
Wir müssen abwarten, bis es hell wird, können erst dann intensiv weitersuchen. Vater muss sich verirrt oder irgendwo anders Zuflucht gesucht haben. Wahrscheinlich kommen wir nur nicht drauf, wo das sein könnte.
Es tut mir leid, Mutter … wir haben für den Moment wirklich alles getan, was in unserer Macht steht«, erzählte Valeriu traurig. Er starrte beim Sprechen deprimiert auf den Fußboden, konnte seiner Mutter nicht in die Augen sehen. Der Ausdruck von heller Panik darin hätte ihm das Herz gebrochen.
»Toma Popescu hat sich vorhin zum Glück bereit erklärt, mit seinem Fuhrwerk zu unseren Familien zu fahren, damit sie sich wegen unseres langen Wegbleibens nicht zusätzlich sorgen müssen. Unterwegs wird er die Augen und Ohren offen halten, vielleicht entdeckt er die Vermissten ja zufällig. Wir bleiben für den Rest dieser Nacht besser hier, um dir beizustehen. An Schlaf wäre sowieso nicht zu denken«, ergänzte Radu einfühlsam, streichelte ihre schlaffe, kalte Hand.
Mirela war indes zu keiner Äußerung fähig. Nichts und niemand hätte ihr die tonnenschwere Last von den Schultern nehmen können. Sie gab einen klagenden Ton von sich und brach zusammen, ohne das Gehörte kommentiert zu haben.
*
Im Morgengrauen versammelte sich die kleine Dorfgemeinschaft fast vollzählig am Ortsrand von Suceagu. Nur die ältesten Einwohner waren zu Hause geblieben, schließlich musste jemand auf die Kinder aufpassen. Man schwatzte, mutmaßte und tauschte Ideen aus, bis wohin man die Suche nach dem Nachbarn Baciu ausdehnen sollte.
Mirela hatte es sich trotz ihres desolaten Zustands nicht nehmen lassen, mitzukommen. Die Frauen des Dorfes scharten sich um sie, zeigten Anteilnahme und versuchten auf mannigfaltige Weise, die Verzweifelte zu beruhigen.
»Wäre dein Mann verschleppt worden, hätte man mittlerweile doch zumindest den Hund oder vereinzelte Schafe finden müssen. Dass sie allesamt wie vom Erdboden verschwunden sind, ist eher ein gutes Zeichen.
Oh nein, Mirela – die sind bestimmt einfach weiter als sonst gewandert, Hoia hat sich durch ein Gespräch oder eine Begegnung ablenken lassen und ist von der hereinbrechenden Dunkelheit überrascht worden. So muss es sein! Wahrscheinlich sitzt er zur Stunde wohlbehalten in einer wildfremden Bauernstube, haut ein üppiges Frühstück rein und ahnt gar nicht, dass wir uns wegen ihm grämen. Hoffen wir also für ihn, dass er letzte Nacht kein ›Schäferstündchen‹ mit einer einsamen Witwe genossen hat. Sonst ziehst du ihm nachher eigenhändig das Fell über die Ohren«, versuchte sich die junge Tereza an einem schwarzhumorigen Scherz.
Solche und ähnliche Kommentare wollte die Hirtenfrau aber partout nicht hören. Ihr Herz kannte die furchtbare Wahrheit; dennoch hoffte sie inständig, es möge sich irren. So drängte sie die anderen ungeduldig zum Aufbruch.
Der achtzehnköpfige Suchtrupp setzte sich nach einer kurzen Wegbesprechung gemächlich in Bewegung, viel zu langsam für Mirelas Geschmack. An den zahllosen frischen Kotkügelchen der Schafe war zweifelsfrei abzulesen, wo Hoia und die Herde entlang gekommen waren. Er hatte seine Tiere tatsächlich links und rechts jenes Feldweges grasen lassen, der direkt zum sogenannten Teufelswald führte. Nach ungefähr zwanzig Minuten passierten sie die abgebrannte Pappel, strebten geradewegs dem Waldrand zu.
»Dort hinein bringen mich aber keine zehn Pferde! Ihr wisst doch, was man sich über diesen Ort erzählt«, stellte Tereza fest, schlang beide Arme fest um ihren schlanken Körper und blieb mitten auf dem Weg abrupt stehen. Andere Frauen taten es ihr nach, nickten zustimmend.
»Jetzt seid nicht albern, ihr abergläubisches Weibsvolk! Es ist helllichter Tag. Was sollte euch da schon passieren? Wir durchkämmen das Waldstück einfach so, dass jeder von uns einen der anderen stets in Sichtund Rufweite behält. Ich glaube nicht an lächerliche alte Schauergeschichten, und ihr solltet das gefälligst auch nicht tun«, verfügte Toma genervt.
Just als er die verängstigten Frauen mit gutem Zureden fast vom Sinn dieser Vorgehensweise überzeugt hatte, tauchte plötzlich eine bunt gekleidete Frau mit hüftlangem schwarzem Haar am Wegesrand auf. Ihr wilder Blick und die vielen Armreifen wiesen sie als Angehörige einer Zigeunersippe aus.
»Das ewig Böse ist wieder erwacht! Geht hinein und ihr werdet allesamt auf grausame Weise sterben«, stieß sie mit kehliger Stimme hervor, kicherte schadenfroh – und verschwand genauso schnell und leichtfüßig, wie sie gekommen war.
Ihr eindrucksvoller Auftritt führte dazu, dass keine der Frauen freiwillig einen Fuß in den mutmaßlich verfluchten Wald setzen wollte. Alle weigerten sich hysterisch, ob Toma nun bettelte, an ihre Hilfsbereitschaft appellierte oder mit Spott drohte. Die eine oder andere bekreuzigte sich hastig.
Die Gruppe teilte sich notgedrungen auf. Während die Männer fluchend zwischen den Bäumen verschwanden, suchten die Frauen das Gebiet außerhalb ab. Wortlos, weil jede einzelne von einem unheimlichen Gefühl beschlichen wurde.
An diesem Tag wirkte alles auf unerklärliche Weise falsch, obgleich die vertraute Landschaft im strahlenden Sonnenschein vor ihnen lag. Die Vögel ließen sich nicht am Himmel blicken, auch sonst gab es kaum Geräusche. Selbst das Tageslicht wirkte verändert. Gleißend, aber wie durch graues Glas gefiltert.
Speziell die feinfühlige Tereza verspürte beunruhigt eine Art elektrisches Kribbeln, das sich in Wellen über ihren gesamten Körper zog und Gänsehaut erzeugte. Am liebsten hätte sie sich die Haut von den Knochen gerissen. Sie zweifelte mittlerweile stark an ihrer eigenen Aussage, dass Hoia im Tagesverlauf bestimmt unversehrt wieder auftauchen werde.
Die Frauen fanden auf Wegen und Wiesen jede Menge Spuren vom Vermissten und seinen Schafen – doch das war leider auch schon alles. Hinter jeden Busch spähten sie, wohl wissend, dass sich dahinter schwerlich zweihundert Schafe nebst Schäfer verbergen könnten. Achselzuckend machten sie am vereinbarten Treffpunkt Halt und warteten niedergeschlagen auf die Rückkehr ihrer Gatten, Söhne und Väter.
»Ich fürchte mich. Was, wenn wir sie auch an den Wald verlieren?«, jammerte eine ältere, hagere Frau namens Sofia, die sich zum Ausruhen auf einen flachen Felsen gesetzt hatte. Sie hielt ihre krallenartigen, runzlig-fleckigen Hände im Schoß gefaltet. Da ihr Ehemann im vergangenen Winter verstorben war, kümmerte sich seither der einzige Sohn um sie. Und der weilte gerade in einem Waldstück, das seit Generationen ein Zentrum für unerklärliche Phänomene zu sein schien.
»Pah, lass das Jammern lieber bleiben. Mir ist ohnehin schon nach Davonrennen zumute«, sagte Tereza vorwurfsvoll. »Außerdem habe ich da drüben gerade ein verräterisches Knacken gehört. Ich glaube, sie kommen!«
Alle Blicke richteten sich auf den Waldrand. Nur Sekunden später traten die herbeigesehnten Männer fast zeitgleich ins helle Tageslicht, beschirmten ihre Augen mit den Händen. Sie wirkten bei weitem nicht mehr so forsch und mutig wie noch vor zweieinhalb Stunden. Der gesuchte Schafhirte war allerdings nicht unter ihnen.
»Und?«, bohrte die vorlaute Tereza ungeduldig nach. Männer waren ja sowas von maulfaul!
»Nichts. Es sieht danach aus, als wären sie außerhalb des Waldes geblieben. Und bei euch?«
»Spuren gibt es trotz der Regenfälle, sogar jede Menge davon. Niedergetrampeltes Gras, Kot, abgerupfte Kräuter, Brotkrümel
… aber weit und breit kein Hoia, kein Hund und erst recht kein Schaf. Weder lebend noch tot«, antwortete Tereza augenrollend. Die Männer setzten sich ins Gras und wurden mit einer Vesper aus dem mitgebrachten Korb versorgt.
Am späten Nachmittag machte sich die Truppe ergebnislos auf den weiten Nachhauseweg. Mirela musste gestützt werden. Gut fünfundzwanzig Kilometer, die sie über Stock und Stein gewandert waren, steckten den hilfsbereiten Dorfbewohnern in den müden Beinen. Sie mussten die Suche schweren Herzens abbrechen, zu Hause ihre Tiere versorgen.
Tereza sah den wortkargen Männern überdeutlich an, dass sie im Wald auf etwas Unaussprechliches gestoßen sein mussten. Hatten sie womöglich Hoias Leiche gefunden und wollten ihre grausige Neuigkeit nur aus Pietätsgründen noch nicht preisgeben? So unauffällig wie irgend möglich schob sie sich beim Gehen näher an ihren Vater Toma heran.
»Was ist da drin vorgefallen? Mir kannst du es doch sagen!«, gurrte die hübsche Siebzehnjährige mit einem taktischen Augenaufschlag. Der verfehlte seine Wirkung selten, was sie sehr genau wusste. Toma wiederum kannte seine Jüngste. Die würde garantiert nicht locker lassen, bevor sie ihn nach allen Regeln der Kunst ausgequetscht hatte. So ergab er sich ins Unvermeidliche, blickte sich links und rechts über die Schultern um sicherzustellen, dass sonst niemand zuhörte, und schilderte mit leiser Stimme die Waldbegehung.
»Du erinnerst dich doch sicher, dass ich dir als Kind von einer kreisrunden Lichtung erzählt habe, auf der zu keiner Jahreszeit jemals Pflanzen wachsen? Diese Stelle wird landläufig Tanzboden des Teufels genannt. Im Winter sieht sie übrigens genauso aus wie jetzt, selbst Schneeflocken meiden sie. Rundherum liegt dann ein Meter Schnee, doch der Kreis bleibt frei.
Wahrscheinlich war noch niemand so dumm, die ebene Fläche zu betreten oder gar näher in Augenschein zu nehmen. Man spürt instinktiv, dass dies ein kapitaler Fehler wäre. Die umstehenden Bäume biegen sich weg, kein Zweig ragt hinein.
Nun, wir sind vorsichtig am Rand dieses unheimlichen Ortes entlang gegangen und haben festgestellt, dass selbst der Wind ihn zu meiden scheint. Nichts rührte sich, man hörte nichts und konnte dort nicht einmal mehr das nasse Gras riechen. Man meint, die Natur halte den Atem an. Und die Lichtverhältnisse passen nicht zur Tageszeit! Obwohl das Sonnenlicht direkt von oben einfallen müsste, wirkt die kahle Stelle düster, was ich mir überhaupt nicht erklären kann.
Wenige Meter weiter fiel Radu dann auf, dass an mehreren Bäumen einzelne Äste verbrannt aussahen und auch so rochen. Dabei kann es in diesem kleinen Wald in letzter Zeit nicht gebrannt haben, denn das hätte man weithin gesehen! Normalerweise fackeln Bäume zudem vollständig nieder, wenn sie einmal Feuer gefangen haben, nicht jeweils nur einzelne Äste, oder? So ähnlich wie die Pappel am Wegrand. Es müsste versengtes Gras zu sehen sein, oder wenigstens Rußspuren … !«
Tereza nickte mit weit aufgerissenen Augen. Ihr lief es eiskalt den Rücken hinunter, doch sie hielt Wort und wahrte das Geheimnis. Es reichte, dass sie sich durch eigene Schuld nun noch mehr als zuvor ängstigte, aber diese Erfahrung wollte sie den restlichen Frauen nicht auch noch zumuten.
Und tatsächlich, in der folgenden Nacht suchten sie fürchterliche Albträume heim. Schwitzend wälzte sich Tereza kreuz und quer durch ihr Nachtlager. Mehrfach stand sie auf, spähte mit wild pochendem Herzen durch das Fenster ihrer Kammer zur dunklen Silhouette des Waldes hinüber. Glomm dort ein grünliches Licht? Vermutlich nur Einbildung – oder doch nicht?
Das hatte sie nun von ihrer leichtfertigen Neugierde! Dieser verdammte Wald … Tereza nahm sich fest vor, so weit wie möglich vom Schauplatz des Grauens wegzuziehen, sobald sie einen lieben Ehemann gefunden hätte.
In den folgenden Wochen befragten die ratlosen Dorfbewohner jeden, dessen sie habhaft werden konnten, aber durch keines der angrenzenden Dörfer war der Hirte gewandert. Auch der örtliche Polizeiposten fahndete nach dem Verbleib von Hoia Baciu – oder gegebenenfalls seiner Leiche. Vergeblich, der Schäfer war und blieb spurlos verschollen.
Nach einem Jahr wurde für die Polizei ein ungeklärter Vermisstenfall aus der Sache. Für die abergläubischen Einwohner der Dörfer rund um den Wald stand hingegen fest, dass sich die Mächte der Finsternis Hoias bemächtigt hatten und sie ihn niemals wiedersehen würden. Sicher … es kam durchaus vor, dass Personen Verbrechen zum Opfer fielen und man sie beseitigte. Leichname wurden, soweit sie nicht begraben waren, meist von wilden Tieren gefressen. Aber mitsamt einer kompletten Herde? Das war mehr als mysteriös, da mussten einfach Dämonen am Werk gewesen sein – oder gar der Leibhaftige selbst!
Hoias untröstliche Ehefrau Mirela nahm sich vor Einbruch des folgenden Winters das Leben. Sie erhängte sich der Überlieferung nach in einer stürmischen Nacht am Rande des Teufelswaldes.
Valeriu und Radu warnten ihren Kinder und Kindeskinder eindringlich von jenem Waldstück, das Lebewesen spurlos verschwinden ließ. Genau wie die restlichen Bewohner des Landstrichs im Kreis Cluj. Und dennoch kam es vor, dass sich, über Jahrzehnte und Jahrhunderte hinweg, immer wieder törichte Menschen in die Nähe dieses verhexten Ortes wagten. Insbesondere Ausländer trieb die pure Neugierde, welche nicht selten als Forschergeist deklariert wurde, dorthin.
Kapitel 2
Der Nabel des Wahnsinns?
Popeşti/Pfaffendorf, Kreis Cluj, Spätherbst 1954
Das beschauliche Dörfchen Popeşti bestand gerade mal aus fünf bescheidenen Wohnhäusern und einer aus Holz erbauten Kirche, vor welcher ein vergleichsweise riesiges Kruzifix aufgestellt war. Es sollte alle bösen Einflüsse von den Bewohnern fernhalten und das schien auch bitter nötig zu sein.
Im Jahr 1848 hatten sich rumänische Bauern aus dem Landkreis Cluj in der nahen Kleinstadt Luna versammelt, um gegen die Einberufung in die ungarische Revolutionsarmee zu protestieren. Am 12. September desselben Jahres verübte diese Armee, der Geschichtsschreibung nach, unter den Aufständischen ein Massaker. Es forderte dreißig Todesopfer. Unter den Opfern dieser Bluttat war auch ein Bauernsohn aus Popeşti gewesen und seither hielt sich hartnäckig die Mär, dass es in der Gegend spuke.
Aus dieser geschichtlich belegten Begebenheit hatte sich mit der Zeit ein regelrechter Volksglauben entwickelt. Man erzählte sich über Generationen hinweg mit einem gehörigen Schaudern, dass die Seelen der Ermordeten zwischen den Bäumen des nahe gelegenen Baciu-Waldes gefangen seien, dort bis in alle Ewigkeit ruhelos umhergehen müssten. Mit giftgrün schillernden Augen, die aus schwarzen Nebelschwaden leuchteten, machten sie angeblich die Lebenden auf ihre Qual aufmerksam.
Wann immer überlieferte Geschichten lange genug von Mund zu Ohr weitergegeben werden, gelten sie schon nach wenigen Jahrzehnten und Generationen als Legenden. Fakten und subjektive Erinnerungen werden mit zusätzlichen Details angereichert – bis eine in sich stimmige Erzählung entsteht, alle Puzzleteile auf wundersame Weise zusammenzupassen scheinen. Triviale Randereignisse, Theorien und abenteuerliche Schlussfolgerungen von Einzelnen werden mit hinein gewoben, auch wenn sie mit der eigentlichen Story kaum etwas zu tun haben.
Man könnte fast glauben, dass mit jedem Weitergeben ein Stückchen mehr Wahrheit darin enthalten sei, dabei ist eher das Gegenteil der Fall. Speziell das nördliche Rumänien mit seinen schroffen Hügeln, dichten Wäldern und Vampirgeschichten ist von jeher ein Land, in dem solche Legenden nicht nur die Zeiten unbeschadet überdauern, sondern in den Gehirnen quicklebendig bleiben und immer farbiger ausgeschmückt werden. Aus einer Legende kann auf diese Weise Überzeugung, wenn nicht sogar Gewissheit werden.
So geschah es natürlich auch im Falle der ermordeten Bauernschar. Bereits kurz nach diesem furchtbaren Ereignis berichteten nahe Anwohner des Baciu-Waldes von einem unheimlichen Heulen, das vorwiegend des Nachts auftrat. Andere wollten ein diffuses Leuchten wahrgenommen haben. Es strahle zwischen den Bäumen hervor, intensiviere sich und wechsle mehrmals die Farbe von Weiß zu Grün und wieder zurück, wurde erzählt.
Außerdem schworen die Leute Stein und Bein, dass in besagtem Waldstück häufiger Nebel auftrete als anderswo, und dass er undurchdringlicher und dunkler ausfalle. Eine logische Erklärung hatte für diese seltsame Naturerscheinung niemand parat.
In Popeşti wagte kein Einwohner, nach Beginn der Abenddämmerung das Haus zu verlassen. Mehrere Frauen behaupteten hysterisch, mitunter eine gebeugte, durchscheinende Gestalt um die Häuser schleichen zu sehen. Sie bewege ihre Beine nicht, schwebe einfach zehn Zentimeter über dem unebenen Boden. Der Weg dieser Gestalt sei immer der Gleiche: die schnurgerade Dorfstraße entlang, dann einmal um jedes Grundstück herum – und zum Schluss verschwinde der Spuk unversehens hinter der Kirche. Danach sei stets für mehrere Wochen Ruhe.
Zuerst hatte der Gemeindepfarrer in der sonntäglichen Messe wütend gegen diesen gotteslästerlichen Aberglauben gewettert – bis er selbst Zeuge einer solchen Heimsuchung geworden war. Seither hatte man sämtliche Fenster des Dorfes mit blickdichten Vorhängen ausgestattet, damit der mutmaßliche Wiedergänger keine Möglichkeit zur Kontaktaufnahme bekam. Einige befürchteten, dass der ermordete Bauernsohn Andraş sich ansonsten an der Bevölkerung des Dorfes rächen könnte – weil man ihm in der Stunde seiner höchsten Not nicht zu Hilfe geeilt war. Die Menschen in Popeşti wähnten sich deswegen kollektiv in einer Art Erbsünde gefangen und gaben diese schwere Last an ihre jeweiligen Nachkommen weiter.
Im Jahr 1954 hielten sich immer noch Reste hiervon im Unterbewusstsein der ortsansässigen Leute, auch wenn Angst und Aberglaube nicht mehr ganz so fest in ihrem Alltag verwurzelt waren. Selbst im höchst provinziellen Popeşti hielt die Moderne allmählich Einzug, nur eben langsamer und inkomplett. Mittlerweile wurden allerdings andere, völlig neuartige Ereignisse mit der alten Geschichte verknüpft. Und wieder schienen sich sämtliche Puzzleteile bestens zusammenzufügen …
*
Sobald an irgendeinem Ort etwas scheinbar Unerklärliches geschehen ist, neigen die Menschen dazu, diesen aus gebührendem Abstand mit Argusaugen zu beobachten, und zwar weltweit und unabhängig vom Kulturkreis. Jeder neuerliche Vorfall, so unbedeutend er auch sein mag, wird entsprechend interpretiert – bis er eben stimmig ins Bild passt.
Die Bevölkerung Nordrumäniens bildete da keine Ausnahme, ganz im Gegenteil. Während jedoch in vergangenen Jahrhunderten hauptsächlich Augenzeugenberichte von grünen Geisteraugen, nächtlichem Frauenund Kinderlachen sowie merkwürdigen Lichtphänomenen die Runde gemacht hatten, ging es jetzt zunehmend um seltsame Wolkenformationen, silberglänzende, fliegende Gegenstände und mutmaßlich böswillige Aktivitäten von Fremden im Baciu-Wald.
Wer oder was diese ominösen Fremden sein sollten, beziehungsweise, was sie dort überhaupt wollten, wusste indes niemand zu deuten. Es kursierten hierüber zwar zahllose Gerüchte, doch tragfähige Beweise fanden sich keine.
Die einzigen Spuren, die in unregelmäßigen Zeitabständen im Waldstück des Teufels gesichtet wurden, waren partiell verkohlte Äste. Allerdings wagten sich meist bloß nichtsahnende Ortsunkundige hinein, was klammheimliche Aktivitäten von ›Fremden‹ sicher problemlos ermöglicht hätte.
An einem wolkenverhangenen, kalten Novemberabend versorgten Dănuţa und Mihai Stanciu gerade ihre Tiere im dem Wohnhaus gegenüber liegenden Ziegenstall, als durch die breiten Ritzen des grob zusammen gezimmerten Bretterverschlags plötzlich grelle Lichtstrahlen ins Innere drangen. Sie schienen irisierend über Boden und Wände zu tanzen.
Beunruhigt sah Mihai hoch, stutzte. Er stieß seine dicke Ehefrau grob in die Seite. Diese beugte sich soeben über die Raufe und hatte daher noch nichts bemerkt. Ihre Leibesfülle ließ jegliche Bewegung zu einem Kraftakt geraten. Mühselig richtete sie sich auf, ächzte und stöhnte dabei.
»Schau mal her! Wo mag dieses außergewöhnlich helle Strahlen bloß herkommen?«, fragte er mit gerunzelter Stirn und stellte langsam die Heugabel in die Ecke zurück, jedoch ohne hierbei das mysteriöse Scheinen aus dem Blick zu lassen. Mit zusammen gekniffenen Augen verfolgte er, wie sich die langen Finger aus Licht ruckartig durch den Stall tasteten.
Dănuţa streckte den Rücken, warf ihren dicken Zopf über die Schulter zurück und kratzte sich am Hinterkopf.
»Was weiß ich? Der Mond vielleicht? Oder es geht jemand mit einer dieser neumodischen Laternen vorbei, will uns drüben im Wohnhaus besuchen?«
»Was bist du doch für ein dämliches, einfältiges Weibsstück«, schimpfte Mihai abfällig. »Der Mond, pah … man sieht doch auf den ersten Blick, dass sich die Lichtquelle da draußen bewegen muss. Der Einstrahlwinkel verändert sich stetig, sieh halt gefälligst genauer hin! Und würde bloß jemand auf unserem Grund und Boden herumgehen, hätte er mitsamt seiner Laterne schon längst den Stall passiert.«
»Wenn du meinst, Meister Oberschlau«, brummte die Rumänin beleidigt. »Dann geh am besten und finde es heraus, bevor du mir Vorträge hältst. Ich mache derweil hier alles fertig.«
Um die Ehe der Stancius stand es schon seit einigen Jahren nicht mehr zum Besten. Dănuţa genoss daher jeden Augenblick, in dem sie sich nicht mit ihrem grantigen, besserwisserischen Gatten befassen musste. Für einen Augenblick beschlich sie der sehnliche Wunschgedanke, etwas Böses möge für das unheimliche Strahlen verantwortlich sein und sie für immer von diesem respektlosen Blödmann befreien.
Zärtlich strich die Frau über den Kopf eines munteren Zickleins, das sie besonders gerne hatte. Das Tier hob erfreut den Kopf, ließ sich zwischen den Hörnchen kraulen.
»Du bist mein kleiner Liebling, nicht wahr?«, flüsterte die korpulente Mittvierzigerin. Sie hatte nach einer dramatischen Fehlgeburt vor mehr als zwanzig Jahren keine Kinder mehr bekommen können, was sie unendlich bedauerte. Wahrscheinlich hatte diese traurige Tatsache maßgeblich dazu beigetragen, dass der damals total untröstliche Mihail sich emotional von ihr entfernte, bis von der Liebe kaum noch etwas übrig war. Seither stürzte Dănuţa sich ersatzweise auf jegliches kleine Wesen, um es mit ihren Gefühlen zu überschütten – egal ob Mensch oder Tier.
Draußen wurde es plötzlich stürmisch. Auffrischender Wind heulte mit schauerlichen Tönen um den Stall, pfiff unangenehm kühl durch die Ritzen und wirbelte feinen Staub auf. Die Partikel schwebten wie Fischschwärme in den Lichtstrahlen, die den Verschlag noch immer diffus erhellten. Dănuţa musste niesen, zog ihr selbstgestricktes Schultertuch enger um den Leib. Mihail war nun schon seit mehreren Minuten weg, ihr wurde nun doch ein wenig mulmig. Ob sie nachsehen gehen sollte?
Mit zitternden Händen drückte die Frau gegen die Lattentür, bis die Scharniere quietschten. Der Wind entriss ihr die Tür, so dass sie krachend außen gegen den Verschlag knallte. Erschrocken steckte sie zunächst nur den Kopf nach draußen, drehte ihn nach links und rechts. Das grelle Licht blendete ihre Augen so sehr, dass man lediglich undefinierte Formen erkennen konnte; Schatten, die mit dem sich verändernden Einstrahlwinkel chaotisch durch die Landschaft zu wandern schienen.
»Mihai?« Ihr Ruf ging im Tosen des Sturmes unter. Sie wagte sich nun ganz aus dem Bretterverschlag, tastete sich vorsichtig um die Ecke. Was sie dort zu sehen bekam, ließ ihr fast das Blut in den pochenden Adern gefrieren. Fassungslos stand sie auf der Wiese, beschirmte ihre Augen mit dem rechten Unterarm gegen die gleißende Helligkeit. Der Wind zerrte jählings an ihren Kleidern, drohte sie jeden Moment von den Füßen zu werfen. Sie wagte nicht mehr, sich zu bewegen, stemmte sich bloß verzweifelt gegen den Sturm.
Nur wenige Meter vor ihr stand die dunkle Silhouette ihres Gatten, ebenso unbeweglich wie sie selbst. Auch er schien entgeistert auf das Lichtspektakel zu starren, welches offensichtlich zugleich die Quelle der peitschenden Windböen war. Und nicht nur das … Dănuţa spürte ein Kribbeln und Krabbeln am ganzen Körper, am stärksten am Scheitelpunkt des Kopfes und in den Extremitäten. Es schwoll rhythmisch an und ebbte wieder ab, um die Sequenz gleich darauf von neuem zu beginnen.
Konnte es möglich sein, dass die grünlichen Strahlen hierfür verantwortlich waren? Sie pulsierten im selben Muster, tasteten ihren Körper mehrfach von oben bis unten ab. Sie begann gellend zu schreien, als urplötzlich das giftgrüne Leuchten mitsamt dem Kreischen des Windes erlosch und eine unheilvolle Stille zurückließ.
Für wenige Sekunden entstand eine Art starker Sog, dann ein Vakuum, das Mihai und Dănuţa brutal den Atem aus den Lungen presste. Es war indessen vollkommen windstill geworden. Eine Art dunkler Nebel umfing die aufgelöste, japsende Frau, die deshalb den Standort ihres Mannes nicht mehr ausmachen konnte. Panik befiel sie.
Auf einmal verebbten auch Dănuţas Schreie. Jegliches Geräusch erstarb, obwohl sie schon wieder nach Leibeskräften ihre Angst hinausplärrte. Ihr war, als würde ihr der Erdboden unter den Füßen weggezogen. Es gab einen Knall, ein Riss bildete sich in dem finsteren Nebelgespinst und für einen kurzen Augenblick bemerkte sie einen schmutzig wirkenden Regenbogen, in dessen fahlem Licht sich sie und ihr Mihail widerspiegelten. Die Schemen der beiden Körper wirkten durchscheinend, standen auf dem Kopf. Dann war unversehens auch dieses Schauspiel vorbei. Der Nebel wurde dünner, verflüchtigte sich in Nichts.
Verdattert standen die Eheleute in der hügeligen Landschaft, trauten sich kaum vom Fleck zu rühren. Der Spuk war vorüber, hatte nichts Ungewöhnliches zurückgelassen. Beide schlotterten am ganzen Körper, brachten keinen Ton heraus.
Erst die Laute der verschreckten Tiere im Stall führten dazu, dass Mihai Stanciu und seine Ehefrau allmählich in die nüchterne Realität zurückfanden, schließlich aufeinander zugingen und sich erleichtert umarmten. Lange Zeit standen sie, sich fest umklammernd, auf der Wiese.
»Was, um Himmels willen, war das?«, hauchte Dănuţa, inzwischen bibbernd vor Kälte.
»Ich weiß es auch nicht. Aber ich fühle, dass sich etwas verändert hat. Als hätte eine unbekannte, jedoch völlig kompromisslose Macht das Ruder übernommen. Hast du das silbrig glänzende Etwas im Licht bemerkt?«
Seine Frau nickte nur, barg verstört ihren pausbäckigen Kopf an seiner Schulter. Ihr Gehirn weigerte sich strikt darüber nachzudenken, worum es sich dabei gehandelt haben könnte. Mihais Knie fühlten sich immer noch weich an. Er führte seine käseweiße Frau zum Wohnhaus und bemerkte beim Gehen, dass der Raureif von der Wiese verschwunden war.
Von dieser Nacht an lebten die Stancius zurückgezogen, verrammelten täglich vor Einbruch der Dunkelheit alle Fenster und Türen. Sie sprachen mit keinem einzigen Menschen über ihr unheimliches Erlebnis der Dritten Art, weil sie von den weiter entfernt angesiedelten Nachbarn ihres Einödhofes möglichst nicht für verrückt gehalten werden wollten. Grausige Albträume suchten sie jede Nacht heim. Für den Rest ihres gemeinsamen Lebens schwiegen sie und warteten darauf, dass die fremdartige Macht, die ihnen eine schauerliche Kostprobe ihrer Fähigkeiten geschickt hatte, die gesamte Erde übernähme.
Doch das geschah wider Erwarten nicht. Erst auf dem Totenbett erzählte Dănuţa einem Priester, was sie in jener Nacht erbeziehungsweise überlebt hatte. Er schob das wilde Fantasieren auf den halb entrückten Geisteszustand einer Sterbenden.
*
In der Nähe des Baciu-Waldes, 18. August 1968
Bereits am Morgen dieses wunderschönen Sommertages wurden im Kreis Cluj über dreißig Grad Celsius gemessen. Bei solch einem heißen, sonnigen Wetter wollte sich kein Mensch freiwillig in geschlossenen Räumen aufhalten, auch der fünfundvierzigjährige Emil Barnea nicht. Zu seiner Freude hatte der gewissenhafte Techniker sich freinehmen und auch seine Freundin Zamfira Mattea zu einem Tag Urlaub überreden können. Sie arbeitete als Angestellte für eine Wohltätigkeitsorganisation. Begeistert hatte die Vierunddreißigjährige ihren Emil gefragt, ob sie noch zwei lieben Freunden Bescheid geben könne. Ein Autoausflug mit gemütlichem Picknick wäre doch heute genau das Richtige! Das sahen besagte Freunde dann genauso, denn ihnen war es selbst leider noch nicht vergönnt gewesen, ein eigenes Auto zu erwerben. Im Rumänien der 1950-er Jahre waren Privatfahrzeuge noch eine rare Mangelware.
Gut gelaunt fuhr die Gruppe los. Man besichtigte zusammen einige Sehenswürdigkeiten und Aussichtspunkte, ging eine Weile in der Innenstadt von Cluj-Napoca bummeln, verdrückte Eistüten und fuhr anschließend ziellos durch die Gegend.
»Ich bekomme langsam Hunger. Wie ist das mit euch?«, fragte Zamfira, drehte sich zum Fond des Wagens um.
»Ebenfalls! Kommt, lasst uns jetzt etwas essen. Ich habe lauter selbstgemachte Leckereien eingepackt, Bier für euch Männer ist natürlich auch dabei!«, lachte ihre Freundin ausgelassen.
»Was für eine aufmerksame Traumfrau mein Schatz doch ist«, schwärmte ihr Begleiter strahlend. Er faltete andächtig die Hände und erntete einen forschen Nasenstüber.
An einem Waldstück, in der Nähe der Landstraße von Cluj nach Bukarest, stiegen die Freunde aus, gingen plaudernd und scherzend wandern. Ein lauschiges Plätzchen auf einer kleinen Lichtung kam alsbald in Sicht, perfekt für eine Rast. Es empfahl sich heute, weitgehend im Schatten der Bäume zu bleiben, denn es war vollkommen windstill und die Sonne brannte gnadenlos vom Himmel. Die Temperatur war mittlerweile auf sechsunddreißig Grad angestiegen.
Gut gelaunt machte sich Emil auf, nach trockenem Feuerholz für ein Lagerfeuer zu suchen. Die anderen bereiteten derweil das Picknick vor. Die Vögel sangen und er dachte bei sich: ›Was für ein perfekter Tag! Es könnte wirklich nichts Schöneres geben, als mit seiner Geliebten und den besten Freunden Spaß zu haben. In letzter Zeit habe ich dermaßen viel gearbeitet, dass ich es mir ausnahmsweise erlauben kann.‹
Zamfiras helle Stimme riss ihn gegen 13.30 Uhr aus seinen angenehmen Gedanken. Sie klang sehr aufgeregt.
»Emil! Bitte komm schnell her! Das musst du gesehen haben! Oh Gott … was könnte das nur sein … ?«
Barnea ließ das Bündel Zweige fallen und eilte zur Lichtung zurück. Schon aus einiger Entfernung bemerkte er, dass Zamfira und seine Freunde allesamt wie gebannt in den Himmel starrten. Gleich darauf bemerkte er es auch. Himmel noch mal … so etwas hatte er noch nie zuvor gesehen! Etwas metallisch Glänzendes schwebte langsam über die Lichtung hinweg und das vollkommen geräuschlos. Das Ding reflektierte das Sonnenlicht, wirkte wie komplett mit Silber überzogen. Die vier Ausflügler verfolgten das unbekannte Flugobjekt atemlos mit den Augen,
keiner sprach ein Wort.
Plötzlich kam Bewegung in Emil. Er stürzte zu seiner Tasche, zog seine Kamera hervor, maß mit zitternden Fingern die Belichtung und stellte die ungefähre Distanz zum Zielobjekt ein. Dann riss er sich zusammen, atmete aus und drückte ruhig auf den Auslöser. Da die Maschine – oder worum auch immer es sich da handelte – sehr langsam flog, blieb sogar Zeit für einen zweiten Schnappschuss.
Während des Fotografierens bemerkte er, dass die Helligkeit des Objekts sich stetig veränderte. Das daraus hervorströmende Licht schien rhythmisch zu pulsieren. Plötzlich stieg es in rasender Geschwindigkeit steil nach oben und Barnea bekam gerade noch Gelegenheit, weitere zwei Male auf den Knopf zu drücken. Dann geriet die unbekannte Maschine außer Sicht. Das gesamte Ereignis hatte nicht mehr als zwei Minuten gedauert.
Die vier Freunde waren baff vor Faszination. Sie blieben etwa weitere zwei Minuten wie angewurzelt stehen, keiner wagte sich zu rühren. Befanden sie sich hier womöglich in Lebensgefahr?
Mit offenen Mündern suchten sie weiterhin den Himmel nach dem Objekt ab, doch das obskure Schauspiel war offensichtlich vorbei. Anschließend packten sie schweigend ihre Siebensachen zusammen und verließen hektisch den Wald, denn er war ihnen nicht mehr geheuer.
Der Schock über diese unerklärliche Beobachtung saß dermaßen tief, dass niemand sprach. Schweißgebadet, mit leichenblassen Gesichtern, saß die Gruppe wenig später im Auto. Die Vesper blieb unangetastet im Kofferraum liegen.
»Ihr habt es aber auch alle gesehen, oder? Ich bin doch nicht verrückt geworden!«, war das Einzige, was Zamfira mit herausgedrehten Augäpfeln von sich gab. Sie wirkte kleinlaut. Ihre drei Begleiter nickten nur mechanisch und Emil startete fahrig den Motor des Dacia, nachdem er ihn zweimal abgewürgt hatte. Die Heimfahrt verlief bedrückend stumm.
*
Am schnellsten erholte sich Emil Barnea von den Ereignissen dieses Nachmittags. Als ehemaliger Militärangehöriger kam er mit Außergewöhnlichem eher klar als seine Freundin oder die beiden jüngeren Bekannten. Letztere hatten ihn bereits eindringlich gebeten, sie vollständig aus der ominösen Sache herauszuhalten. Er dürfe nirgends namentlich erwähnen, dass sie es gewesen seien, die dieses Ding ebenfalls gesehen hatten.
Nach einigen Tagen konnte Barnea sich endlich dazu überwinden, den ORWO-Film aus seiner FED 2-Kamera entwickeln zu lassen. Er war sich selbst nicht mehr sicher, ob er tatsächlich ein nicht identifizierbares Flugobjekt abgelichtet hatte. Vielleicht hatten sie im Wald aufgrund der Hitze nur überreagiert, waren einer Spiegelung von irgendwas zum Opfer gefallen. Einer Art Fata Morgana – oder so. Die dichten Wälder Transsilvaniens waren schließlich bekannt dafür, dass sie Angst erzeugen konnten. Aber diese Hoffnung sollte sich nicht erfüllen.
Knapp zwei Wochen später hielt er die Ausdrucke in Händen und fragte sich beunruhigt, was er hiermit nun anfangen sollte. Das fliegende Objekt war auf den Fotografien gestochen scharf zu erkennen, doch er wusste ziemlich genau, wie die Leute über abstruse Erzählungen dachten – und natürlich über diejenigen, welche mit solchen Geschichten über verhexte Wälder daherkamen. Er wollte sich nicht zum Gespött machen.
So wandte er sich nach dessen Urlaubsrückkehr an den rumänischen Ingenieur Florin Gheorghita, weil er wusste, dass der sich brennend für solche Phänomene interessierte. Mehrmals hatte er bereits UFO-Sichtungen untersucht. Barnea kannte den Mann von früher, hatte bereits zwei Jahre lang auf einer Baustelle mit ihm zusammengearbeitet.
Er zeigte ihm die ersten drei Fotos, auf denen das fragliche Objekt relativ groß abgebildet war. Gheorghita stellte daraufhin eigene Ermittlungen an und rekonstruierte die Flugbahn. Diese stimmte mit den Zeugenangaben von Emil und Zamfira, sowie den Fotos überein. Der Ingenieur blieb aber dennoch skeptisch. Auch er hatte einen Ruf zu verlieren.
Eines der Fotos wurde dennoch am 18. September 1968 in einigen Zeitungen der Region abgedruckt, und zwar zusammen mit einem durchwegs sachlich gehaltenen Augenzeugenbericht von Barnea. Nicht jeder nahm das gelassen auf.
Der Direktor des Observatoriums in Cluj fühlte sich daraufhin leider berufen, eine Gegendarstellung in die Welt zu setzen. In Unkenntnis dessen, dass nur ein einziges Objekt mehrmals fotografiert worden war, behauptete er kurzerhand, es habe sich garantiert um eine Ansammlung von Wetterballons gehandelt. Barnea sei bestimmt nichts als ein ignoranter Alkoholiker, der sich wichtigmachen wolle und habe die Fotos gefälscht. Wohlgemerkt – Wetterballons waren während der fraglichen Zeitspanne in der gesamten Region Cluj-Napoca nicht aufgestiegen, was sich hinterher leicht beweisen ließ.
Die Sache stieß bei einem Fotoreporter aus Cluj auf Interesse. Er und ein weiterer Fotograf einer Presseagentur aus Bukarest gingen der Sache auf eigene Faust nach und prüften die Fotografien akribisch auf Echtheit. Sie fanden keinen Hinweis auf irgendeine Trickserei. Sogar ein großes Fotolabor untersuchte sie auf Ungereimtheiten – ebenfalls ergebnislos.
Weitere Zeitungsveröffentlichungen, und zwar aller drei Fotos, zogen schier endlose Debatten in der Öffentlichkeit nach sich. Emil Barnea und seine Freundin wurden vom Staatsfernsehen interviewt. Ersterer wurde sogar auf neurologische Auffälligkeiten untersucht, allerdings fand sich hierbei nichts Außergewöhnliches. Aber wie hätten die beiden bekannten Augenzeugen zweifelsfrei beweisen sollen, dass sie die Wahrheit sprachen, nichts hinzugefügt oder weggelassen hatten?
Zum Schluss nahmen sich Techniker der Universität Cluj der Sache an, untersuchten die Fotografien sehr lange und fertigten sogar maßstabgerechte Modelle der abgebildeten Flugscheibe an. Jeder Schatten war in Übereinstimmung mit den beschriebenen Manövern vorhanden, man sah die Reflektionen der Sonne und sogar die Eigenbeleuchtung des Objekts. Eine geschickte Fälschung schien auch nach ihren Schlussfolgerungen ausgeschlossen zu sein.
Das UFO hätte demnach einen Durchmesser von mehr als dreißig Metern haben müssen. Es sei in sechshundert Metern Höhe erst langsam Richtung Nordost, zum Schluss in südwestlicher Richtung davon geflogen und hierbei leicht gesunken, hielten die Techniker in ihrem Abschlussbericht fest.
Zweimal traf sich Emil Barnea mit dem rumänischen Ufologen Ion Hobana, einmal 1968 und einmal 1970. Dieser fand in Befragungen heraus, dass weder Emil Barnea noch seine Freundin Zamfira Mattea viel über UFOs wussten und die Geschichte somit wohl kaum erfunden haben konnten, um sich interessant zu machen. Zu dieser Zeit wurden in Rumänien schließlich auch noch keinerlei Bücher über UFOs verkauft.
Hobana hielt das Ereignis über dem Baciu-Wald für eine der wichtigsten UFO-Sichtungen überhaupt. Die vierte Fotografie reichte Barnea ihm und seinem Bekannten Gheorghita mit erheblicher Verspätung nach. Auf diesem war das mutmaßliche Fluggerät wegen der erheblich größeren Entfernung viel kleiner festgehalten, es verschwand gerade in einer Wolkenbank.
Der Name Emil Barnea sollte für immer mit dieser Sichtung in Verbindung stehen, später massenhaft durch eine Erfindung namens Internet geistern und, über Jahrzehnte hinweg, weiterhin für Diskussionsstoff bei Skeptikern und Ufologen sorgen. Aber das konnte er damals natürlich nicht voraussehen.
Kapitel 3
Zeitloses Mädchen
Kreis Cluj, 29. April 1975
»Mama, wann gibt es endlich Abendessen? Ich habe schon einen Bärenhunger«, rief die fünfjährige Marta über den Gartenzaun. Der kleine Wirbelwind hopste fröhlich den schmalen Feldweg entlang, der unmittelbar an das Grundstück des recht kleinen, etwas baufälligen Hauses grenzte. Bei jedem Hüpfer flogen ihre braunen Zöpfe in die Höhe.
Ihre Mutter lächelte, richtete sich stöhnend auf. Sie hatte im Gemüsebeet schon den ganzen Vormittag lang Unkraut gejätet. Beide Hände ins schmerzende Kreuz gestützt, antwortete sie:
»Das wird noch gut eine Stunde dauern. Ich muss das hier erst fertig machen, sonst erstickt mir die Queckenplage meine jungen Salatpflänzchen. Iss derweil einen Apfel, oder geh noch ein bisschen auf die Wiese spielen. Das Wetter ist heute so schön. Man mag gar nicht glauben, dass es in der vergangenen Woche kalt war und geregnet hat!«
»Au ja, mach ich. Ich hole gleich meinen Ball!«, lachte Marta vergnügt und verschwand im Schuppen. Anna Ionescu blickte ihr versonnen nach. Ihr ging das Herz auf. Was für ein aufgewecktes Kind! Und so hübsch anzusehen mit ihrem herzförmigen Gesichtchen, den Sommersprossen auf der Stupsnase und seinen großen, braunen Rehaugen. Es bereitete der stolzen Mutter viel Freude, der Kleinen ausgefallene Kleidchen zu nähen. Heute trug sie ihr Lieblingskleid. Jenes zartgelbe mit den großen, weißen Margeriten am ausgestellten Saum, das sie erst am vergangenen Wochenende fertiggestellt hatte.
»Aber bleib in Rufweite! Mach dich nicht schmutzig und geh keinesfalls in den verwunschenen Wald, hörst du?«, rief Anna ihrer Tochter noch hinterher. »Ja ja, Mama«, tönte es fröhlich über die Wiese – und schon war das quirlige Mädchen über den Hügel und außer Sicht.