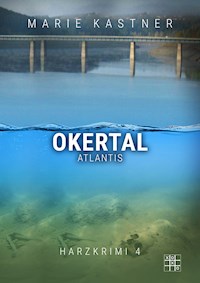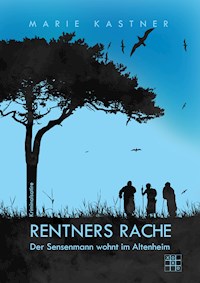Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: XOXO-Verlag
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
Entscheidet sich Deutschlands Zukunft am Kyffhäuser? Auf der Abschlussfeier einer deutschen Universität vereinbaren drei befreundete Studenten, sich von nun an jedes Jahr einmal zu treffen, um sich nicht aus den Augen zu verlieren. Anschließend verschlägt es die einstigen Kommilitonen aus beruflichen Gründen in verschiedene Bundesländer. Schon nach wenigen Jahren entwickeln sich vollkommen gegensätzliche politische Ansichten, die in extremistischen Weltanschauungen gipfeln. Als die beiden Männer und ihre ehemalige Freundin im Jahr 2020 erneut aufeinandertreffen, wird die Sache gefährlich – nicht nur für sie, sondern auch für die Demokratie … Ein spannender Politkrimi, jenseits von Meinungsmache, Hetze oder political correctness.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 427
Veröffentlichungsjahr: 2020
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Der Barbarossa-Effekt
Das große Erwachen am Kyffhäuser
Marie Kastner
XOXO Verlag
DER BARBAROSSA-EFFEKT
Das große Erwachen am Kyffhäuser
Marie Kastner
XOXO Verlag
Impressum
Bibliografische Information durch die Deutsche Nationalbibliothek: Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://www.d-nb.de abrufbar.
Print-ISBN: 978-3-96752-018-7
E-Book-ISBN: 978-3-96752-518-2
Copyright (2019) XOXO Verlag Umschlaggestaltung: Grit Richter
© Ulrich Guse, Art Fine Grafic Design, Orihuela (Costa)
© Fotos/Grafiken: Lizenz von www.dreamstime.com
Buchsatz: Alfons Th. Seeboth
Rechtlicher Hinweis:
Sämtliche Personen, Orte und Begebenheiten rund um diesen Roman sind, abgesehen freilich von real existierenden Ortschaften, frei erfunden. Dasselbe gilt bezüglich der beschriebenen Vorgänge bei Behörden sowie anderen Institutionen oder Firmen. Eventuelle Ähnlichkeiten mit lebenden oder verstorbenen Menschen sowie deren Vereinigungen sind von der Autorin nicht beabsichtigt und wären daher rein zufällig. Selbstverständlich gilt letzteres nicht für ›Öffentliche Personen‹ aus der Politik.
Hergestellt in Bremen, Germany (EU)
XOXO Verlag
ein IMPRINT der EISERMANN MEDIA GMBH
Gröpelinger Heerstr. 149
28237 Bremen
Der alte Barbarossa
Der Kaiser Friederich Im unterird’schen Schlosse Hält er verzaubert sich
Er ist niemals gestorben Er lebt darin noch jetzt;
Er hat im Schloss verborgen Zum Schlaf sich hingesetzt
Er hat hinabgenommen Des Reiches Herrlichkeit
Und wird einst wiederkommen Mit ihr, zu seiner Zeit
Auszug aus dem Gedicht Der alte Barbarossa von Friedrich Rückert, 1817
Vorwort der Autorin
Liebe Leser/innen,
mir ist vollkommen bewusst, dass dieses Buch geistigen Zündstoff liefert, geht es darin doch um linken, rechten und religiösen Extremismus. Ein Reizthema, zweifellos. Ich bemühe mich in meiner fiktiven Geschichte, die Zustände und Denkweisen im Deutschland unserer Tage darzustellen und hoffe, dass es Ihnen bis zum letzten Buchstaben nicht gelingen möge, meine eigene politische Ausrichtung durchschimmern zu sehen, denn diese spielt keine Rolle.
Es geht um das Prinzip von Ursache und Wirkung, Bewegung und Gegenbewegung, um zu erwartende Folgen für eine von Wirtschaftsinteressen gesteuerte Republik.
Dies ist zwar ein Politkrimi, doch im Grunde dreht er sich um die Menschen, die mehr oder weniger glücklich in dieser larvierten Kapitaldiktatur leben – um ›uns Deutsche‹. Wobei die genaue Definition, wer unter diesen Begriff fallen soll, zunehmend schwieriger wird; schon insofern scheiden sich mittlerweile die Geister.
Ob wir Menschen es nun wahrhaben wollen oder nicht, die Wahrheit hat viele Gesichter. Sie lässt sich niemals greifen und festnageln, das hat die Weltgeschichte eindrucksvoll bewiesen. Es laufen unter der Oberfläche immer wieder dieselben Mechanismen ab, auch wenn im Laufe der Zeit viele unterschiedliche bunte Etiketten über den obskuren Machenschaften der Mächtigen kleben.
Hochkulturen kommen und gehen. Deutschland wird sich da kaum ausnehmen können, es existiert in Wirklichkeit kein Status quo, den man mit stetigen Bemühungen aufrechterhalten könnte. Auch das geheiligte Wirtschaftswachstum muss – und wird – irgendwo ein Ende finden, selbst wenn man mithilfe der Allmacht von bunten Werbebildern ständig Bedürfnisse für neue, im Grunde völlig überflüssige Güter schafft.
Nichts ist so beständig wie der Wandel. Die einzigen Leitfäden, die auf ewig Bestand zu haben scheinen, sind die ehernen Regeln der Vernunft und des zwischenmenschlichen Anstandes – auch wenn beides oft genug für Machtansprüche missbraucht und bis zur Unkenntlichkeit verbogen wird, was für die meisten Politiker leider besonders in Wahlkampfzeiten zu gelten scheint. Zudem gibt es auch in Bezug auf hehre Werte eklatante kulturelle Unterschiede zwischen den Völkern, vieles davon ist nicht kompatibel. Die subjektive Meinung eines jedes Menschen bildet sich aus einem Konglomerat, das von persönlichen Erfahrungen seiner Vergangenheit, der individuellen Erziehung, den durch die Medien vorgegebenen Denkweisen und anderen Einflüssen gespeist wird. Das Ich ist alles andere als objektiv.
Wie sollte aber angesichts dessen die eine, weil allgemeingültige Wahrheit für sämtliche Einwohner eines Landes, geschweige denn der gesamten Welt, existieren? Vollkommen ausgeschlossen. Wer da allen Ernstes behauptet, sie zu kennen, überschätzt sich selbst, belügt sich und andere gleichermaßen.
Extremisten hat es in jedem Zeitalter gegeben, doch bezeichnet die Nachwelt die prominentesten von ihnen, je nach gegenwärtig vorherrschender Strömung in der Geschichtsschreibung, als Feldherren, Eroberer, Religionsstifter, Heilige, Revolutionäre, Wahnsinnige oder blutrünstige Verbrecher. Irgendeine Form des Extremismus scheint in jeder Epoche salonfähig zu sein.
Ich möchte diese Geschichte daher all jenen Menschen widmen, die sich von politischen und kirchlichen Ideologien nicht die Gehirne verkleistern lassen und sich daher von Extremismus und Schönfärberei in jeglicher Verbrämung distanzieren.
Ich nenne sie Realisten.
Eigentlich, und das finde ich unsäglich traurig, muss ich mich bei Menschen von Angela Merkels Charakterstruktur sogar bedanken. Ohne sie wäre dieses Buch sicher nie erschienen.
Orihuela (Costa), im Winter 2017/2018 Marie Kastner
10. September 2020
Der Berliner Stadtteil Prenzlauer Berg gehört mit seinen Kneipenstraßen nicht zu den ruhigsten Wohnlagen. Es handelt sich um ein turbulentes Viertel, das vornehmlich kinderlose, junge, urbane Menschen anzieht, die sich teure Mieten leisten können. Was sich an diesem Donnerstag frühmorgens in der Lychener Straße abspielte, lockte jedoch außergewöhnlich viele Bewohner an die Fenster und aus den Hauseingängen.
Auf dem breiten, von Laubbäumen gesäumten Bürgersteig vor einem frisch renovierten Apartmenthaus mit Balkonen standen die Einsatzfahrzeuge von Polizei, Notarzt und Feuerwehr. Blaulicht zuckte, eine Bahre wurde ins Haus getragen.
Eine junge Frau mit leuchtend rot gefärbtem Haar sprach am Eingang mit einer Polizeibeamtin. Ein auffälliges, buntes Tattoo in Form eines Diamanten mit Flügeln verzierte ihr Dekolletee.
»Ich weiß nicht genau, könnte so gegen vier Uhr gewesen sein, vielleicht auch viertel nach vier. Der Knall war dermaßen laut, dass er mich aus dem Schlaf gerissen hat«, berichtete sie gestikulierend. Ihr Freund – oder Lebensabschnittsgefährte – stand in Boxershorts und T-Shirt daneben, nickte zu jedem ihrer Worte. Der Endzwanziger schien noch nicht ganz wach zu sein, rieb sich gähnend die Augen. Er fröstelte in der kalten Morgenluft, die bereits von ersten Herbsttagen kündete.
»Und wieso dachten Sie auf Anhieb daran, dass Ihr Nachbar sich etwas angetan haben könnte? Gab es zuvor entsprechende Anzeichen?«, hakte die Polizistin nach.
»Och, das war immer so ein dynamischer Typ, ein echter Tausendsassa. Sie wissen schon, einer dieser Erfolgsmenschen mit ganz besonderer Ausstrahlung. Immer bestens gelaunt, immer freundlich, zumindest nach außen hin gab er sich so. Aber seit einiger Zeit hatte ich beobachtet, wie er sich veränderte. Ich bin meistens in meiner Wohnung, betreibe dort ein Künstleratelier. Meine Staffelei steht in der Nähe des Fensters, deswegen sah ich ihn jeden Tag mehrmals kommen und gehen.
Er wirkte auf mich zunehmend bedrückt und desinteressiert, schien seine Umwelt komplett auszublenden. Nahm seine Post nicht mehr aus dem Kasten, bis er überquoll und einige Briefe schon auf dem Fußboden landeten. Gestern Abend klingelte ich bei ihm, brachte sie ihm – und erschrak. Offensichtlich hatte er getrunken. ›Danke Ina‹, sagte er, ›aber das Zeug interessiert mich gar nicht mehr.‹ Er hat mir die Wohnungstür vor der Nase zugemacht, ließ mich mitsamt seiner Post einfach auf dem Hausflur stehen«, berichtete sie in unverkennbarem Berliner Dialekt.
Während seine Kollegin der Nachbarin weitere Fragen stellte, fischte Kommissar Maximilian Schmidke oben in der Wohnung, im grellen Blitzlichtgewitter des Polizeifotografen, mit der Pinzette einen mutmaßlichen Abschiedsbrief aus dem Drucker.
Der Leichnam saß, mit einem deutlich erkennbaren Loch in der Schläfe, an seinem Schreibtisch. Mund und Augen standen offen, der schlanke Körper war in sich zusammengesackt.
Dunkelrote Blutströme hatten sich über den mit schneeweißem Nappaleder bezogenen Bürosessel ergossen und auf dem Parkettboden eine Lache gebildet. Teile seines Gehirns, winzig kleine Knochensplitter und unzählige Blutspritzer verunzierten die satinierte Glasplatte des flächigen Schreibtisches sowie den cremefarbenen Lamellenvorhang, der allzu grelles Sonnenlicht aussperrte. Einige davon waren auch auf dem Blatt im Ausgabeschacht des Druckers gelandet, verliehen ihm den Charakter eines schaurig gestalteten Briefpapiers.
Das Design würde gut für die Einladung zu einer Halloween-Party passen, sinnierte der Kommissar. Diesen Beruf konnte man auf Dauer nur mithilfe einer gehörigen Portion schwarzen Humors ertragen, besonders hier in der Landeshauptstadt. Er steckte die blutbesudelten Blätter einzeln in Klarsichthüllen, versenkte diese wiederum in einem verschließbaren Asservatenbeutel. Erst danach begann er, Blatt für Blatt, aufmerksam zu lesen.
Sieben Minuten später ließ er den ›Abschiedsbrief‹ sinken, pfiff durch die Zähne. Alter Falter … dafür werden sich wohl noch ganz andere Behörden als die Kripo interessieren müssen, dachte er bei sich.
1
LEITKULTUR IM VERTEIDIGUNGSMODUS
21. Februar 2016
Auf der Hoyerswerdaer Straße war trotz der frühen Stunde kein Durchkommen mehr. Sirenen der Einsatzfahrzeuge von Polizei und Feuerwehr jaulten durch die Nacht, rissen etliche Bewohner der ostsächsischen Stadt Bautzen abrupt aus dem Schlaf. Jedenfalls diejenigen der Anwohner rund um den Käthe-KollwitzPlatz, welche nicht bereits der penetrante Brandgeruch alarmiert hatte aufschrecken lassen.
Marcel Lünitz wurde auf dem Nachhauseweg von einer Familienfeier von den Stauungen überrascht. Seine Schwester lebte seit den Neunzigern im benachbarten Ort Neschwitz. Ortskundige Bautzener und Navi-Verwender bogen in Seitenstraßen ab, um die Verkehrsbehinderung möglichst weiträumig zu umfahren, alle anderen Autos verharrten notgedrungen in der blechernen Kolonne. Es ging nur im Schritttempo voran. In Höhe der Abzweigung zur Thrombergstraße schwante dem zweiundfünfzigjährigen Geschäftsführer und Firmeninhaber, was die Ursache für das konvulsive Blaulichtblitzen sein mochte.
Irgendwo im Bereich der Löhrstraße brannte ein Dachstuhl. Es war noch stockdunkel, die in den Himmel lodernden Flammen waren deutlich zu erkennen. Ein orangefarbenes, flackerndes Leuchten lag über dem historischen Kern der Kleinstadt an der Spree. Prompt kam der Verkehr auf der 156 wegen der vielen Schaulustigen komplett zum Erliegen. Einige Fahrzeuginsassen stiegen jetzt sogar aus ihren Autos und gafften, manche mit einem hämischen Grinsen im Gesicht.
Ein weiteres Löschfahrzeug versuchte mit Hupen und abenteuerlichen Fahrmanövern, sich eine Durchfahrt zum Brandort zu bahnen, schien jedoch große Schwierigkeiten damit zu haben.
Schemenhaft konnte Marcel erkennen, dass in der Zwischenzeit offenbar ganze Pulks aus Menschen dorthin gepilgert waren und jetzt massiv die Löscharbeiten behinderten.
Was ist nur in die Leute gefahren? Die Bautzener sind doch sonst nicht so unvernünftig, fragte er sich verwundert.
Siedend heiß kam ihm die Erkenntnis, welches Gebäude, oder vielmehr, welcher steinerne Zankapfel da lichterloh brannte. Es musste sich wohl um das ehemalige Hotel Husarenhof handeln, das seit einiger Zeit geschlossen war, um renoviert und für die neue Zweckbestimmung umgebaut zu werden. Seit Wochen und Monaten erhitzten sich an diesem einstigen, offenbar unrentabel gewordenen Traditionshaus die Gemüter. Er hatte die Pros und Contras in Zeitung und Internet genauestens verfolgt. Und nun das … an Zufall glaubte er keine Sekunde. Andernorts hatte sich der Volkszorn schließlich in ähnlicher Weise entladen. Dies hier war möglicherweise weniger ein Stau als vielmehr eine Blockade.
Sein Interesse war geweckt.
Spontan entschloss er sich, in der Nähe des Geschehens einen Parkplatz zu suchen und die skurrilen Vorgänge rund um das geplante Asylbewerberheim live zu beobachten. Der Großbrand im Husarenhof würde unter Garantie schon morgen Abend in der üblichen Runde thematisiert werden, daher konnte es kaum schaden, über eigene Informationen zu verfügen. Die Pressevertreter würden die Geschehnisse zweifellos wieder so lange aufbereiten, bis der Volkswille der Einheimischen wie stramm rechtes Gedankengut herüberkam. Es ging denen vorrangig darum, zu polarisieren und eine Sensation abdrucken zu können.
Er bog in die Peter-Jordan-Straße ein, mühte sich durch das Gewirr von Anwohnerstraßen. Zwei Blocks weiter fand er endlich einen semilegalen Stellplatz für seinen schwarzen Audi A 6, parkte ihn zwischen einem überfüllten Müllcontainer und einer mit Verbotsschildern bepflasterten Garagenausfahrt.
Lünitz beglückwünschte sich innerlich dazu, die Geburtstagsfeier seiner kleinen Schwester als letzter Gast verlassen zu haben. Er hatte bis zum Schluss damit geliebäugelt, auf Martinas Ledercouch zu nächtigen, aber dann hatte ihm sein volltrunkener Cousin Jojo einen Strich durch die Rechnung gemacht. In seinem desolaten Zustand hatten sie ihn nicht mehr nach Hause fahren lassen können, das wäre unverantwortlich gewesen. So hatten sie ihm in gemeinsamer Anstrengung den Autoschlüssel abgenommen und vorsorglich einen Kotzeimer auf den Teppich gestellt. Zum Glück war er halbwegs nüchtern geblieben.
Im Laufschritt hastete er in Richtung des Feuerscheins.
Nach wenigen Minuten kam das lange, einstöckige Gebäude mit seinem ausgebauten Dachgeschoss in Sicht – oder vielmehr das, was noch vorhanden war. Im flackernden Schein des Feuers und dem Blitzlichtgewitter der Einsatzfahrzeuge konnte man schon von weitem erkennen, dass der gesamte Dachstuhl des rechtwinkligen Baus in Flammen stand. Die in Apricot gestrichene Fassade war teilweise rußgeschwärzt.
Wow, was für ein Inferno … hier wird bestimmt so schnell niemand mehr einziehen können, dachte er, nicht ohne ein Gefühl der Befriedigung. Hier kam schließlich kein einziger Mensch zu Schaden, das Gebäude hatte wegen der aufwändigen Renovierungsarbeiten vollkommen leer gestanden. Tote und Verletzte waren nicht zu befürchten. Es handelte sich daher nur um ein weiteres eindrückliches Signal, dass die Leute in dieser Region die aufgezwungene Überfremdung allmählich leid waren.
Sicherlich, der Steuerzahler würde am Ende wieder einmal die Zeche für die Brandstiftung zahlen müssen, verhindern ließ sich die massenhafte illegale Einwanderung von sogenannten Flüchtlingen mit solchen Aktionen selbstverständlich auf Dauer nicht. Dieses ehemalige Viersternehaus wäre schon die sechste Unterkunft in dieser gemütlichen Stadt mit ihren zirka vierzigtausend Einwohnern gewesen, die ihre Pforten seit Beginn der aktuellen Flüchtlingskrise für dreihundert weitere Zuwanderer aus Syrien, Afghanistan und anderen Ländern öffnen sollte, deren Identität zum Teil nicht einmal geklärt war. Aber natürlich, das vollmundige ›Wir schaffen das‹ ging der Frau Kanzlerin immer noch über die ureigenen Interessen der Bevölkerung.
Viele junge Heißsporne sahen nun mal keine andere Möglichkeit, auf ihre Wut aufmerksam zu machen. Vielleicht würde er den einen oder anderen als Mitstreiter für die gemeinsame Sache gewinnen können … mal sehen. Es war alles andere als leicht, passende Gefährten im Geiste zu gewinnen. Das Glatzenund Springerstiefelgeschwader kam hierfür nicht infrage. Diese Sorte sollte sich lieber weiterhin in ihren erfolglosen Neonazi-Parteien tummeln und sich zum Gegenstand für Gespött und öffentliche Ächtung machen. Bedauerlicherweise führten ihre oft saudummen Aktionen dazu, dass in dieser schadhaften Republik auch gemäßigte Nationalisten gleich mit an den Pranger gestellt wurden. Das war Lünitz und seinen treuen Weggefährten verständlicherweise ein Dorn im Auge.
Mithilfe beider Ellbogen bahnte er sich einen Weg durch die Menge, die in vorderster Front eher einem erregten Mob glich. Es grenzte nahezu an Unmöglichkeit, mit dem Smartphone über Kopf zu filmen, ohne dass einem dieses im dichten Gerangel der Menschenleiber aus der Hand gestoßen wurde.
Lünitz sah bewusst genauer hin. Der erste Eindruck hatte ihn scheinbar getrogen. Klar, die Leute standen hier vorne dicht an dicht, bildeten im Zwielicht des Feuerscheins eine dunkle, anonyme Masse … aber der Platz vor dem Gebäude war durch die quer geparkten Löschzüge und Absperrbänder der Polizei sehr begrenzt. Um wie viele Schaulustige mochte es sich da handeln, die den Brand des Husarenhofs aus nächster Nähe sehen wollten … fünfzig, maximal hundert?
Die Presse wird sicher ein paar tausend daraus machen und vom Niedergang der Demokratie und einem braun durchsetzten Bautzen sprechen, obwohl es eine ähnliche Anzahl von Gaffern bei jedem Brand gibt, mutmaßte er in Gedanken.
Außerdem – und das muss man bei objektiver Betrachtung auch ins Kalkül ziehen – viele der Parolengröler sind vermutlich nicht nüchtern. Um diese Uhrzeit sind neben extremen Frühaufstehern und Pendlern nur letzte Nachtschwärmer auf den Straßen unterwegs.
Die bleierne Müdigkeit schien wie verflogen. Aufmerksam wie ein Erdmännchen sog er die Eindrücke aus seiner näheren Umgebung in sich auf, reckte den Hals wie alle anderen. Seine Körpergröße von einem Meter neunzig kam ihm dabei sehr zupass.
Ein paar offenkundig besoffene Teenager, drei oder vier, krochen behände unter den flatternden Absperrbändern hindurch, brüllten Parolen wie: »Raus mit dem Ausländerpack!« und »Weg mit den Kanaken!« Andere Leute diskutierten über das Für und Wider der Unterbringung von Muslimen und ob der starke Zustrom jemals enden werde, oder zogen scharfzüngig über Merkels Willkommenspolitik her. Wieder andere waren hauptsächlich an der Feuersbrunst selbst interessiert – und diese stellten wahrscheinlich den Löwenanteil. Er sah seine Vermutung verifiziert. Von einem Mob zu sprechen, wäre übertrieben gewesen.
Auf dem Rückweg zum Auto zog Marcel Lünitz das subjektive Resümee, dass viele der Anwesenden einfach nur sensationsgeile Gaffer gewesen waren und nicht wenige es begrüßten, dass die neue Ladung von ungewollten Fremden jetzt erstmal nicht anrücken konnte. Besonders die Anwohner schien das zu freuen. Es hatte zwar ein paar Behinderungen der Feuerwehr gegeben, oh ja, aber womöglich lag das lediglich an einer mangelhaften Organisation am Brandort.
Den eilig angerückten Löschtrupps war kaum Zeit geblieben, sich auch noch um das adäquate Fernhalten der teils alkoholisierten Leute zu kümmern. Sie hatten lieber das Ausbreiten der Flammen auf Nachbarhäuser vereitelt, so wie es ihre Aufgabe war. So viel er von seiner Warte aus erkennen hatte können, waren zwei der Parolengröler unter Gewaltanwendung von der Polizei abgeführt worden, weil sie den Beamten bei der Räumung der unmittelbaren Gefahrenzone angeblich körperlichen Widerstand geleistet hatten.
Zur Hexenjagd brauchte man immer ein paar Schuldige, die man als Warnung für andere Randalierer pressegestützt verfolgen konnte. Die dummen Jungs taten ihm ein bisschen leid, sie würden die Härte des Gesetzes zweifellos in vollem Ausmaß zu spüren bekommen.
Wie alt mögen die beiden Unglücksraben sein, zwanzig bis zweiundzwanzig? In deren Haut möchte ich lieber nicht stecken. Sie werden mehr Verachtung auf sich ziehen als der Brandstifter selbst. Bei objektiver Betrachtung hat allein dieser zündelnde Mitbürger sich heute Nacht schuldig gemacht. Aber es ist sonnenklar, wie das wieder ablaufen wird.
Eines wusste er leider jetzt schon zu prophezeien. Die Schilderungen der soeben observierten Ereignisse würden sich in den Medien ganz anders anhören. Politiker aller Couleur würden das Ereignis für propagandistische Zwecke ausschlachten, sich in Statements als Gutmenschen profilieren und mit dem Finger auf all Jene zeigen, die es auch bloß ansatzweise wagten, gegen die Flüchtlingspolitik der Regierung aufzubegehren.
War denn wirklich jeder Bürger, dem am Wohlergehen seiner Heimatstadt gelegen war, gleich ein fieser, menschenfeindlicher Rassist, ein Neonazi oder sogar ein Volksverhetzer? Man musste als halbwegs gebildeter Mitteleuropäer doch zweifellos befähigt sein, vorurteilsfrei differenzieren zu können! Geschweige denn, es als freier Bürger überhaupt zu dürfen.
Es war ihm schon seit längerem unerfindlich, was diese Praxis der Massensteuerung inzwischen noch mit freier Meinungsäußerung oder einer Demokratie zu tun haben sollte. Die herrschende Groko regierte in ihrer eitlen Selbstgefälligkeit frech am Volk vorbei und regte sich auf, wenn das zunehmend bemerkt wurde. Manch einer wollte sich wohl noch zu Lebzeiten ein Denkmal setzen, sich dazu um jeden Preis von Viktor Orbán und seinen Grenzschließungen an der Balkanroute abheben. So einfach war dieses Phänomen zu erklären. Sich deutlich von jenem Ungarn zu distanzieren, gegen welchen man regelmäßig den moralischen Zeigefinger erhob, hielt man wohlweislich für ratsam. Man hätte ihm stattdessen dankbar sein sollen. Die langfristigen Folgen der Masseneinwanderung für Deutschland und Europa behielt aber keiner ernsthaft im Fokus, geradeso als wären diese nebensächlich oder bereits eingepreist. Lünitz fand das reichlich abstrus. Wo genau verlief die Grenze zwischen mildtätiger Großzügigkeit und bodenloser Dummheit, die förmlich danach schrie, sie schamlos auszunutzen? Diese unfähige, sich selbst beweihräuchernde Regierungskoalition schien sie nicht einmal klar definieren zu wollen. Angela Merkel duckte sich lieber weg, so wie sie es in Krisenzeiten meistens handhabte.
Kopfschüttelnd stieg Lünitz in seinen Audi und steuerte ihn auf dem schnellsten Wege nach Hause. In einer Dreiviertelstunde würde er sich den Brandgeruch vom Körper duschen und sich eine Weile hinlegen können. Als Inhaber eines mittelständischen Betriebs musste er im Büro seiner Firma ranklotzen, auch sonntags. Wenigstens ein paar Stunden Schlaf hatte er nach alledem bitter nötig.
*
Tiefe, dunkle Augenringe verunzierten Marcels attraktives Gesicht. Nach dem Heimkommen hatte ihn seine Ehefrau Eva mit hunderttausend Fragen über die Geburtstagsfeier und die dort aufgeschnappten Neuigkeiten am Schlafen gehindert. Sie konnte zwar die meisten Mitglieder seiner überwiegend aus dem unterfränkischen Würzburg stammenden Verwandtschaft nicht ausstehen, genauso wenig wie deren schrägen Dialekt, wollte jedoch trotzdem ihre Neugierde nicht länger zügeln. Eva stammte von hier, genauer gesagt aus der Oberlausitz, konnte mit bayrischer Gemütlichkeit wenig anfangen.
Es war ihm gelungen, eine halbe Stunde zu dösen, dann hatte der Wecker des Smartphones geklingelt. Während Eva und sein achtzehnjähriger Sohn Arne weiterhin selig in den Federn lagen und pennten, versuchte er, die Lebensgeister mit starkem Kaffee aufzuwecken. Ein schier nutzloses Unterfangen.
Sinnierend stand er in der großzügigen Designerküche seines Einfamilienhauses am Zittauer Ortsrand. Er hatte es nach der Wende mit viel Fleiß, ererbtem Geld und Geduld geschafft, sich und seiner kleinen Familie hier im Dreiländereck, an den Grenzen zu Polen und Tschechien, etwas aufzubauen. Schade, dass die aktuelle Bilanz der Firma zu wünschen übrig ließ. Die massiv auf den europäischen Markt einfallende Billigkonkurrenz aus Asien hatte in den vergangenen fünf Jahren für eklatante Einbrüche im Auftragsbuch gesorgt. Er schrieb das den negativen Effekten der leidigen Globalisierung zu. Es zählte für die Leute heutzutage scheinbar nur noch der Preis – und nicht Qualität, Langlebigkeit des Produkts oder toller Kundenservice, wie sein Unternehmen ihn bot.
Ein Hoch auf Oma Erna. Hätte sie mir keine zwei Millionen Euro vermacht, könnte ich nicht quersubventionieren und die Firma wäre längst pleite. Ich könnte es kaum ertragen, mein mühsam aufgebautes Lebenswerk wegen ein paar Schlitzaugen in die Tonne zu treten und meine Angestellten in die Mühlen der Arbeitslosigkeit zu entlassen.
Seufzend schlüpfte Lünitz in seine gefütterte Outdoorjacke. Sie roch immer noch dezent nach Rauch. Es galt, in seiner mittelständischen Firma für Solaranlagentechnik eine Reihe E-Mails abzuarbeiten, Personalentscheidungen zu treffen und anschließend einen Ausflug mit Eva zu unternehmen.
Erst gegen sechs Uhr gelang es Marcel Lünitz, sich von seinen geschäftlichen und familiären Verpflichtungen frei zu schaufeln. Zumindest glaubte er das. Aufatmend schnappte er seine Autoschlüssel von der Kommode. Die allwöchentliche Versammlung fand diesmal ausnahmsweise sonntags statt.
»Kannst du mich mit in die Stadt nehmen?«
Lünitz‘ achtzehnjähriger Sohn Arne lehnte lässig im Türrahmen seines Zimmers, wie immer komplett in Schwarz gekleidet.
»Ach, hast du dich von deinen Games losreißen können? Wie lange hast du heute wieder gezockt … fünf, sechs Stunden?«
Arne kratzte sich ausgiebig am Hinterkopf, strich eine widerspenstige Strähne seines schulterlangen Haares aus den Augen. Der einstige moderne Kurzhaarschnitt war schon seit Monaten herausgewachsen, das Haar wirkte zerzaust und fettig. Der Junge war sichtlich genervt und das völlig grundlos.
»Weiß nicht, kann schon sein. Also, was ist jetzt … nimmst du mich mit oder nicht?«
»Ich vermisse da ein ganz bestimmtes Wort.« Verständnisloses Augenrollen und Stöhnen.
»Na schön: BITTE.« Er buchstabierte das Wort.
»Dann zieh deine Latschen und was Warmes an, ich bin spät dran. Triffst du dich wieder mit deinen nichtsnutzigen, stinkfaulen Kumpels?«
»Klar. Genauso wie du«, konterte der Sohn respektlos.
»Nicht frech werden, sonst kannst du den Bus nehmen. Morgen habe ich übrigens einige Aufgaben für dich, also übertreibe es heute Nacht besser nicht mit dem Alkohol. Es kommt nicht infrage, dass du hier wie eine Made im Speck lebst und zu keiner Gegenleistung bereit bist. Wann hast du überhaupt zuletzt deine Socken gewechselt? Die stinken zum Himmel!«
»Und du muffelst wie eine Brandruine. Allerdings gehe ich dir nicht mit blöden Fragen auf den Geist.«
Lünitz spürte, wie sein Adrenalinspiegel schon wieder sprunghaft anstieg. Seit Arne volljährig geworden war, benahm er sich unmöglich. Aktuell wiederholte er die elfte Klasse Gymnasium, was aber nicht an mangelnder Intelligenz, sondern eindeutig an seiner notorischen Faulheit lag. Er umgab sich mit fragwürdigen Freunden, die zum Teil nicht einmal über einen Hauptschulabschluss verfügten und blauäugig in den Tag hinein lebten.
Er hätte es sich anders gewünscht, erkannte sein eigen Fleisch und Blut kaum wieder. Arne, der ihm optisch wie aus dem Gesicht geschnitten war, entwickelte zu seinem Entsetzen gerade eine ziemlich linke Gesinnung, hing gelegentlich auf Demos von Linksautonomen herum. Und je mehr er dagegen wetterte desto weiter driftete sein Sohn in diese Richtung ab. Er war enttäuscht und wusste sich keinen Rat mehr, wie er mit dem Jungen umgehen sollte. Eva fand eher einen Draht zu ihm, aber die verhielt sich auch erheblich nachgiebiger, obwohl das unter dem Strich wahrscheinlich kontraproduktiv war.
Die Fahrt verbrachten Vater und Sohn in eisigem Schweigen. Am Ende der Böhmischen Straße hielt Lünitz am Straßenrand, um ›Arnie‹ aussteigen zu lassen. Der Marktplatz lag hier ganz in der Nähe. Wahrscheinlich ging er mit seinen Gammlern wieder in den Filmpalast und danach in die übliche Musikkneipe. Was für ein dekadentes Leben.
»Soll ich dich heute Nacht wieder mit heimnehmen?«
»Nö. Ist mir viel zu früh. Irgendwie finde ich schon einen Lift, oder ich penne bei Carlo!« Er zündete sich fahrig eine Kippe an, knallte die Autotür zu und trottete grußlos von dannen.
Marcel sah ihm beunruhigt hinterher. Wenn der Bub sich nicht bald am Riemen riss, würde er jemand anderen als Nachfolger für seine Firma aufbauen müssen. Aktuell jedenfalls hätte er den eigenen Sohn nicht einmal als Azubi im Betrieb einstellen wollen. Rannte mit einem ausgeleierten Sweatshirt durch die Gegend, das vorne und hinten mit geballten Fäusten bedruckt war. Seinem Stammhalter schien nicht ansatzweise klar zu sein, welchen Eindruck das in der Öffentlichkeit hinterließ.
Er fragte sich zum wiederholten Mal, was Eva und er bei der Erziehung falsch gemacht hatten.
Auf dem unbefestigten Parkplatz der alteingesessenen Gaststätte Zum Schwarzen Ross streifte Lünitz die unerfreulichen Gedanken über seinen missratenen Nachwuchs in Windeseile ab. Hier, im abgetrennten Veranstaltungssaal des Lokals, war er kein erfolgloser Vater eines anmaßenden Rotzlöffels, sondern vielmehr ein eloquenter Redner und glühender Verfechter der gemeinsamen Sache. Diese Rolle stand ihm besser zu Gesicht.
Schlimm genug, dass er sich diesmal kaum hatte vorbereiten können. Während er über den langen, verwinkelten Flur hastete, ging er die brandaktuellen Themen noch im Kopf durch. Apropos ›Brand‹ … na schön, dazu würde ihm nach dem Erlebnis der letzten Nacht mit Sicherheit genügend einfallen. Es hatte vorhin dicke gereicht, im Internet einen kurzen Blick auf die n-tv-Seite zu werfen, um seinen düsteren Verdacht bestätigt zu sehen.
Schon geriet das abgegriffene Pappschild mit der Aufschrift Geschlossene Gesellschaft in sein Blickfeld, das, wie an jedem beliebigen anderen Abend, an den wuchtigen Flügeltüren des einstigen Tanzsaales baumelte.
Seit den Siebzigern war hier immer nur das Notwendigste renoviert wurden, deshalb stand der Anbau für Versammlungen wie diese meist zur Verfügung. Außer einer Karnevalsveranstaltung am Rosenmontag und gelegentlichen Hochzeitsjubiläen von älteren Stammgästen herrschte im Schwarzen Ross tote Hose. Die betagten Inhaber waren nicht gerade mit Reichtümern gesegnet, Umbaumaßnahmen waren und blieben obsolet.
Einfache, bescheidene Leute, diese Hartmanns, vor genauso wie nach der Wende.
Ein lausiges Ambiente, den klugen Köpfen da drinnen eigentlich unangemessen, dachte Lünitz beim Anblick zersprungener Bodenfliesen, des stumpfen Lacks über der zerkratzten Wandvertäfelung aus Holz und der vom vielen Qualmen vergilbten Deckenfarbe. Den Toilettenanlagen sah man schon von außen an, was einen drinnen erwartete.
Momentan ist das Lokal trotzdem ideal, gerade wenn man wie wir unter dem Radar bleiben möchte. Es werden bessere Zeiten für Unseresgleichen anbrechen, aber noch ist es nicht so weit.
Bis vor kurzem hatte Eva fast jeden Freitag erbittert mit ihm gestritten, weil er, anstatt mit ihr auszugehen, hier stundenlang mit seinen Brüdern im Geiste herumhing. Ihr fehlte es an politischem Interesse. Aber wäre er eingefleischter Fußballfan gewesen, wie so viele andere Ehemänner, hätte sie ihn am Wochenende erst recht kaum zu Gesicht und später noch alkoholisiert zurückbekommen. Ein schlagendes Argument. Eva kannte solche Fälle aus dem Bekanntenkreis zur Genüge.
Inzwischen hatte sie sich notgedrungen damit abgefunden, ihr blieb auch keine Wahl. Meistens ging sie mit ihren Freundinnen in edle Restaurants, ins Theater oder ins Kino und machte sich selbst einen schönen Abend. Gut so, sie nörgelte dann wenigstens nicht an ihm herum.
Lünitz war es gewohnt, dass alles nach seinem Kopf ging. Er war ein Alpha-Tier, ein charismatischer Leitwolf. Nicht zuletzt aus diesem Grund machte ihm die Verweigerungshaltung seines einzigen Sohnes derart zu schaffen, sie brach ihm einen Zacken aus der funkelnden Krone des Familienund Firmenoberhaupts. Er holte tief Luft, drückte die Türklinke herunter, setzte ein selbstbewusstes Lächeln auf und trat mit gewohnt dynamischem Schritt in den Saalbau, steuerte auf das provisorische Rednerpult aus weiß lackierten Spanplatten zu, während er von seinen Mitstreitern freudig begrüßt wurde. Viele waren aufgestanden, einige klatschten schon, bevor er den ersten Satz gesagt hatte. Momente wie diese bestärkten ihn in seiner Überzeugung, dass er sich auf dem richtigen Dampfer befand. Vielleicht war Deutschland doch noch zu retten.
Er war hier voll und ganz in seinem Element. Schilderte seine Erlebnisse aus der vergangenen Nacht, analysierte, verglich sie mit den Aussagen aus der Berichterstattung. Abschließend warf er ein Statement in den Raum:
»Dieses Beispiel zeigt doch überdeutlich, wie es um die deutsche Bildungspolitik bestellt ist! Nicht einmal mehr Journalisten scheinen den eklatanten Unterschied zwischen besoffenem Grölen und dem Skandieren von Parolen zu erkennen. Es gab dort weder Sprechchöre noch einen Mob. Ein typisches Beispiel von gesteuerter Meinungsmache. Die überwiegende Masse der Konsumenten glaubt das ungefiltert, obwohl die Feuerwehr dazu ein eigenes Statement, eine Gegendarstellung abgegeben hat. Diese liest sich in etwa so wie mein Augenzeugenbericht, den ich hier wiedergebe. Man bestreitet sogar, massiv beim Löschen behindert worden zu sein.
Aber diese Meldung geht in der Flut der Falschdarstellungen unter. Bautzen musste sich einfach nahtlos hinter Claußnitz und Freital auf der langen Liste verrufener, sächsischer Orte einreihen, wie das neulich ein Schreiberling vom Magazin Spiegel formuliert hat. Dabei gab es auch in Claußnitz jede Menge Gegendarstellungen, aber die Verfasser wurden trotzdem gleich pauschal als verkappte Rechtsextreme eingestuft, einschließlich des Heimleiters der betroffenen Asylunterkunft.
In diesem Zusammenhang ist folgendes frappierend: Solange es in den Medien um die Montagsdemonstrationen der friedlichen Revolution des Jahres 1989 geht, wird die einstige DDRBevölkerung wegen ihres Rufes: ›Wir sind das Volk!‹ respektiert, er wird als untrügliches Zeichen für Demokratiewilligkeit interpretiert. Wenn dieselbe ostdeutsche Bevölkerung jedoch denselben Geist heutzutage beschwört, ist sie plötzlich mit unbelehrbaren Neonazis gleichzusetzen. Das darf doch nicht wahr sein!«
Lünitz zog vor seinem Auditorium von etwa hundert Personen anschließend über angeblich bestens ausgebildete Vorzeigeflüchtlinge her, die Deutschland und seine Kultur so sehr bereicherten und in Wirklichkeit Hartz IV bezogen, und bezeichnete die derzeit allgegenwärtige Mega-Werbekampagne der Initiative Wir zusammen als sozialromantische Fehleinschätzung der tatsächlichen Möglichkeiten zur Migrantenintegration. Die deutsche Wirtschaft sei dabei sowieso weniger am Wohlergehen von Flüchtlingen aus Kriegsgebieten interessiert, eher schon an billigen Arbeitskräften für die Industrie.
»Ich frage Sie ernsthaft: Was soll ein achtundfünfzigjähriger Deutscher denken, der in seinem Alter keinen Job mehr findet, als Langzeitarbeitsloser geführt wird und künftig von einer Mini-Rente leben muss? Gibt es für ihn solche Kampagnen? Nein! Im Gegenteil. Er wird keinen bezahlbaren Wohnraum finden, weil jetzt jede verfügbare Sozialwohnung mit Flüchtlingen belegt wird. Falls er großes Glück hat und doch irgendeine Bruchbude zugeteilt bekommt, darf er zukünftig im Dreck zwischen Menschen aus einem fremden Kulturkreis hausen, die oft sogar ihre Abfälle vom Balkon schmeißen. Man weiß ja zur Genüge, wie diese rechtsfreien Räume in vielen Großstädten aussehen. Nicht einmal mehr die Polizei traut sich ohne weiteres dorthin.
So sieht es inzwischen leider aus, meine Damen und Herren: Die eigene Bevölkerung ist unseren Politikern keinen Pfifferling mehr wert! Sie setzen lieber weiterhin auf die Integrationslüge und dulden beispielsweise, dass arabische Familienclans ungestört ihr Unwesen treiben, das Sozialund Rechtssystem ausnutzen können.
Und warum tun sie das, was glauben Sie? Es liegt doch auf der Hand! Angela Merkel ist keine Volksvertreterin. Sie ist eine Marionette der Wirtschaft und holt ihr viele neue Konsumenten ins Land, für die anschließend der deutsche Steuerzahler berappen darf. Was mit der deutschen Leitkultur passiert, wenn sie dauerhaft verwässert wird, schert diese selbstgerechte Pfarrerstochter aus der Uckermark einen feuchten Dreck. Wir Deutschen haben das Land mit viel Fleiß nach dem Krieg wieder aufgebaut und wahrlich schon genug am Erbe aus dem Dritten Reich zu knabbern, das uns zu einem kollektiven Schuldgefühl gegenüber der halben Welt verpflichtet.
Aber dass wir unseren sauer erarbeiteten Wohlstand an Fremde verschleudern sollen, und das auf Kosten des eigenen Volkes, seiner Bildung und Infrastruktur … tut mir leid, dafür bringe ich kein Verständnis auf. Hilfeleistung ja, aber doch bitte in festen Zentren an den Grenzen und ausschließlich für tatsächlich Verfolgte, nicht jedoch für Wirtschaftsflüchtlinge, Kriminelle, Menschen mit ungeklärter Identität oder sonstige Illegale.
Wozu überhaupt Integration? Die Leute sollen gefälligst nach Hause zurückkehren und den Wiederaufbau in Angriff nehmen, spätestens wenn die gröbsten Konflikte in ihren Heimatländern beendet sind. Diese unkontrollierte Masseneinwanderung muss unverzüglich aufhören! Was glauben Sie, weshalb so viele Migranten unbegleitete Minderjährige vorschicken, die strafrechtlich noch eine weiße Weste haben? Damit diese anschließend ihre gesamte Verwandtschaft ins deutsche Sozialsystem einschleusen können, und oft sind das vielköpfige Großfamilien! Die meisten davon finden – oder wollen – keinen Job. Egal, bei uns lebt es sich ja auch ohne Bemühungen sehr gut.
Es reicht, dass das Trojanische Pferd des Islam bereits mitten in Deutschland steht und auf seine Stunde wartet. Ich ziehe ehrfürchtig den Hut vor den Tschechen, Polen und Ungarn, die sich diesem Wahnsinn weitgehend verweigern. Die Außengrenzen dienen seit jeher dem Schutz eines Landes und seiner Bevölkerung, und das aus gutem Grund, wie die Geschichte zeigt. Sie einfach zu öffnen, ist unglaublich leichtsinnig.
Wer, so frage ich Sie jetzt, würde in der arabischen Welt uns Deutsche aufnehmen und integrieren, uns obendrein auch noch christliche Kirchen bauen und obskure Kulturvereine gründen lassen, wenn Sie oder ich eines Tages hier für unsere Gesinnung verfolgt würden, in Not gerieten? Welches von diesen Ländern würde es langmütig dulden, dass wir Ausländer uns in Gruppen zusammenrotten und stetig versuchen, überall den Ton anzugeben?
Und welches Volk dieser Erde würde nach mehreren terroristischen Anschlägen noch eine Lanze für uns brechen und amtsbekannte Gefährder ungehindert frei herumlaufen lassen, diesen unberechenbaren Zeitbomben langmütig finanzielle Unterstützung in Form von Sozialhilfe gewähren?
Kein Wunder, dass wir in Afrika und dem Nahen Osten als Lemminge betrachtet werden, die man einfach nur zu überrennen und nach Strich und Faden auszunehmen braucht. Dabei ist es mit dem Wohlstand in Deutschland längst nicht so weit her wie es nach außen hin dargestellt wird. Es gibt jede Menge Missstände, von maroden Schulen über kaputte Autobahnen bis hin zur Kluft zwischen Armen und Reichen, die täglich breiter wird. Wirklich reich sind nur die Konzerne und die oberen Zehntausend, selbst der unverzichtbare Mittelstand verarmt zusehends. Manch einer lebt inzwischen auf Pump, um sich den bisherigen Lebensstandard überhaupt erhalten zu können.
Für Einwanderer hingegen muss Deutschland wie ein Eldorado wirken. Kriegt einer mal ausnahmsweise kein Asyl – na, dann klagt er eben und darf dableiben, bekommt weiterhin Leistungen vom Staat und obendrauf noch jede Menge Zeit zum Untertauchen. Abgeschoben werden sowieso die allerwenigsten und das spricht sich blitzartig herum.
Man kann und darf diese Mentalitäten einfach nicht mit der unseren vergleichen. Integration und ein friedliches Zusammenleben derart gegensätzlicher Kulturen und ihrer Religionen wird niemals mehr als ein hanebüchener Wunschtraum sein.
Wir sind für viele dieser Leute Ungläubige, deren Frauen und Töchter man ungestraft anfassen darf, meine Damen und Herren. Ich sage Ihnen: Der Islam gehört eben nicht zu Deutschland und wir sollten kein offener Selbstbedienungsladen bleiben, den man skrupellos mithilfe gefakter Mehrfachidentitäten bestehlen kann!
Hier ein treffender Vergleich: Stellen Sie sich vor, ihr liebster Freund steckt in einer Notlage und bittet darum, dass er für eine Weile in Ihrem Gästezimmer wohnen darf. Sie sagen spontan zu, wollen ja helfen und ahnen nichts Böses. Natürlich gibt es in Ihrem Haus gewisse Gewohnheiten, wie zum Beispiel, um welche Uhrzeit gegessen wird oder wann Nachtruhe herrscht. Hält sich der Gast nie daran, bleibt länger als nötig, frisst Ihnen den Kühlschrank leer, wirft seinen Abfall auf Ihren Rasen und befummelt zum Dank für den Stress auch noch Ihre Tochter … würden Sie den Schmarotzer nicht am liebsten nur noch von hinten sehen und schließlich hochkant hinauswerfen? Eine gesunde, nachvollziehbare Reaktion, wenn Sie mich fragen. Eines würden Sie jedoch garantiert nicht tun: zulassen, dass er auch noch seine Verwandtschaft mit in Ihr Haus bringt!«
Lünitz straffte seinen muskulösen Rücken und legte eine kleine Kunstpause ein, während Applaus aufbrandete. Unmissverständliche Handgesten des Redners sorgten dafür, dass er sich ebenso schnell wieder legte.
»Auf Dauer nutzt es niemandem, wenn wir hier Stammtischparolen ausgeben, die widerlichen Zustände nur aufdecken und anprangern. Wir müssen an die Öffentlichkeit, die Bürger aufrütteln und versuchen, ein Umdenken der Bevölkerung einzuleiten, damit sie das aufgezwungene Joch abschüttelt, bevor es zu spät ist. Wie ich in dieser illustren Runde vor ein paar Wochen schon ausführte, funktioniert dies leider nicht über die Gründung einer politischen Partei.
Wir haben alle mitbekommen, wie es der AfD ergeht. Anstatt eine echte Alternative für Deutschland sein zu dürfen, werden helle Köpfe wie Petry, Gauland, Höcke oder Poggenburg medial an den braunen Pranger gestellt, damit sie möglichst niemand mehr für voll nimmt. Man spielt bewusst mit den Ängsten der Wähler, suggeriert unterschwellig, dass sich selbst unter solchen gemäßigten Nationalisten erneut ein Adolf Hitler emporschwingen und eines furchtbaren Tages die Bundesrepublik übernehmen könnte.
Unter anderem deshalb werden zurzeit wahrscheinlich wieder vermehrt angestaubte Dokumentationen über die Nachrichtensender ausgestrahlt, die ihn und die Verbrechen seines Regimes zum Thema haben. Das Grauen von damals soll über die düsteren Schwarzweißfilme in lebendiger Erinnerung behalten werden und unbewusst Furcht vor einer Wiederholung implementieren. Spätestens am Wahltag überlegt es sich dann jeder zweimal, ob er resigniert und mangels echter demokratischer Alternativen wieder die Etablierten wählt oder endlich Flagge zeigt, politisch neue Wege gehen möchte.
Indessen entzweit sich die Partei aufgrund ständiger Anfeindungen und medial aufgebauschter Wortklauberei, teilt sich in mehrere Lager auf, was durchaus so beabsichtigt ist.
Der Medienrummel hat System, ist kalt kalkulierte Propaganda, um dieser Partei den Garaus zu machen. Traut sich niemand mehr, die AfD zu wählen, bleibt am Ende ein größeres Stück Kuchen für die Regierenden übrig. So einfach ist das. Ergo erscheint es mir vollkommen sinnlos, es mit einer neuen Partei zu versuchen. Ihr würde es genauso ergehen.
Dasselbe gilt für Organisationen wie Pegida, auch diese Bewegung ist trotz einiger recht vernünftiger Ansätze schnell in Verruf geraten. Und weshalb? Weil sich zu viele ›Glatzen‹ in ihren Reihen tummelten. Eine Masse kann sich nur auf den kleinsten Nenner einigen und der liegt nach den Regeln der Schwarmintelligenz gemeinhin am untersten Rand des Niveaus.
Wenigstens an diesem Problem leiden wir zum Glück nicht, meine geschätzten Freunde. Der Durchschnitts-IQ hier im Saal liegt deutlich über der Zimmertemperatur.«
Wohlwollendes Brummen durchzog den Raum, einige lachten über den seichten Witz.
»Ich habe in der Zwischenzeit die Möglichkeiten erwägt, einen Verein zu gründen. Aber diese Idee musste ich nach ausgiebigen Recherchen ebenfalls verwerfen. Eine juristische Person ist eine greifbare Institution – und somit kann man ihr Schaden zufügen und sie diskreditieren, sobald sie unbequem wird. Es gibt Vereine, die in unserem vorgeblich demokratischen Staat sogar vom Verfassungsschutz beobachtet werden.
Sowas ist also keine gangbare Option für uns. Überwachung erzeugt Druck und dieser wiederum sorgt für Zwist.«
Zustimmendes Gemurmel brachte Unruhe in den Saal, an den hinteren Tischen entspannen sich Diskussionen im Flüsterton.
»Es muss andere, bessere Möglichkeiten geben, den Bürgern die Machenschaften dieser vorgeblich demokratischen Republik ungeschönt vor Augen zu führen, sie endlich zur Gegenwehr zu bewegen. Wir dürfen dabei nur nicht den Fehler begehen, uns von irgendeiner Seite angreifbar zu machen. Daher sollten wir, ein jeder für sich, wie Phantome agieren. Einzelne Bürger, die jeweils in Eigenregie handeln – das ist der harmlose Eindruck, den wir in der Öffentlichkeit hinterlassen müssen.
Keine überprüfbare Organisation, keine verantwortliche Führung, keine markigen Parolen, nichts dergleichen darf es geben. Getrennt marschieren, Sachverhalte im Vorfeld so gründlich wie möglich recherchieren, wohldurchdachte, gewaltfreie Einzelaktionen fahren, die Bevölkerung aufklären und gelegentlich vereint Teilerfolge feiern, heißt die Devise, die zum Erfolgsrezept werden könnte. Nicht mehr und nicht weniger.
Mir sind dazu bereits ein paar vage Gedanken gekommen, die ich ausarbeiten und Ihnen als Ideenpool gerne nächsten Samstag vorstellen möchte. Gerne dürfen und sollen Sie dazu eigene Einfälle beisteuern, denn wie gesagt, ich bin ja nicht Ihr Führer«, grinste Lünitz augenzwinkernd. Er hielt sich Zeigeund Mittelfinger vertikal unter die Nase.
Ein paar laute Lacher zollten der humoristischen Darstellung von Hitlers albernem Bärtchen Beifall. In dieser Runde, die sich überwiegend aus Lehrern, Polizisten, Anwälten und Firmenbossen zusammensetzte, war sowas wenigstens ungestraft möglich. Aber auch nur, solange keine der Bedienungen herumschwirrte.
»Wir würden mit ein wenig Engagement erheblich mehr Zulauf von Gleichgesinnten bekommen, könnten die allzu duldsamen Menschen dieses im Niedergang begriffenen Landes wachrütteln, jedoch ohne dabei selbst zur populistischen Zielscheibe zu werden.
Wir, die wachsame Bildungselite, sind eben keineswegs braun, auch nicht knallrot, nicht grün, gelb, blau oder schwarz, sondern vertreten schlicht und einfach die Stimme der Vernunft, somit die ureigenen Interessen unserer wirklichen Mitbürger!
Wer wüsste es zu sagen … vielleicht macht unser innovatives Beispiel des subtilen Widerstands und der ehrlichen Aufklärung sogar bald in all jenen europäischen Ländern Schule, welchen dieselbe Überfremdung aufgezwungen wird. Schnelle Ergebnisse werden wir wohl kaum erzielen, dafür aber hoffentlich nachhaltige. Wer könnte für das überfällige Umdenken sorgen, wenn nicht das geknechtete und betrogene Volk selbst?«
Nun brandete frenetischer Beifall auf, der kein Ende nehmen wollte. Der rotblonde Franke mit den leuchtend grünen Augen hatte den Nerv seiner Mitstreiter wieder mal meisterlich getroffen, die gesamte Zeit über völlig frei gesprochen. Das fand Anerkennung, zeigte, dass er mit Kopf und Herz bei der Sache war. Der Grundstein für eine sinnvolle Neuausrichtung der anwesenden Gesellschaft war jetzt gelegt. Blieb für Lünitz zu hoffen, dass die handverlesenen Mitglieder tatsächlich bereit waren, ihre glühende Gesinnung umsichtig in Taten münden zu lassen.
Er trat winkend ab, überließ dem nächsten Redner das Pult. Ein pensionierter Oberstudienrat referierte über den Verfall des völkischen Brauchtums, der mit einer Vermischung der Kulturen zwangsläufig einhergehen würde. Er wusste genau wovon er sprach, gehörte er doch selbst der sorbischen Minderheit an, die noch heute in diesem Landstrich lebte und verzweifelt versuchte, ihre Identität halbwegs zu bewahren. Aber – wohlgemerkt – auf sozialverträgliche, integre Weise.
Wie Recht er doch hat … wir Franken sind einst ja auch von den Bayern assimiliert worden. Doch selbst heutzutage zeigen sich noch hier und da Unterschiede in der Mentalität und mit unserer Akzeptanz ist es in Süddeutschland auch nicht allzu weit her. Man spricht dort nicht umsonst vom Weißwurstäquator, der angeblich irgendwo bei Ingolstadt verläuft. Was nördlich dieser Linie liegt, wird argwöhnisch beäugt. Man soll Gott für alles danken, sogar für Unter-/Mittel-/Oberfranken, heißt es in München.
Wenn die Angleichung bereits bei dermaßen ähnlichen Völkern nicht vollständig gelingt, wie sollte sie dann mit einer völlig fremden Kultur funktionieren? Menschen von gleicher Herkunft werden sich immer und überall zusammenrotten, weitgehend unter sich bleiben. Man kann das sogar an Urlaubsorten beobachten. Wahrscheinlich ein evolutionär erklärbares Phänomen, ein Überbleibsel aus dem Rudelund Clanverhalten, sinnierte Lünitz bedrückt.
Der wohlbeleibte Lehrkörper regte sich gerade wortreich darüber auf, dass es für Politiker inzwischen sogar als verpönt gelte, das harmlose Wort völkisch noch in den Mund zu nehmen, ohne sofort als Rechter eingestuft zu werden. Das käme einer Zensur des deutschen Wortschatzes gleich.
Ein Horst Seehofer könne sich ohnehin glücklich schätzten, dass seine CSU derzeit zum Mitregieren benötigt werde, ansonsten wäre er mit seinen recht vernünftigen Ansätzen zur Änderung der Einwanderungspolitik schon längst in der Luft zerrissen worden, spätestens nach seinem Besuch bei Orbán. Dabei besitze der wenigstens ein Rückgrat und versuche im Alleingang, die Außengrenzen der EU zu schützen.
An solchen Beispielen zeige sich übrigens, dass die sogenannte Europäische Union in Wahrheit immer noch dasselbe wie früher sei – mehr oder weniger bloß eine Wirtschaftsunion, in der jedes Mitglied eigene Interessen in den Vordergrund stelle. Abgesehen von Deutschland natürlich, denn dieser Regierung eines günstig, weil zentral gelegenen, Landes scheine die selbstinszenierte Außenwirkung wichtiger zu sein.
Deswegen reiße Mama Merkel mit Hurra die ärmeren Nachbarstaaten an den südlichen und südöstlichen Außengrenzen der EU, wie zum Beispiel Griechenland und Kroatien, dank ihrer Willkommenspolitik selbstherrlich in den Abgrund der Masseneinwanderung, lasse sie mit dem kaum mehr zu bewältigenden Flüchtlingsansturm und den zahllosen damit verbundenen Problemen kaltherzig im Stich. Auch Durchreiseländer wie Österreich hätten darunter schwer zu leiden und mittlerweile die Nase gestrichen voll.
»Und selbst wenn das Dublin-Abkommen, welches eigentlich besagt, dass jeder Flüchtling dort seinen Asylantrag stellen muss wo er zuerst europäischen Boden betritt, nicht einfach widerrechtlich ausgesetzt worden wäre, wie hätten diese Länder mit der brisanten Situation umgehen sollen? Es sind dort innerhalb kürzester Zeit ganze Menschenhorden eingefallen und die kamen bekanntlich nicht nur aus Bürgerkriegsgebieten.
Die EU hätte somit die Pflicht gehabt, alle ihre Außengrenzen mit vereinten Kräften und gebündelten finanziellen Mitteln zu schützen. Es ist ein äußerst bedenklicher Rechtsbruch unserer Bundeskanzlerin, die Leute gar noch hierher nach Deutschland einzuladen. Aber einmal abgesehen davon … insbesondere wir Ostdeutschen hätten jedes Recht, nach all diesen vielen Jahren der Einschränkung, Mangelwirtschaft und Gängelung, endlich an uns zu denken, die Früchte unserer Arbeit zu genießen, anstatt die Ungerechtigkeit der Welt auf unsere Schultern zu nehmen und uns überdies gewaltbereite Muslime ins gemachte Nest setzen zu lassen«, schloss er seinen Vortrag.
Zwei weitere Redner hatten sich auf die Liste für die heutige Zusammenkunft setzen lassen. Es gab zwar kein offizielles Veranstaltungsprogramm, das im Vorfeld erstellt worden wäre, aber man konnte sich auf einer Schiefertafel ad hoc als Redner registrieren. Falls doch einmal mehr als fünf Anwesende hieran Interesse zeigten, wurden sie automatisch für das nächste Freitagstreffen vorgemerkt. Aber das kam höchst selten vor; die meisten lauschten lieber, anstatt selber aktiv zu werden.
Jens Böhler, ein gerade mal neunundzwanzigjähriger Neuzugang und Gründer einer Werbeagentur aus Berlin, kam jetzt an die Reihe. Er gedachte über die berechtigte Frage zu referieren, ob es tatsächlich notwendig sei, gekenterte Bootsflüchtlinge aus Nordafrika nach ihrer Rettung aus selbst verschuldeter Seenot an die italienische Küste zu befördern. Er zeigte sich erstaunt, dass man illegale Einwanderer nicht postwendend dorthin zurückbrachte, wo sie aufgebrochen waren.
Seines Wissens gebe es im internationalen Völkerrecht keine Regelung, die es Staaten erlaube, die Rücknahme eigener Staatsbürger zu verweigern oder dafür gar noch Gegenleistungen zu verlangen. Europa lasse sich ständig von jeder dahergelaufenen Bananenrepublik erpressen und leiste hierbei auch noch verbrecherischen Schlepperbanden Vorschub, deren Geschäftsmodell dadurch weiterhin floriere, warf er erregt in den Raum.
Der engagierte Jungspund liegt mit seiner Meinung im Grunde vollkommen richtig … aber es gibt nun mal Staatsoberhäupter, die sich einen feuchten Dreck um Anstand oder das geltende Völkerrecht scheren. Und mit haargenau solchen Despoten wird man hier leider konfrontiert, wusste Marcel Lünitz.
In diesem Fall blieb europäischen Politikern eigentlich keine andere Wahl. Sie mussten teure Zugeständnisse machen, wenn sie etwas erreichen wollten. Sonst durften die Schiffe nicht einmal die libyschen Hoheitsgewässer befahren, geschweige denn, an der Küste anzulegen und die Leute abzuladen. Traurig, aber wahr. Man konnte die Aufgegriffenen schließlich nicht einfach mit dem Fallschirm über dem jeweiligen Staatsgebiet abwerfen.
Abschiebungen … auch so ein Reizthema, über das es noch viel mehr zu sagen gäbe. Lünitz nahm sich vor, es in Kürze aufzugreifen.
Jens Böhler raffte fahrig seine Notizen zusammen und verließ mit grimmiger Miene das Pult. Ihn hatte wohl sein eigener Vortrag in Rage versetzt. Man würde das im Auge behalten müssen. Es war nicht ganz ungefährlich, junge Leute aufzunehmen, die sich die Hörner noch nicht abgestoßen hatten und zu spontanen Dummheiten neigten. Dieser Böhler kam zwar auf Empfehlung von Franz Kosziol, einem treuen Mitstreiter der ersten Stunde – aber ob der seinen entfernten Verwandten aus Berlin wirklich so genau kannte, dass man dem jungen Mann vorbehaltlos vertrauen konnte? Er würde Franz danach fragen müssen.
Den Abschluss sollte eine attraktive Dame im Kostüm bilden, der Burkas und Nikabs in deutschen Fußgängerzonen ein Dorn im Auge waren. Die langbeinige Blondine namens Pauline Stölzel würde, zumindest in optischer Hinsicht, für ein finales Highlight sorgen und die überwiegend männliche Gesellschaft schon deswegen bestens bei Laune halten. So viel er wusste, arbeitete die etwa vierzigjährige Schönheit in einer Sparkassenfiliale.
»Wir Frauen haben uns damals nicht mühevoll die Emanzipation erkämpft und ringen bis heute noch um berufliche Gleichstellung, damit uns ungebildete Vogelscheuchen alles Erreichte wieder zunichtemachen«, wetterte sie mit ihrer hellen Stimme.
Nach diesen Reden war geselliges Beisammensein angesagt. An den Tischen bildeten sich kleine Grüppchen, die angeregt über das Gehörte sowie Privates diskutierten.
Man vertraute sich untereinander, viele waren bereits befreundet. Andere lernten sich erst hier kennen und schätzen.
Ja, es sollte zweifellos wieder ein langer Abend werden. Lünitz bestellte sich bei Bedienung Marga vorsorglich die dritte große Cola, um nicht gähnend am Tisch zu sitzen. Es hätte womöglich einen falschen Eindruck hinterlassen. Mit dem bisherigen Verlauf dieses Abends konnte er mehr als zufrieden sein. Sein Beitrag hatte vorhin mit Abstand den lautesten Beifall generiert und man würde sicher mit Spannung auf den folgenden warten.
Im Gehen trug er sich gleich für nächsten Freitag auf der mobilen Schiefertafel ein. Der Dresdner Gymnasiallehrer Ludwig Ströhlein, ein eingefleischter Junggeselle, würde das Relikt aus Kindertagen nachher wieder mit in sein Zuhause nehmen, es dort im Arbeitszimmer verwahren.
Erst draußen auf dem Flur streckte sich Lünitz, gähnte herzhaft und rieb sich die schmerzenden Schläfen. Ihm war ein wenig schwindlig. Jetzt durfte er seinen Ermüdungserscheinungen endlich freien Lauf lassen. Das selbstlose Engagement für die Erhaltung der Heimat kostete ihn zunehmend Kraft, Geld und Nerven. Aber sie war den ganzen Aufwand wert.
*
Eva Lünitz und ihre Freundin Annika saßen beim Dessert. Beide hatten sich je ein Tiramisu bestellt.
»Puh … eigentlich kann ich nicht mehr, bin pappsatt. Alfonso hat es mit seinen Portionen wieder heillos übertrieben. Ich hätte vor der göttlichen Penne arrabiata nicht auch noch den Krabbencocktail bestellen sollen. Spätestens morgen bereue ich die Völlerei wieder, wenn ich auf die Waage steige und mich frage, ob das verdammte Ding womöglich kaputt sein könnte«, stöhnte Annika augenrollend.
Die hübsche Fünfundvierzigjährige mit dem schwarz gefärbten Bobschnitt neigte ein wenig zum Übergewicht, aber die paar überzähligen Kilos standen ihr sehr gut. Eva beneidete sie sogar um ihre frauliche Figur und das sehenswerte Dekolleté, welches sie meistens mit auffälligem Silberschmuck in Szene setzte. Ein Hingucker, der die Blicke der meisten Männer anzog.
»Stimmt. Das waren viel zu viele Kalorien, die möchte ich gar nicht zusammenrechnen. Oder wie heißen diese elenden Dinger, die einem nachts immer heimlich alle Klamotten enger nähen?«, entgegnete sie scherzhaft.
Eva Lünitz war zwar groß und schlank, aber ausgerechnet auf Oberschenkeln und Hüften lagerte sich eben doch immer etwas Speck ab. Diäten halfen nur wenig und das ärgerte sie gewaltig. Wenn diese Pfunde wenigstens weiter oben angesiedelt gewesen wären, aber so … sie schüttelte den Gedanken seufzend ab.
Beide lachten herzhaft, genossen die Köstlichkeit in kleinsten Häppchen, ließen sich jeden Bissen genüsslich auf der Zunge zergehen. Alfonso hatte sich wieder selbst übertroffen. Er verwendete einen besonders milden Kaffeelikör aus seiner umbrischen Heimat und fügte Vanille hinzu – echte Bourbon natürlich, frisch aus der Schote geschabt. Mit Rispen roter Johannisbeeren garniert, schmeckte seine Version von einem Tiramisu nicht nur ausgezeichnet, sondern war überdies eine Augenweide.
»Wen interessiert schon, was morgen ist! Komm, wir bestellen uns noch einen Cappuccino zum krönenden Abschluss. Es ist gerade so gemütlich, ich möchte noch nicht heimfahren«, suggerierte Annika genießerisch und lehnte sich zurück. Ihr Bäuchlein wölbte sich unter der engen nachtblauen Spitzenbluse.
»Einverstanden. Mein Göttergatte kommt sowieso erst wieder weit nach Mitternacht. Ich habe keine Lust, mich von ihm aus dem Tiefschlaf reißen zu lassen, ergo kann ich genauso gut noch eine Weile mit dir ausgehen«, meinte Eva achselzuckend.
Annika beugte sich weit nach vorne. Nun drohten ihre Brüste jeden Moment den Ausschnitt zu sprengen. Ein älterer Herr am Nebentisch konnte kaum die Augen davon lassen und das, obwohl er sich in weiblicher Begleitung befand. Das dürre Gerippe an seiner Seite zog bereits ein säuerliches Gesicht.
»Hast du inzwischen herausgefunden, was dein Marcel freitags immer dermaßen lange im Wirtshaus treibt?«, raunte sie, als ginge es um brisante Staatsgeheimnisse.
»Nicht wirklich, nein. Wie er immer sagt, muss es sich um eine Art Herrenabende handeln. Du weißt schon, so eine Herde von Stammtischphilosophen die meinen, sie hätten die Weisheit mit Löffeln gegessen. Es wundert mich zwar schon ein wenig, dass ausgerechnet mein Mann sich befleißigt fühlt, sich an sowas zu beteiligen, aber … ach, Männer. Wer könnte die je richtig verstehen«, grinste Eva.
»Und du bist vollkommen sicher, dass es sich um keine andere Frau handelt?«, bohrte Annika skeptisch nach. Sie stand offenbar noch ganz unter dem Eindruck ihrer letzten Trennung. Ihr Freund war mit einer Nachbarin durchgebrannt.
»Ja, da bin ich allerdings sicher. Marcel liebt mich. Außerdem habe ich … sagen wir mal … ein paar Nachforschungen betrieben. Nur zu meiner persönlichen Beruhigung. Mir kam es spanisch vor, dass mein Gatte in seiner Freizeit ständig am Computer hockt, obwohl er da schon während der Arbeit jede Menge Zeit verbringen muss. Ich kenne sein Passwort, es handelt sich um den Namen und das Geburtsjahr unseres Sohnes.