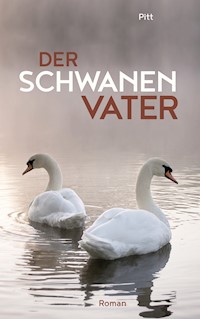
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
"Muss man Göttinnen lieben? Man dient ihnen." In der Not der Nachkriegszeit heiratet ein Arbeiter die unversorgte Witwe eines Oberregierungsrats der Gestapo, die zwei kleine Töchter in die Ehe bringt. Der Mann, in einem Fürsorgeheim aufgewachsen, schafft seiner Familie ein Paradies nach seiner Vorstellung. Trotz ihrer Liebe zum Stiefvater besinnen sich die Töchter in ihren Karriereplänen - Heirat in eine Unternehmerdynastie hier, eine akademische Laufbahn da - auf den gesellschaftlichen Status des leiblichen Vaters: sie "schneiden und radieren" den Stiefvater aus den Dokumenten ihres Lebens. Der Schwanenvater, von seiner Frau schon getrennt, bricht den Kontakt zu seinen Töchtern ab.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 317
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
Heinrich Langhans am Stölpchensee
Ein Zaungast
Der Sammler
Der Pavillon
Am Stölpchensee
Der Gärtner
Villa Langhans
Im Versorgungsheim
Brigitte Langhans verw. Stein
Das Wunder
Der Zaunkönig
Der Eindringling
Der erste Mann
Die Schwestern Stein
Eine falsche Adresse
Sternstunden
Das Dutzend Jahre
ORR Günther Stein
Abschiede
Das Dossier
Der Herrenorden
Renten, Rätsel,
Eine Hochzeit
Das Testament
Die Doktorarbeit…
Helga Jahn und Dr. Hannelore Wefers
Die Parzelle
Der Wille
Frau Jahn
Bilder an der Wand
Eine Schuld
Das Treffen am Stölpchensee
Vier Briefe (die nicht gelesen werden müssen)
Statt eines Nachworts: Warum eine Schublade geöffnet wurde
I
Heinrich Langhans am Stölpchensee
Ein Zaungast
Sollte er nicht vorn stehen, neben den Töchtern? Hatte er in den letzten zehn Jahren dem Toten nicht näher gestanden als die beiden Damen, die den Vater lange nicht gesehen haben? Der Trauerredner ist falsch instruiert. Oder trägt er einfach einen Standardtext vor? Die Formel von der Geborgenheit des Menschen in der Liebe der Familie passt nicht, nicht hier. Hier hatte es einen Bruch gegeben, den zu erklären jeder Redner, wohl auch einer im Ornat, überfordert gewesen wäre. Wie gern hätte er dem Redner einen kleinen Text geschrieben! Keiner, außer den Damen in Grau und Schwarz, niemand in der kleinen Trauergemeinde, wusste etwas über das Leben des Verstorbenen, auch nicht der junge Kassierer aus dem SPD-Distrikt, der seinem alten Vorgänger das Gesteck aufs Grab gelegt hat, nicht das halbe Dutzend der Bewohner des Farmsener Pflege- und Altenheims, das den Hausgenossen seit wenigen Monaten kennt, nicht der Schatzmeister, dem Pitt den dezenten Wink gegeben hatte, er könne eine hübsche Erbschaftsspende für den Freundeskreis des Pflegeheims erwarten. Eine Rede am Grab darf kurz sein, für die Kapelle 13 hätte der Stoff nicht gereicht – wenn Heinrich Langhans sie überhaupt gewollt hätte.
Pitt hat sich an das Blütengewölbe des Rhododendronwalls gestellt, hinter dem das Gebrumm des Linienbusses 270 auf der Lärchenallee des Ohlsdorfer Friedhofs während der Zeremonie nur ein einziges Mal zu hören gewesen war. Von hier aus kann der Zaungast unauffällig die beiden Töchter beobachten. Sie interessieren ihn jetzt mehr als der alte Mann in der Grube. Während die Trauergäste für ihre Beileidsbekundungen an die Töchter herantreten, beschließt Pitt, sich seiner Kondolenzpflicht zu entziehen. Er drückt sich an der Blütenwand entlang auf den Rasen, auf dem nur wenige Steine aus kissengroßen Blumenbeeten ragen, geht rasch quer über die Gräberbrache, als könne er den Parkplatz an der Allee nicht schnell genug erreichen.
In der Lärchenallee setzt Pitt sich in sein Auto. Um seinen Plan zu erfüllen, muss er warten, bis das Grab verlassen ist. Er ist ein bisschen unruhig, weil er mit den Gepflogenheiten nicht vertraut ist: stehen schon die Totengräber an den Büschen, räumen sie schon die grünen Kunststoffteppiche und die Bretter der Randbefestigung fort? Wann poltert es auf den Deckel? Er will dem Toten ein Geschenk ins Grab werfen, das er dem Lebenden einmal versprochen hat, ein kleines Buch. Doch er will das unbeobachtet tun.
Der Redner sitzt noch in seinem Auto in der Allee, gegenüber dem Wegweiser zum Prominentengrab des Heinz Erhardt, und kramt im Handschuhfach, vielleicht nach dem Manuskript für den nächsten Termin. Die Heimbewohner sammeln sich an der Bushaltestelle, ein Uralter darunter, der von zwei Mitbewohnern an den Oberarmen gestützt wird. Der Redner fährt ab, und Pitt schaut ihm im Spiegel nach, bis er in die Seehofstraße zum Bramfelder See abgebogen ist. Er will noch die Abfahrt des Busses abwarten. In der Allee stehen nur drei Autos, außer seinem. Ein silbergrauer BMW der Siebenerreihe trägt das Ortskennzeichen WI. Das wird der Wagen der ältesten Tochter sein, der Helga aus Oestrich- Winkel. Kein Frankfurter Wagen. Die Hannelore wird im Wagen ihrer Schwester gekommen sein. Wo sind die beiden?
Er blättert in dem Büchlein, das er Heinrich Langhans ins Grab werfen will, und betrachtet die Stiche, die den Leser auf die drastischen Schwänke einstimmen. Die Fastnachtsspiele des Hans Sachs hatte er Heinrich Langhans zu Weihnachten schenken wollen, für seine Sammlung. Der hatte Anfang Dezember einen leichten Schlaganfall erlitten, und seit seiner Entlassung aus dem Barmbeker Krankenhaus hatte er im Farmsener Pflegezentrum gelebt, depressiv, misslaunig, gar nicht wiederzuerkennen. Pitt hatte bessere Tage abwarten sollen, um ihm das gewiss willkommene Geschenk zu machen. Heute ist kein besserer Tag, doch sein Geschenk soll Heinrich Langhans erhalten, jetzt. Es gab keinen törichten Grund mehr zu warten.
Die Schwestern sprechen lebhaft miteinander. Streiten sie sich? Hannelore Wefers bleibt immer wieder stehen, in der Erstarrung eines Filmstops. Helga Jahn fasst ihre Schwester am Arm, als wolle sie die Lähmung lösen. Sie ist fast einen Kopf größer als die Schwester. Unter dem flauschigen, lang fallenden dunklen Mantel ist eine füllige Figur zu ahnen, ein breites, dichtes Blond liegt auf dem Schultertuch der Sechzigjährigen, die das frische faltenfreie Gesicht einer Vierzigjährigen hat. Die Jüngere, die Hannelore, wirkt älter. Ihr hageres Gesicht ist eingeschlossen von grauem glatt-flachen, leicht strähnig wirkenden Haar. Aus der Jacke des dunklen Kostüms treten die Schultern eckig hervor.
Die Frauen gehen zum BMW, steigen jedoch nicht ein. Der heftige Wortwechsel setzt sich fort. Neugierig senkt Pitt die Scheibe eine Handbreit ab, doch die Worte verwehen. Helga Jahn öffnet den Kofferraum und nimmt ein großes Blumengesteck heraus. Sie geht schräg über die Allee. „Komm endlich!“, ruft sie, schon auf dem Seitenweg, zu ihrer Schwester hinüber, die schon die Autotür geöffnet hat. Die zieht die Schultern so hoch, dass der Riemen ihrer Beuteltasche wie auf einem Kleiderhaken liegt, und setzt sich auf den Beifahrersitz. Helga Jahn verschwindet im Seitenweg. Sie wird, vermutet der Zaungast, zum Grab der Mutter gehen.
Pitt fährt zur Eichenallee und über die Kapelle 13 zur Mittelallee, um die Seehofstraße zu zu erreichen, von der es nicht weit zum Grab ist. Die Arbeiter machen sich schon am Grab zu schaffen. Auf dem lehmig zertretenen Rasen liegt ein Holzkreuz mit der Aufschrift: Heinrich Langhans 1913–1999. Bretter knallen auf einen Karren. „Zu spät gekommen?“, fragt ein Arbeiter teilnahmsvoll. „Sollen wir aufhören?“ Auf der dunklen Schleife des Wagenradkranzes aus Rosen und Lilien steht in goldenen Buchstaben: Unserem guten Vati Helga und Hannelore.
Die beiden Arbeiter – nennt man sie nicht Totengräber? – stehen unschlüssig auf ihre Schaufeln gestützt. Pitt schaut in die Grube. Der Sand und die Blütenblätter auf dem hellen Holz erinnern ihn an die Keksteller auf dem Tablett, das Heinrich Langhans so oft in seinen Pavillon getragen hat. Etwas verwirrt klopft Pitt mit der Linken auf den harten Buchdeckel in seiner Brusttasche. Er mag das Büchlein nicht hinabwerfen: er will nichts erklären. „Ein Verwandter?“, fragt der redselige Arbeiter. Pitt nickt. „Unser Beileid“. Wenn er es recht bedachte, ja, ein Verwandter. „Danke“. Beinahe hätte Pitt „ein Freund“ gesagt. „Wissen Sie“, hört er sich sagen, „er hat es immer schwer gehabt in seinem Leben.“ Der Redselige sagt: „Na, das ist ja nun vorbei. Bei uns in Ohlsdorf haben’s alle gut. Können wir dann?“
Der Lehmhaufen stürzt wie von Geisterhand bewegt auf den Sarg, die Hülle des kleinen dürren Körpers. Der steckt in einem dunkelblauen Anzug. Aus einem viel zu weiten Kragen ragt ein rhombuseckiger Kopf, der Borsten drahtigen Haares über Ohren legt, die in unterschiedlichen Winkeln zum Gesicht stehen. Es ist in den letzten Jahren so hutzelig geworden, dass es nur noch aus einem Stirndreieck und der scharf gezeichneten Nasenpyramide zu bestehen scheint.
Pitt bleibt in der Nähe des Grabes stehen, bis die Arbeiter die Lehmerde zu einem kunstvollen Sargdeckel festgeklopft haben. An seiner glatten Perfektion hätte Heinrich Langhans seine Freude gehabt: gerade gezogene Kanten wie auf dem Spargelbeet, ebene Flächen. Einer rammt das Holzkreuz in den weichen Grund. Der andere legt die Kränze auf den Hügel und strählt die Schleifen. Die Goldlettern auf der dunklen Schleife des Riesenkranzes leuchten tief in der Sonne. Pitt richtet zwei müd gewordene Nelken auf dem Parteigebinde, das er ja auch mitbezahlt hat, und er fühlt sich ein bisschen beschämt, dass er der Gärtnerei einen anonymen Kranz in Auftrag gegeben hat. Was könnte auf seiner Schleife stehen?
An seinem Wagen in der Allee stehend, ist Pitt in der Versuchung, ein Zigarillo zu rauchen, und er hält den Stängel – Rauchen auf dem Friedhof, auch wenn der ein großer verkehrsreicher Park ist? – unschlüssig in der Hand. Er hat den Wiesbadener Wagen nicht kommen sehen. Sein Schlag öffnet sich. „Entschuldigen Sie, mein Herr!“ Pitt steckt die Hand mit dem Zigarillo blitzschnell in die Manteltasche. „Ja, bitte.“ Jetzt erst erkennt er die Blonde, Helga Jahn, die ihren Körper mit einer gewissen Anstrengung aus dem Wagen hebt. „Mein Herr, haben Sie nicht eben an der Beisetzung meines Vaters teilgenommen? Entschuldigen Sie, aber wir möchten doch – “. Sie steht vor Pitt und sieht ihn mit forschenden Augen an. Die Unternehmerin. Ihr Blick fragt: warum stehen Sie hier herum? Die Schwester im Wagen schüttelt mit abweisend verzerrtem Gesicht den Kopf.
Pitt fühlt sich in seiner Verlegenheit klein vor der stattlichen Dame, die ihn unbarmherzig anblickt, eine strenge Frage in den Augen, kräuselndes Misstrauen auf der Stirn über der Nasenwurzel. „Sie waren das, nicht wahr? Vorhin am Grab. Haben Sie meinen Vater gekannt? Ich bin Helga Jahn, die Tochter. Wir sind die Töchter. Meine Schwester, Dr. Wefers.“ Die Hand fährt hinüber zum Wagen, am Gelenk klirren silberne Ringe. Pitt stellt sich vor, kondoliert in der verunglückten Angemessenheit und bittet um Verständnis, dass er sich so früh vom Grab abgewendet habe –
„Sie haben meinen Vater gekannt?“ Er ist froh, unterbrochen zu werden. Ja, er und der Vater seien in den letzten Jahren gute Bekannte gewesen. „Sind Sie der Herr, der meinen Vater häufiger besucht hat?“ Pitt ist überrascht: wie kann sie das wissen? Ja, sie hätten häufig zusammengearbeitet. „Mein Vater hat für Sie gearbeitet?“ Nein, nein, ein bisschen im Garten, am Haus. Haben die Töchter vielleicht von Frau Bollmann, dem Engel wahrer Nachbarschaft am Stölpchensee, den Tod des Vaters erfahren? Aber sie ist heute nicht hier gewesen. Oder von der Heimleitung? Zu ihm war die Nachricht zufällig gekommen, weil er Heinrich Langhans am Nachmittag seines Todestages im Heim besuchen wollte. „Wir danken Ihnen, dass Sie unserem Vater das Geleit gegeben haben. Er kannte ja wohl niemanden mehr in Farmsen.“ Warum sind nicht wenigstens die Nachbarn gekommen, denkt Pitt, er hat über fünfzig Jahre am Stölpchensee gewohnt. Musste er nicht auch Hannelore Wefers kondolieren? Die blickt so demonstrativ gleichgültig die Allee hinunter, dass er es vorzieht, an seinen Wagen zurückzutreten.
„Ich habe mich sehr gefreut, Sie noch kennengelernt zu haben. Mein Vater war sehr allein in seinen letzten Jahren.“ In den letzten? „Auf Wiedersehen.“ Helga Jahn reicht Pitt zögernd die Hand, eine weiche, eine feste. „Noch einmal, vielen Dank.“
Im Wagen zündet sich Pitt, erlöst aus seiner Trotteligkeit, eine Petit an – der Stängel in der Manteltasche ist zerbröselt. Der BMW fährt durch das Portal am Bramfelder See. Beklommen denkt Pitt daran, dass er wenigstens einer der Schwestern noch einmal begegnen werde. Er hat einen Auftrag von Heinrich Langhans, den er auszuführen hat, und ohne Mitwirkung der Töchter ist das nicht möglich. Er ist zornig auf sich, beschämt: warum hat er nicht gleich ein Gespräch vereinbart, nach einer anständigen Beileidsbekundung am Grab, auf einem gemeinsamen Weg zu den Wagen? Er könnte jetzt mit den Langhanstöchtern im „Seehof“ sitzen, wie so viele Menschen das nach anständigen Beerdigungen tun. Die blonde Helga ist eine resolute Unternehmerin: sie würde sich über seine Zögerlichkeit erstaunt zeigen, wenn sie ihn wiedersehen würde, um ihm zu ermöglichen, Heinrich Langhans’ Auftrag zu erledigen.
… Der in der Brusttasche steckende Hans Sachs soll ihn besser begleiten in Langhans’ Haus, in den Pavillon, er wird ihn einfügen in die Sammlung, sie ist ja nach Nummern geordnet.
Der Sammler
Vor zehn Jahren hatte das Pittpaar, in Frankfurt lebend, für das geerbte Häuschen in Farmsen, das sie als ihr Hamburger Domizil nutzen wollten, nach einem Gartenpfleger, vielleicht einem rüstigen Rentner, Ausschau gehalten. Beim Blättern und Suchen im Wochenblatt für Rahlstedt und Farmsen, einem jener in die Briefkästen gesteckten Anzeigenblätter, in denen sich neben spannenden lokalen Nachrichten und Reportagen die nachbarschaftlichen Märkte in der ganzen Bandbreite menschlicher Bedürfnisse darbieten, war das Auge auf eine überraschende Anzeige in der Rubrik „Ankauf“ gefallen: „Suche aus der Insel-Bücherei die Nummern 46, 152, 183, 246, 403, 467. Zahle jeden angemessenen Preis.“ Eine Telefonnummer.
In den Frankfurter Zeitungen oder in der „Zeit“ mochte man solche Anzeigen gelegentlich lesen. Doch im Wochenblatt, dem ganz und gar auf das Praktische und Nützliche gestellten Anzeiger? Ein literarisch interessiertes Publikum wird in ihm nicht nach Raritäten fahnden. Wenn der Inselbücherfreund mit den unerträglichen Lücken in seiner Sammlung die Anzeige in der Hamburger Gesamtausgabe des Wochenblatts geschaltet hatte, konnte er mit seinem Hilferuf zwar gut und gern eine Million Leser erreichen, doch die suchten doch allenfalls die Offerten der Schnäppchenmärkte, den Service von Bestattungsinstituten, Fahrschulen und Frisiersalons und Scheidungsanwälten, Informationen über Hobbykreise, die Protokolle verdienstvollen ehrenamtlichen Wirkens. Auch Kulturelles, ja Literarisches hatte seinen Platz im Wochenblatt – so erinnerte sich Pitt an einen Bericht über die Instandsetzung des weitläufigen Familiengrabes Detlev von Liliencrons auf dem Rahlstedter Friedhof, der dem größten Lyriker des eben ausklingenden Jahrhunderts, dem Gottfried Benn, in seiner Jugend ein „Gott“ gewesen war. Aber eine Suche nach literarischen Perlen in der alltäglichen Warenwelt? Musste sie nicht hoffnungslos ins Leere laufen: wie viele Menschen mochten sie lesen und wie viele von ihnen horteten Inselschätze in ihren Bücherregalen? Und der Hamburger Osten ist auch nicht gerade Eimsbüttel oder Eppendorf.
Pitt hatte den Ausriss in sein Portemonnaie gesteckt. Er wollte unbedingt daran erinnert werden, in seiner Insel-Sammlung nach den begehrten Nummern zu fahnden. „Sammlung“ ist übertrieben: er sammelt nicht, nichts. Doch vielleicht hundert Nummern hatten Liebesblicke in Schaufenster, Geschenke, Zufallskäufe in Bahnhofsbuchhandlungen, der Griff in Grabbelkisten zusammengetragen, und er liebte seit früher Jugend diese farbenfrohen und figurenreichen schmalen Bändchen, die sich typographisch jedem Stoff und jeder Form einfühlsam anschmiegen, deren Kartons so lichtvoll individuell bedruckt sind – er muss immer an den kindlichen Tuschedruck mit den aus Kartoffeln geschnitzten Stempeln denken.
Wenn der Zufall ihm aus den über tausend Nummern der Insel-Bücherei die Bände ins Regal gestellt haben sollte, nach denen das Herz des Sammlers schrie, wollte er sie keineswegs verkaufen. Er hatte gehört, dass einige Titel der Sammlung einen hohen und kostspieligen Rang auf der Raritätenskala hatten. Wertschätzung hat nichts mit Geldwert zu tun, klar, aber es würde Spaß machen, einmal den Zufall auszutesten, wie das ja Millionen Lottospieler jede Woche tun. Vielleicht interessierten den Sammler ja wirklich nur Goldstücke.
Und es verschlug ihm den Atem: von den sechs Nummern, nach denen es den Bücherfreund verlangte, für die er jeden, wenn auch angemessenen Preis zu zahlen bereit war, besaß Pitt vier, genauer drei, denn eine hatte Pitts Frau in die eheliche Bibliothek eingebracht. In seinen Händen hielt er Storms Schimmelreiter (die Nummer 152), von Klabund den Pjotr (die Nummer 403) und die chinesische Kriegslyrik (die Nummer 183) und die „Beichte“ von Wilhelm von Scholz (dass der Scholz unter den Funden war, verblüffte ihn am meisten, denn der hatte ein wundersames Buch über das bizarre Spiel des Zufalls geschrieben). Und zehn Jahre nach diesem ersten Nummernvergleich, im vergangenen Herbst, hatte Pitt in einem von ihm seit Studententagen geliebten Antiquariat am Dammtor, in einer offenen Lade im Freien, die Nr. 46 gefunden, Hans Sachs’ Fastnachtsspiele.
Pitt wählte die Telefonnummer und stellte sich mit seinem Namen und seinem Frankfurter Wohnort vor.
„Ja?“
„Ich habe im Wochenblatt Ihre Anzeige gelesen – wegen der Insel-Bücherei.“
„Wird das Wochenblatt denn auch in Frankfurt gelesen?“ Eine helle feste Stimme. In einem kürzlich gelesenen Roman Gerhart Hauptmanns hatte Pitt das Bild von den zusammenschlagenden elfenbeinernen Billardkugeln gefunden, in dem der Dichter die Stimme eines Kapitäns beschreibt. Das fiel ihm ein, wenn auch der Singsang der fremden Stimme nicht ganz in das Bild passte.
„Nein, ich habe Ihre Anzeige in Farmsen gelesen.“
„In Farmsen?“ Ein Misstrauen war zu spüren.
„Ich bin manchmal in Farmsen. Also, um es kurz zu machen, ich habe die Nummern …“ Eine Aufzählung in der frohgemuten Stimme einer Lottofee, die zusammenfassend das Losschicksal vermeldet.
„Nein! Wirklich?“
„Doch, ich habe vier.“
„Kann ich sie sehen? Ach, nein, Sie wohnen ja in Frankfurt. Ich kann nicht nach Frankfurt fahren, nein, leider. Wollen Sie sie verkaufen?“
„Entschuldigen Sie, ich hatte Ihren Namen nicht verstanden.“ „Ich heiße Langhans, Heinrich. Wollen Sie mir die Nummern verkaufen?“
„Das weiß ich noch nicht, Herr Langhans. Kann ich Sie besuchen, wenn ich wieder in Farmsen bin? Vielleicht in vierzehn Tagen?“ Eine lange Pause entstand – angefüllt mit Misstrauen, mit Hoffnung, mit Unglauben?
„Ja, das würde mich sehr freuen. Vier Nummern haben Sie? Die Klabunds, den Storm, den Scholz? Ich suche schon lange nach ihnen, zwanzig Jahre.“ Das war ein taktischer Fehler, der den angemessenen Preis hochtreiben könnte.
„Bitte, geben Sie mir Ihre Adresse, Herr Langhans.“
„Ich kann Sie besuchen, wenn Sie in Farmsen sind. Das ist doch möglich, nicht?“
„Herr Langhans, Sie würden mir eine große Freude machen, wenn Sie mir Ihre Bibliothek zeigen würden.“ In Anbetracht einer zwanzigjährigen Suche und Sorge um quälende Lücken konnte dieser Wunsch weder aufdringlich noch unbescheiden klingen.
„Meine Bibliothek – “ Die präzise, von Silbe zu Silbe ins Offene schwingende Artikulation verriet immer noch viel Zaudern. „Ja. Gut. Ich wohne am Stölpchensee – “
Pitt unterbrach ihn. „Stölpchensee. Aber der ist doch in Berlin!“ „Nein, nein, unser Stölpchensee ist hier in Hamburg. Swartenhorst. Der Kleingartenverein. Parzelle Nr. 128. Heinrich Langhans, direkt am See.“
„Ich hab’s notiert. Danke! Wenn ich in Farmsen bin, rufe ich Sie an, Herr Langhans. Ich besuche Sie! Und dann schauen wir uns Ihre Schätze an, ja?“
„Anschauen? – Aber Sie bringen die Bände mit? Sie rufen mich wirklich an?“
„Versprochen, Herr Langhans! Ich rufe Sie an, auf Wiedersehen.“
Das war das erste Versprechen, das Pitt Heinrich Langhans gegeben und es auch gehalten hat, wie das letzte.
Ein Kleingartenverein. An einem Stölpchensee. Er kannte sich in Farmsen nicht gut aus. Er wusste aber: in Farmsen, in einem Kleingartenverein, in einem Häuschen auf einer Parzelle, musste ein Liebhaber der Insel-Bücherei eine gewissermaßen exzentrische Erscheinung sein. Zwar war die Insel-Bücherei von klugen Verlegern ersonnen worden, die Schätze der Weltliteratur über alle Hütten zu streuen, aber – merkwürdig, nicht? – den Hüter einer Insel-Sammlung, der ihre Vollzähligkeit anstrebt, wollte sich Pitt nur als Herrn eines kleinen Palastes vorstellen.
Er telefonierte noch zweimal mit Heinrich Langhans, um das vereinbarte Treffen bedauernd zu verschieben. Jedes Mal klang die Stimme des Sammlers enttäuschter und mutloser. Nein, auf die Anzeige im Wochenblatt hatte sich außer Pitt niemand gemeldet. Schien eine Hoffnung sich zu verflüchtigen? Heinrich Langhans kam sogar auf die geradezu leichtfertige Idee, die Inselbändchen per Post nach Farmsen schicken zu lassen, zur Ansicht. Und einmal nannte er Pitt – es ging um den Schimmelreiter – einen Ankaufspreis, dessen Höhe die Qual eines Sammlers widerspiegelte.
Ist einer, der in einem Kleingartenverein auf einer Parzelle wohnt, nicht auch ein Gärtner, zwangsläufig? Noch war das Problem der Gartenpflege auf dem geerbten Farmsener Grundstück nicht gelöst. Nach dem Alter des Büchersammlers hatte Pitt nicht gefragt. Seine Stimme – die springenden, lebendigen Billardkugeln – schien eher zu einem Jüngeren zu gehören als zu einem rüstigen Rentner, der neben dem eigenen noch einen fremden Garten versorgen wollte. Am Telefon sind viele Stimmen alterslos. Pitt erwog, die Begierde des Sammlers zu nutzen: könnte er nicht die Objekte seiner Leidenschaft gegen einen kleinen Gartendienst – Rasenmähen, ein wenig Jäten, eine Hecke schneiden, Sprengen – tauschen? Ist es nicht schnöder, ja perverser Eigennutz, eine literarische Passion derart zu missbrauchen? Kann denn ein Bücherliebhaber ein guter Gärtner sein? – doch da musste Pitt gleich an Hermann Hesse denken. Ich schenke ihm zwei Bände, dachte er, und die anderen beiden, die Klabunds, stelle ich ihm in Aussicht, und dann spreche ich beiläufig über meine Gartensorgen. Könnte er mit dieser List nicht gar einen Gärtner aus Liebe gewinnen?
Der Pavillon
Eine Brücke, von gekalkten Steinen gefasst, führte über einen schmalen Sumpfwassergraben zu einer Holzpforte, auf der unter der Nummer 128 der Name Langhans in schmiedeeisernen Majuskeln stand. Das glattverputzte weiße Torgewölbe, über dem ein Laternchen schwebte, teilte eine Hainbuchenhecke, deren Blattknospen sich schon so weit geöffnet hatten, dass die Wand des Grüns einen Einblick in den Garten verwehrte. Trotz seines architektonisch stattlich anmutenden Rahmens war das Tor niedrig und schmal. Pitt drückte den Klingelknopf. Nichts geschah: kein Surren, kein Summen, keine schnarrende Stimme aus dem Lautsprechersieb, kein Ruf über die Hecke. Noch einmal drückte Pitt: er war doch angemeldet! Sonnabend, elf Uhr. Er blickte auf seine Uhr. „Herr Langhans!“, rief er und drückte sein Gesicht nahe ans duftende Knospengrün, um nach Leben im Garten zu spähen. Er ging ein paar Schritte nach links, wo die Buchenhecke an einem Ligustergestrüpp endete. Er sah den See, den Stölpchensee, sah ihn zum ersten Mal, einen Ausschnitt seines kleinen dunklen Runds mit dem tiefliegenden Spiegel, den an einem Ufersegment Weidenruten ritzten. Aus einer Hütte sah er einen kleinen Mann treten. Ja, das war der Mann, der sich die eindrucksvolle und doch so niedrig-schmale Pforte gebaut hatte. Er lief zu ihr zurück.
Doch sie öffnete sich noch nicht. Pitt klingelte noch einmal, ohne Echo, rief: „Herr Langhans!“. In einem Spalt der Bretterpforte zeigte sich ein halbes Gesicht. „Ich bin’s, der Inselmann!“ Das Tor war der zierlichen Gestalt, die in ihm erschien, angemessen; Pitt, auch recht klein, zog den Kopf ein, als er durch die Pforte ging. „Es ist elf“, sagte Heinrich Langhans. „Ich war im Pavillon, da höre ich die Klingel nicht. Da will ich nicht gestört werden. Sie haben doch nicht gewartet?“
Heinrich Langhans gehörte nicht zu den Menschen, die man gutaussehend nennt. Ein Gesicht ohne Weichheit, ohne Wärme und Blut unter der Haut, alles in ihm spitz, knochig, knorpelig, scharf geschnitten. Die Augen in enger stummer Tiefe über dem kantigen, höckerigen Nasenrücken. Nur sein Lächeln machte die Lippen lebendig, die breit und blass wie ein alter Regenwurm zwischen den bartschattigen Kiefern lagen. Pitt musste sich Mühe geben, nicht auf die schief verwinkelt abstehenden Ohren zu starren, denen die Vormittagssonne ein wenig Blutlicht schenkte.
„Wir gehen gleich in den Pavillon.“ In den weiß gestrichenen Würfel, dessen Flachdach von dunkel gebeiztem Kiefernholz gerahmt war, führte eine Tür so schmal wie die Gartenpforte, keine Fenster waren zu sehen. Er stand nahe am Ufer des Sees, und an seiner südlichen Wand lief ein Bootssteg in den See, der mit einem Balkenpier verbunden war. Pitt wäre gern auf den Steg gegangen, um einen Rundblick auf den See zu haben, der mit seiner größeren Hälfte im Lichte der Vormittagssonne lag. Doch der Hausherr hatte schon das Türchen geöffnet. „Treten Sie ein, bitte! Ich habe lange auf Ihren Besuch gewartet.“
Da war der See! – hinter der durch eine Holzsäule geteilten Fensterfront lag er unter den Kronen der schräg über die Ufer wachsenden Bäume, die einen schwachen Wind, der die Batikschabracke über zwei geöffneten Klappen bewegte, herüberzufächeln schienen. Die linke Wand war zu einem Teil bedeckt von einem Regal aus hellem Holz, vom Boden bis zur Decke, auf dessen handtiefen Borden die vielen Bändchen der Insel-Bücherei standen, eine Tapisserie aus den zarten lichten Farben und Ornamenten der Buchrücken, über die, etwa im goldenen Schnitt, das weißschwarze Band der Titeletiketten lief. In dieser Geschlossenheit und farblichen Vielfalt musste einst das Bild der Insel-Bücherei vor den Augen ihres Schöpfers gestanden haben, ein Prisma des Geistes in leuchtend magnetischer Kraft. Das hatte Pitt noch nie gesehen.
Der Besitzer der Sammlung weidete sich lächelnd am Staunen seines Gastes.
Das Regal war eingefasst von grünen Vorhängen, die Heinrich Langhans behutsam zuzog. „Bitte, nicht!“, bat der Gast. Der Hausherr wollte aber nur die sinnreiche Vorrichtung vorführen, die an den Spätnachmittagen des Hochsommers die Buchrücken vor den flach einfallenden Sonnenstrahlen schützen sollte. Die Sonne werde zwar durch die Baumkronen der Ufer gefiltert, habe aber doch Kraft genug, die Einbände auszubleichen, erklärte der Sammler.
An der Wand ein Heizkörper, ein Hygrometer, ein Ventilator. Er habe lange experimentiert, um das ideale Raumklima zu halten, sagte der Hausherr, der Pavillon habe kein Kellerfundament, und die Lage am See begünstige Feuchtigkeit. In den Wintermonaten müsse er dem leichten Bau kräftig einheizen. Der Wechsel in Feuchtigkeit und Wärme müsse umsichtig geglättet werden, um die Bücher vor Schäden zu bewahren. Gott sei Dank seien die Inselleute nie von der Fadenbindung abgegangen, so dass ein Auseinanderbrechen der Seiten wie bei den alten Taschenbüchern nicht zu befürchten sei.
Ein niedriges Bücherregal mit Lexika, Ratgebern und Sachbüchern stand an der rechten Wand, unter einigen Familienfotos, Kindermalereien und gepressten Blumen und Blättern unter Glas, in dem sich Fragmente des Inselteppichs spiegelten. Zum zierlichen runden Tisch am Fenster mit dem Korbsessel davor hatte der Hausherr einen Stuhl, wohl aus seiner Wohnstube, gestellt. Die Leuchtarme der Stehlampe waren auf das Inselregal und den Sessel gerichtet. Das Design des Kaffeegeschirrs auf der Glasscheibe des Tisches hätte ein kreativer Kopf des Inselverlages entworfen haben können, in der Schale das Gebäck wohl selbstgemacht. „Ich meine, wir trinken Kaffee“, sagte der Hausherr, „ich kann Ihnen aber auch, wenn Sie wollen, einen Saft anbieten.“ Er liebe es, einen Kaffee zu trinken, wenn er in seinem Pavillon bei seinen Büchern sitze. Kaffee, natürlich.
Der Bibliothekar trug einen dunkelblauen Anzug von bretthafter Flächigkeit, der das Eckige seiner Figur betonte und die scharf geschnittene Lineatur seiner Züge unterstrich. Der Kragen des weißen Hemdes ließ dem kantigen, ja schartigen Adamsknorpel viel Raum. Nicht nur für das Kaffeekännchen, auch für den ganzen Mann schienen die Hände mit den langen Fingerknochen, die in den Gelenken durch Kugeln verbunden waren, viel zu groß zu sein.
Der Hausherr hatte den Besucher in den Korbsessel genötigt, so dass dessen Blicke zwischen dem Panorama des Sees und dem der Bücherwand schweifen konnten. „Sie leben hier allein?“, fragte Pitt ahnungsvoll. Ja, seine Frau sei tot seit langem, zwei Töchter mit ihren Familien lebten weit entfernt. Er komme aber gut zurecht. Die Rente sei klein, er bessere sie durch Gelegenheitsarbeiten auf – „hier am Stölpchensee wird dauernd gebaut und gewerkelt, da kann ich mich nützlich machen.“ Der rüstige Rentner!, blitzte es in Pitts Kopf, vielleicht hast du heute einen zuverlässigen Gärtner gefunden. Das Gespräch, kaum begonnen, versickerte. Der alte Mann – ein Mittsiebziger? – sah Pitt in forschender Spannung an. „Sehen Sie die Kordeln am Regal?“, fragte er, „mit ihnen markiere ich die Nummern, die mir fehlen.“
Aus seiner Mappe nahm Pitt die Bände, die in wenige der kordelverzierten Lücken passten. Einer nach dem anderen verschwand in Heinrich Langhans’ großen Händen. Sie betasteten ihren Einband, sie klappten sie wie ein Gebetbuch auf, sie wendeten sie und prüften auch Nummer und Titel auf dem Rücken.
„Sehen Sie die Sternchen hier? Die neuen Ausgaben haben sie nicht mehr. Darf ich wohl mal?“ Er stand auf und schob die vier Bändchen in die Lücken, nahm sie jedoch gleich wieder heraus, als sei er bei Verbotenem ertappt worden. „Den Schimmelreiter und den Pjotr hatte ich früher einmal. Die sind verlorengegangen.“
Er blätterte in Klabunds chinesischer Lyrik. „Dumpfe Trommel und berauschter Gong. Der ist in einer Auflage von mindestens dreißigtausend erschienen. Und ich habe ihn nie gefunden. Ich habe gesucht und gesucht.“ Es tue ihm leid, sagte Pitt, aber von den Klabunds könne er sich nicht trennen, nun ja, vielleicht, aber nur schweren Herzens. Den Schimmelreiter wolle er ihm gern schenken, doch der Scholz, leider, der gehöre seiner Frau. „Schenken wollen Sie ihn mir?“ Ein Schatten der Ungläubigkeit auf dem Gesicht. Die tiefliegenden Augen begannen zu strahlen. „Erlauben Sie mir – “, sagte Pitt, stand auf und schob die Nummer 152 in die Lücke. Dem Sammler gab er die Kordel: „Die brauchen Sie schon mal nicht mehr.“
Als sich der alte Mann bedankte, lag die Strategie klar vor Pitts Augen. Er würde ihm auch die anderen drei Bände schenken, im Abstand von jeweils mehreren Wochen. Er wollte mindestens noch dreimal in den Pavillon eingeladen werden. Der Sammler war ihm das Objekt seiner Neugier geworden. Er wollte auch gern in das Haus gebeten werden, an dem der Gastgeber vorhin achtlos vorübergegangen war, als stünde es auf dem Nachbargrundstück. Seine Absicht, einen zuverlässigen Gärtner zu gewinnen, hatte er vergessen, wirklich: das würde sich finden. „Wissen Sie, Herr Langhans, ich würde Ihnen gern bei der Suche nach den fehlenden Bänden helfen.“
„Das würden Sie tun?“ Seit seiner Lehrzeit in den zwanziger Jahren sammle er die Insel-Bändchen. Es habe Zeiten gegeben, in denen er sich keine habe kaufen können. Er könne sich gar nicht vorstellen, wie Pitt ihm helfen könne, die Lücken zu schließen, die ja, wie die vielen Kordeln zeigten, viel größer seien, als seine Anzeige im Wochenblatt verrate.
„Sie wissen doch, Herr Langhans, vier Augen finden mehr als zwei.“ Er stöbere gern in Katalogen und Antiquariaten, vielleicht gäbe es ja Inselspezialisten, die noch abgeklappert werden könnten, auch habe er Freunde mit großen Bibliotheken, die altersbedingt anfingen, ihre Borde von Überflüssigem zu befreien. Er redete sich in seinen Eifer, dem Sammler zu helfen, hinein, er, der schon als Kind an den einfachsten Sammlungen von Margarinebildchen gescheitert war, war in das Magnetfeld dieses kleinen Büchertempels geraten, und er malte sich die Freude aus, an der Vervollkommnung dieses Kunstwerks als Zuträger mitwirken zu dürfen.
„Ich muss Ihnen etwas gestehen. Alle Bände habe ich nicht gelesen. Bei manchen habe ich es versucht, aber es ging nicht. Sie müssen wissen, ich bin ein ungebildeter Mann.“ Pitts lachendem Protest antwortete ein bekümmertes Kopfnicken, in dem sich das Sandpapierkinn auf den vorstehenden Hemdkragen senkte, der deutliche Spuren von Aufrauung zeigte. „Sie können noch so viel lesen. Es gibt Dinge, da kommen Sie einfach nicht mit. Früher konnte ich meine Tochter fragen, ja, die Hannelore, die jüngste, die hatte es mit den Büchern, aber die ist lange weg. Ich habe keinen, mit dem ich über die Bücher sprechen kann. Aber sehen Sie! Sind sie nicht schön, meine Bücher? Gibt es etwas Hübscheres als diese Bücher? Wie sie alle da stehen und mich angucken. Manchmal sitze hier und spreche mit ihnen, da brauche ich gar nicht zu lesen. Ja, und die Augen werden ja auch alt.“
Er habe seinen Pavillon vor fast zwanzig Jahren eingerichtet. Früher, nach dem Krieg, als er sein Haus baute, war er ein Stall für die Schweine und für die Hühner, später eine Werkstatt und ein Geräteschuppen. Nach mehrjährigem Alleinleben war ihm der Gedanke gekommen, sich einen Seepavillon für seine Sammlung und für die Lesestunden zu schaffen. „Das Fernsehen, das mach’ ich im Haus. In meinem Pavillon fühle ich mich nie allein.“
Pitt ging an das Regal und tippte auf den Rücken einiger Bände, die er auch besaß. Heinrich Langhans’ Bemerkungen verrieten ihm, dass er seine Bücher kannte. „Ich habe ein Schriftsteller-Lexikon“, sagte er, „leider nur ein deutsches.“ Für diesen Leser war nur der ein Autor, der eine Heimstatt in seiner Insel-Bücherei hatte. „Soll ich Ihnen mein Lieblingsbuch zeigen? Nehmen Sie es, es ist die Nummer 278.“ Pitt zog die Nummer – Adalbert Stifter, Brigitta. „Das kenne ich nicht“, sagte er. „So? Ich kann es auswendig. Brigitte – so hieß meine Frau.“ Sollte Pitt jetzt fragen? Er tat es nicht. Er wollte noch viel wissen über Heinrich Langhans und seine Welt. Er würde wiederkommen.
Zwei Stunden waren vergangen, eine eben angemessene Spanne für einen ersten Besuch, der auch sechs Stunden hätte dauern können angesichts der Schnittmengen von Interessen, die sich auf Buchseiten häufen können. Ich kann es auswendig! Die Bücher, die wir kennen, Seite um Seite wiedererkennen, wenn wir sie aufschlagen, sind die, in denen wir Essenzen unseres Lebens schmecken. Brigitta. Frau Langhans. Pitt war neugierig auf die tote Frau eines Mannes, der sich eine Welt aus kleinen Büchern geschaffen hatte. Hatte sie seinen Sammeleifer gefördert? Oder die Tochter, die es mit den Büchern hatte, früher. Ach nein, schon der Lehrling Heinrich war ja auf die kleinen Bücher versessen gewesen. Die Liebe zu den kleinen und großen Büchern kennt kein Woher, Warum, Wohin.
Pitt glaubte, eine Verabredung mit seiner Frau fingieren zu müssen, um sich von Heinrich Langhans anständig verabschieden zu können. „Werden Sie mit ihr über den Scholz sprechen?“ Ohne es zu versprechen, sagte Pitt: „Darf ich Sie wieder anrufen?“
Auf dem Weg durch den Garten warf Pitt einen neugierig verlangenden Blick auf das kleine Haus. Er hatte die beiden Klabunds und den Scholz auf dem Tisch im Pavillon liegengelassen. Hatte sein Gastgeber das schon bemerkt? Es lag eine große Erwartung in seinem Abschiedsgruß am niedrigen Portal, das Pitt jetzt durchschritt, ohne seinen Kopf einzuziehen. Er hatte seinen Besucher weder nach seiner Frankfurter noch nach seiner Farmsener Anschrift oder den Telefonnummern gefragt.
Am Stölpchensee
Pitt ist noch oft im Kleingartenverein Nr. 548 am Stölpchensee gewesen. Eigentlich ist dieser Verein eine Gartenkolonie oder eine kleine Gartenstadt.
Im weitläufigen Hamburg gibt es etliche Gartenstädte, in denen die Ideen der zwanziger und dreißiger Jahre noch anschaulich sind – Kleinverdiener mit oft großen Familien an den Stadträndern in kooperierenden Nachbarschaften in guter Luft, unter heller Sonne auf einem Fleckchen agrarisch autarken Grüns für Gartenbau und Haustierhaltung anzusiedeln. Auch nach dem Zweiten Weltkrieg sind viele Siedlungen für Ausgebombte entstanden, zum Beispiel in der Jenfelder Märchensiedlung (alle könnten so heißen). Geblieben ist nur das Grün in der Monotonie steriler, sogar den Gänseblümchen feindlicher Rasenflächen, in den Buschbergen der Rhododendren, Koniferen oder Eiben, aus denen hie und da noch die knorrig vermoosten Apfel-, Birnen- oder Kirschbäume der Gründerzeit herausragen, oft nur in schier vertrockneten Stämmen mit Blattwedeln wie Ruinen in uralten Landschaften. Ob Genossenschaftswohnungen mit lebenslänglichem, oft vererbbarem Wohnrecht oder Eigenheime, die in den dreißiger Jahren schon für vierzehn Tausend Mark und mit kräftiger Eigenleistung, der Muskelhypothek, für weniger zu haben waren: das Wohnen hier, diese kleinschollige Bioexistenz in der großstädtischen Ballung, in der anheimelnden Selbstgenügsamkeit, die für die Gemeinschaft über den Gartenzaun hinweg offen war, wurde als ein soziales Privileg empfunden. In den fünfziger und sechziger Jahren war die städtische Welt enger und kostspieliger geworden: da konnte das gartenstädtische Ideal nur noch in Reihenhaussiedlungen mit symbolischen Gartenflächen, aber parkähnlicher Umgebung, verwirklicht werden, doch auch auf sie blickten die weniger Begünstigten von ihren Hochhausbalkonen mit stiller Sehnsucht herab. Viele Kleingartenvereine sind geschlossene Gesellschaften geworden: ihre Wartelisten spotten der Jahre.
Am Stölpchensee, auf dem Gelände zwischen Swartenhorst und dem Farmsener Strandbad, das aus einer der vielen Lehmkuhlen der früheren Ziegeleien entstanden ist, hat ein Grundeigentümer die Parzellen an die Siedler verpachtet, die dort ihre kleinen Eigenheime errichtet haben. Eigenheime – das klingt großartig. In der Wohnungsnot der Nachkriegszeit sind aus Behelfsheimen nach dem Muster des Kinderverses „Das ist das Haus vom Nikolaus“ Miniaturvillen entstanden. Aus Neubauten, Anbauten, Draufbauten und Umbauten hat die anarchische Baumeisterseele, die sich aus dem animalischen Nest- und Höhlenbautrieb begeistert erhebt, die Kunterbuntvielfalt einer Villenlandschaft geschaffen, die sich von den Prachtsiedlungen der Elbvororte nur in Größe, Aufwand und Stil, nicht jedoch im gestaltenden Impuls unterscheidet. Die Menschen richten sich nach ihren Mitteln ein, wobei natürlich Übertreibungen an der Elbe eher als am Stölpchensee anzutreffen sind. Pitt will das Wort „Villa“ stehen lassen. Es ist mit dem bürgerlich-herrschaftlichen Bau- und Wohnstil verbunden, gewiss. Wer sagt aber, dass die Siedler am Stölpchensee nicht die Herrscher im Reich ihrer Träume seien? Und „bürgerlich“ ist jeder, der für sein Eigen kämpft.
Eine Villa am Stölpchensee wird nicht unbedeutend, weil sie auf einem Pachtgrund steht oder mit den Versatzstücken der Baumärkte verschönert wurde. Gewiss sind Bauidealen Grenzen gesetzt, wenn Dächer nicht mit Reetpolstern oder engobierten Farbziegeln gedeckt sind, sondern mit pilzüberwucherten grauen oder rostroten Betonziegeln, Wellblech oder Teerpappe. Eternitplatten verbreiten nicht den Glanz heller Klinker, und Bretterverkleidungen haben nicht den Schimmer von Edelholzpaneelen. Die Wintergärten wirken nicht wegen des simpleren Materials uneleganter, sondern wegen ihrer kümmerlichen Größe, die sich der Beengung des Hauses anpassen muss. Die flatternden Toppfahnen an Masten und Rahen, wasserspeiende Pinguine oder Windmühlen findet man in den Gärten der großen wie der kleinen Villen, und wo hier einem Frosch ein Wasserstrahl aus dem Maul springt, ist es dort ein Triton in Gesellschaft von Delphinen, die es plätschern lassen. Nur Gartenzwerge, Wagenräder auf Baumstümpfen, Zierbrunnen im Stubenformat oder von Blumen überquellende Schubkarren finden die Besitzer der großen Villen genierlicher.
In den Vorgärten oder unter den Carports am See stehen die gleichen Autos wie auf den breiten Auffahrten der Großvillen, wenn auch deren Garagen oft größer sind als so eine Stölpchenvilla. Die Schornsteine der Kamine fügen sich den Minivillen natürlich etwas ungelenk an. Auch am Stölpchensee mischt sich unter die Warnungen an den Pforten „Vorsicht Hund“ oder „Hier wache ich“ gelegentlich ein „cave canem“ im Terrakottastil pompejanischer Paläste.
Ein Wetterhahn auf dem spitzen Giebel eines Hauses in den Maßen eines Containers scheint lauter zu krähen, als wenn er sich auf einem ausladenden Walmdach um sein Bein dreht. Ornamentale Namensschilder bezeugen Besitzerstolz hier wie da, wirken jedoch an den kleinen Häusern pompöser und reduzieren sich dort auch nicht auf die Initialen, weil sich nur Prominente ihre Anonymität leisten können. Auch auf dem Koloniegelände am Stölpchensee können alleenartige Heckenwege im Schein von Laternen im verschatteten Hintergrund stilisierte Anwesen ahnen lassen. Dornröschen lebt überall, auch wenn die Pfade, die zu ihm führen, nicht von Granitfliesen, sondern von Waschbetonplatten gedeckt sind.
Wenn Pitt im Pavillon saß und auf das höher gelegene Westufer des Sees sah, auf die Glasveranden unter den Silberpappeln und Birken, auf die Giebel mit ihren von Klinkern gefassten Rundfenstern, auf die Gauben, die aus den Weidenkatarakten hervorlugten, auf Trompetenbaum, Buchsbaum und Oleander, die in Kübeln die Terrassen einzäunen, fühlte er sich ans Gestade des Zürich-Sees versetzt.





























