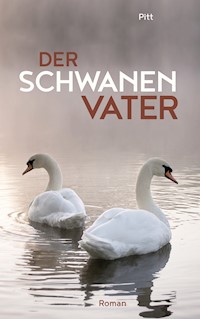Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Der Zusammenbruch der gemeinwirtschaftlichen Unternehmen der Gewerkschaften hat in den 80er Jahren hohe Wellen geschlagen. Vor 25 Jahren stand am Ende der co op AG ein spektakulärer Strafprozess, in dem der gesamte Vorstand des großen Handelskonzerns zu Haftstrafen verurteilt wurde. Wie konnte es dazu kommen? Der frühere Pressesprecher des co op Konzerns, Armin Peter, schickt seinen fiktiven Autor Pitt auf die Suche nach den Ursachen für das Scheitern der „Lebensmittel-Assoziationen“ und ihrer „As AG“, einer genossenschaftlichen Gruppe, die ihr Heil in der Rechtsform der Kapitalgesellschaft gesehen und sich in einen Irrweg verrannt hat. Dr. Burchard Bösche von der konsumgenossenschaftlichen Heinrich-Kaufmann-Stiftung, die den Roman herausgegeben hat: „Der Roman zeigt, wie wichtig es ist, nicht nur den Markt und die kapitalistischen Konkurrenten im Blick zu haben, sondern auch die Mitglieder und Gesellschafter, die das Unternehmen tragen.“
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 943
Veröffentlichungsjahr: 2014
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
Vorwort
Vorspiele in der Provinz
Ammersee
Ruhrtal
Oste
Pitts Notizen zur Quellenlage
Erstes Buch
1: Der Freitisch
2: Freundinnen
3: Eisbein mit Sauerkraut
4: Eine Weltformel
5: Die Stadt der Gemeinwirtschaft
6: Im Kreissaal
Pitts Notizen zur Quellenlage
Zweites Buch
1: Ein Sieg
2: Pläne
3: Die Probe
4: Eine Bürogeschichte
5: Das Papier
6: Das Fest
Pitts Notizen zur Quellenlage
Drittes Buch
1: Wirbelstürme
2: Eine Berufung
3: Ein Blatt Papier
4: Ein Arbeitsessen
5: Standpunkte
6: Ritterspiele
7: Im Markt
Pitts Notizen zur Quellenlage
Viertes Buch
1: Die Kür
2: Nester
3: Tagundnachtgleiche
4: Worte, Werte
5: Im Zoo
6: Ein Ball
Pitts Notizen zur Quellenlage
Fünftes Buch
1. Das Angebot
2: Ein Kuckucksei
3: Zankpatience
4: Brüder
5: Ein Orden
6: Die Krönung
Pitts Notizen zur Quellenlage
Sechstes Buch
1: Eine Stiftung
2: Die Bombe
3: Tombstone
4: Der Koffer
5: Im Zelt
Pitts Notizen zur Quellenlage
Nachspiele, irgendwo
Werner Steinberg
Hans Egloff
Gerd Frantz
Alle Figuren, Institutionen und Handlungselemente des Romans sind frei erfunden. Der Roman geht jedoch mit der Gemeinwirtschaft auf ein reales Wirtschaftsmodell zurück,das in der Sozialgeschichte, in Wissenschaft, Fachliteratur und Belletristik,Publizistik und Presse vielfältig diskutiert und dokumentiert ist. Die Quellen, Erlebnisse und Begegnungen, von denen der Erzähler berichtet, sind ebenfalls fiktiv, von einigen Ausnahmen abgesehen, die in der Debatte um die Gemeinwirtschaft eine Rolle gespielt haben. Der Erzähler Pitt tritt nicht unter einem Pseudonym auf, sondern ist selber eine fiktive Figur. Der Autor formt seine Erzählung aus der Logik gesellschaftlicher Grundentscheidungen, aus der sich typische Entwicklungen und Folgerungen ergeben.
Vorwort
Als Auftrags- und Gebrauchsautor ist Pitt auch Ghostwriter gewesen. Da er darüber in seinem Buch „Für den Redner schreiben – Ghostwriters’ Guide für die redselige Gesellschaft“ berichtet hat, erhält er immer noch, nach fast zwanzig Jahren, interessante, oft ehrenvolle Anträge, seine Feder zu verleihen. In einem dieser Aufträge liegt der Ursprung seines Romans.
Auftraggeber war ein hochbetagter früherer Manager der Hamburger As Zentrale, der jenseits der Lebensmitte eine akademische Karriere gewagt hatte. Er hatte es sich zur letzten Aufgabe seines Lebens gemacht, die in den Dingen liegenden Ursachen und die in den Seelen wurzelnden Motive zu ergründen, die zum Scheitern, ja zum kriminellen Finale seines genossenschaftlichen Unternehmens geführt haben. Er hat in seinem Leben umfangreiche Bücher auch über die geliebten Assoziationen geschrieben: das letzte aber, so musste er bald erfahren, überstieg seine physische Kraft. Er betraute Pitt nicht nur mit den Recherchen, sondern gab auch den Text in Auftrag, der unter seinem angesehenen Namen erscheinen sollte, nach kräftigen Korrekturen und Ergänzungen der letzten Hand. Der Arbeitstitel des Buchs war „Herrenstift“ – ein Titel, in dem das Bündel der vermuteten Gründe für den Zusammenbruch geschnürt war. Mit seinem grossen Gedächtnis und seiner immensen Bibliothek war er der erste Helfer am eigenen Werk.
Für Pitt begann ein Wettlauf gegen die Zeit, die einem sehr alten Menschen geschenkt ist. Er hat ihn gewonnen. Er konnte dem Autor ein Typoskript vorlegen, das sich durch die dem Ghostwriter eigene Gabe der literarischen Mimikry auszeichnete: denn er hatte alle Bücher seines Auftraggebers gelesen und durfte sich schmeicheln, dessen Darstellungsstil auf der Mitte zwischen dem wissenschaftlich anspruchsvollen Sachbuch und dem literarisch ambitionierten Essay gerecht geworden zu sein. Mit Sorge sah Pitt die Versuche seines Auftraggebers, die Textmasse auf ein neues, durch Recherchen nicht belegtes Ende hinzubewegen, beobachtete er die flackernde Energie, den schwankenden Fleiß und den Gestus der Ungeduld in der Arbeit des Autors. „Ich bin mit Ihrer Arbeit nicht recht zufrieden,lieber Pitt, lassen wir’s liegen.“ Er hat Pitt ohne Streit großzügig honoriert. Er starb bald.
Wenn der Entwurf eines Ghostwriters keine Gnade vor den Augen des Auftraggebers findet, muss er von der Festplatte verschwinden. Was tun mit einem Text, in dem so viel Arbeit steckt? Wie mancher Ghostwriter träumt auch Pitt davon, einmal den eigenen Namen auf dem Titelblatt zu sehen. Lass die Wahrheit, die dein Auftraggeber erstrebte, in der Schwebe und mache aus dem Stoff vor deinen Füßen, den er dir aufzuheben befahl, einen Roman!
Die Wahrheit: es gibt manchen, der sie kennt. Es gibt viele, die immer noch einiges dafür geben würden, sie zu erfahren. Das Scheitern eines Unternehmens ist ein fast alltägliches Schicksal, ob unbeobachtet, ob spektakulär. Die Frage nach der Schuld am Scheitern wird mit einem Achselzucken beantwortet, wenn es nur um die Schwäche oder das Versagen von Managern geht. Wo die Schuld so schwer wiegt, dass sie Sache von Gerichtshöfen wird, kann die Schuldfrage dringend, ja schmerzlich sein. Pitt denkt an Menschen, die mit ihrem Geld Vertrauen verloren, die aus Karrieren geschleudert wurden, Geschäftspartner, die sich auf Gedeih und Verderb mit dem Groschenimperium der Konsumenten liiert hatten, Banken, die Gutgläubigkeit riskierten, und natürlich an den harten Kern der Schuldigen, Mitschuldigen und schuldlos Verstrickten, die sich alle Illusionen machen, wenn es um das Maß der Schuld geht. Es geht auch um die Trauer, die das Ende einer schönen Idee umweht.
Die Aktenberge in den Archiven des Gerichts, die unterm Staub immer noch wachsen, können Pitt nicht helfen, die Geschichte der Katastrophe zu erzählen. Sie haben nie dazu beigetragen, zu einem Urteil zu kommen. Die intelligenten und gründlichen Beamtinnen und Beamten des Bundeskriminalamtes, die mit Phantasie und Spürsinn – assistiert von den Redakteuren des „Echo“ – die Fäden in diesem von Kameraderie, Inkompetenz und Korruption gewobenen Riesenknäuel freigelegt haben, sind ja nicht belohnt worden. Entnervt hat das Gericht den mühsam zusammengetragenen Haufen der Schuldbeweise von seinem Tisch in die Asservatenkammer geschoben und mit den Beschuldigten ein akzeptables Maß der Strafe ausgehandelt. In diesem traurigen „Deal“, wie viele Zeitungen schrieben, blieb die Wahrheit auf der Strecke. Sie schlummert in den Akten und wird durch keinen juristischen Diskurs geweckt.„Lassen wir’s liegen.“
Die As Geschichte hat Mitte des 19. Jahrhunderts in einem kleinen Ort der damaligen preußischen Provinz Sachsen begonnen. In Eilenburg haben Arbeiter und Handwerker die Lebensmittel-Assoziation gegründet, eine erste deutsche Genossenschaft der Konsumenten. Sie hat sich als nicht so entwicklungsfähig wie die britische Genossenschaft der Redlichen Pioniere von Rochdale erwiesen, aber auch sie ist ein Anfang gewesen. Ihr dramatisch kurzes Leben hat der Arbeiterdichter Heinrich Lersch in seinen „Pionieren von Eilenburg“ beschrieben. Schuld am Misslingen des frühen genossenschaftlichen Experiments war keineswegs der Branntwein, der – in größeren Mengen eingekauft, in kleinen abgegeben – ein Sortimentsschwerpunkt der Lebensmittel-Assoziation war. Den brauchten die Arbeiter aus den Kattunfabriken als billiges Lebensmittel, um ihre schwere Arbeit, in strengen Wintern oft im Wasser unter freiem Himmel, durchstehen zu können.
Wären die Arbeiter nicht klug beraten gewesen, nach dem gescheiterten Eilenburger Versuch die Finger von den Assoziationen zu lassen? Wäre ihnen, knapp 150 Jahre später, das Scheitern und die mit ihm verbundene tragische Blamage ihrer Gewerkschaften erspart geblieben, wenn sie nicht die Hartnäckigkeit des Selbsthilfewillens und das Organisationsgeschick besessen hätten, die As zu einer der führenden Handelsgruppen mit 15 Milliarden Mark Umsatz und 50000 Mitarbeitern zu machen? Pitt will die Frage nicht beantworten. Er gehört einer Generation an, die Not, Kälte und Hunger noch als kollektives Schicksal erlebt hat, die sich noch an die Zeit erinnern kann, in der die von den Assoziationen gezahlten Rückvergütungen auf den großen Familienumsatz sich in einen Wintermantel, in ein paar Zentner Kartoffeln für die Kiste im Keller oder viele Schütten Koks für den Kanonenofen in der Stube verwandelt haben.
Etwas Eilenburgisch-Provinzielles haftete den Assoziationen, ungeachtet ihrer Größe und Marktbedeutung, immer an. Provinz ist Herkunft. Pitt macht sich auf den Weg in die Provinzen zu seinen Protagonisten an der Leine, am Ammersee, an der Ruhr und der Oste, ehe er nach Hamburg und Frankfurt am Main reist, den Schauplätzen des Aufstiegs und des Niedergangs der As.
Vorspiele in der Provinz
Leine
Das Buch lag auf dem von Hitze und Regen gewellten Brett des Schallloches. Die graue Dunstwand des Deisters lag fern. Werner Steinberg sah auf den Feldern, zur Leine hin, die Menschen, die sich in einem verstörend unregelmäßigen Rhythmus in den Ackerfurchen bückten. Er hatte ein schlechtes Gewissen, denn er musste unten auf dem Feld sein, an der Seite seiner Mutter. Er saß im Glockenturm auf einem Melkschemel, dessen Fuß er zwischen den Brettern verankert hatte. Werktags, an einem frühen Mittag, war er selten hier oben. Am Sonntagmorgen, nachdem er sich mit dem Federgewicht seines Körpers in die Seile gehängt hatte, um den Tonschwall – ohne einen einzigen, verloren in der Luft schwebenden Nachklang – zu stoppen, ging er hinauf zur Glocke und setzte sich auf seinen Schemel und las. Seine Mutter, die den Küsterdienst in der Sarstedter Gemeinde versah, brauchte gar nicht in den Turm hineinzurufen, um das Ende des Gottesdienstes und den Beginn des Schlussgeläutes zu signalisieren: er konnte sich auf das Zeitmaß der gelesenen Seiten verlassen, auf einer bestimmten Seite aufspringen, um die Leiter zum Zwischenboden hinunterzurutschen und sich in die Seile zu werfen. Wenn Pastor Dietrich unten vor dem Portal seine Schäfchen in ihren dunklen Kleidern in ihre Häuser zurückschickte, saß Werner Steinberg schon wieder über seinem Buch. Er hätte unten sein müssen, im Schiff, um seiner Mutter zu helfen, die Gesangbücher einzusammeln, die Blumen vom Altar zu nehmen, die Kerzen zu versorgen. Er las. Und seine Mutter ließ ihn lesen. Sie war ein bisschen stolz auf ihren lesenden Sohn.
Werner Steinberg fühlte das fein gewobene, von der Aprilsonne erwärmte himmelblaue Leinen, das siebenhundert Seiten verpackte, schwer in seiner Hand liegen. Das Titelgold blinkte im Licht, als hätte das Buch etwas vom Glockenglanz eingefangen. Er las es jetzt zum zweiten Mal. Pastor Dietrich hatte es ihm geschenkt, zur Konfirmation, Palmsonnntag. Der Pastor schenkte natürlich nicht allen seinen Konfirmanden Bücher. Er war der Hauswirt und zum Teil auch der Arbeitgeber der Familie Steinberg, und er hatte schon kurz nach Beginn des Konfirmandenunterrichts gesagt: „Werner, wenn du nur nicht immer diesen Schund lesen würdest, könnte aus dir noch ein Pastor werden.“ Ein Pastor! Ein Studierter! Sollte man da lachen? „Ihr Junge hat einen hellen Kopf, Frau Steinberg.“
„Das ist das schönste Buch des deutschen Volkes“, hatte der Pastor gesagt, „Millionen haben es schon gelesen. Du musst es lesen, gerade du, weil du ein Kaufmann wirst und weil du ein Schlesier bist.“ Schlesier, Kaufmann, das war ihm egal. Das Buch fesselte ihn. Er las es zum zweiten Mal, er würde es ein drittes, ein viertes Mal lesen, wie den Lederstrumpf oder den Sigismund Rüstig. Ja, er war ein Kaufmann, er würde einer werden. Er hörte das Knarren, Scharren und Klicken über sich, fühlte die Erschütterungen der zwölf Schläge in den Händen und Armen und sah seine Mutter auf dem Feld mit dem Kopftuch winken: das war der Befehl, vom Turm herunterzusteigen, auf den Dachboden des Pastorenhauses zu gehen, wo sich die Wohnküche und die Schlafkammer der Familie Steinberg befanden, um das Mittagessen auf den Herd zu stellen. In zwei Wochen würde er aus der familiären Dienstbarkeit entlassen. Schon Anfang März hatte seine Mutter mit Herrn Möller, einem Süßwarengroßhändler in Hildesheim, einen Lehrvertrag geschlossen.
Soll und Haben. Von Gustav Freytag. Ein Kaufmannsbuch. Das deutsche Volk bei seiner Arbeit, sagt der Spruch vorn im Buch. Spannend, aufregend, zum Schluss ganz schön abenteuerlich. Der Anton Wohlfart hatte es gut, der hatte einen Vater, einen königlichen Kalkulator dazu – was der wohl machte? wohl Wichtigeres als ein schlesischer Landarbeiter. Der hatte dem Handelshaus T.O. Schröter einmal einen großen, in Taler und Groschen zu berechnenden Gefallen getan. Jahr für Jahr erhielt er darauf von der Firma Schröter zum Weihnachtsfest eine Kiste ins Haus geschickt, die ein Paket Kaffee und einen „Hut des feinsten Zuckers“ barg. Ein Zuckerhut! Was das wohl ist? Wozu braucht man den? Dieser Anton hatte das Abitur, seine Eltern wurden von den Lehrern des Ostrauer Gymnasiums bestürmt, den intelligenten Sohn Philologie studieren zu lassen – ist das so etwas wie Philosophie? wollte er den Pastor fragen – oder Maler werden zu lassen, doch der Vater, der Herr Kalkulator, bat den Prinzipal Schröter, seinen Sohn in die Lehre und in sein Haus zu nehmen. Wie war der Vater Wohlfart auf seinem Bittgang in die Hauptstadt empfangen worden! Kiebitzeier – die kannte Werner Steinberg auch – hatte er gegessen, griechischen Wein aus den Kellern des Großkaufmanns getrunken. Einen Vater müsste man haben, und erstmal so einen.
Diese Großhandlung Möller in Hildesheim war mit dem Handelshaus Schröter nicht zu vergleichen. Kein Warenmagazin, kein großes dämmeriges Gewölbe, in dem sich Tonnen, Kisten und Ballen mit all den kolonialen Herrlichkeiten türmen, keine von Hindufrauen geflochtenen Bastmatten, keine von Chinesen gemalten roten und schwarzen Hieroglyphen, keine von virginischen Negern verschnürten Tabakballen, keine Farbhölzer aus den Wellen des Mexikanischen Meerbusens oder Blöcke von Zebra- oder Jakarandaholz aus den Urwäldern Brasiliens, weder Stockfisch noch Elefantenzähne, nein, nur Kartons mit Drops, Lakritzen, Dauerlutschern und Schokolade, knisternde Beutel bunter Bonbons stapelten sich auf Metallregalen in einer Doppelgarage, vor der, unter einem Teerpappendach, ein dreirädriger Tempolieferwagen stand. Der Herr Möller hatte Werner etwas skeptisch gemustert und der Mutter bedeutet, ein Großhandelslehrling würde bei der Auslieferung der Ware allerlei zu schleppen haben. Ein Pöttpött, dachte der Lehrling, als er von den Pferdefuhrwerken der Firma Schröter unter der Regie der riesengestaltigen Packmeister las.
Wollte er denn unbedingt Kaufmann werden und ging es ihm nicht wie dem Anton Wohlfart? Als seine Mutter vor zwei Jahren ein paar Monate lang im Haushalt des Kaufmanns Möller nach dem Rechten gesehen hatte, war sie oft mit all dem Bunten und Süßen beladen nach Hause geradelt. Dieser schimmernde Reiz wird auch auf den Zuckerhüten der dankbaren Firma Schröter gelegen haben, er wird den Knaben Anton sein „Ja“ entlockt haben, wenn der Vater, fasziniert von der rätselhaften Fülle des weltumspannenden Handelsgeschäfts, den Sohn fragte, ob er nicht Kaufmann werden wolle. Werner Steinberg wollte Kaufmann werden, wohl, aber es grauste ihn ein bisschen vor der Garage und dem winzigen kahlen Büro im Möllerschen Bungalow, in dem nicht einmal ein Stuhl für den Lehrling stand. Zur Schule müsse er gehen, hatte sein Klassenlehrer Kirchhoff immer wieder gepredigt, es dürfe nicht Schluss sein mit dem Lernen nach den acht Jahren in der Volksschule. Im Februar hatte Werner Steinberg die Aufnahmeprüfung für die Städtische Handelsschule in Hannover abgelegt, in dem wuchtigen grauen Gebäude am Leineufer an der Andertenschen Wiese, in dem er zwei Jahre den Handel lernen konnte: wenn er das Glückslos zöge. Der Lehrer hatte ihm diesen Weg gezeigt, doch hinzugefügt, die Chance, angenommen zu werden, sei nicht groß: die Volksschulen steckten voller intelligenter lernbegieriger Jungen und Mädchen, die zur Städtischen Handelsschule mit ihren drei Klassen drängten, weil die private Handelsschule mit ihrem höheren Schulgeld für die meisten nicht in Frage komme. Hatte er die Prüfung bestanden? Es war schon April, und er hatte keinen Bescheid bekommen. Herr Kirchhoff hatte nachgefragt, doch keine Auskunft erhalten, nur eine hoffnungsvolle Information: eine vierte Klasse solle eingerichtet werden.
Was heißt das: Schund? Der Anton Wohlfart liest auch Coopers Letzten Mohikaner, und der hat das Abitur und ist schon Kontorist bei Schröter, weil man ihm dank seiner Tüchtigkeit die Lehrzeit von vier auf zwei Jahre verkürzt hat. Viel scheint der Anton nicht zu lesen, der Gustav Freytag erwähnt nur den Mohikaner. Ob ein Kontorist, der einmal Kaufmann sein will, so wenig Zeit hat, dass er nicht mehr zum Lesen kommt oder soviel Aufregendes erlebt, dass alle Lektüre ihm schal wird? Nein, nein, das wollte Werner Steinberg sich nicht vorstellen.
Er klappte das Buch zu. Soll und Haben. Ob Lehre oder Handelsschule: bald würde er lernen, was diese Begriffe bedeuten. Der Gustav Freytag war wohl so vertraut mit der Buchführung, dass er sie nicht erklären zu müssen glaubte. Unten fuhr die rote Straßenbahn, die Linie 11, auf ihrem Weg von Hildesheim nach Hannover. In welche Richtung würde er fahren, nach Norden, nach Süden? Mit der Bahn würde er nicht fahren, mit dem Fahrrad. Wenn die Handelsschule ihn wollte, würde er nach Hannover gehen, das war klar. Aber eher wohl doch Hildesheim in die Garage. Auf „Sprungfedern fortgeschnellt“, so wie der begeisterte Anton Wohlfart auf seiner Wanderung zum Schröterschen Handelshaus in der Hauptstadt, würde er ja wohl nicht zur Möllerschen Großhandlung wandern. Nein, er war wohl eher der Veitel Itzig aus der Bürgerschule, der zufällige Reisegefährte Antons, in seiner alten Jacke und den schäbigen Beinkleidern – warum schreibt der nicht: Hose? Heute trug Werner die verschossene rote Manchesterjacke über der schwarzblanken Lederhose, und als er die Leiter hinunterrutschte, ragten seine knochigen dünnen Arme so weit aus den Ärmeln, als trüge er eine Weste. Gott sein Dank, er hatte seinen Konfirmationsanzug. Aber konnte er in ihm Bonbons und Lakritzen ausfahren und Kartons in die Regale stapeln?
Er ging auf den Hof des Pfarrhauses, wo der Schuppen der Familie Steinberg stand, eingemauert von den Holzscheiten, die er gespalten und kunstvoll geschichtet hatte. Er klemmte das blaue Buch unters Kinn und lud sich die duftenden Scheite hoch in die Armbeuge. Die Familie Steinberg hatte keinen eigenen Briefkasten im Pfarrhaus. Der Brief lag auf der dritten Treppenstufe. Die Absenderin war die Stadt Hannover. Er griff nach dem Brief, das blaue Buch rutschte aus der Kinnklemme, und die instinktive Bewegung, es zu halten, ließ den Holzstapel auf die breiten ausgehöhlten Stufen poltern. Er riß den Brief auf. Er war angenommen, im Mai sollte das Schuljahr 1954/55 beginnen. „Bist du gefallen, Junge?“ rief Frau Dietrich aus der Diele. Nur das Holz, nur das Buch. Nein, er war gestiegen.
Ammersee
„Bist du schon wieder bei den Genossen?“
Erika Reichenbach hatte ihrem Vater telefonisch zum Geburtstag gratuliert, und sie hatte ihm gesagt, sie rufe aus der As Schule für Führungskräfte in Dießen an, wo sie gestern Nachmittag ihren Vortrag vor der Frauengilde gehalten habe. „Und heute? Konntest du heute nicht kommen? Sind dir die Genossinnen lieber als dein Vater?“ Ihr Vater war selber ein Genosse, ein hochrangiger, ein Genossenschafter, der geschäftsführende Vorsitzende des bayerischen Raiffeisenverbandes.Wenn Dr. Reichenbach spitz und halb herablassend, halb verächtlich von den Genossen sprach, dann meinte er nicht seine Bauern, die mit Hilfe ihrer weitverzweigten Genossenschaften um ihre kleinen Existenzen kämpften, dann meinte er die Mitglieder der Verbraucherassoziationen, die angeblich den Markt und die Preise kaputtmachten, die alles Bodenständige und Gewachsene durch ihr sozialistisches Geschwätz von Konsumentensouveränität bedrohten.
Erikas Vater tat sich viel darauf zugute, dass der Friedrich Wilhelm Raiffeisen im Westerwald die Grundformel des Genossenschaftsgeistes ersonnen habe: einer für alle, alle für einen. Sie hatte im Genossenschaftsseminar bei Professor Weippert in Erlangen herausgefunden: den schönen plastischen Satz, der das Wesen der solidarischen Vermögenshaftung erklärt, ohne einen Kommentar zu brauchen, den hatte schon die Eilenburger „Arbeiter-Verbrüderung“ in ihr Statut geschrieben. Das war eine Genossenschaft zur Beschaffung von Rohstoffen wie Leder, Garn und anderem in einer Zeit, in der die Arbeiter noch hofften, sie könnten sich als Unternehmer im reißenden Strom der Industrialisierung auf irgendeine kleine Insel retten. „Arbeiterverbrüderung, Arbeiterverblödung“ hatte ihr Vater geknurrt. Erika Reichenbach hatte im Frühjahr in Erlangen ihren Diplom-Volkswirt gebaut, mit exzellentem Ergebnis, und sie war nun Doktorandin am Institut von Professor Weippert, der das Genossenschaftswesen in seinem ganzheitlichen Geist, nicht interessiert an Branchen und Interessen, erforschte. Dass der ältere Dumas Raiffeisens Losung schon seinen draufgängerischen drei Musketieren als Wahlspruch mitgegeben hatte, wusste der Professor nicht – er meinte aber, der Flammersfelder Bürgermeister habe keine Zeit gehabt, die Neuerscheinungen aus Frankreich zu lesen.
Musste sie ihren Auftritt vor den Frauen der Assoziationen rechtfertigen? Der Vater verstand nichts von Verbrauchern, so wenig er, der Anwalt und christlichkonservative Bauernführer, im Grunde von seinen Bauern verstand. Die Akademiker und die kleinen Leute: die Hirten, die sich von ihren Schafen gestört fühlen. Der Vater ließ sich überhaupt nicht durch den Hinweis beeindrucken, dass auch die Assoziationen, die angeblich so sozialistischen, einen starken rheinisch-süddeutschen christlichen Flügel hatten. Erika Reichenbach stand über diesen politischen Querelen. In ihrer Dissertation beschäftigte sie sich mit der Zusammenarbeit der Konsumgenossenschaften mit anderen Genossenschaftssparten, vor allem den landwirtschaftlichen Absatzgenossenschaften. Ein hausfrauliches Herz schlug unter ihrem methodischen Kopf: die Assoziationen der Verbraucher, das waren soziale Gebilde, vor denen sie ins Schwärmen geraten konnte. Die Generalsekretärin der Frauengilde, die sie eingeladen hatte, über die Marktwirkung der As Gruppe zu sprechen, hatte das gespürt. Ihre Diplomarbeit war im „As Magazin“ sehr freundlich besprochen worden.
Der Ammersee, die Kindheit. Schon ihr Großvater, der Arzt in München, hatte seine Hütte auf ein Ufergrundstück bei Riederau gebaut, ihr Vater hatte ein komfortables Wochenendhaus aus ihr gemacht. Dießen war ihr so vertraut wie Grünwald, sie kannte noch das alte Hotel Seeblick, das seit ein paar Monaten erst die Schule der bayerischen Lebensmittel-Assoziationen war – es war ihnen als eine Entschädigung für die Enteignung ihrer Betriebe während der Nazizeit übertragen worden. Sie hätte gestern Abend zuhause übernachten können, war aber lieber bei den Frauen im Heim geblieben. Die saßen so früh am Kaffeetisch, als müssten sie auch hier Mann und Kindern das Frühstück bereiten. Das Referat des Vormittags begann um neun, aber sie hatte noch genügend Zeit, dem Vater zu gratulieren und hinunterzulaufen zum See, um in tiefen Zügen Himmel und Weite, Ufer und Wellen, Licht und Bläue einzuatmen. Am liebsten wäre sie in den See gesprungen. Sie ging über das Ammerbrückchen zum Strandhotel, das noch geschlossen war, und setzte sich auf einen der feuchten Gartenstühle. Sie nahm sich vor, ihrem Vater ein paar geräucherte Renken zu kaufen. Sie würde nach Riederau laufen und sie auf den Küchentisch legen, einen Zettel dabei: „mit einem Gruß von den Genossen“.
Der Vater war Ehrengast gewesen, vor drei Jahren, auf dem Assoziations-Tag in München, auch ihr Professor Weippert, und sie, die wissbegierige Begleiterin ihrer beiden Väter, hatte sich in der tausendköpfigen Delegiertenversammlung auch ein bisschen als Ehrengast gefühlt. Der Wirtschaftsminister Erhard hatte Kritisches und Schmeichelhaftes vorgetragen. Auf dem bunten Abend, bei Blasmusik und Volkstanz, hatte sie Christel Holle kennengelernt, die Generalsekretärin der Frauengilde, das „Ass der As“, wie sie der Professor vorstellte, eine Mittdreißigerin, weißblond, blauäugig wie sie, nur stämmig breiter, impulsiv und sympathisch redselig in ihrem hart klingenden Fränkisch. Die leitete das Frauenseminar und stellte um neun Uhr „unsere Freundin“ vor, die SPD-Abgeordnete Käte Strobel, ein zartes Persönchen, das etwas eckig unter dem breiten weißen Kragen überm schwarzen Kleid wirkte, wenn sie sich an den Kanten des Pults hochreckte.
Wieviel hatte sie schon gelernt gestern! Gestern Nachmittag, vor ihrem Vortrag, hatte die Christel Holle sie beiseite genommen: „Hören Sie, Fräulein Reichenbach, ich sehe, Sie haben da Ihr schönes Manuskript. Wenn Sie merken, dass die Frauen mit den Gabeln klappern, dann – kürzen Sie ab. Hören Sie auf.“ An den weißgedecken Tischen saßen etwa sechzig Frauen vor den Kaffeegedecken, der Kuchen lag schon auf dem Teller, doch die Kannen standen noch nicht auf den Tischen. Frische,glänzende Dauerwellen, geblümte Kleider, weiße Blusen – die Feierlichkeit einer Konfirmationstafel lag im Raum, der durch die Holztäfelung und die blaugewürfelten Vorhänge etwas Häusliches hatte. Und wirklich: nach etwa zwanzig Minuten pickten erste Gabeln Streusel von den Kuchen, nicht ohne klickende Geräusche auf ihre Worte fallen zu lassen, wurden Tassen auf Tellern gerückt, als riefen sie: wann endlich kommt der Kaffee? Dabei waren die Zuhörerinnen nicht nur assoziierte Hausfrauen, sie hatten alle ihre kleinen Ämter in den lokalen Gruppen, waren Vertreterinnen oder gar Aufsichtsratsmitglieder. Erika Reichenbach fühlte sich gelähmt, ein heißes Zittern lief durch die Hand, mit der sie ein Blatt zur Seite schob: aufhören, abkürzen? Scheitern. Sie blickte hoch von ihrem Blatt. „Meine Damen“, sagte sie, sanft beschwörend. Blickten die beiden älteren Funktionärinnen vorn am Tisch die junge Referentin nicht etwas mitleidig an? „Meine Damen!“ rief sie mit fester lauter Stimme. Köpfe hoben sich, erstaunt. „Meine Damen! Ich komme zum Schluss.“ Sie raffte die Blätter ihres Manuskripts zusammen, stieß seinen Rand heftig auf die Platte des Pults, und sie sprach weiter, ließ ihre Augen herausfordernd forsch in die Augen der Frauen, die sich ihr zugewandt hatten, wandern und sprach weiter, weiter, frei, mit fester Stimme. Das Klappern der Gabeln erstarb, die Tassen standen still, keine Kettchen klirrten mehr an den Tellerrand, weil die Finger nicht mehr Krümel tupften.
Käte Strobel hatte ihr gegenüber am Vormittag einen Vorteil: bei ihrem Vortrag waren die Tische nur mit Papier und Stiften bedeckt, und wenn sich eine Hörerin ablenken wollte, konnte sie ein paar Notizen kritzeln, ohne die Rednerin zu stören. Doch die hätte niemand stören können. Eine zwingende Energie fegte durch den Raum, alle Gesichter waren vom Stakkato eines starken Willens getroffen: praktische Wirtschaftspolitik von unten, Politik für den Verbraucher, die sei das Gebot der Stunde, hinein, alle ihr Frauen, in die Vertreterversammlungen und Aufsichtsräte der Assoziationen, von der lokalen Genossenschaft bis hinauf in die Verbände und die Hamburger As Zentrale, die Großeinkaufsgesellschaft. Denn wer wisse mehr von den Bedürfnissen der Menschen als die Frauen: ihre Aufgabe sei es, eine gemeinwirtschaftliche Oase in den Wüsten des egoistischen Kapitalismus zu schaffen. Selbsthilfe in der Kraft der Assoziation, das sei die Losung. Neidlos registrierte Erika Reichenbach den heftigen Beifall der Frauen. Es war ihr ein bisschen peinlich, in ihrem Vortrag gestern, ohne Käte Strobels Konzept zu kennen, so stark auf dem Gedanken der Selbsthilfe herumgeritten zu sein. Eigentlich war ihr Vortrag systematisch und didaktisch viel klüger angelegt gewesen als der Käte Strobels. Sie war stolz darauf, sich auf ihrer wissenschaftlichen Mittelstrecke noch freigeschwommen zu haben, und gönnte der Freistilschwimmerin auf der Kurzstrecke ihren begeistert dankbaren Beifall. Sie war froh darüber, dass Frau Strobel ihren Vortrag nicht gehört hatte.
Sie hatte mit den Gedanken des Hamburger Wirtschaftssenators begonnen, die der im letzten Jahr auf dem Assoziations-Tag in der Hansestadt vorgetragen hatte. Der Professor Schiller hatte die genossenschaftliche Selbsthilfe in der freiheitlichen und sozialen Wirtschaftsordnung auf einem dritten Weg zwischen der Freiheit, von der es soviel wie möglich geben solle, und der Planung, die soweit wie nötig zum Zuge kommen solle, gesehen. Ein bisschen janusköpfig bewegten sich die Genossenschaften in der Marktwirtschaft: nach Bindung strebten sie, nach ein wenig mehr Gemeinschaft im anonymen Ellenbogenwettbewerb der Gesellschaft, andererseits drückten sie die Preise und trieben damit den Wettbewerb an und machten die Freiheit ungemütlicher. Sie hatte dem Hamburger Professor den Wirtschaftsminister Erhard mit seinen Thesen gegenübergestellt, die der vor drei Jahren auf dem Münchener Assoziations-Tag im Deutschen Museum vertreten hatte. Die beiden Professoren waren sich einig: Preiswettbewerb müsse auf Leistung beruhen, und wenn es den Assoziationen gelänge, durch bessere Organisationsformen den Preiskampf zu beflügeln, könne sich der Einzelhändler nicht beschweren – ganz schön mutig für einen Minister, dessen Vater Lebensmitteleinzelhändler gewesen war (hier hatten die Frauen herzlich gelacht). Es komme nicht darauf an, was Assoziationen nach allen möglichen Theorien tun sollten, sondern was sie tatsächlich für die Verbraucher leisteten. Nein,die beiden Gurus lagen nicht auseinander in ihrer Meinung über die Assoziationen, der schlanke Karl Schiller mit seinen graziösen Gesten und der hell artikulierenden Stimme, die jeder eleganten Formulierung eine Pause spitzbübischen Lächelns hinterherschickte, der tapsig füllige Ludwig Erhard, der wie ein großer Schulbub wirkte und seinen geraden, direkten Gedanken in der Perfektion der Schlichtheit Überzeugungskraft verlieh. Sie hatte viel mehr über den Professor Erhard gesprochen. Weil der ein Bayer war, ein Franke? Mein Gott, wie hatte der Mann vor drei Jahren, 1951, unter Beschuss gestanden, weil die Preise zu hoch waren in der jungen Marktwirtschaft, wie war er auch von den Genossenschaften kritisiert worden. Und jetzt, drei Jahre später: Hochkonjunktur, steigende Löhne, fallende Preise. Sie hatte im vergangenen Jahr nicht den Adenauer, sondern den Erhard gewählt, in der ersten Bundestagswahl ihres Lebens.
Heute Abend würde sie in der Hütte in Riederau schlafen. Sie freute sich darauf. Die Frauen reisten mittags ab. Sie hörte noch manches ermunternde Wort über ihre Vortragskunst. Christel Holle besprach mit dem Schulleiter die nächsten Seminare. Sie hatte ihre jüngste Referentin schon gefragt, ob sie Lust hätte, wiederzukommen. Erika Reichenbach ging in den Ort. Zum Schulheim, das in einem parkartigen Garten lag, gehörte eine Kapelle. Sie war leer, man hatte der Marienfigur und den Putten in einer Holzbaracke Asyl gegeben, um sie vor der Witterung zu schützen: sie sollten später in einem weiteren Schulbau auf dem Gelände einen würdigen Platz finden. Der Engel! Sie ging zurück ins Heim, wo sich Christel Holle gerade vom Schulleiter verabschiedete. „Frau Holle, ich möchte Ihnen gern meinen Engel zeigen!“ Wie ein Spiegelbild, dachte sie, als Christel Holle die weißen Brauen hoch in die gewölbte Stirn hob, die sich in welligen Linien fragend furchte. „Im Dießener Himmel. In der Stiftskirche – da oben!“ Christel Holle kannte die Kirche nicht, sie war neugierig auf sie, und die Frauen gingen hinauf. Die Generalsekretärin wusste das Barockwunder kenntnisreich zu würdigen, und Erika Reichenbach stellte sich mit ihr an den Taufstein in der Seitenkapelle, über den ihr Engel schwebte, schlank und zartgliedrig, von einem Seil getragen, mit ausgebreiteten flugbereiten Flügeln – „haben Sie so etwas schon einmal gesehen?“ – mit einem lachenden, freudig und frech wirkenden Gesicht ein übermütiger Engel. Seit ihrer frühesten Kindheit habe sie ihren Engel besucht, sagte sie ihrer Begleiterin. „Dann ist er Ihr Schutzengel!“ Im Bahnhof sagte Christel Holle: „Sie machen jetzt Ihren Doktor und dann – dann kommen Sie zu uns in die As Zentrale, nach Hamburg. Wir brauchen tüchtige junge Frauen wie Sie. Frauen mit Doktorhut gibt es bei uns noch nicht, nur die Betriebsärztin. Wissen Sie was, wir nehmen Sie auch ohne das Hütchen. “ Erika Reichenbach verbarg ihre Ablehnung in einem Lachen. Weg aus Bayern? Aus diesem Land, in dem alles Helligkeit und Schönheit ist. Nie.
Ruhrtal
„He, Fratz! Willst du weg?“ Gerd Frantz stand vor dem Taschenspiegel, den er an die Spindtür geklebt hatte, glättete den Schillerkragen überm Jackett und rieb mit zwei Fingern eine Spur Spucke auf den Wirbel oberhalb der linken Schläfe, der die kurzwellige Ordnung seines dichten blonden Haars bedrohte. Er drehte sich nicht zu dem Fragenden um. Er hatte den Formersaal extra um die Öfen herum verlassen, um Theo Mucha nicht in die Arme zu laufen. Ja, er wollte weg, er wollte rechtzeitig auf der Wiese sein, in Eickel, bei den Naturfreunden. „Du kannst doch heute nicht abhauen! Dr. Wellmann kommt doch. Wir wollen über die Hütte reden.“ Die Hütte, die Hütte! Die war weit weg.
„Mein Alter. Der feiert doch seinen Geburtstag heute auf der Wiese.“ Theo Mucha, noch im Blaumann, blickte ihn mit schräg nach oben geneigtem Kopf misstrauisch an. „Das hast du mir ja gar nicht gesagt. Der feiert den ganzen Abend. Komm. Die zwei Stunden wird er auf dich warten können.“ Der Vater würde warten, ja, würde murrend in seinem Rollstuhl sitzen und auf den unzuverlässigen Sohn schimpfen, der ja, wie üblich, keine Rücksicht auf einen „Krüppel“ nähme. Aber Hilde – würde die warten auf ihn? Theo Mucha presste mit der Linken, dieser für den kleinen drahtigen Mann viel zu großen Schraubstockhand, seinen Oberarm und schob ihn vor sich her, und er ließ nicht locker, bis sie im Sitzungszimmer des Betriebsrats standen. Sie waren die ersten dort.
Theo Mucha ist Mitglied des Betriebsrates der Neuen Bochumer Eisengießerei und Maschinenfabrik. Er ist nicht sein Vorsitzender, und Gerd Frantz fragt sich seit langem, warum der alte Former es nicht sei, ist er doch Seele, Geist, Motor des Rats, Aufpasser, Antreiber. „Du gehst in die Jugendvertretung!“ hatte der Altgeselle befohlen, als der Formerlehrling Frantz vor zwei Jahren an seinem Kasten aufkreuzte. Es gab keinen Widerstand, keine Ausflüchte. „Du bist intelligent.“ Es war wohl so: seine Kollegen hielten ihn für besonders intelligent. Er hatte in der Konstruktionssektion ein Jahr am Reißbrett gestanden, als Technischer Zeichner, im ersten Lehrjahr. Er hatte nicht versucht, den Kollegen zu erklären, warum er Schluss gemacht hatte mit dieser Lehre und eine neue in der Formerei angefangen hatte, gesprochen darüber hatte er nur mit Theo Mucha, der ihn vom ersten Tag an unter seine mächtigen, kein Entkommenen duldenden Fittiche genommen hatte: wahrscheinlich hatte er in dem Ankömmling gleich einen künftigen tüchtigen Betriebsrat erkannt. „Und gesoffen wird nicht! Junge, das ist hier heiß. Hier musst du schwitzen und trinken. Aber gesoffen wird nicht.“
Die Lehrlinge der Neuen Bochumer hatten ihn mit der höchsten Stimmenzahl in die Vertretung gewählt, obwohl sie ihn kaum kannten, und die sieben Vertreter schickten ihn, als sei das selbstverständlich, in die Sitzungen des Betriebsrats, wo ein unnachsichtiger Theo Mucha darüber gewacht hatte, dass er in zwei Jahren nicht eine einzige versäumt hatte. Der heimliche Vorsitzende hatte auch schon angeordnet, dass sein Gesellenbrief, den er in einem Jahr erhalten würde – „mit Goldrand, du Windpfeife, sonst gibt’s was mit der Kelle!“ – auch das Billett für den Betriebsrat sein würde, für eine ehrenamtliche Funktion in der Ortsverwaltung der Metaller sowieso.
Der Betriebsrat war versammelt, nicht vollzählig, denn Theo Mucha hatte ihn außerplanmäßig zusammengetrommelt, wahrscheinlich auf Wunsch Dr. Wellmanns, des Arbeitsdirektors. Und tatsächlich begrüßte der Rudi Wellmann den Theo vor dem Vorsitzenden, einem jüngeren Schlosser, der zögernd, unschlüssig, nach Worten suchend, die Versammlung eröffnete und nach wenigen Sätzen dem Theo das Wort erteilte. In vierzehn Tagen waren in der Neuen Bochumer die Betriebsratswahlen,und heute hatten die Ergebnisse der Dortmunder Westfalenhütte für einen Schock gesorgt, bei den Betriebsleitungen, bei den Gewerkschaften, bei vielen der Arbeiter. Die Kommunisten hatten im Westfalenbetriebsrat die Macht ergriffen, mit doppelt soviel Sitzen wie die Sozialdemokraten, und die Christlichen hatten nur zwei ergattert. Bei der Bundestagswahl vor zwei Jahren, 1953, waren die Kommunisten aus dem Parlament geflogen, und nun das! In Dortmund! In der Nachbarstadt. „Bei uns gibt es doch keine Kommunisten“, sagte der Lehrlingssprecher. Fast hätte er hinzugefügt: nur bei mir zu Haus. Ja, sein Vater war Kommunist, seit er mit einer Kriegsverletzung gelähmt im Rollstuhl saß. Dass er heute seinen Geburtstag bei den harmlosen Naturfreunden feierte, verdankte er seiner Frau, die sich bei ihnen mit großer Liebe engagierte.
Für den bald achtzehnjährigen Gerd Frantz war dieser Rudi Wellmann ein Granitblock, der auf einer Wiese liegt. Wie ehrfürchtig hatte Theo Mucha oft davon gesprochen, dass der alte Kollege nicht nur Metaller seit Urzeiten gewesen sei, sondern bis zur Katastrophe der Demokratie Reichstagsabgeordneter, in der Berliner Ruine, die er vor zwei Jahren gesehen hatte. Ein Arbeiter ist der Doktor sicher nie gewesen. Aber er ging oft durch die Halle und sah zu, wie die Gießkellen zu den Dammgruben balanciert wurden und das heiße Eisenwasser vom Einguss verschluckt wurde, oder er stand an den Öfen und beobachtete den Abstich wie ein faszinierendes Schauspiel – was das ja auch ist. Auch mit dem Formerlehrling hatte er oft über seine Arbeit gesprochen; merkwürdig, im Zeichensaal hatte er ihn nie gesehen.
Rudi Wellmann schaute nur den Lehrlingsvertreter an, als er sagte: „Wenn alle schlafen, dann reißen die, die wach sind, das Ruder an sich. Da können hundert im Boot sein.“ In der Westfalenhütte sei das genauso. Er könne die Dortmunder Kollegen fragen, ob sie ihre Interessen wirklich von Kommunisten vertreten lassen wollten. Es brauche nur eine Handvoll wirklich entschlossener Leute: und aus jeder Minderheit könne eine Mehrheit werden, eine Majorität an entscheidender Stelle. Wenn alle schlafen! „Ihr müsst wach sein!“ rief der alte Kollege Arbeitsdirektor, „durch den Betrieb gehen und alle wachrütteln. Ihr jungen Kollegen müsst vorangehen. Ihr wollt doch noch in sechzig Jahren als Demokraten leben.“
Der Vater wartete auf ihn im Naturfreundeheim, und Hilde. Die Kollegen redeten sich die Köpfe heiß. Saßen sie schon zwei Stunden? Sollen doch die Kommunisten einziehen in den Betriebsrat, der hat sowieso nicht viel zu sagen, und der Wellmann wird auch die um den kleinen Finger wickeln, wie er es mit dem Theo und allen Kollegen tut. Wie er da sitzt, der Wellmann, hat die Krawatte halb heruntergerissen, die Hemdsärmel hochgeschlagen, die Weste aufgeknöpft, gemütlich, humorvoll, listig. Ein Kumpel. Ein Doktor. Ein Direktor. Der wird ein ganz schönes Stück verdienen. Manche kommen schön hoch im Leben, werden Direktor. Wie die das machen! Weil sie studiert haben? Aber er muss gewählt werden. Der Theo zum Beispiel, im Aufsichtsrat, der muss ihn wählen. Wenn er zehn, fünfzehn Jahre lang im Betriebsrat wäre, könnte er eines Tages, vielleicht mit dreißig, vierzig, auch in den Aufsichtsrat gewählt werden. Dann würde er, ein kleiner Chef, den Dr. Wellmann als Direktor einstellen. Aber der war dann schon tot. Ein guter Schüler war er wohl, aufgeweckt haben sie ihn genannt. Der Großvater war noch auf der Grube „Präsident“ Bergmann, der Vater war als junger Mann ein guter Schlosser beim Verein. „So begabt ist der Junge“ – die Mutter meinte sein Talent für das Zeichnen, auch für das Malen mit Tusche. Von diesem Talent waren alle entzückt, die Lehrer auch. Alle haben sie ihn in seinen Traumberuf hineingeredet, Technischer Zeichner, wer so aufgeweckt, so talentiert ist, ein sauberer Beruf, wird immer gebraucht, das ist doch fast so anspruchsvoll wie Ingenieur oder Architekt, ohne Studium. So eine richtige Kacke. Er hätte es geschafft, er war gut, auch in der Berufsschule. Strich, Strich, Winkel, Zirkel, Strich, spitze Feder, breite Feder, das geometrische Gespinst aus Skriptol. Korrekturen, Änderungen des Maßstabes, massenhaft. Am meisten Spaß machten ihm die Beschriftungen, aber mehr als vier Schrifttypen waren nicht erlaubt. Er ertappte sich dabei, dass er, angetrieben von der technischen Phantasie der Skriptolfeder, neue Schriftformen erfand. Schriftenmaler, Schildermaler – das müsste ein Beruf für ihn sein. Ein Onkel, Lagerhalter bei der Bochumer Assoziation, hatte sein Talent schon entdeckt, und ihm manche Mark zugesteckt für Fensterplakate und Angebotsschilder.
Dass die Maschinenteile, die sie am Reißbrett, die Zunge zwischen den Zähnen, die Augen lupenhaft geschärft, an den Linealen entlang kritzelten, in Modelle verwandelt und diese mit Sand ummantelt wurden, um Gefäße für Eisen zu werden, das seine Gestalt sucht – das hatten die Zeichenknechte schon in der ersten Lehrwoche gesehen. Immer wieder hatte es Gerd zu den Formern gezogen, die den mageren oder fetten lehmigen Sand mit ihren hölzernen und eisernen Stampfern in die Kästen drückten, mit Formteilen hantierten, Stifte und Nägel in den gepressten Formsand trieben wie ein Chirurg bei der Nagelung von Trümmerbrüchen. Waren sie nicht wahre Künstler, diese Former? Zauberer, die den Sand mischten wie der Maler seine Farben, Magier, die jede Blase, jede Körnung beim Guss in der behutsamen Lenkung der fließenden Materie zu verhindern wussten? Meister eben, die – oh, das Lied hatte er im Kopf, schon seit der siebten Klasse! – die „zähe Glockenspeise“ fließen ließen nach der „rechten Weise“. Die hatten wohl auch die achtundzwanzig Glocken des Glockenspiels am Rathaus fabriziert – aus Gussstahl, nicht Kupfer und Zinn wie bei Schiller.
Wenn er ehrlich war: die Begeisterung für die Formerei war verflogen. Er musste sich das eingestehen, ein paar Monate vor der Gesellenprüfung, auf die er sich mit Ehrgeiz vorbereitete. Er wollte sie mit Glanz bestehen, da brauchte der Theo gar nicht zu reden. Wenn wir einen zweiten Anlauf nehmen, müssen wir allen beweisen, dass wir gut daran taten, den ersten vor dem Sprungbrett abzubrechen. Formen, ein Leben lang? Formen, gestalten, bilden, ja – drei Leben lang! Doch die Geschicklichkeit nach der Schablone, das Talent, das sich auf der fremden Linealschiene führen lässt: wie lange kann man Spaß daran haben?
Die Sitzung war beendet. Die Männer hatten die meiste Zeit gestanden, waren gestikulierend an den Fensterbänken entlanggelaufen oder hatten sich für ein paar Minuten auf sie gesetzt. Nur Rudi Wellmann hatte ruhig dagesessen, dabei war er wohl derjenige, der die stärksten Gründe hatte, sich über die Kommunisten in der Westfalenhütte aufzuregen. Er stand auf, zog das Jackett an, schüttelte jedem die Hand, während er mit der Linken nach seinem Unterarm fasste, und sagte zum Lehrling: „Du hast noch ein paar Minuten Zeit für mich?“ Auch das noch!
Gerd Frantz verließ mit dem Direktor den Raum. Die Tür zum kleinen Sitzungszimmer der Lehrlingsvertretung, einem Abstellraum, den Gerd mit Hilfe Theo Muchas dem Betriebsrat abspenstig gemacht hatte, stand offen, und Dr. Wellmann ging hinein. Die linke Wand gegenüber dem kleinen Fenster war vom Boden bis fast zur Decke mit einer Kollage auf Packpapier bespannt, Gerd Frantz’ „Klebekunstwerk“ aus Zeitungsausschnitten, zwischen denen pflanzenhafte Skriptolornamente wucherten. Die Passion für die Illustrierten hatte er von seinem Vater, der sich mit dem Lesezirkel nicht zufrieden gab, sondern unanständig beträchtliche Teile seiner mageren Versorgungsrente in frische Zeitschriften steckte, zur Freude seines Sohns, der sie nicht nur verschlang, heißhungriger vielleicht als der Vater, sondern ihnen auch die Figuren und bunten Formen seiner Tapetenwelt entriss, Leute und Landschaften, Fahrzeuge zu Lande, zu Wasser und in der Luft, Türme, Schlösser, kubische Häuser, die Geschöpfe des Films, die Rennfahrer und Trompeter, den Schah und Albert Schweitzer, mit der Fertigkeit des Schattenrissschneiders ausschnitt und Meter für Meter auf die Tapete klebte, oft auch eine Schlagzeile oder Bruchstücke von ihr dazu, wenn das Schriftbild in sein Patchwork passte – das Wort hatte er zum ersten Mal von Dr. Wellmann gehört, der auch jetzt wieder an der das Klebwerk trat und mit spontanem Entzücken sinnreiche Kombinationen würdigte.
Der Arbeitsdirektor legte dem Lehrling den Arm um die Schulter. „Gerd“, sagte er, „junge Kollegen wie dich brauchen wir. Kollegen, die sich kümmern. Kollegen, die was können. Mach deine Arbeit ein paar Jahre, mach sie gut. Setz dich ein für deine Kollegen. Dann schicken wir dich auf die Akademie. Wenn du willst. Willst du?“
„Eine Akademie?“
„Die Akademie der Arbeit in Frankfurt oder die Akademie für Gemeinwirtschaft in Hamburg – wenn du willst. Wir haben die Stiftung Mitbestimmung, die bezahlt das.“
„Ich habe kein Abitur.“
„Brauchst du nicht. Du brauchst nur deinen Kopf.“
„Da soll ich studieren?“
„Ja, Junge, ja, lernen, lernen –„
„Und was?“
„Was dir hilft, unsere gewerkschaftliche Sache zu fördern. Zerbrich dir jetzt nicht den Kopf darüber. Ich will nur, dass du weißt – wir haben ein Auge auf dich, Junge. Wir brauchen dich. Du musst schon sehr laut ‚nein’sagen, wenn wir dich vergessen sollen. Ich habe mit Theo Mucha gesprochen. Sprich du auch mit ihm über meinen Vorschlag. In zwei, drei Jahren – dann musst du dich wohl entscheiden.“
Der Kofferraum war nicht groß genug für das Fahrrad, aber Wellmanns Fahrer hatte die Klappe mit wenigen Handgriffen über dem Vorderrad festgemacht. Er fuhr erst den Chef nach Hause und dann den Lehrling auf die Wiese. Der Abend war warm, die Naturfreunde saßen vor dem Haus auf den Bänken an den Bohlentischen im Geviert der Laternenbänder, die noch nicht leuchteten. Gerd Frantz hatte den Fahrer zu einem Würstchen, einem Bier eingeladen, doch der hatte nur laut „Feierabend“ gerufen. Besser wäre es gewesen, das letzte Stück des Weges zur Wiese zu radeln. Als der Fahrer das Rad aus dem Kofferraum hob, waren einige von den Bänken aufgestanden und zum Tor gekommen, auch der Vater hatte mit hektischen Schlägen an die Felgen seines Stuhls gegriffen. Die Fahrt sei die Idee des Fahrers gewesen, erklärte er dem Vater und den Freunden: warum genierte er sich zu sagen, dass er neben dem Direktor im Fond gesessen hatte?
Hilde war schon weg. Gerade war sie weggefahren. Der Vater, hörte Gerd von seiner Mutter, hatte wieder an ihr herumgekrittelt, wegen des Rocks, wegen der Frisur, weiß der Kuckuck weswegen. Er war erleichtert, heute Abend nicht mehr mit ihr über Dr. Wellmanns Ideen sprechen zu müssen. Das Naturfreundeheim war eine Blockhütte, die gerade um einen um das Doppelte größeren Steinbau erweitert wurde. Der stand, mit offener Tür- und Fensterhöhle, unverputzt, unansehnlich, vor den Büschen und Hecken, in denen Lampions und Girlanden hingen. Auch Gerd Frantz hatte manche Stunde an dem Haus gewerkelt. Er holte sich einen Klappstuhl aus der Hütte und setzte sich neben den Rollstuhl. Der Vater hatte offenbar scharf getrunken. Er brabbelte halb Verständliches über die Tische. Hilde! rief es in Gerd Frantz. Meine lustige, freche, süße Hilde. Wollen wir zusammen nach Hamburg fahren? Oder nach Frankfurt? Ob ihre Eltern einverstanden wären? Arzthelferinnen werden doch überall gesucht. Er blickte auf den Rohbau und dachte: wenn das Haus nicht bald fertig wird, werde ich in ihm keine Feste feiern.
Oste
Das ist eine Aufgabe für den Lehrling im ersten Jahr. Doch der ist in der Berufsschule. Hans Egloff muss sich der Auszüge annehmen. Bankvorstand Quast hat ihm den Stapel der Kontoauszüge und Belege stumm auf den Schalter gelegt. Wenigstens ein kleiner mimischer Protest wäre jetzt angebracht, irgendeine gelangweilt angewiderte Geste oder auch ein Witzwort, das ganz unaggressiv zum Ausdruck brächte, einer Zumutung konfrontiert zu sein. Das Einsortieren der Belege in die Kontokartei ist natürlich keine Aufgabe für einen Banklehrling im dritten Jahr, der fast – nur die Formalität der Prüfung steht davor – ein ausgewachsener Bankkaufmann ist. Die Sache muss jedoch erledigt werden. Die Kunden wollen morgen die Belege sehen, wenn sie ihren Kontoauszug studieren. Der Schwierigkeitsgrad dieser Aufgabe ist nicht zu unterschätzen: auf Konzentration kommt es an, die am Ende eines Arbeitstages mit regem Betrieb schwerfallen kann. Die Schecks, die Überweisungsträger, der Kontoauszug selbst, Zinsnoten, Mitteilungen müssen hinter die Karte des Kontoinhabers gesteckt werden und dabei ist auch auf die Datumsreihe zu achten. Es hat Irrläufer gegeben, peinliche, unentschuldbare, und zweimal haben sie zu heftigen Beschwerden gegenüber dem Vorstand geführt, waren einmal sogar im Aufsichtsrat Gegenstand einer unerfreulichen Aufregung, weil ausgerechnet ein Notar, dessen Beruf Diskretion sein sollte, den in seinem Bündel auftauchenden Fehlbeleg seinem Nachbarn, einem Schlachtermeister, über den Tresen gereicht hat. Wenn die Belege am Schalter den Kunden ausgehändigt werden, sollen sie zwar kontrolliert werden, doch das geschieht meistens oberflächlich.
Die Welt des großen Geldes ist klein hier in der Volksbank Bremervörde eGmbH. Der Vorstand, die Angestellten, die Lehrlinge sitzen eng aufeinander, wenn auch in großen Räumen, nicht selten lassen sich Aufsichtsratsmitglieder an den Schaltern blicken und fragen mal fachmännisch nach dem Gang der Dinge, und die Kunden sind Mitglieder der Genossenschaft mit einem Kapitalanteil, mit einem Stimmrecht: und der Lehrling einer Volksbank lernt in der ersten Woche, in jedem Kunden seinen Arbeitgeber zu sehen.
Hans Egloff hätte auch nicht freudig nach dem Stapel der Belege greifen dürfen, denn das hätte dem Vorstand signalisieren können, er stürze sich mit Begeisterung, glücklich über geringe Anforderungen, auf die Geduldsaufgabe. Er nimmt den Stapel mit undurchdringlich sachlicher Miene vom Tresen, legt ihn auf den Tisch neben dem Karteischrank und sortiert die Zettel nach dem Alphabet. Er muss sich beherrschen. Der Quast soll sein Lächeln nicht sehen. Die Sortiererei, das Hantieren in den Konten, macht ihm Spaß. Er freut sich schon darauf, den ersten Karteikasten aus dem Blechschrank zu ziehen. Vor zwei Jahren waren die Schränke erneuert worden. Einen von den alten hatte er mit nach Hause nehmen dürfen: der steht jetzt auf dem Dachboden und dient ihm als Archiv. Ein künftiger Bankkaufmann muss auch in seinen persönlichen Sachen auf Ordnung sehen.
Wie immer, finden sich heute im Stapel Belege, auf denen der Name des Empfängers nicht zu entziffern ist. Die Kontonummern lassen sich den alphabetisch geordneten Kunden nicht leicht zuordnen, weil sie einer Ordnung gehorchen, die der Lehrling im dritten Jahr respektlos „Unordnung“ nennt – nicht ohne auf seine Verbesserungsvorschläge verweisen zu können. Wie bei einem Zahlenrätsel merkt er sich die namenlosen Nummern, um sie beim Blättern mit dem Namen assoziieren zu können. „Unglaublich, wie schludrig manche Leute ihre Geschäfte betreiben.“ So gewaltig sind die Summen nicht, die den Bremervördener Handwerkern, Ärzten, Angestellten über die Konten laufen, ihre astronomische Dimension leuchtet nur auf, wenn er das Vielfache des Monatsgehalts, das er nach der Lehre haben würde, im Kopf überschlug.
Die Bank hat kein Monopol hier am Ort, da ist die Sparkasse, da ist die Raiffeisenkasse – doch weite Teile des finanziellen Innenlebens unserer Kreisstadt liegen doch in diesen Blättern vor mir. Wenn ich eine detektivische Neugier hätte, könnte ich das Schicksal so manches Kunden buchstäblich entziffern. Will ich aber gar nicht. Es macht mir Spaß zu sehen, wie’s wirkt und sich verwebt, wie an winzigen Details Zusammenhänge deutlich werden, zu erkennen, dass und wie’s den Klugen gut und Dümmeren schlecht geht und zu ahnen auch, warum das so ist, ohne Neid auf die Könner zu blicken, die mit ihrer Arbeit, ihren Ideen, ihrer Pfiffigkeit Tag für Tag die fetten Gelder aufs Konto locken, das Mitleid mit denen, denen alles zerrinnt, in Grenzen zu halten und sich mitzufreuen, wenn Zuflüsse Überraschungsgewinne verraten, wie hier zum Beispiel der Abschnitt der Spar- und Kredit-Bank e. Gen. m. b. H. in Drochtersen mit der Notiz „Erbanteil“ und dem Sümmchen von viertausend Mark. Hans Egloff hält den Abschnitt sinnend in der Hand: so eine Zahl, das ist ein bewegendes Ding.
Was macht ihm wirklich Spaß hier in der Bank? Immer deutlicher wird ihm bewusst, dass er sich vor den Gesprächen mit den Kunden am Schalter drückt, nein, das ist ja nicht möglich, innerlich drückt, wegduckt. Mag er die Menschen nicht? Hat er Scheu, gar Angst vor ihnen? Er weiß, dass er begabt für den Umgang mit Menschen ist, auch mit Kunden. Direktor Quast hat öfter schon seinen souveränen Gesprächsstil gelobt: „Sie geben den Kunden Durchblick. Sie zwingen die Kunden mit ihren unklaren Wünschen und Vorstellungen auf eine logische Bahn. Das machen Sie sehr, sehr gut.“ Und er hat es erlebt, dass eine der älteren Kolleginnen ihn schon im zweiten Jahr unauffällig an den Schalter bugsiert hat, um sich von ihm mitten in einem Kundendisput ablösen zu lassen. Er hat sich dabei ertappt, ungeduldig mit Kunden zu werden, hochfahrend, herrisch, und das beschämte ihn. Die wuselige oder joviale Redseligkeit mancher Leute geht ihm auf die Nerven, Weitschweifigkeit verursacht einen körperlichen Schmerz. Dienst am Kunden, ja ja, tausendmal ja, aber er fühlt, dass ihm die Dienstbereitschaft, diese hilfswillige Gesinnung, die man braucht, um einen Menschen mit Wünschen, Absichten, Interessen wirklich zufriedenzustellen, wohl abgehe. Ist er nur für den Schreibtisch geboren?
Er hat auch schon den Kassierer vertreten, im Kabuff mit seinen dunkel gebeizten Holzwänden, hinter der kleinen Durchreiche in der schmalen Glasfront, die ihn an den Postschalter erinnert, hinter dem sein Vater thront. Macht ihm die Arbeit in der Kasse soviel Spaß wie seinem Vater, dem Postsekretär, sein amtliches Walten? Der alte Herr ist wirklich schon ziemlich alt, steht vor der Pensionierung, an die er mit Unbehagen denkt: ist er doch erst vor wenigen Jahren in den Postdienst zurückgekehrt, der stramme SA-Mann, der sich in den Entnazifizierungsverfahren nicht ganz reinwaschen konnte, aber sauber und solide genug war für den 131-er Schein, der eine ehrenvolle Rückkehr in die Zivilisation ermöglichte. Auch hatte er sich demokratisch gewendet, war angesehenes Mitglied der Postgewerkschaft, auch bei den Sozis, sogar Aufsichtsratsmitglied der Assoziation, tat überhaupt so, als sei er die vierte Säule zu den dreien der Arbeiterbewegung. Die Mutter ist viel jünger als ihr Mann. Der Bremervörderer Assoziation in der dritten Generation verbunden, hat sie schon vor der Währungsreform eine der drei Verteilungsstellen geleitet. Lehrling bei der Volksbank: für die Eltern wäre das ein Traum geblieben. Nur dem Einsatz Rektor Frankes für den besten Schüler, den seine Volksschule in seiner langen Dienstzeit hervorgebracht hat, ist die Chance zu danken gewesen. „Ich hasse Protektion“, hat der Rektor zum Vater gesagt, „aber für Ihren Sohn würde ich zum Adenauer nach Bonn marschieren“ – was er in diesem Jahr nicht nötig gehabt hätte, denn der alte Kanzler ist in seinem dritten Wahlkampf auch nach Bremervörde gekommen, und Rektor Franke ist an seiner Seite auf einem Foto der Bremervörder Zeitung zu sehen gewesen. Vor die Kontokarte seines Vaters hat Hans Egloff keinen Beleg zu stecken. Bei seinen Streifzügen durch die Welt des kleinen nachbarschaftlichen Geldes wirft er immer wieder einen Blick ins väterliche Geheimfach: der Vater hat schon gedroht, zur Sparkasse abzuwandern, doch so groß wäre der Verlust für die Volksbank nicht.
Fürs Geld in der Kasse hat er einen präzisen Griff, da gibt’s kein Manko, kein zeitraubendes nörgeliges Geldzählen und Belegprüfen beim Kassenschluss. Da ist nur dieses befriedigende Gefühl: Punkt, die Kasse stimmt, wie im Buchführungsunterricht, wenn nach langen operativen Buchungen der Sollgewinn getroffen ist und Aktiva und Passiva sich die Waage halten. Aber Geld an sich? Macht das Spaß, es durch die Finger schnurren zu lassen, das Kritzeln in den Sparbüchern, Abgang, Zugang, Einzahlung, Auszahlung, Gutschrift, Lastschrift, Guthaben? Vielleicht die Zinsrechnung zum Jahresschluss, ja, die macht ihm Spaß. Geld ist etwas Unlebendiges, etwas Abstraktes, es hat so etwas punkthaft Inhaltsloses. Und doch: jeder Punkt ist ein bewegendes Ding, jede Mark ein Takt der Zeit: jeder Saldo ein Pulsschlag des Lebens.
Die Kredite sind die Domäne der beiden Chefs, eigentlich nur Herrn Quasts. Hans Egloff hat jedoch etliche der Kreditakten unter seiner pflegerischen Obhut. Ob das seine Zukunft sein könnte: Kreditsachbearbeiter mit dem Fernziel, irgendwann einmal von den Mitgliedern in den Vorstand gewählt zu werden?
Er traut sich schon heute zu, jedes, fast jedes Kreditgespräch zu führen. Letztlich waltet auch hier, im Herzen des Geschäfts, ein leicht zu durchschauender Schematismus, wenn sich auch die Volksbanken und ihre Werbeleute in der Frankfurter Genossenschaftskasse viel darauf zugute halten, dass der genossenschaftliche Kreditgeber viel einfühlsamer und effektiver als jede andere Bank einen Schuldner auf Herz und Nieren prüfen könne, weil er eben nicht nur einen Kreditnehmer vor sich sähe, sondern einen Menschen mit einem Willen und einem Charakter, einen Nachbarn, dessen Tüchtigkeit und Tugend jedermann bekannt sei: was als Sicherheit für einen Kredit durch keinen Sachwert zu überbieten sei. „Wo andere aufhören, fangen wir an“, sagt Herr Quast, aber natürlich: der Lehrling kennt die Akten und hat schon begriffen, dass dieser Spruch durch ein stabiles Netz ordentlicher Garantien gesichert ist. Das soll ihm Spaß machen? – die Prüfung der Pläne, des Charakters, der Tüchtigkeit, das Feilen an Verträgen und Urkunden? Den Daumen senken oder heben? Urteilen vor der Tat, Urteilen während der Tat, die Trümmer von Ruinen verwerten?
Wir in den Banken kümmern uns nur um den Schatten, den die Dinge werfen. Der Schatten: etwas Dunkles, etwas Kühles, etwas Steriles. Spannend, warm, lebendig ist das Ding jenseits des Schattenrisses. Können wir denn die Dinge wirklich bewegen? Oder werden wir nur bewegt durch den ängstlichen Gedanken an Sicherheit und Garantie, tragen wir immer nur dem Wagemutigen Schild und Schwert hinterher, weil wir sie nicht halten und führen können?
Hans Egloff schiebt den letzten Karteikasten mit einem krachenden Schwung auf seine Schienen. In der Tür seines durch Glaswände abgetrennten Büros steht Herr Quast. „Bitte, Herr Egloff, kommen Sie doch zu mir!“ Ein bescheidenes Büro, das niemand imponieren will. Über dem Chefsessel die dunklen Ölporträts zweier silberbärtiger Herren, von denen Hans Egloff annimmt, dass sie den Gründervater Schulze-Delitzsch persönlich gekannt haben. Herr Quast wirkt bedrückt, ja gehemmt und braucht ein paar Minuten, um seinem begabten Lehrling zu sagen, dass nach seiner Prüfung trotz der zu erwartenden glanzvollen Noten für ihn kein Platz in der Volksbank Bremervörde sein würde. Hans Egloff hat sich längst darauf eingestellt. Er kann ja sehen, er kann ja rechnen. Ihn zieht es nach Hamburg oder nach Bremen. Allerdings würde er gern noch ein, zwei Jahre in der Volksbank tätig sein, weil er es strategisch nicht für gut hält, gleich nach der Prüfung einen neuen Arbeitgeber zu suchen. „Natürlich, lieber Herr Egloff, lassen wir einen Mann wie Sie nicht gehen. Ich habe mit den Kollegen gesprochen. Alles ist klar. Sie haben die Wahl: Bremerhaven oder Buxtehude.“
In der Luftlinie liegt Bremervörde an der Oste genau in der Mitte zwischen Buxtehude an der Este und Bremerhaven an der Weser. Wie heißt doch der Esel, der sich zwischen zwei völlig gleichen Heubündeln, links und rechts von seinem Kopf, nicht entscheiden kann und darüber verhungert? „Sie haben ja bis zu Ihrem Examen Zeit, sich die Sache zu überlegen, sagen wir, ein paar Wochen vorher, die Stellen sind für Sie offen.“ Hans Egloff sagt nur ein Wort: Bremerhaven. Das ist fast Bremen. Bremen kann noch ein bißchen warten. Oder Hamburg. Bremerhaven ist eine wichtige Stadt, Buxtehude wird ja doch nur für den Schauplatz des Märchens gehalten. B – B – Buridan, das war der mit dem Esel.
Pitts Notizen zur Quellenlage
Als Ghostwriter hat Pitt sich daran gewöhnt, die Quellen aller Informationen, die er in seinen Texten verarbeitet, sorgfältig kenntlich zu machen und zu archivieren, denn oft genug muss er seinen Auftraggebern gegenüber darlegen, ja beweisen, dass er sich seine Arbeit nicht zu leicht gemacht und Fiktionen für Fakten ausgegeben habe. Alles muss nachprüfbar sein, muss belegt sein: und schwingt der Ghostwriter sich in rhetorisch begründetem Eifer zu Wertungen auf, muss er fähig sein, auch ihren sachlichen Kern offenzulegen. Es ist also nicht eine Marotte, wenn Pitt auch in einer belletristischen Arbeit daran festhält, seine Quellen zu beschreiben.
Spärlich flossen die Informationen über die Lehrjahre Hans Egloffs. Er ist nicht unschuldig daran. Ein Gespräch mit ihm über seine Jugend war nicht möglich. Die biografischen Informationen, die er selbst, zum Beispiel dem Munzinger Archiv, gegeben hat, waren immer karg, ja hinsichtlich der frühen Entwicklung geradezu geizig. Warum haben manche Männer, die Großes in ihrem Leben geleistet haben, oft diese Scheu, über ihre Wurzeln zu sprechen? Als Hans Egloff kurz vor der Jahrhundertwende vom Vorstandsvorsitz der Großkauf-Gruppe in den Stiftungsvorstand wanderte, richtete der Weltkonzern in Berlin das große Fest aus, zu dem Pitt nur geladen war, weil er für die Rede des Repräsentanten eines bedeutenden Konkurrenzunternehmens einige Formulierungen zum Thema „Führungsstile im Handel“ geliefert hatte. Zufällig saß er während des Banketts an einem Tisch, an dem drei Kommilitonen Egloffs aus seiner Studienzeit an der Akademie für Gemeinwirtschaft sich ziemlich laut und offen über die erstaunliche Vita ihres Freundes unterhielten, wobei einer seine Karriere nicht ohne einen gallig-kritischen Unterton kommentierte. Pitt mischte sich mit Fragen zur Hamburger Akademie ins Gespräch und erfuhr, dass die in den fünfziger, sechziger Jahren eine Kaderschmiede war, von der aus viele bedeutende Karrieren in Politik, Gewerkschaften und Industrie ihren Ausgang genommen haben. Der junge Egloff hat seinen Kommilitonen Anekdotisches aus seinen Bremervörder Lehrjahren erzählt, woran sich die älteren Herren, von Pitt immer wieder ermuntert, erinnerten, ja einer von ihnen stammte aus Bremervörde, hatte aber in der Heimatstadt Hans Egloff nicht gekannt. Noch im Hotel, mit schwerem Kopf, hat Pitt das muntere Gespräch nachstenografiert. Zu Rate gezogen hat Pitt auch den spannenden Lebensbericht des erfrischend kernigen Präsidenten des Bundesverbandes der Industrie, Hans-Olaf Henkel, des ehemaligen IBM-Topmanagers, der ein Kommilitone Egloffs gewesen sein musste. Er erzählt in „Die Macht der Freiheit“ über sein Studium und seine Lehrer an der Akademie in großer Dankbarkeit; der Eintritt in die Akademie sei „die entscheidende Weichenstellung“ seines Lebens gewesen. Lord Dahrendorf hat in seinen Lebenserinnerungen „Über Grenzen“ über diese erste Stätte seines professoralen Wirkens gesagt, nie habe er das Lehren mehr genossen „als bei diesen Studenten, die zugleich erfahrungsgesättigt und wissenshungrig waren“ – und er war doch der Direktor der weltberühmten London School of Economics gewesen.
Über den Formerlehrling Gerd Frantz wissen wir dagegen recht viel. In dem zauberhaften Buch „Wie sie wurden, was sie sind“, Düsseldorf 1989, hat Imke Zimmer-Rahlfs den Vorstandschef der As AG,neben elf weiteren Topmanagern, ein Kapitel gewidmet, das – wen wundert’s bei diesem Werdegang – gerade der Adoleszenz besondere Aufmerksamkeit schenkt. Gerd Frantz ist ja ein Mann, der gern und offen über die Welt im Spiegel seines fröhlichen Ichs spricht, als habe der Schöpfer sie ihm zum Maßanzug geschneidert. Der vielfache Grimme-Preisträger Friedrich Bendler hat in seinem TV-Film „Kaiser Frantz“, zu dem ihm sein Protagonist aus dem Gefängnis viele Briefe mit Lebensberichten und –impressionen geschickt hat, die anrührende Szene dargestellt, in der dem Lehrling Gerd beim Guss heiße ätzende Gasdämpfe ins angestrengt verzerrte Gesicht wabern. Es erübrigt sich hinzuzufügen, dass Dr. Frantz Pitt sehr bereitwillig zu vielen Gesprächen am Tegernsee empfangen hat.
Dr. Erika Reichenbach, die am Ammersee auf ihrem verwilderten Grundstück hinter einer hohen Pforte ohne Sprechanlage lebt, ist keinem Gespräch zugänglich. „Was ich wusste, habe ich geschrieben, und über mich ist nichts zu sagen“. Dennoch kann Pitt sich für die Authentizität ihres Dießener Auftritts verbürgen, den er hat mit einer hochkompetenten Zeugin gesprochen, der Christel Holle, die, weit über achtzig Jahre alt, in einem Luftkurort des Bayerischen Waldes lebt und Pitts Recherchen zu seinem Roman vom Soll und Ist mit dankbarer Anteilnahme und Wissbegierde verfolgt.
Werner Steinberg hat über sein Kirchturmsglück und seine Handelsschulzeit in seiner Studie über das Verhältnis Gustav Freytags zu den Juden und den Polen erzählt, einer interessanten Schrift, die keine Resonanz gefunden hat, weil sie in einem Druckkostenverlag erschienen ist. Steinberg versteigt sich in seiner Schwärmerei für „Soll und Haben“, das Buch mit den „Buddenbrooks“ zu vergleichen. Aus einem Besuch Thomas Manns während seiner triumphalen DDR-Reise im Goethe-Jahr 1949 in Gustav Freytags Sommerfrische Siebleben bei Gotha, in dem „Soll und Haben“ entstand, schließt er, der Nobelpreisträger habe einem „Vorbild“ seine Referenz erweisen wollen. Er hat aber nur vor dem Haus gestanden, hat nicht das Arbeitszimmer besichtigt und schon gar nicht das Grab besucht. Der literarhistorische Dilettant mag sich hier verrannt haben. Auf einem witzig-realistischen Boden steht er, wenn er von den didaktischen Schnurren des Diplom-Handelslehrers Püster, des Verfasser eines damals bekannten Lehrbuchs der doppelten Buchführung, erzählt, die den Schülern halfen, in den zu buchenden Geschäftsvorfällen das Soll und das Haben im Kontenrahmen zu unterscheiden.