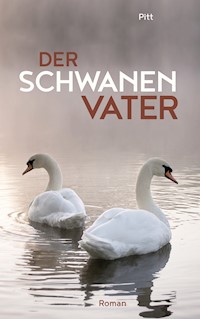Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
In 17 Parabeln berichtet Pitt, was er in Isenburg erfahren und gelernt hat. - "Schaut nur in eure Herzen!" Ein kluger Seelsorger weiß, warum so viele Isenburger verschwanden. - "Sie haben alle Sprachen gelernt und das Sprechen verlernt", sagen die Isenburger über das babylonische Ehepaar. - "Wer neue Wege nutzt, ist fähig neue zu suchen." Ist er der Meisterfotograf? - "Oh Herr Professor Gott, lass mich mein Bruder sein!" ruft der unschuldige Brudermörder. - "Nach unserem Glück müssen wir uns tausendmal bücken", sagt der greise Bankier, der sich immer noch bückt. -"Wer sich das Wort gibt, sollte nicht über Buchstaben streiten", sonst droht die Isenburger Scheidung. - Warum sagen die Isenburger: "Da liegt der Knippel beim Hund"? - Warum es besser gewesen wäre, Professor Zumpf hätte ein Handy besessen.- Wer kann die Menschen lehren, wie man fällt, ohne zu fallen? - Eine Regel für Sammler: "Suche nur das, was du auch finden kannst."
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 170
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhalt
Zum Geleit
Die Unsichtbare von Isenburg
Das babylonische Ehepaar
Der Meisterfotograf
Der Polizist von Isenburg
Zibbel und Zibbelchen
Der unsterbliche Jonathan
Das Isenburger Testament
Der Gasthof „Zur Klasse 3 b“
Der Brudermörder
Der Glücksgroschen
Der Froschteich
Der Aufstieg der Brüder Dingeldein
Die Isenburger Scheidung
Knippels Toast
Eine peinliche Geschichte
Isenburger Spinnen
Der Glückskäfer
Anna Peter (1904-1986),
die Geschichten liebte,
an ihrem 111. Geburtstag gewidmet
Zum Geleit
Isenburg ist keine bedeutende Stadt, und der „Isenburger Kurier“ ist keine bedeutende Zeitung. Bedeutend sind nur die Isenburger, wie alle Menschen an allen Orten. Auch eine richtige Zeitung war der „Isenburger Kurier“ nicht. Er war ein so genanntes Anzeigenblatt, das den Isenburger Haushalten wöchentlich kostenlos in die Briefkästen gesteckt wurde, wie in vielen Orten. Pitt war einer der Reporter des „Kurier“, das heißt eigentlich war er kein richtiger Reporter, sondern ein Anzeigenwerber, der nur manchmal zur Feder greifen musste, um eine kleine Reportage für sein Blättchen zu schreiben. Diese halbjournalistische Arbeit war natürlich auch nicht so bedeutend wie das Einwerben von Anzeigen von den Isenburger Gewerbetreibenden, denn Anzeigenblätter leben nun mal von den Anzeigen und nicht von den Geschichten oder den Ankündigungen, die sie veröffentlichen, so spannend sie sein mögen. Pitt hat vieles in seinen Gesprächen mit den Isenburgern erlebt, was er zu seinem großen Bedauern nicht im „Kurier“ berichten konnte, aus Gründen des beschränkten redaktionellen Raums und auch wegen der betrüblichen Tatsache, dass Pitt eben kein richtiger Reporter war, sondern nur ein Lückenberichterstatter. Er hat im Laufe seiner entsagungsvollen Tätigkeit für den „Isenburger Kurier“ viele märchenhafte Geschichten erlebt und erfahren. Hier sind einige von ihnen. Pitt bittet alle Leserinnen und Leser, nicht alle Isenburger für fabelhafte Menschen und Isenburg nicht für eine märchenhafte Stadt zu halten. Was ist der Ort des Menschen anderes als ein großer Strom aus vielen Lebensläufen, ein buntes Gemälde aus vielen Lebensbildern.
Die Unsichtbare von Isenburg
Zu der Zeit, als Isenburg noch ein Städtchen von nur dreitausend Einwohnern war, brach dort eine Katastrophe aus, die nicht nur die Bürger von Isenburg in Verzweiflung stürzte, sondern das ganze Land verwirrte. Die Chroniken und amtlichen Protokolle, die Pitt im Stadtarchiv studiert hat, sagen nicht, wer als erster von dem Unglück betroffen wurde. Es war ein Ostersonntag, an dem der Isenburger Polizei vier Vermisste gemeldet wurden.
In einem vergilbten Zeitungsbericht, den Pitt in einem verstaubten Aktenbündel fand, war zu lesen, dass einige gemeint hatten, die Zahl der schon am ersten Tag Vermissten sei höher gewesen. Die Polizei habe jedoch das Problem verkleinert, um keine Unruhe unter den Isenburgern entstehen zu lassen. Vier Vermisste an einem Tag! Einmal waren an einem Tag zwei junge Männer von ihren Frauen als vermisst gemeldet worden: aber das war im Karneval gewesen, in dem schon mancher den Weg nach Hause vergessen hatte.
Fünf Tage nach Ostern waren schon siebzehn Vermisste registriert. Und noch hatte man von den ersten nicht die kleinste Spur entdeckt. Die Wachstuben der Polizei hatten noch nie so viele Tränen gesehen, so viele schmerzliche Klagen vernommen, so viele Anklagen gegen die Unfähigkeit der Ämter gehört. Zwei Wochen später war die Zahl der Vermissten auf achtundzwanzig geklettert, und Pfingsten waren es schon dreiundvierzig, die verschwunden waren – auf rätselhafte, auf unerklärliche Weise wie alle anderen. Eben waren sie noch gesehen worden, und im nächsten Augenblick hatte sich ihre Spur im Nichts verloren. Familienväter kamen von der Arbeit nicht nach Hause, Frauen, die eben nur auf den Markt gehen wollten, kamen zum Mittagessen nicht heim und ließen ihre hungrigen Kinder allein. Der Schornsteinfeger schien in den Schornstein gefallen zu sein, der Bürgermeister, der nur seine Pantoffeln aus dem Schlafzimmer hatte holen wollen, kehrte nicht zu Pfeife und Apfelwein in die Stube zurück. Wer sich von Freunden verabschiedete, wurde von ihren sorgenvollen Blicken verfolgt. Natürlich gab es einige Witzbolde, die ihm dann lachend ein „Auf Nimmerwiedersehen“ zuriefen. Ähnlich muss es im Mittelalter gewesen sein, wenn die Menschen in Sorge um sich und den Nächsten nach den ersten Anzeichen der Pest auf der Haut des Nächsten spähten.
Die Zahl der Vermissten erreichte schließlich sechsundsechzig. Die Polizei, die das Problem dieses massenhaften Verschwindens nicht lösen konnte, tat, was ratlose Behörden in solchen Fällen tun: sie veröffentlichte die Untersuchung eines Professors der Universität der nahegelegenen Metropole. Aus dem Bericht erfuhren die Isenburger, dass unter den Vermissten auffällig viele Männer und Frauen waren, die länger als sieben Jahre verheiratet waren, viele Unternehmer, die Arbeiter und Angestellte beschäftigten, auch höhere Beamte, auffällig viele ältere Menschen mit größerem oder kleinerem Vermögen. Kinder waren glücklicherweise nur in zwei Fällen verschwunden. Das beruhigte wenigstens die Mütter etwas, während die Witzbolde Wetten darüber abschlossen, wann wohl der vermögende Großbauer Schmoller, im Nebenberuf Vorsteher der Isenburger Bauernbank, seit acht Jahren mit einer jungen Frau verheiratet, verschwinden würde. Eine Häufung von Risikomerkmalen hatte der Professor in einem solchen Fall erkannt.
Auf dem Höhepunkt der Vermisstenkatastrophe, zur Weihnachtszeit, waren – um diese bestürzende, ganz Europa in angstvolle Erregung versetzende Zahl vorwegzunehmen – einhundertzwanzig Personen in Isenburg als vermisst gemeldet. Düsternis und Grauen lagen über dem Weihnachtsfest. Die Angst vor dem plötzlichen Verschwinden war ein Albtraum bei Tag geworden. Sogar die Witzbolde wagten es nicht mehr, auszurechnen, an welchem Tage Isenburg sich in eine Geisterstadt verwandelt hätte, wenn in diesem wachsenden, ja noch steigenden Tempo Menschen aus ihrer Mitte verschwänden. Isenburg, eine Stadt der Waisenkinder?
Während die Einwohnerzahl Isenburgs auf so bedrohliche Weise schrumpfte, machten sich Heerscharen von Wissenschaftlern, Experten, Detektiven und Scharlatanen auf den Weg nach Isenburg, um das Verschwinden seiner Bewohner zu ergründen. Mancher hat in dieser Zeit der allgemeinen Ratlosigkeit und Sorge ein gutes Stück Geld gemacht. Da alle Gasthöfe belegt waren, verdienten auch die Isenburger an ihren wissbegierigen Gästen, in dem sie diese in den Betten der Vermissten schlafen ließen. Es kamen eine Menge von Reportern, die verzweifelte Angehörige vor leeren Stühlen und Betten interviewten und fotografierten. Der „Isenburger Vermisstenanzeiger“, der vom Bürgermeister täglich herausgeben wurde, war in jenen bösen Monaten die am weitesten verbreitete Zeitung in Deutschland und wurde von den Frankfurter Bankiers und den Hamburger Kaufleuten sogar noch vor den Börsenachrichten gelesen. Nach und nach wuchs die Befürchtung, die Isenburger Epidemie könnte auch auf andere Städte Deutschlands übergreifen.
Alle Theorien, Methoden und Erklärungsversuche verhalfen den Vermissten nicht zu ihrem Wiedererscheinen. Was gab es nicht für hochinteressante, vieldiskutierte Spekulationen! – kosmische Strahlen, denen eine die Körper auflösende Kraft zugeschrieben wurde, Menschenraub aus dem Weltall, plötzlich auftretende Erdrisse, seelische Störungen, die Schlafwandler auf eine ziellose Wanderschaft zwingen. Doch nirgendwo Spuren der Vermissten, außer in den Spintisierereien der Hellseher.
Natürlich lief die Fahndung nach den Vermissten im ganzen Land, und auch im Ausland wurde gesucht, da organisierter Menschen- und Sklavenhandel nicht ausgeschlossen werden konnte. „Unauffindbar wie ein Isenburger“, sagte man damals über Leute, die man aus welchen Gründen auch immer nicht erreichen konnte. Niemand hatte den scharfen Verstand, auch keiner der Spürhunde, die in Rudeln über Wiesen und Felder schnupperten, hatte die feine Nase, die nötig war, um nur einen einzigen Vermissten der großen Epidemie des Verschwindens zu entreißen. Es war hoffnungslos.
In jeder Stadt gibt es auch außerhalb ihres Magistrats kluge Köpfe, so auch in Isenburg. In Isenburg gehörte der Dompfarrer Blasius dazu. Der verstand sich auf die Menschen. Er kannte viele Isenburger, ging in ihren Häusern ein und aus, wusste in den Familien Bescheid. Und auch in seinem Beichtstuhl mochte er manches hören, was ein Kind nicht seiner Mutter, ein Mann nicht seiner Frau anvertraut. Auch er hatte den „Isenburger Vermisstenanzeiger“ jeden Tag gründlich studiert, und jeder Name, der dort auftauchte, hatte sich vor seinen Augen in einen Menschen aus Fleisch und Blut, mit einem Gesicht und einer Geschichte, verwandelt.
Pfarrer Blasius war kein Hellseher, nur ein hellsichtiger Mann. Ihm saßen die Augen im Herzen, und er hatte das Ohr an der Brust der Menschen. Es war nicht nur Anteilnahme am Schicksal der Menschen, es war nicht nur berufliche Neugier, es war die Klugheit des Menschenverstehers, die ihn trieb, mit den Isenburgern, die ihre Lieben vermissten, zu reden. Das hatten auch die Kriminalisten getan: natürlich hatten sie sich nach den Lebensgewohnheiten und Eigenarten der bedauernswerten Opfer erkundigt, wie das bei jedem aufzuklärenden Verbrechen geschieht. War das Gespräch des Hirten mit seinen Schafen etwa auch ein Verhör? Nein, es war nur ein Gespräch, in dem einer durch kluge, einfühlsame Fragen Dinge erfährt, die dem Befragten verborgen sind.
Es war der Heilige Abend, an dem der Pfarrer Blasius die Ursache der großen Not erkannt hatte, die unumstößliche, die endgültige Wahrheit. Da seine Erkenntnis ihn selbst erschreckt hatte, wartete er noch eine Woche, um den Isenburgern die Wahrheit zu sagen. Am Neujahrsmorgen stand Pfarrer Blasius in seinem Dom, der noch nie so voll gewesen war, vor seiner Gemeinde und sprach:
„Im neuen Jahr, ihr Unglücklichen, wird keiner mehr aus unserer Mitte verschwinden. Fragt nicht mehr, warum eure Nächsten und Nachbarn verschwanden, und fragt nicht mehr, wer morgen verschwunden sein wird. Schaut nur in eure Herzen.“ Pfarrer Blasius genoss ein wenig die Spannung seiner Gemeinde und holte erst einmal sein Taschentuch aus dem Rock, in das er schnäuzte, als riefe eine Posaune zum Gericht. „Findet den Grund des Elends in euren Herzen, wenn ihr eins habt. Dort liegt die Lösung des Rätsels, das euch alle quält. Hört die Wahrheit, die euch beschämen soll. Die Vermissten sind die Menschen, die euch im Wege stehen. Von denen ihr in euren Herzen wünschtet, dass sie aus euren Augen, ja aus eurem Leben verschwänden. Sie sind nicht fort, sie sind unter uns, doch sie haben sich unsichtbar gemacht, um euch nicht mehr im Wege zu stehen. Denn wenn ich weiß, dass ich von einem Menschen abgelehnt werde, gehe ich ihm aus dem Wege. Sie alle, die Vermissten, gehorchten eurer Lieblosigkeit. Glücklich ist der Mensch, der niemand im Wege steht und von dem niemand sagt: ach, wäre er, wo der Kuckuck ist, ach, wäre er nie geboren, und der nie das schlimmste Wort, das einer denken und sagen kann, hören muss: du bist für mich gestorben. Ihr seid die Glücklichen, die niemand im Wege stehen, denn ihr seid da. Keiner hat über euch gedacht: wäre er doch, wo der Pfeffer wächst. Aber das ist nicht euer Verdienst. Ihr habt das Glück, dass die Menschen in eurer Nähe euch ertragen. Ihr seid die Glücklichen und die Schuldigen. Es liegt in eurer Hand, die Unsichtbaren sichtbar zu machen.“
Hatten die Isenburger ihren Pfarrer verstanden? Da waren viele, die senkten ihre Augen unter Pfarrer Blasius’ flammendem Blick. Da waren viele, die interessierten sich in auffallender Weise für die pausbäckigen Engel über dem Altar. Da waren andere, die tuschelten aufgeregt mit ihrem Nachbarn: die zweifelten am Verstand ihres Pfarrers.
„Der Knecht“, fuhr der Pfarrer fort, „der im Zorne über den Bauern spricht: dass doch der Blitz ihn treffe! der Mann, der über seine Frau denkt: wär’ ich ihr nie begegnet, der Sohn, der nach dem Erbe seines Vaters schielt, die Frau, die ihrem Manne wünscht, dass ihn der Teufel hole, der Handwerker, der seinen Konkurrenten die Pest an den Hals wünscht, die Kinder, die ihren Lehrer verwünschen – das sind die Schuldigen. Was ihr gewünscht habt, habt ihr nicht wirklich gewollt, o nein. Jeder böse Gedanke hat eine hexerische Gewalt. Sie machte die Unglücklichen unsichtbar. Bekennt die Schuld eures unschuldigen Wünschens und Verwünschens, und ihr ruft die Unsichtbaren aus eurem Gericht zurück vor euer Gesicht, zurück in ihr Dasein, das ihr ihnen nicht gegönnt habt, weil es auf euer Dasein einen Schatten geworfen hat. Jetzt müsst ihr nur ehrlich sein. Zeigt eure finsteren Gedanken. Die Schuldbewussten trennt nur ein Engelshaar von den Schuldlosen. Euch soll verziehen sein.“
Wenn Pfarrer Blasius Recht gehabt hätte, so sollte man denken, wäre er im Nu von einhundertdreiundreißig schuldbewussten Isenburgern umringt gewesen – denn die Zahl der Vermissten war von Weihnachten bis zur Neujahrsnacht weiter gestiegen. Aber das geschah nicht. Nur ein siebzehnjähriges Mädchen sank neben seiner Bank auf die Knie und rief mit Tränen in der Stimme: „Ich habe meine Freundin verwünscht, weil ich sie um ihre Schönheit beneidet habe.“ Da sahen die Isenburger zwei Mädchen, die sich in den Armen lagen.
Doch in den nächsten Tagen hatte Pfarrer Blasius viel Arbeit in seinem Beichtstuhl. Auch der Pastor der evangelischen Stadtkirche, der die Reumütigen in seiner Studierstube empfing, weil er keinen Beichtstuhl hatte. Die vermissten Isenburger tauchten auf, wie sie verschwunden waren. Sie lagen wieder in ihrem Bett, rackerten in den Ställen, hobelten an der Werkbank, standen hinter dem Ladentisch, kamen vom Markt mit prall gefüllten Taschen heim. Unsichtbar hatten sie, die den anderen im Wege gestanden hatten, ihr Leben fortgeführt, ohne zu wissen, dass sie unsichtbar waren, als hätten sie in einem Traum gelebt. Sie rieben sich die Augen wie nach einem tiefen Schlaf. Es gab keine Vorwürfe, keine Feindseligkeit, kein Abbitten und Verzeihen. Ein neuer Zauber war über die Stadt gefallen, der Zauber des Vergessens, ein guter Zauber: er hilft den Menschen nach einem Streit, friedlich und liebevoll miteinander umzugehen.
Und die beiden Beichtväter waren Brunnen, auf deren tiefen Grund die vielen Geständnisse wie Steine plumpsten. Da konnten die Isenburger ganz ruhig sein. Natürlich machten sich alle, die zufällig niemand gehabt hatten, der ihnen im Wege stand, ihre Gedanken, wenn ein Nachbar nach längerer Abwesenheit wieder im Hause war. Hatte man nicht immer gewusst, dass die Frau des Bäckers lieber den Gesellen genommen hätte? Musste der Schneidermeister auch immer die Katze des Spenglers mit Steinen von seinem Fenster verjagen? Jetzt schmunzelten manche über den Lehrer, der während der Katastrophenmonate den Frieden in seiner Klasse ohne den Lümmel von der letzten Bank sicher sehr genossen hatte. Im Falle des geizigen, despotischen uralten Würstchenfabrikanten musste es ja wohl drei Geständnisse gegeben haben, denn in seiner Fabrik gab es drei Angestellte, die seine Söhne waren. Man machte sich so seine Gedanken. Doch niemand, wirklich niemand sprach sie aus. Wusste man denn, ob man dadurch nicht neues Unheil über Isenburg heraufbeschwören würde? Mit Schaudern dachten die Isenburger an die Möglichkeit, dass einem von ihnen der Dompfarrer Blasius hätte im Wege gestanden haben können (vielleicht der Pastor, dessen Stadtkirche immer viel leerer war als der Dom? ), nicht auszudenken, welche Folgen sein Verschwinden für die leidgeprüfte Stadt gehabt hätte.
Als aus allen bösen Wünschen fromme geworden waren und alle leeren Plätze in der Gemeinschaft der Isenburger wieder aufgefüllt waren, rief der Pfarrer Blasius noch einen Unbekannten auf, endlich sein Geständnis abzulegen. Anna Fiola, ein siebzehnjähriges Mädchen von stadtberühmtem Liebreiz, war verschwunden geblieben. Es war Annas Mutter zum Pfarrer gegangen und hatte gestanden, das Mädchen in einer Zorneswallung, hervorgerufen durch ständige Unordnung, verwünscht zu haben. Anna Fiola blieb verschwunden. Annas heimlicher Verlobter gestand unter Tränen, aus Eifersucht einen grässlichen Fluch gegen seine Liebste gesprochen zu haben. Anna Fiola blieb verschwunden. Es meldeten sich Neunmalkluge, die Geständnisse erfanden, um das schöne Mädchen zu erlösen. Es half nichts. Anna Fiola blieb unsichtbar. Nach einem Jahr, als alle Hoffnung auf eine Rückkehr Annas aus dem Reich der Unsichtbaren geschwunden war, schufen die Isenburger ihr ein Denkmal, das sie auf einen Brunnen stellten. Helle Quellen sprudelten zu Anna Fiolas Füßen. Auch Pitt hat aus ihnen getrunken und erlebt, was ihm, dem ungläubigen Fremden, die alten Isenburger gesagt hatten, dass es nämlich aus dem Sprudeln und Murmeln des Brunnens wie ein Weinen klinge.
Zu der Zeit, als Pitt aus dem Brunnen trank, war aus Isenburg eine Stadt von fünfzigtausend Einwohnern geworden. Die Hauptstraße musste verbreitert werden, und die Kreuzung, die der Anna-Fiola-Brunnen schmückte, sollte mehr Raum gewinnen. Das Stadtplanungsamt hörte sich ratlos und mit größtem Missfallen die Proteste der alten Isenburger gegen die Verlegung des Brunnens an. Immer diese alten Geschichten! Eines Morgens war Anna Fiola von ihrem Brunnen verschwunden. Hatte das Amt die Figur heimlich, bei Nacht und Nebel, abtransportiert, um endlich mit den Straßenbauarbeiten beginnen zu können?
Es kam zu einer Demonstration vor dem Brunnen. Die alten Isenburger waren empört und erregt und riefen nach dem Bürgermeister. „Ich habe schon oft“, sprach der Bürgermeister zu der aufgebrachten Menge, „die Anna Fiola zum Kuckuck gewünscht, aber den Brunnen haben wir nicht angefasst.“ Der Bürgermeister war als ein ehrlicher Mann bekannt, und man glaubte ihm. Allmählich leerte sich der Platz vor dem Brunnen, dessen Quellen versiegt waren. Niemand beachtete das Mädchen, das verwundert und ängstlich in die Runde sah, und wer es sah, der kannte es nicht. Noch am späten Abend stand das Mädchen am Brunnenrand und rührte sich nicht. Eine Polizeistreife forderte es bei Anbruch der Dunkelheit auf, nach Hause zu gehen. „Wo bin ich?“ fragte das Mädchen. Die Streife brachte das Mädchen zum Revier. Die Isenburger erfuhren – etwas verspätet auch aus dem „Isenburger Kurier“ – ,ein offenbar geistesverwirrtes Mädchen behaupte, Anna Fiola zu heißen, und die Isenburger, auch die alten, die ihren Brunnen so liebten, schüttelten den Kopf.
Das babylonische Ehepaar
Genau weiß man es nicht, in wie vielen Sprachen die Menschen der Welt miteinander sprechen. Sicher sind es sehr viel mehr, als es Länder gibt, denn in einem einzigen Land, zum Beispiel in Indien, werden viele Sprachen gesprochen, und jede Sprache wird in verschiedenen Gegenden eines Landes oft so unterschiedlich ausgesprochen, das man glauben könnte, in einer Sprache viele Sprachen zu hören. Wenn man aufmerksam hinhört, wird man erfahren, dass jeder Mensch seine eigene Sprache hat.
In Isenburg lernte Pitt ein altes Ehepaar kennen, von dem die Isenburger behaupteten, beide könnten in mindestens zwanzig Sprachen sprechen, vielleicht sogar mehr, so genau wusste man das in Isenburg nicht, denn das alte Paar brüstete sich mit seinen schier übermenschlichen Sprachkenntnissen nicht. Die Isenburger nannten die beiden sprachkundigen alten Leutchen das „babylonische Ehepaar“, und einige von ihnen haben Pitt die Geschichte dieser erstaunlichen Sprachmeisterschaft erzählt, in der isenburgischen Sprechweise, und – wie es nicht anders möglich ist – in verschiedenen Fassungen.
Die Frau war eine geborene Knüll, Charlotte Knüll, und der Mann ein geborener Amerikaner namens John Smith, der als Besatzungssoldat durch die Brille seiner Liebe zu Fräulein Charlotte Knüll das Städtchen Isenburg so bezaubernd gefunden hatte, dass er beschlossen hatte, mit seiner jungen Mr. Smith in Isenburg zu leben. Die Isenburger beobachten mit großem Staunen, wie schnell Mr. Smith die deutsche Sprache – in ihrer liebenswerten Isenburger Färbung – begriff und lernte. Im Laufe eines einzigen Jahres sprach er so gut Isenburgisch, dass man ihn für einen Isenburger halten konnte. Nur mit dem „Ü“ hatte er Schwierigkeiten, und es war gut, dass seine junge Frau nicht mehr „Nüll“, sondern Smith hieß.
Es war ganz allein das Verdienst von Charlotte Smith, ihren jungen Ehemann so rasch zu einem Isenburger gemacht zu haben. Die Isenburger sahen das Ehepaar durch die Straßen und die Felder und Wälder von Isenburg spazieren, und immerfort sah man den Zeigefinger der jungen Frau auf irgendwelche Gegenstände gerichtet, auf Häuser und Fenster und Dächer, auf Blumen, Pflanzen und Tiere, auf Bäume und Vögel und Beeren, und „Eiche, Eiche, Eiche“ hörten die Isenburger im Stadtwald aus dem Mund der jungen Frau, und „Eische, Eische, Eische“ hörten sie den Amerikaner sagen, der aber bald, auch das hörten die Isenburger, verstanden hatte, dass das „ch“ in Eiche, Buche und Charlotte anders ausgesprochen wird als das in „cheese“, das die Amerikaner – und jetzt auch die Deutschen – sagen, wenn sie beim Fotografen lächeln sollen.
Tag und Nacht – ja, sicher auch nachts – sprach Charlotte Smith ihrem Mann die Namen aller Dinge, allen Tuns, aller Eigenschaften und Gefühle in die Ohren, baute sie aus den bekannten Begriffen erst kurze und dann immer längere Sätze, und John Smith wiederholte alles, einmal, viele Male, und er küsste seine Charlotte nach jedem gelungen Satz auf den immer plappernden Mund, und als John Smith zum ersten Male völlig fehlerfrei das ch-reiche „Ich liebe dich, Charlotte“ sagen konnte, da war er in der deutschen Sprache schon so weit fortgeschritten, dass er sich mit den Isenburgern mühelos über das launischste Wetter unterhalten konnte.
Mr. Smith sprach nun immer fließender und gewählter Deutsch. Doch je mehr er sprach, desto stiller wurde Mrs. Smith. Es war merkwürdig. Sie sprach bald gar nicht mehr. „Der Amerikaner hat sprechen gelernt“, sagten die Isenburger kopfschüttelnd, „und dabei hat die Deutsche das Sprechen verlernt.“ Wenn das immer noch junge Ehepaar durch die Straßen, Felder und Wälder von Isenburg ging, dann sprach der Amerikaner in geradezu isenburgischer Schwatzhaftigkeit das Blaue vom Himmel herunter, und Charlotte ging stumm neben ihm her, als spräche er Chinesisch. Die Isenburger wunderten sich sehr.