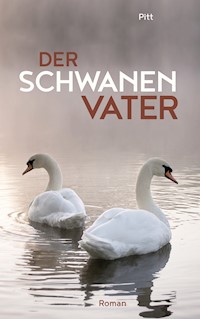Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Vier Brüder, geboren in den Jahren des so genannten Dritten Reichs, wachsen unter dem Bild des aus dem Krieg nicht heimgekehrten Vaters auf. Pitt erzählt, wie die Jungen als Kinder und Männer ihre Vaterlosigkeit erlebt haben, jeder auf seine individuelle Weise. Das Band zwischen den episodischen Erlebnissen ist der Versuch einer Philosophie der Familie. In seinem Kern steht der anschauliche Begriff des Elternleibes. Die Folgen seiner Zerstörung vor dem 17. Lebensjahr, dem Jahr der zweiten Geburt, werden in vielen Facetten beleuchtet. Mit zahlreichen Erfahrungen aus der Psychologie, der Anthropologie, der Belletristik und der Lebenswirklichkeit vieler Menschen reflektiert der Essay, was der Roman in spannenden Geschichten erzählt. Der Roman-Essay könnte auch den Titel tragen: Parzival im XX. Jahrhundert.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 375
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
Vaternamen
Im Blitzlicht
Mutterseelenallein
Vatersubstitute
Schutzmächte
Der Leihvater
Vaterspuren
Fürsorgliche Okkupanten
Verbündete
Die Jugend des Vaters, unerzählt
Privilegierter Parzival
Die Befragung
Das Vaterbuch
Die Schutzengel der Toten
Ein Brief an den Vater, citroënesk
Das Mutterkind
Am Herzschlag sterben Helden nicht
Vom Elternleib
Mutterraum, Vaterzeit
Parzivals prominente Brüder
Gurnemanz
Vaterbild, rekonstruktiv
Vatertraum, Traumvater
Parzival im Glück
Wanderungen zum Vater
Defizite
Am Mutterhaus
1Vaternamen
Als vier Brüder im Abstand weniger Jahre das Mutterhaus verließen, eignete sich jeder von ihnen in der Heimlichkeit einer fetischistisch anmutenden Begierde Gegenstände aus dem Besitz des lange toten Vaters an. Natürlich hätten sie die Mutter fragen können, ob sie die Objekte ihrer Faszination dem gemeinschaftlichen Erbe entziehen dürften, und sie hätte es ihnen nicht verwehrt. Doch Söhne fragen die Mutter nicht.
Der älteste Sohn, Willi, nahm den Fotoapparat des Vaters, die wegen eines schier irreparablen Schadens museal gewordene Voigtländer, und große Teile des familiären Fotoschatzes. Dieser Raub war jedoch legitimiert. Der Vater hatte den Erstgeborenen in den Jahren vor dem Krieg in unermüdlicher Begeisterung fotografiert, hatte einige Motive sogar im Hannoverschen Tageblatt, dessen Werbeleiter er war, veröffentlicht oder in Anzeigen für Küchen- und Gartenmöbel montiert. Der Zweitgeborene, systemisch nicht selten unter nachlassender Aufmerksamkeit leidend, erschien auf den Bildern oft nur als Begleiter des Kronprinzen. Der dritte und der vierte Sohn waren infolge der Kriegsabwesenheit des Vaters und seines Todes selten fotografiert worden, denn der Mutter stand in den Nöten und Wirren ihres zehnjährigen Krieges bis 1950 nicht der Sinn nach Fotografien.
Der zweite Sohn, Lambert, hatte eine in ockerfarbenes Leinen gehüllte, von einer goldschimmernden Kordel gebundene Mappe mit einem Dutzend Trennkartons in seinen Besitz genommen. „Arbeit“ stand in goldenen Lettern auf dem Titel. Dieses Sammelgefäß für Arbeitsproben, die für Bewerbungen in kreativen Berufen unentbehrlich sind, schien ihm für seinen Karriereweg als Grafiker, der ihm vorschwebte, nützlich zu sein.
Der dritte Sohn, Armin, hatte sich den Pelikanfüller hannoverschen Ursprungs – schwarz, gold, grün gestreift! – und Bücher aus dem nicht sehr üppigen Bestand des puttengeschmückten Bücherschranks des Vaters angeeignet. Auch er durfte sich in gewisser Weise dazu berechtigt fühlen, denn er galt in der Familie als ein geschickter Aufsatzschreiber und war Ghostwriter der Mutter für nervtötende Behördenkorrespondenz, die gerade in unvollständigen Familien bedrückend sein kann.
Der vierte Sohn, Rainer, der bis zum Tod der Mutter im Mutterhaus lebte, konnte frei über alle im Laufe der Zeit nutzlos gewordenen Schätze des Vaters verfügen. In seiner Wohnung fanden die Brüder nach seinem Tod den Rauchtisch aus dem Herrenzimmer, einen altertümlichen Zirkelkasten, der ihm in der Berufsschule gewiss ein brauchbarer Helfer gewesen ist, und eine Ikone aus der russisch-orthodoxen Glaubenswelt, die der Vater als blutjunger Kriegsfreiwilliger im ersten Krieg aus Weißrussland nach Hannover gebracht hatte. Das fromme Kunstwerk war für Rainer eine kompensatorische Aneignung, denn er war infolge der Kriegsturbulenzen als einziger der Brüder nicht getauft worden, hatte jedoch, wie seine brüderlichen Nachlasspfleger verwundert erfuhren, zeitlebens Kirchensteuer gezahlt.
Das größte Buch, das Armin dem väterlichen Bücherschrank als Dauerleihgabe entnommen hatte, war Meyers Konversationslexikon aus den großväterlichen Bildungsjahren des späten 19. Jahrhunderts, das kleinste war ein Taschenkalender auf das Jahr 1934. Das größte Buch hätte er ohne Gewissensnot nehmen dürfen, denn er hatte es stöbernd längst in Besitz genommen. Das kleinste dagegen hatte er gestohlen. Es gehörte dem Erstgeborenen, da gab es gar keinen Zweifel. Die Seiten des Kalenders waren nahezu leer. Ab Juni einige ärztliche Termine der Mutter, und am 13. Juli der Eintrag: „Wilhelm-August Peter geboren“. Keine Uhrzeit: offenbar war der Vater frei vom astrologischen Aberglauben. Der völlig unbefugte Sohn, der dritte, hatte sich das Büchlein angeeignet, weil er in der kraftvoll ornamentalen Schrift seines Vaters eine Vergegenwärtigung seiner glänzenden Persönlichkeit sah. Doch konnte das die Beraubung des ältesten Bruders rechtfertigen?
Dem Dieb wurde vom Bestohlenen verziehen. Armin schenkte seinem immer noch „großen“ Bruder zu seinem 80. Geburtstag den Kalender aus seinem Geburtsjahr, in dem der allerhöchste, der väterliche Standesbeamte seine Existenz und seinen Namen eigenhändig beglaubigt hatte. Die seit Jahrzehnten überfällige Rückgabe hatte er in eine Geburtstagsrede eingebaut. Und weil alle Laudationen nicht frei sind von halb taktlosen, halb unbedachten Indiskretionen, hat er ein Lebensgeheimnis eines Bruders offenbart.
Bruder Willi war nämlich mit dem Namen, den ihm sein Vater gegeben hatte, nie einverstanden gewesen. Der Vater hatte seinem Erstgeborenen – „Stammhalter“, sagte man in den voremanzipatorischen Zeiten – den eigenen Namen, Wilhelm, und den Namen seines Vaters, August, im Doppelpack gegeben (vielleicht auch als ein kleines Zugeständnis an seine Frau Anna, deren Vater der August Klostermeier war). Wilhelm-August: ein Graus. Jungen hießen Horst, Helmut, Günter, vielleicht noch Fritz. Und wenn schon Wilhelm, dann Willi oder eleganter: Willy. Auch der Vater Wilhelm hatte seinen Namen auf Willi verkürzt – nicht nur im familiären Gebrauch, sondern auch im beruflichen, gesellschaftlichen Umfeld, im Impressum von Zeitungen oder unter Artikeln, die er gelegentlich schrieb. Wilhelm-August wollte Willi heißen, und so kannte, so nannte man ihn, auch in seiner großen Familie bis zu den Urenkeln.
Es war ja zwangsläufig der Höhepunkt der kleinen Rede, dieses Kalenderblatt vom 13. Juli 1934 in seiner dokumentarischen Präzision zu verlesen. Ein schlagender Beweis wurde geliefert: Seht her, dieser Jubilar, dieser jugendlich-spannkräftige, weißbärtige Mann, glaubt’s oder glaubt’s nicht, ist wirklich einer des Jahrgangs 34, hier halte ich die Geburtsurkunde in meiner Hand, und sie wurde tatsächlich vor achtzig Jahren ausgestellt. Von seinem Vater.
Wilhelm in der strengen, Willi in der verkleinernden Form – in Wahrheit ein August! Wie der Reiterkönig Ernst August vor dem Hauptbahnhof, unter dessen Schwanz sich Generationen von Hannoveranern gern verabredeten. Die Enthüllung des Namensgeheimnisses wirkte erheiternd auf alle, und ein Siebenjähriger sagte: „Oma Renate, das hättest du mir doch sagen müssen, dass Opa Willi in Wirklichkeit August heißt.“
Für ein zweites Heiterkeitsecho hatte der Redner allerdings unehrerbietig tief in die Anekdotenkiste gegriffen. Der kleine Bruder enthüllte, dass der große, der Respektsbruder, in seiner Kindheit „Bübi“ genannt wurde. Der Patriarch Bübi! Erst der siebzehnjährige Willi hatte den Brüdern das Versprechen abgerungen oder abgezwungen, ihm gegenüber, dem Chef des Hauses, auf die Niedlichkeitsform ein für Allemal zu verzichten. Die Mutter hatte sich jedoch geweigert, die vom Vater kolorierte Kinderfotografie des schelmisch dreinblickenden Bübi nach seinem Auszug aus dem Mutterhaus von der Wand des Schlafzimmers, in dem schließlich alle Jungen schliefen, zu entfernen. Wer hatte den schon verkleinerten Namen Willi noch einmal in die Koseform verkleinert? Die Mutter? Der Vater selbst?
Eine einzige Schublade im Schreibtisch des Vaters war, gesichert durch ein stilwidriges kleines Vorhängeschloss, ewig verschlossen. Wahrscheinlich hat jeder der Jungen schon einmal nach dem Schlüssel gesucht, um herauszufinden, was sich in ihr verbarg. „Das geht euch nichts an“, war die wiederkehrende Reaktion der Mutter gegenüber den Neugierigen. In der Mutterlade, so vermuteten die Brüder, würde die Mutter die kostbaren Erinnerungen an ihren Mann aufbewahren, sicher die Briefe der lange Verlobten in den zwanziger Jahren oder die Kriegsbriefe. Papiere, die das Regiment des Alltags betrafen, gehörten wohl nicht zum Inhalt der Lade. Die Rentenausweise zum Beispiel, die farbigen Wachstuchkärtchen, mit denen die Witwe Anna Peter für sich und ihre Kinder die Sozial- und Versorgungsrenten vom Postamt im alten Dorf abholte, existenzwichtige Dokumente also, wurden im Kleiderschrank und in der Kommode unter Wäschestapeln versteckt, auch im bauchigen Büffet in der Stube, und zu jedem Ultimo wiederholte sich die hastige, von wachsender Panik begleitete Suche nach den Rentenausweisen zwischen Laken, Tischdecken und Geschirrstapeln, wobei oft genug der Spürsinn der Jungen zur Hilfe kommen musste, damit die kargen Subsistenzmittel der Familie pünktlich fließen konnten.
In den siebziger Jahren verließ auch die Mutter das Mutterhaus in der Saldernstraße, in dem sie über vierzig Jahre gelebt hatte. Die Doppelhaushälfte am Rande der Stadt war nicht ihr Eigentum gewesen, sondern von dem jungen Ehepaar Mitte der dreißiger Jahre gemietet worden, und als die Eigentümer nach dem Krieg als Vertriebene aus Pommern in ihr Haus zurückkehrten, zogen sie in die Räume im Erdgeschoss und die Peters in das Obergeschoss, nachdem das Wohnungsamt beiden Parteien noch Räume für Dritte genommen hatte. Die älter gewordene Witwe entschloss sich erst schweren, dann leichten Herzens, eine kleine komfortablere Wohnung am Laatzener Leinezentrum zu beziehen, wo ihr eine hilfreiche Infrastruktur, auch mit dem dankbar genossenen Unterhaltungswert des belebt-turbulenten Einkaufszentrums, buchstäblich zu Füßen lag.
Der Schreibtisch, ein dunkel gebeiztes Nussbaumungetüm, fand in der neuen Wohnung keinen Platz, und auch die Pietät der Söhne gegenüber der Aura des väterlichen Arbeitsplatzes, der einmal ein Fundament des familiären Wohlstandes gewesen war, erwies sich als zu schwach, um ihm eine neue Heimstatt in einer ihrer Wohnungen zu sichern. „Wo ist der Schlüssel?“ Der Schreibtisch stand, leergeräumt, bereit zum Abtransport zu irgendeinem Schredder (landete aber doch in Rainers Kellerwerkstatt), das Ladenarkanum war immer noch unangetastet. Der Schlüssel war verschwunden. Einfach aufbrechen? „Lohnt sich nicht“, sagte die Mutter, „die Schublade ist leer.“
Ja, es waren Briefe in der Lade aufbewahrt worden, auch Zettelbotschaften, die vom Vater auf allen möglichen Möbelstücken deponiert worden waren, ehe er morgens das Haus verließ, mit Sprüchen und Witzchen, die die Hausfrau bei ihrer Arbeit überraschen und amüsieren sollten. Nicht im Kanonenofen, der noch bis in die frühen sechziger Jahre in der Stube stand, hatte das Autodafé stattgefunden, eine schäbige Tonne der Stadtreinigung hatte eines Tages den vollgestopften Beutel verschluckt. Sollten die Söhne fragen: warum? Warum die Briefe des Vaters vernichtet, die doch ein Spurenzeugnis seines Lebens hätten sein können? Die Mutter ließ die Frage gar nicht zu: „Die Briefe gehen keinen etwas an!“
Als Lambert – zwei Jahre nach der Mutter – starb, 1988, kam einer der väterlichen Schätze, nämlich die Mappe mit den väterlichen Arbeitsproben, in Armins Besitz. Das faszinierende Prunkstück in der Arbeitsmappe war die Ausgabe einer Modezeitschrift vom Oktober 1927, einer Zeitschrift im Werden, eine Null-Nummer, zwar mit Titel, doch noch ohne Titelfoto und ohne den Ausdruck des Preises. Der weiche grobkörnige Entwurfskarton des Titels hatte einen Goldgrund, auf dem hell das leere, von weißen Schmuckornamenten umrahmte Geviert für ein Titelbild lag, und den Heft rücken zierte – verblüffend atypisch selbst für ein Modemagazin – eine aus schwarzen und goldenen Fäden geflochtene Kordel.
Eine überwältigende Überraschung, eine frappierende, beim Aufklappen der goldenen Einbandpappe: Auf ihren Innenseiten, den Spiegeln, floss in schwarzer Tinte die prägnante Handschrift des Vaters, die Armin schon im Taschenkalender bewundert hatte. Der Vater, sechsundzwanzig Jahre alt, hatte das Magazin in einen zweiseitigen Brief an seine Verlobte, an sein „Mädel“, gebunden. Ein gleichsam versteckter Brief, im Grunde eine lange Widmung, hatte sich eine Überlebensnische gesichert, ein einziger Brief, geschrieben am 10. September 1927, hatte sich dem Bestreben seiner Adressatin widersetzt, alle Zeugnisse erlebter Intimität und zärtlicher Neigung fremden Blicken ein für Allemal zu entziehen.
Lambert hatte durch seinen Diebstahl den größten Schatz gerettet, doch er hatte ihn verborgen wie ein Kunstliebhaber, der ein Gemälde aus einer Galerie stehlen lässt, um es in der Stille seines Tresors zu genießen. Armin war zornig auf ihn: er musste fünfzig Jahre alt werden, um das wichtigste Lebenszeugnis seines Vaters zu Gesicht zu bekommen. Natürlich: auch der Bruder Willi hatte ja Grund, zornig auf ihn zu sein, der ein schriftliches Zeugnis seiner Existenz, mehr noch: einen Beleg für seine begeistert begrüßte Aufnahme in Leben, Familie und Welt in Jahrzehnten vor ihm verborgen hatte.
Ein Dokument, das Armin selbst aus eigenem Recht besaß, konnte das persönliche, das handschriftliche Zeugnis nicht ersetzen: ein Telegramm, das der freundliche Nachbar, der Fliesenlegermeister Willy Kurlbaum, am Tag der Geburt, die eine Hausgeburt war, am Erntedanktag des Jahres 1939 an die Weddigen-Jugendherberge in Wilhelmshaven geschickt hatte, wo der Obermatrose Willi Peter seit vier Wochen für seinen Einsatz im gerade begonnenen Krieg ausgebildet wurde, ein Telegramm aus wenigen Worten: „Armin ist da. Mutter und Kind wohlauf.“
Darf Pitt die immer fragwürdige Generalerlaubnis der künstlerischen Freiheit nutzen, den Brief eines Vaters, den einzigen überlieferten, literarisch auszubeuten, gegen das strenge Verbot seiner Witwe, das doch durch ihr grausames Vernichtungswerk ins Unumstößliche gesteigert worden war?
Aus Andeutungen der Mutter wussten die Brüder, wie sehr sie als junge Frau gelitten hatte unter der langwierigen Abwesenheit ihres Verlobten, der im fernen Berlin an der Null-Nummer seines Magazins, die eine berufliche Bewährungsprobe war, werkelte. Muss Pitt den Satz unterdrücken, der doch im Zusammensein vieler junger, durch Zwänge schwieriger Zeitläufte getrennter Paare sein universales Gewicht hat
„ daß Du und Deine Liebe es waren, die mir genug Energie und Schaffensfreudigkeit gaben, die mir vielleicht sonst gefehlt, um das vorliegende Werk anerkannt erfolgreich zu vollenden.“ Muss das Liebesversprechen, das erst nach vier Jahren zu einer Ehe führen konnte – „Hab Dank, Liebes! Immer bin ich Dein!“ – vor fremden Augen verborgen werden, wo dieses Immer und Ewig doch nur fünfzehn weitere Jahre dauern konnte? Oder die Widmung am Schluss des Briefes, geschrieben mit spitzer Skriptolfeder auf dem goldenen Pappspiegel, „als Ausdruck der tiefsten Verehrung, Liebe und Dankbarkeit von mir – Deinem Bub.“
Wenn der Vater der „Bub“ ist, ist der erstgeborene Sohn das „Bübchen“. Hat der Vater „Bübchen“ gesagt? Tat es die Mutter? Die Brüder sagten „Bübi“, was eher wie „Bübbi“ klang. Älter werdend, haben sie manchmal an den „Buben“ gedacht, keinen Kose-, sondern einen Streitnamen, in dem die leidige Erfahrung mitschwingt, dass ein großer Bruder manchmal tyrannisch fordernd und in seiner Despotie sprichwörtlich „böse“ sein kann.
Pitt vermutet, dass Willi in der hartnäckigen Unterdrückung seines offiziellen Namens, in der beharrlichen Umwandlung seines Taufnamens in eine griffig-informelle Verkleinerungsform eine Annäherung an den Namen des Vaters gesucht hat. Das Bübchen ist auf einer höheren späteren Ebene im Willi wieder auferstanden.
Armin hätte auch gern auf einen Kosenamen gehört, war aber schon froh, dass seine Mutter ihm versicherte, der Vater habe seinen Namen nicht dem Fundus der zeitgenössischen völkischen Mythen entnommen – dem Standesbeamten Piontek in Arno Surminskis Roman Vaterland ohne Väter galt er als der germanischste Name, den er gern für eine Halbwaise eingetragen hätte, wenn sie ein Junge gewesen wäre. Um den Namen ganz sicher abzuschirmen gegen den antiwestlichen Giftgeist, den Feinde der Weimarer Republik in Zeitschriften wie „Arminius“ verspritzten, hatte Armin beschlossen, seinen Namen als ein Anagramm von Marine, die der Vater geliebt hatte, zu betrachten.
2Im Blitzlicht
Armin hatte seine älteren Brüder immer um ihre Erinnerungen an die leibhaftige Erscheinung des Vaters beneidet. Lambert, der drei Jahre alt war, als der Vater eingezogen wurde, und knapp fünf, als er starb, brüstete sich, vom Vater einmal verhauen worden zu sein (hatte aber einen Klaps, wie die Mutter meinte, aufgebauscht). Willi präsentierte ein Arsenal von Erinnerungen, deren Glanzstück die Beerdigung des Vaters auf dem Stöckener Ehrenfriedhof im frühen März 1942 war: Soldaten hätten mit ihren Gewehren in die Luft geschossen, und eine Kapelle sei mit klingendem Spiel abgezogen (dass sie das Lied vom lustigen Hannoveraner intoniert hätte, glaubte Armin ihm nicht). Da der Vater das von Gottfried Benn melancholisch beschriebene Unglück hatte, nicht im Sommer zu sterben, wenn alles hell ist und die Erde für Spaten leicht, sondern in einem verspäteten bitterkalten Winter, musste sein Grab in den Boden gesprengt und die gefrorenen fragmentarischen Schollen über dem Zinksarg geradezu gestapelt werden, und als die unvollständige Familie das Grab zum ersten Mal besuchte, hatten die Jungen das Grün des Grabschmucks in die Hohlräume gestopft, um das ein strömende Tauwasser daran zu hindern, den Vater in der Tiefe zu überfluten.
Nicht einmal zweieinhalb Jahre alt war Armin, als der Vater starb – und wie oft hatte er ihn schon gesehen? Oder bewusst wahrgenommen: einmal, zweimal? Er fand nicht die leiseste Spur eines Eindrucks in seinem episodischen Gedächtnis, das ja persönliche Erlebnisse und konnotierte Gefühle aufbewahren soll. Die hirnlichen Schaltzentralen Hippocampus und Amygdala, deren Zusammenspiel manchem Menschen ein frühes, ein lückenloses oder fotografisches Erinnerungsvermögen schenkt, hatte Mnemosyne, die Mutter der Musen, für ihn nicht zu bedienen gewusst. Auch die später in der Schule Anstoß erregende Linkshändigkeit, die ja angeblich die rechte Hirnhälfte als den Speicherplatz für autobiografische Informationen weitet, half ihm nicht auf den Weg ins frühe Ich. Waltraut, Armins Frau, ist eine Favoritin Mnemosynes: Nach über fünfzigjähriger Abwesenheit konnte sie in Kiel, in dem die Zweieinhalbjährige an der Hand ihres Kapitänvaters spazieren gegangen war, die Haustür der Wohnung am Probsteier Platz wiedererkennen und mit nachtwandlerischer Sicherheit eine Treppe finden, auf der sie mit dem Vater zu einem tiefer gelegenen Stadtteil hinabgetippelt war.
Die Häufung und wachsende Massivität der Bombenangriffe auf Hannover ließen auch den grünen Vorort Kirchrode nicht ohne eindrucksmächtige Treffer, die in ihrer Bedrohung existentiell einprägsam waren. Armin meint sich erinnern zu können, dass seine Brüder ihm den in der Ferne brennend einstürzenden Turm der Marktkirche zeigten, und auch der metallische Leib der nicht gezündeten Bombe, die sich hart an der Wand des Nachbarhauses in die Erde gebohrt hatte und bei einer Explosion wohl das Doppelhaus wegge rissen hätte, haftet in seiner Erinnerung, wie auch das unter Druckwellen und Granatsplittern geborstene Dach und die mit Pappe vernagelten Fenster, und auch der klagende nächtliche Ruf eines Bekannten der Familie auf der Straße vor dem Haus: „Unser Haus ist kaputt!“ hat noch ein Echo in seinem Ohr.
Zu Armins 75. Geburtstag revanchierte sich Willi für seinen Geburtskalender mit einem Familienfoto: die Mutter, Rainer auf dem Schoß, die drei Brüder, stehend hinter ihnen Christa, die schon zehnjährige Tochter eines Nachbarn, die im Team mit ihrem Vater am Heiligen Abend als Christkind erschien. Armin kannte das Bild. Er hatte es früher flüchtig betrachtet: Er ist nie ein Augenmensch gewesen, immer nur ein Stimmen- und Wortmerker, und er würde die Haufen der Fotos, die sich in einem Leben ansammeln, nicht in den Koffer mit der lebensnotwendigen Habe packen. Jetzt, am 75. Geburtstag, betrachtet er das Foto so aufmerksam, wie Willi sein Geschenk, den Kalender, betrachtet hatte.
Willi hatte das Bild zum Aufhängen rahmen lassen, Armin wollte es jedoch gern aufstellen, und so rahmte er es neu. Er sah die Rückseite des Fotos, und es traf ihn der Blitz. Er hatte ihn schon einmal getroffen.
Ein Blitz – was Wunder – war die stärkste Erinnerung an seine frühe Kindheit. Das Blitzlicht hatte mit seiner Helle den Raum und sein Gesichtsfeld erfüllt, er glaubt, den brennenden Schlag des Lichts noch auf seiner Haut zu spüren. Er konnte sich erinnern, dass der Blitz von einer Stehlampe ausgegangen war, die immer im Herrenzimmer gestanden hatte – und Pitt hat später recherchiert, dass die Fotografen früher ihren Magnesiumblitz durch einen elektrischen Impuls an einer Lampe zündeten. Ein zischender, ein rauchender, ein splitternder Blitz: So liegt er als Erinnerung auf Armins Sinnen. Da die Familie bis 1945, bis in sein 6. Lebensjahr, noch im Erdgeschoss des Mutterhauses lebte, dessen verlassenes Herrenzimmer in eine Stube verwandelt worden war, hatte Armin immer gedacht, Christas Vater oder der Großvater oder Willi mit Hilfe eines Selbstauslösers hätten – Weihnachten, an einem Geburtstag – eine Blitzlichtaufnahme gemacht und das unauslöschliche, fast traumatische Erinnerungsbild in seinem limbischen System deponiert.
Auf der nie gesehenen Rückseite des Bildes im Postkartenformat die kraftvolle, in breiten Pelikanstrichen fließende Hand schrift des Vaters: „Schönste Stunden während unseres so ‚inhaltsreichen‘ längsten Urlaubs Weihnachten 1941. Mit vielen Grüßen u. Küssen von Euerm Vati! 9. II. 42.“ Der Vater war am 18. Februar, neun Tage nach diesem Datum, gestorben. Wenn er das Foto auf den langen Feldpostwegen nach Hause geschickt hat, ist es dort zusammen mit der Todesnachricht eingetroffen.
In der Mitte des Bildes steht Armin, noch nicht zweieinhalb Jahre alt, zu seiner Rechten sitzen Willi und Lambert, lachend, zur Linken die Mutter mit dem Kleinkind Rainer auf dem Schoß, er steht unter den langen Zöpfen Christas, die seinen Nacken zu kitzeln scheinen. In allen Augen die Lichtpunkte des Blitzes. Armin hat den Kopf – er sitzt so unförmig groß auf den schmalen Schultern, unter denen sich Hosenträger kreuzen – in den Nacken gehoben, seine Augen schielen leicht, der Mund ist wie zu einem „Ah“ geöffnet. Das Gesicht verrät Staunen und Überraschung und Schrecken. Es ist auf die Quelle des blitzhaften Lichts gerichtet. Und hinter der blendenden Helle des Lichts, in der Aura des explodierenden Blitzes, ein Schatten, eine erahnte Kontur: der Fotograf. Der Vater. Armin hat doch eine Erinnerung an die Nähe des Vaters. Er hat sie durch sein Leben getragen im Bild eines Blitzes. Da war der Vater, ganz nah bei ihm, im Licht. Der Urheber des Blitzes. Pitt fügt hinzu: sein Zeus, der Blitzeschleuderer.
Als das Mutterhaus in Kirchrode aufgelöst wurde, erbat Armin sich von der Mutter einen gerahmten Spruch, der unverrückbar an der Wand des Treppenflurs gehangen hatte. Armin hat Pitt den Spruch für die schönste seiner Isenburger Parabeln, die vom Glückskäfer handelt, geschenkt. Die Skriptolfeder des Vaters hat die Verse in gotischen Minuskeln, doch modernen Großbuchstaben geschrieben, auf ein Blatt, das wie ein Holzfurnier anmutet:
Wer stets dasselbe will und immer nur dasselbe, Der bricht vom Himmel das Gewölbe. Dem müssen selbst die Engel sich verneigen Und rufen: komm und nimm, du nimmst dein Eigen!
Das junge Paar hatte in den ersten beiden Ehejahren in der Wohnung der Großmutter Peter, unweit der Goseriede, gewohnt. Immer noch lebten von den sechs Schwestern des Vaters drei in der großen Wohnung der verwitweten Mutter. Es hatte Reibereien und familiäres Mobbing gegeben, die Frau des einzigen Bruders, der in der großen Wirtschaftskrise von seinem Gehalt die Familie unterstützen musste, war nicht sehr willkommen gewesen. Anna Peter hatte nur einen Wunsch: die eigene Wohnung. Und als sie sie endlich gewonnen hatte, eine kleine in einem Neubau an der Tiefenriede in der Südstadt, hatte ihr Mann als Einzugsgeschenk sein kleines grafisches Kunstwerk geschaffen. Die Götter, die Laren, hatten sich vor ihrem Willen verneigt. Die Rückseite ist sorgfältig verklebt, und kein Staubkorn ist in Jahrzehnten unter dem Glas sichtbar geworden. Wie oft hat Armin vor dem Bild mit dem Brieföffner gespielt: Sollte er das Klebeband aufschlitzen? Aber es gehört zum Kunstwerk wie der Talgbalg zur Beuys’schen Badewanne. Er vermutet, dass auf der Rückseite des Bildes die Handschrift des Vaters zutage treten wird wie die Schrift auf Dokumenten, die in den Grundstein eines Hauses eingelassen sind. Eines Tages – vielleicht in zehn Jahren – wird er der archäologischen Versuchung nicht widerstehen können: Er erwartet wieder eine Überraschung.
In den Fotoalben und auf den Bildschirmen von Millionen von Familien diese Bilder: Mütter und Kinder, und der Vater, der fotografiert, fehlt. Der Vater ist für einen kreativen Moment aus dem Bild getreten. Das Bild, das Armin an seinem 75. Geburtstag betrachtete, hatte schon diese Eindeutigkeit: Der Vater wird nie wieder in das Bild treten. Er wird immer fehlen. Was fehlt?
Vielleicht ist es besser, das Bild von einem beschreiben zu lassen, der in einer heilen Familie aufgewachsen ist. Philip Roth, dessen Vater in manchen seiner Romane präsent ist, konnte in seinem Leben als Sohn von einer Beziehung zum Vater bis zu dessen 90. Jahr erzählen. Er ist hochkompetent in der Analyse einer schier lebenslänglichen Vater-Sohn-Symbiose mit allen ihren wechselseitigen Forderungen, ihrer wechselseitigen Förderung, ihren Spannungen und Erfüllungen, ihren Konflikten. Der Künstler, der Spezialist für das Ganze, ist am fähigsten, das Fragmentarische zu erkennen, das, was fehlt. Im Roman Die Tatsachen, den Philip Roth eine Autobiografie nennt, sagt er, er sei aufgewachsen in der Vorstellung, dass ein Vater unzerstörbar war. Und er sprach dabei nicht von einer platonischen Vorstellung, keiner Schopenhauerischen Unzerstörbarkeit unseres Wesens an sich, sondern von seiner kindlichen Überzeugung, der Vater würde physisch-geistig dauerhaft in seinem Leben präsent bleiben. Muss ein Vaterloser sich nicht wenigstens ein unzerstörbares Bild des Vaters erschaffen?
Ich kannte nur zwei Jungen in unserer Nachbarschaft, deren Familien vaterlos waren, und sie schienen mir nicht weniger versehrt zu sein als das blinde Mädchen, das eine Zeit lang auf unsere Schule ging und dem man vorlesen und das man überall behüten musste. Die vaterlosen Jungen schienen fast ebenso gezeichnet und isoliert zu sein; der Tod ihrer Väter bewirkte, dass auch sie mir erschreckend und ein wenig tabu vorkamen. Hier ist das Kind in Philip Roth, im Autor, fasziniert von einer Ausnahmeerscheinung. Wenn die Vaterlosigkeit ein Millionenschicksal ist wie in und nach den großen Kriegen, darf man die Dramatik des Befundes, dass einer ein Junge mit einem toten Vater war, nicht so stark, wie Philip Roth es in der Erinnerung an seine Newarker Familienwelt tat, steigern. Ein Schrecken erregendes Kontrastbild der heilen Familie ist die unvollständige nicht.
Heute, am 24. April 2016, ist ein amerikanischer Präsident in der Messestadt Hannover, und mit europäischen Regierungschefs berät er im Herrenhäuser Schloss, das viele Jahrzehnte von der Oberfläche des grandiosen Gartens verschwunden war.
Präsident Barack Obama sah im Alter von 34 Jahren in den Dreams from my Father (bei uns: Ein amerikanischer Traum) auch das durch die Abwesenheit des Vaters verursachte Sehnsuchtsleiden – sind Träume wirklich etwas anderes? – als einen bestimmenden Faktor seines Bildungsweges. Er hat das Phänomen der Vaterlosigkeit auf den Punkt gebracht: Es gab nur ein Problem: Mein Vater war nicht da.
Doch was fehlte ihm? Ist er nicht ein vor Selbstgewissheit und ansteckender Stärke strotzender Kandidat und Präsident geworden? Sein Gegenkandidat, John McCain, hat ebenfalls ein Buch mit einer Beschwörung der väterlichen Welt geschrieben. Faith of my Fathers, und in ihm die überlebensgroßen Vorbildfiguren des Vaters und des Großvaters, beide Admiräle der Kriegsmarine, vor Augen geführt. Hat in Obama nicht der Vaterlose über den, der von Vätern inspiriert, gefordert, gefördert und erzogen worden war, den Sieg davon getragen? Wer ist denn mit diesem sieghaft-ansteckenden, trutzig-trotzig auffordernden Slogan Yes, we can! in den Wahlkampf gezogen? Das war doch einer, der nicht das gelernt hatte, was nach Dieter Thomäs moderner Heldengeschichte, seinem Buch Väter, die Söhne von ihren Vätern lernen sollen: nämlich das Können und das Wollen. Der Kandidat Obama hat sein Ziel ohne den väterlichen Lebenshelfer (Thomä) erreicht. Er ist zwar nicht in die Geschichte als der vaterlose Parzival, der den Gral errang, eingegangen, wie es ja auch bei uns in Deutschland dem Parzival Gerhard Schröder in erbitterter Rivalität zum Parzival Oskar Lafontaine nicht gelungen ist. Doch wer sagt denn, dass nicht der abwesende Vater Obama der Lebenshelfer gewesen ist, der den Sohn Obama das große Wollen gelehrt hat? Vaterentbehrung als verbreitetes präsidiales Leiden: Auch Nicolas Sarkozy, eine Scheidungswaise mit ihrem etwas peinlichen Vater Pal, soll nach einem Bericht der Frankfurter Allgemeinen gesagt haben: „Außer einem Vater fehlte mir nichts.“
Ist es natürlich oder grenzt es an eine traumatische Entbehrung, wenn Maarten ’t Hart (in seinem Vater-Sohn-Roman Der Flieger) einen Mann über seinen vor einem Vierteljahrhundert gestorbenen Vater sagen lässt: Und gleich danach wurde mir bewusst, dass in all den Jahren kein Tag vergangen war, an dem ich nicht an ihn gedacht hatte. An den toten Vater denken, bei vielen Gelegenheiten, die Tag für Tag an Väterliches erinnern, ernsthaft konzentriert, assoziativ flüchtig, in fiktiven Gesprächen, bei einer Lektüre, im Traum: nur Fehlendes kann die Phantasie so intensiv beschäftigen. Aber in dem vom Zufall geschnürten Ränzel für den Lebenskampf fehlt immer vieles. Warum über das Defizit des Väterlichen reflektieren?
In seinem Dokumentarfilm Söhne ohne Väter hat Andreas Fischer 2007 mit acht Interviewpartnern – darunter der Intendant Peter Voß, der Historiker Jürgen Reuleke und der Psychotherapeut Hartmut Radebold, Professoren alle – über die Sehnsucht nach dem nie gekannten Vater gesprochen, über einen Verlust, den nahezu jedes dritte zwischen 1933 und 1945 geborene deutsche Kind erfahren hat, – und Kinder weltweit in unterschiedlichen statistischen Relationen. Nüchterne, vom Lebenserfolg verwöhnte Männer von 60 und 65 Jahren können auch durch herzhaftes Räuspern nicht die Tränen wegpressen, die über ihre Stimmbänder kullern.
In ihrem Buch Söhne ohne Väter sprechen Hermann Schulz, Hartmut Radebold und Jürgen Reulecke vom vaterlosen als von einem amputierten Leben: Pitt findet das übertrieben, doch vom Phänomen einer oft nicht eingestandenen lebenslangen Trauer, die Sehnsüchte auslöst, werden viele der von den Autoren befragten Parzivals aus der Kriegsgeneration heimgesucht.
Kein Mensch ist das Urbild seiner Fotografie. Der schöpferische Moment des Ablichtens schafft Lichtbilder, in denen der fotografierte Mensch verwandelt wird. Die Petersöhne wuchsen auf unter einem großformatigen Bild des Vaters – rechts unter ihm eine Messingvase, an deren Nagel das Eiserne Kreuz 2. Klasse hing. Die Mutter hatte es aus einem der letzten militärischen Gruppenfotos – die Individualität der Gesichter verschwunden in der vielreihigen blauen Mauer der Marineuniformen und tiefsitzenden Mützen – herauslösen und vergrößern lassen. Es war ein lächelndes Gesicht in einem schwebenden Lichtweiß, das von der dunklen Uniform und der Unteroffiziersmütze betont wurde. Andere Fotos aus früherer Zeit zeigten einen anderen Vater: Sie verrieten in ihrem Schwarzweiß nicht, ob sein Haar blond oder brünett, seine Augen blau oder grau waren. In unveränderter Freundlichkeit, in ewig lächelnder Nachsicht blickte der Vater auf das Leben in der Stube, die nach dem Krieg eng geworden war.
Dem Bild des Vaters hing ein Foto der Mutter gegenüber, der jungen, noch kinderlosen Frau. Der Vater hatte – ein früher Arnulf Rainer – das leicht zur Seite gewandte schmale Gesicht in der gleichmacherischen Frisur der zwanziger Jahre durch eine ornamentale Rahmung mittels seiner Skriptolfeder zeitlos gemacht. Von den Bildern, deren Blicke sich in unaufhebbarer Neigung über dem großen Ausziehtisch, an dem sich das Leben im Alltag und an Feiertagen, bei den Schularbeiten und beim Basteln, beim Essen und beim Mensch-ärgeredich-nicht abspielte, begegneten, blieb das eine Urbild alterslos, das andere alterte (und ähnelte im Greisenalter der alten britischen Königin Elisabeth II.).
Das den Raum beherrschende Bild des Vaters an der Wand, das die große Fehlstelle verdecken sollte, hatte eine familienpolitisch eminent wichtige Funktion. Die Jungen der Witwe Peter – wie energisch die Mutter ihr „Wwe“ hinter ihre Unterschrift setzte, wie einen akademischen Grad! – standen ja als Halbwaisen unter amtlicher Vormundschaft. Vormundschaft bedeutet Kontrolle, und die nahte manchmal in Gestalt streng blickender Damen in eng geschnittenen grauen Kostümen, die in die Schränke guckten oder mit dem nach Staub fahndenden Zeigefinger über die Schrankkanten fuhren – eine Kontrolle, die die Mutter vor Zorn erbleichen ließ und die nicht selten zu einer bedrohlich anmutenden Herzbeklemmung führte.
Auch Philip Roth hatte bei den Vaterlosen schon beobachtet, dass der eine ein Vorbild an Folgsamkeit und der andere ein Unruhestifter war, und diese Anlage gab es, in wechselnden Rollen, auch bei den Peterjungen. An kaum einem Bubenstreich oder einem Vergehen jugendlicher Straßengangs in Kirchrode – wieviel Kinder in den Vierteln tobten! – war nicht wenigstens einer der Vier aus der Saldernstraße beteiligt, als Rädelsführer oder Mitläufer. Dann erschien manchmal eine der Damen mit den strengen Blicken, um mit der Mutter über eine grässliche und hässliche pädagogische Alternative zu diskutieren, nämlich über das nahegelegene Stephansstift, eine Anstalt für Schwererziehbare – mit der übrigens auch die Mutter gelegentlich drohte, wenn sie sich mit ihrem erzieherischen Latein am Ende wähnte. Das war eine Drohung, die wenig verfing: Die Brüder sahen zwar die unerziehbaren Jungs auf den Gemüsefeldern der Umgebung, wie sie nach Unkraut robbten und von ihren Aufsehern ziemlich brutal in den Rücken („Arsch“, sagten die Jungen) getreten wurden, doch Lambert war Zeuge gewesen, als die Mutter einen der sadistischen Aufseher auf den Äckern an der Langen Feldstraße in einer vehementen Attacke beschimpft hatte.
Ja, die Brüder haben es erlebt: Wenn die Dame mit dem harten Lächeln (manchmal kam auch ein leutseliger Herr) das blumengeschmückte Bild des Vaters in seiner dominanten lichten Größe an der Wand sah, wurden die Blicke weicher. Ja, wo der tote Vater so geehrt wurde, hat die vaterlose Kinderwelt noch ihre Ordnung, hat die Mutter sozusagen eine pädagogische Hilfe, die symbolische „feste Hand“, deren Fehlen in solchen sozialpädagogischen Gesprächen nicht selten vermisst wurde. Dieses Haus war kein Haus ohne Hüter, wie Heinrich Böll einen seiner schönsten Romane genannt hat, in dessen Heldinnen Bundeskanzler Gerhard Schröder unsere Tanten und Mütter erkannt hat, wie er anlässlich der Vorstellung einer neuen Böll-Ausgabe 2002 in Köln gesagt hat.
3Mutterseelenallein
Was reden wir von Vaterlosigkeit?
Anna Peter hat mit ihren Söhnen nie darüber gesprochen, was es für sie bedeutete, im Alter von 37 Jahren mit vier Kindern – ein halbes Jahr, zwei, fünf und acht Jahre alt – allein dazustehen in einer Zeit, in der sie nicht pessimistisch gestimmt sein musste, um in eine düstere Zukunft zu sehen.
Über den Tag der Todesnachricht hat sie einmal gesprochen. Anfang 1942 hatte das Massensterben an den Fronten ja noch gar nicht recht begonnen, die Toten waren noch nicht in der Anonymität des Massengrabs versunken, Todesnachrichten wurden noch individuell formuliert, noch nicht durch Stempelaufdrucke auf den zurückkommenden unzustellbaren Feldpostbriefen übermittelt. Für den schlimmsten Fall hatte Willi Peter, der umsichtige Schreibstubenunteroffizier, einem Kameraden und seinem Kompaniechef, einem Arzt, die Adresse seines Schwagers Arthur Lincke, der an der Christuskirche seinen bedeutenden Nähmaschinen-, Fahrrad- und Motorradhandel betrieb, gegeben. Als die Witwe, bügelnd am Fenster zur Straße stehend, ihren Schwippschwager – an einem Werktag, nachmittags – am Gartenzaun zaudernd auf ihre Fenster blicken sah, „da habe ich alles gewusst“. Auf eine innere Stimme musste sie sich nicht berufen, denn im Krieg sind alle Frauen gegenüber der persönlichen Katastrophe ahnungsvoll.
Vier Kinder, Krieg. Die Witwe war skeptisch hinsichtlich des tröstenden Versprechens ihres wohlhabenden und wohlwollenden Schwagers, die Familie nach Kräften unterstützen zu wollen (er starb am Kriegsende, und der Wohlstand war zerbombt), skeptisch gegenüber den Beteuerungen des Ortsgruppenleiters der NSDAP, der Führer sei der Vater aller Waisen und werde sich nach dem Sieg um alle kümmern (er schickte sie am Ende selbst noch in den Krieg), skeptisch gegenüber ihrer eigenen Stärke, mit der Aufgabe, die in vielen, vielen Jahren vor ihr liegen würde, fertig werden zu können. Sie hatte in den schwersten Wochen Unterstützung im Haus: Ihre Mutter, die resolute, in ihrer Wortkargheit weise und schweigend zupackende Luise Klostermeier kam zu ihr, und sie hatte auch eine Gehilfin und junge Gefährtin, erst die Lehrerstochter Erika aus Bemerode und dann das Arbeiterkind Erika aus Linden, junge Frauen, die ihr Pflichtjahr in einem kinderreichen Haushalt absolvierten und sich tatsächlich auf Kinder verstanden (künftige Lehrerinnen und Kinderheimchefinnen waren sie).
Haben die Söhne über die Frage nachgedacht: Was ist in der Mutter vorgegangen, als sie erfuhr, der Mann werde nie zurückkehren von seiner Fahrt an seine Front mit der Fotografie seiner Familie im Gepäck? Wie muss die Wucht des Gedankens sie niedergedrückt haben: Ich bin mit vier Kindern allein. Waren die Söhne beschämt davon, wie gedankenlos sie über die Stunde des Erschreckens, in der das Leben aus den Gleisen sprang, hinweggegangen waren, viele Jahre lang? Haben sie es nicht für selbstverständlich gehalten, ja für alternativlos lebensklug, die Mutter habe ihr Alleinsein und die Alleinverantwortung für ihre Kinder akzeptiert, klaglos und ohne Furcht? Und was bedeutete der Verlust des geliebten Mannes?
Der Tod des Vaters war für die Kinder kein Ereignis auf dem Zeitstrahl, war ein Geschehen außerhalb aller Zeit. Für die Mutter war die Katastrophe der unaufhebbaren Trennung eine langwährende Gegenwart. Als Armin im Herbst 1945 eingeschult wurde, war der Vater für ihn seit einer Ewigkeit tot, im Geist der Mutter lebte er und ging an ihrer Seite, das Kind zwischen ihnen, seinen ersten Gang zur Schule; als Willi 1948 konfirmiert wurde, war der Vater gerade sechs Jahre tot. Wie kurz kommt uns die Zeitstrecke vor, die wir in zehn, fünfzehn, ja zwanzig Jahren zurückgelegt haben: Alles ist ein Gestern, das nahe am Heute liegt. Was für die erwachsenen Söhne nicht einmal Geschichte war, nämlich die Existenz eines leibhaftigen Vaters, war für die Mutter Gegenwart oder ein Gestern, das sich dem Heute nicht entwunden hat.
Willi erzählt: Beim Singen des Weihnachtsliedes, in dem den Kindern die Freude verheißen wird, die der Vater im Himmel ihnen mache, sei Lambert wild schluchzend vor die Krippe gelaufen und habe gerufen: „Ich will nicht, dass der Vater im Himmel ist!“ Pitt hat ihn nicht gefragt, wie die Mutter darauf reagiert habe.
Erst spät, durch berufliche Erfahrungen belehrt, haben die Jungen sich klar gemacht, wie unendlich schwer Entscheidungen in der Verantwortung für andere sind, wenn einer sie allein treffen muss – mutterseelenallein zumal. Die Managerin eines Familienunternehmens, über dem jeden Tag buchstäblich das Dach oder gleich der Himmel einstürzen könnte: allein, ohne Vorstandskollegen, ohne Aufsichtsrat, ohne Berater. Sie gehörte nicht einer entscheidungsfreudigen, emanzipiert unabhängigen Frauengeneration an, sie hatte ihrem Mann die dem Haushalt vorgelagerten administrativen Funktionen überlassen, war gewiss nicht die robuste Seele (Walt Whitman), die in vitalem Selbstbewusstsein entscheidungsmutig ist. Sie hatte – eine Tochter Lindens, in denen die Tuch- und Samtweber zu Hause waren – nach der Volksschule und der Lehre als Stoffverkäuferin im Kaufhaus Sternheim gearbeitet, und als der zierlichen jungen Frau das Hantieren mit den Stoffballen zu viel wurde, hatte sie sich in Volkshochschul- und Abendkursen zur Stenotypistin ausbilden lassen. Nichts, aber auch nichts – außer der Schule der eigenen Mutter – hatte sie vorbereitet auf ihren Familien beruf. Als Armin sie, spät, viel zu spät, danach fragte, woher sie Kraft und Klugheit genommen habe, souverän ihr Manage ment („Chefin“ nannte Erika sie) zu meistern, sagte sie nur: „Es musste eben gehen.“ Doch eine Ahnung von ihrer permanenten Überforderung in finanzieller Enge hatten die Söhne schon.
Souverän? Dann wäre es leichter gewesen. In Grenzsituationen – schier aussichtslosen Manövern am Rande des pekuniären Bankrotts, in Auseinandersetzungen mit ihren oft so harthörigen Söhnen, im defensiven Kampf um fundamentale familiäre Interessen – rebellierten Körper und Seele gleichzeitig gegen die Überbürdung. Die Jungen kannten die Symptome. Die Mutter sank mit dem Oberkörper zurück in den Sessel, ihre Hände kneteten fahrig seine Lehnen, die Lippen verfielen in ein mikroskopisch rasendes Zittern, der Körper war von einer Starre befallen, der Atem schien nur noch nach innen zu strömen. Ein Glas Wasser, ein Streicheln von Kopf und Wange genügten, um die Mutter aus dem psychosomatischen Alarm an der Grenze der Belastbarkeit zurückzurufen. Nicht selten mussten sich die Jungen, immer schuldbewusst, immer ratlos, auf diese hilflose Weise als Sanitäter betätigen. In den Hungerjahren mussten Furunkel, die den Körper übersäten, in strapaziösen ambulanten Operationen in der Praxis Dr. von Cöllns geschnitten werden. „Wir essen das Fleisch und sie die Knochen“, hatten Lambert und Armin in einem illustrierten Gedicht zum Muttertag geschrieben.
In ihrer Kindheit und frühen Adoleszenz sahen die Söhne die Mutter nur in ihrer ernsten, konzentriert strengen Erscheinung, die noch Jahre nach dem Krieg in Trauer getönt zu sein schien: Schwarzgraue Kittel mit dünnen weißen Punkten, Kopftücher (wenn sie so bunt wie bei den jungen Türkinnen gewesen wären!), das streng gescheitelte dunkle Haar, in das sich früh Silberdrähte flochten, rahmte ein schneeiges schmal-hartes Gesicht. Ihr Wesen war das nicht: Ihre Lust zu fabulieren, ihre Lachbereitschaft, ihr Geselligkeitstalent brachen sich erst Bahn, als mit den Söhnen die Sorgen aus dem Haus verschwanden. Sie hatte einen Zufluchtsort, den sie häufig aufsuchte: die Bücher. Überaus wählerisch war sie vor den Borden der Leihbücherei am Großen Hillen nicht, und sie freute sich auch auf die Ankunft des Mannes mit dem Kastenfahrrad, der die Illustrierten des Lesezirkels brachte.
Die Witwen oft nachgesagte Neigung, in ihren Söhnen den verlorenen Mann zu finden, war Anna Peter fremd. Ihre Söhne hatten nie das Gefühl, die Mutter wolle Dank und Liebe einfordern. Ihre Söhne haben in ihren Freundeskreisen manche dieser einseitig klammernden Mutter-Sohn-Beziehungen beobachten können, und sie fand das so belustigend, dass Umgangsverbote über sie verhängt wurden. Oder waren die Brüder dem Muttersohn-Komplex nur deshalb entgangen, weil sie sich in ihrer Vierer-Phalanx erfolgreich gegen ihn wehren konnten? Nein, die Mutter war froh, die Jungen aus dem Nest werfen zu können, und sie war unglücklich darüber, dass es ihr bei ihrem Jüngsten nicht gelungen war, trotz der Lebenshilfe, die sie durch ihn erfuhr.
„Mutterseelenallein“ – gewiss eine Überzeichnung. Der tägliche Lebenskampf unvollständiger Familien war eingebettet in eine von biblisch-christlicher Tradition geforderte Solidarität mit den sprichwörtlichen „Witwen und Waisen“. Im Alten Testament sind die Witwen und Waisen eine hilfsbedürftige und die am stärksten von Ausbeutung bedrohte Gruppe des Volkes Israel. Gott sprach zu Moses, nachdem er ihm die zehn Gebote übereignet hatte: Ihr sollt keine Witwen und Waisen bedrängen. Wirst du sie bedrängen, so werden sie zu mir schreien, und ich werde ihr Schreien erhören (2.22.21/22). Und der Prophet Jesaja fordert, den Waisen Recht zu schaffen und der Witwe Sache zu führen (1.17). Jeremia (22.3) fordert, nicht die Witwen und Waisen zu schinden, und nennt sie in einem Atemzug mit den Fremdlingen (so hatte sie ja auch Philip Roth gesehen). Das sind wohl universale Gebote, die auf die Unentbehrlichkeit des Vaters deuten, der noch nicht durch wohlfahrtsstaatliche Institutionen und Gesetze ersetzt ist.
Die Witwe Peter fand viele Kümmerer in ihrer familiären Sorge. Jeder Name ein kleines Denkmal für soziale Paten neben den vielen Denkmälern, die den gefallenen Soldaten – und neuerdings auch den Deserteuren – gewidmet sind.
Schon der Pastor Gerhard Dietrich von der evangelisch-lutherischen St. Jacobi-Gemeinde – die Kirchröder haben einen Weg an seiner Kirche nach ihm benannt – hat anstandslos den Trauergottesdienst auf dem Stöckener Friedhof gehalten, für den Ex-Katholiken Willi Peter, der die familiäre kirchliche Traditionslinie rigoros durchtrennt hatte. Strittig immer wieder, ob man Kriegern in Kirchen gedenken solle, doch das Gedenkblatt, das in St. Jacobi bis heute im Totenkalender aufgeschlagen wird, bedeutet auch, dass eine Gemeinde die Witwen und Waisen unter ihren Schutz stellt.
Der Staat hat nach dem Krieg Versorgungsgesetze erlassen, die den Witwen und Waisen ihre Lebenschancen, bis hin zum Studium, sichern. Wahre christliche Hauswirte waren Heinrich und Emma Drewes und später ihr Sohn Herbert und seine Familie. Drei Familien lebten nach dem Kriege in einem für eine einzige Familie gebauten Haus zusammen, darunter die der Witwe Peter mit ihren vier wilden Knaben, die in Streitlust und Temperament wenig Rücksicht auf das Ruhebedürfnis der betagten Hauseigentümer nahmen („So seid doch ruhig,“ rief die Mutter, „das ganze Haus bratzt ja zusammen!“). Wie stoisch war der alte Herr, wie verständnisvoll. Wie oft zog er die Jungen ins Gespräch, erkundigte sich nach Interessen, Lektüre und schulischen Dingen, ermutigte, regte an. Wer sich der spannungsvollen, oft tragisch konfliktreichen Beziehungen zwischen den in engen Häusern zusammengepferchten Eingesessenen, Ausgebombten und Vertriebenen erinnert, wird die Hochherzigkeit des Hauswirts in der Saldernstraße Nr. 24 zu würdigen wissen. Langmut und Verständnis – nie wurde die Witwe bedrängt. Als Pitt für seine Recherchen das Haus am Wendehammer besichtigte, fand er an der Pforte noch immer das Messingschild „A. Peter“ (Armins Schwägerin Renate hat es anlässlich des Umbaus dieses Hauses durch neue Eigentümer abmontiert und ihm geschenkt).
Der Nachbar Willy Kurlbaum, der Fliesenlegermeister, machte für die Witwe aus dem Luftschutzkeller eine rotweiß geflieste Küche. Seine Kunst konnte nicht verhindern, dass im Frühjahr, nicht nur 1946, das Grundwasser knöcheltief in ihr stand. Der Bäckermeister Ludewig, der Kolonialwarenhändler Lohe, der Milchmann Hilpert, der weißrussische Schuster Wassilewski in der Gartenkolonie Hahnenburg – sie halfen, wo’s ging, mit Improvisation, mit kleinen, das Zuteilungsmaximum übersteigenden Extras, mit Gefälligkeiten, mit dem Anschreiben, wenn das Portemonnaie leer und der Monat noch nicht voll war. Das sind ein paar Namen nur aus der nichtorganisierten Schar der Lebenshelfer, die der mosaischen und moralischen Gebote nicht bedürfen. Einen Namen haben Willi und Armin vergessen: den des Mannes mit dem Wäschekoffer, der immer ein Sonderangebot für die Witwe und die Waisen in seinem fabelhaften Bauchladen hatte.
Und es wurde von Männern und Frauen der Familie viel praktische Hilfe zur Selbsthilfe geleistet, eine Überlebenshilfe in der Ruinenlandschaft. Es fanden sich Helfer, die das zerstörte Dach des Hauses deckten, die Ziegel dazu besorgten, den unter Bombengetöse eingestürzten Schornstein auf dem Dachboden richteten und die Fenster mit Pappe vernagelten, sie fanden sich beim Holzraub und Stubbenroden in der nahe gelegenen Seelhorst. Auch das illegale Schlachten des im Treppenverschlag gemästeten Schweins war nicht ohne die sachkundige Hand eines Metzgers und eines Trichinenbeschauers zu bewältigen. Die Zentner der Zuckerrüben und die Saftpresse, die man zur Produktion von Sirup braucht, wurden in die Waschküche neben den Kupferkessel gestellt. Das Abflussrohr der Jauchegrube wurde erneuert. Die Kellertür wurde mit Eisenstangen gegen marodierende Plünderer verbarrikadiert. Sogar die nach langer Knechtung befreiten Zwangsarbeiter, denen die Besatzungsmacht Plündertage gewährt hatte, stellten vor Anna Peters Haus eine Schutzwache, weil sie ihnen einmal erlaubt hatte, vom Feld über den Gartenzaun zu klettern und sich am Pflaumenbaum gütlich zu tun. Wenn Anna Peter mit ihrer jungen Hausgenossin, der Irmgard Freihold, am Feldweg zwischen den Feldern des Ritterguts Bemerode beim Ausbuddeln einiger Kartoffelstauden von einer britischen Streife erwischt wurde, genügte das Losungswort „a widow with four little children“, um die Wächter in Komplizen zu verwandeln. Eines der children, der elfjährige Willi, zog schon mit den Plünderern los, die wie Piraten die auf den Kanälen um Hannover liegenden Frachtschiffe mit ihren Lebensmittelbäuchen und die Kohlenzüge der Umgehungsbahn enterten. Annas Vater, August Klostermeier, verließ oft seinen Kleingarten im Lindener Fössefeld, um sich im größeren Hausgarten Annas der Vorratsprobleme des „Mäkens“ anzunehmen, und half ihr im Handwerklichen, auch beim Schlachten der Kaninchen.
Annas solidarische Hilfe war auch gefragt. In ihr Haus war ein ausgebombtes älteres Ehepaar eingewiesen worden. Der Bomben- und Feuerschock hatte beide versehrt: Der verwirrte Mann verunsicherte das Haus, und nach der ebenso verwirrten Frau, die oft unterwegs war, um ihre Habe zu retten, musste sie oft in Kirchrode fahnden. Edgar, der kleine Sohn der neuen Hausgenossin Freihold, schloss sich ihr an, ein Vaterloser mehr, denn sein Vater kehrte erst Anfang der 50er Jahre aus russischer Gefangenschaft heim. Haus mit sorgenreicher Hüterin.
An Solidarität gegenüber den „Witwen und Waisen“ fehlte es nicht. Offenbar bestärken die Gebote der Religionsstifter tief verwurzelte Haltungen der Stammesmenschen: Die Angehörigen der im Beute- und Kriegszug umgekommenen Kampfgenossen müssen mitversorgt werden – als wär’s ein Stück von mir. Dieser Impuls der Gemeinschaft, um mit den schönen Begriffen des von Pitt geliebten Ferdinand Tönnies zu reden, ist auch in der modernen Gesellschaft mit ihrer auf sozialen Ausgleich bedachten Sozial- und Wohlfahrtspolitik lebendig.