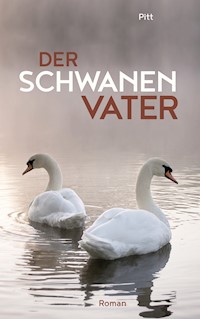Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Der Kapitän und Reeder will für seinen Sohn und Erben eine erstklassige seemännische Ausbildung. Der Kadett des Segelschulschiffs „Pamir“ kehrt nicht zurück. Der Vater zweifelt und hadert. War der Weg seines Sohnes richtig? Hat er seinen Sohn sorgfältig beraten? Er und sein Lebenswerk zerbrechen am Verlust und an diesen Fragen. Der Kadett ist als Schüler auf dem Schiff seines Vaters gefahren und hat eine ausgezeichnete illustrierte Reportage über seine Reise geschrieben. Sie vermittelt ihm einen der begehrten Plätze unter den Segeln des Schulschiffs. Er ist ein begeisterter Kadett. Doch es gibt nicht nur bei der Mutter Zweifel, ob diese Reise wirklich der Beginn eines Lebensberufs gewesen wäre.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 483
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
Der Auftrag
Die Nachricht
Orkan
Lichtsignale
Tagundnachtgleiche
Überleben
Die Bilder
Die Nachfolge
Klaus-D. Thorborgs „Reise auf einem ‚Kümo‘“
Die Tante in Buenos Aires
Vertrauen
Novemberreise
Verschollen
Remember – September
Der Sonne am nächsten
Das Seefahrtbuch
Gorch Fock
Lieber leicht lieber Mercedes
„Falsches Manöver im Nebel“
Meister und Lehrlinge
Traum, Tod
Die Schiffe, die für einige von ihnen Leben und Tod bedeuteten.
Und über die Toten zu schreiben,
ist auch ein Spiel, das schwer ist
von dem, was einst kommt.
Aus dem Gedicht „Der vergessene Kapitän“
von Tomas Tranströmer
Der Auftrag
Als Kapitän Heinrich Thorborg am 21. September 1957, an einem Sonnabend, nach der ersten Meldung der Seenot des Segelschulschiffes „Pamir“ aus einer Sitzung beim Verband der Küstenschiffer in seinem Auto nach Hause gerast war, hoffend, mit seiner Frau Frida und seiner Tochter Waltraut vor den Funknachrichten sprechen zu können, als er mit fragwürdigem Erfolg versucht hatte, seine Damen durch Sorglosigkeit über den Ernst der Nachricht zu täuschen, als er aus dem Haus getreten war, um seinen Wagen in die Garage zu bugsieren, hörte Waltraut ihn in seinem Selbstgespräch murmeln: „Wenn der Junge nicht wiederkommt, das überleb’ ich nicht“.
Das Haus in Farmsen birgt viele Spuren des Kapitäns und des Kadetten Klaus-Diedrich Thorborg, der es am 1. Juni 1957 im Alter von achtzehn Jahren verlassen hatte, um mit der stolzen „Pamir“ auf die Reise nach Südamerika zu gehen. Der kleine Wintergarten, dem die Eichentäfelung von Wand und Fensterlaibung die Anmutung einer Kajüte gibt, ist erhalten. Bewahrt ist das Ensemble von Erinnerungen, so die Bilder der Schiffe, auf denen der Kapitän fuhr und die er als Reeder besaß, das Ölporträt des Kadetten in der Uniform, die er auf seiner ersten und letzten Reise trug, ein von einem Tampen überspanntes hölzernes Kreuz, gezimmert aus den Trümmern eines Rettungsbootes, die Fotografie der Gedenktafel in der Turmhalle der Katharinenkirche. Es vergegenwärtigt das kurze Leben von Vater und Sohn.
Pitt, dem Jahrgang des Kadetten angehörend, hat nur dank seines Alters die Kompetenz, die Geschichte des Kapitäns und des Kadetten zu erzählen. Den Auftrag musste er sich selber geben.
„Herzinfarkt“ hatte der Arzt, der am 20. August 1958 in das Haus des Kapitäns gerufen worden war, in die Todesbescheinigung geschrieben. Ein Infarkt in der Morgenstunde, 7 Uhr, sagt der Schein, der auch bekundet, dass dem tödlichen Schock als ursächliche Krankheit „funktionelle Herzbeschwerden“ vorausgegangen waren, wohl die diffusen Beschwerden, die den Kapitän wenige Tage vor seinem Tod auf Drängen seiner Frau bewogen hatten, einen Kardiologen aufzusuchen, der ihn nach den üblichen Untersuchungen ohne Befund in sein Haus zurückgeschickt hatte, zur Beruhigung Fridas, die vor einer Kurreise nach Bad Sobernheim stand, auch Waltrauts, die in ihrem Urlaub auf dem Küstenmotorschiff „Waltraud Thorborg“, dessen Patin sie war, von Gent nach Finnland reisen wollte.
Am Beginn des neuen Jahrhunderts beschrieb die medizinische Wissenschaft, auf eine wachsende Zahl von Fällen gestützt, eine Krankheit, die sich deutlich von einem Herzinfarkt unterscheidet: das Broken-Heart-Syndrom. Da es zu den Auffälligkeiten dieses Krankheitsbildes gehört, dass sich die linke Herzkammer aufbläht, fühlten sich Ärzte an das Bild einer japanischen Tintenfischfalle in Form eines Kruges mit kurzem Hals erinnert und fanden so den Namen für die Krankheit: Tako Tsubo.
Eine Überaktivität des autonomen Nervensystems, so vermutet man, führe in plötzlichen Stresssituationen, in existentiellen Krisen oder Verlusten oder dramatischen Lebenswenden zu Verkrampfungen der Herzkranzgefäße, die Schmerzen verursachen, doch nur in seltenen das Herz „brechen“ lassen.
Heinrich Thorborg ist elf Monate nach dem Tod seines Sohns Klaus-Diedrich – in der Familie Dieter genannt – im Alter von 49 Jahren gestorben. Lässt sich das Broken-Heart-Syndrom auch auf einen Prozess zurückführen, auf ein serielles Schockerleben im zerstörerischen Zusammenspiel von Herz und Hirn bis zum tödlichen Krampf? Die Reflexion des schockhaften Grunderlebnisses irritiert in blitzhaften Erinnerungen, Erkenntnissen und Zweifeln das Herz und lässt es nach und nach erstarren.
Heutige Kardiologen mit ihrer Bild- und Laborpräzision hätten den Vater eines der „Pamir“-Opfer, der schon einmal eine Ohnmacht erlebt hatte und über Brustbeklemmungen klagte, vielleicht von Monitoren überwachen lassen. Dem Angebot eines Psychologen, eine erkannte Bedrückung in Gesprächen abzufedern, hätte sich Kapitän Thorborg gewiss verschlossen.
Aber war er nicht ein infarktgefährdeter Charakter? Der Bewegungsradius des Kapitäns eines Küstenmotorschiffes von etwa vierzig Metern Länge und sieben Breite ist begrenzt. Berühmt waren Hein Torboorchs gesellige Runden mit Schiffsmaklern, Ausrüstern, Zollbeamten, befreundeten Hafenlotsen, Verbandskollegen in der Kapitänskajüte nach dem Einlaufen seines Schiffes in Hamburg, in Amsterdam oder Åbo oder all den kleineren und größeren Häfen an den Küsten des Kontinents und Englands, in denen kräftig geraucht, getrunken, gegessen wurde, das Herz des Kapitäns war unaufhörlich mit dem Takt der Maschinen und aller ihrer Irritationen synchronisiert. Und sagt man nicht auch: autoritäre Persönlichkeiten – das war der Kapitän sicherlich – trügen ein höheres Infarktrisiko? Seine Statur war klein und massiv: als sich der Kapitän auf großer Fahrt auf Drängen seiner jungen Frau vor dem Krieg, noch nicht dreißig Jahre alt, nach einem ungeliebten Landjob umsehen musste und in Husum als Zollschifferdiätar beim Oberfinanzpräsidenten Nordmark anheuerte, wurde bei der amtsärztlichen Körpervermessung ein gesundheitlich nicht unbedenkliches Gewicht ermittelt.
Am 1. Oktober 1957 erschien im „Hamburger Abendblatt“, wie in anderen Zeitungen, die halbseitige Anzeige der Stiftung Pamir und Passat mit den Namen der achtzig Jungen und Männer, die mit dem Segelschulschiff auf See geblieben sind. Unter dieser Anzeige hatte die Gewerkschaft Öffentliche Dienste, Transport und Verkehr (heute gehört sie zu ver.di) für ihr Mitglied, den Kapitän der „Pamir“ Johannes Diebitsch, einen Nachruf geschaltet. Pitt ist überzeugt, dass der Name des Kapitäns Heinrich Thorborg auch zu der großen Namenstafel gehört, in die Nachbarschaft des Mannes, der sein Schiff nicht nach Hause geführt hat.
Den Zusammenhang zwischen dem Tod des Kadetten und dem des Kapitäns hat auch Seemannspastor Harald Kieseritzky, der im Gedenkgottesdienst für die Männer der „Pamir“ am 8. Dezember 1957 in der Katharinenkirche einer der beiden Liturgen war, gesehen. In seiner Gedächtnisrede am Sarg des Kapitäns, mit dem er oft über den „verborgenen Glauben“ gesprochen hatte, zuletzt wenige Wochen vor seinem Tod, sagte er über Heinrich Thorborg, der sich um die Gesundheit seiner Frau gesorgt hatte: „Er verschwieg seine ihn zermürbende Erschütterung aus dem Leid um seinen Jungen.“ Er habe ein „Zwiegespräch der verklärten Gemeinsamkeit“ mit seinem Sohn geführt.
Die Nachricht
Es war ein einziger Gedanke, der Heinrich Thorborg auf dem Weg zu seiner Frau bewegte: „Ich muss es sein, der es ihr sagt.“ Sagt, die „Pamir“ sei in Seenot. Als er in der Sitzung der Küstenschiffer die Augen der Kapitäne auf sich gerichtet sah, als sich der Unglaube, der sich auf seinem Gesicht gemalt hatte, auf allen Gesichtern zeichnete, war er ruhig aufgestanden und hatte Kapitän Breuer gefragt, ob er in seinem Büro telefonieren dürfe. Kapitän Breuer hatte die Sitzung unterbrochen und ihn zu seinem Büro begleitet, ihm angeboten, mit dem Reedereiverband zu telefonieren, um zu klären, ob dort bereits Nachrichten vorlägen. Heinrich Thorborg hatte abgewinkt. Auch den Gedanken, mit der Korrespondentreederei der Stiftung, Zerssen, vielleicht mit Kapitän Dominik, ihrem Inspektor, zu sprechen, hatte er sich verboten. Er konnte zu Hause telefonieren. Jetzt kam es darauf an, mit Frida über die Nachricht zu sprechen. Sie war allein zu Haus, Waltraut und ihre Freundin Gisela Roeske wollten im Orchideencafé in Planten un Blomen tanzen. Hatte Frida Radio gehört? Das tat sie selten. Auch nicht, wenn sie allein zu Hause war? War die Nachricht schon im Fernsehen gelaufen? „Ich muss es ihr sagen.“
Er ertappte sich zum zweiten Mal dabei, in das Rotlicht zu rasen. Sein Fuß, der auf dem Pedal lastete, schmerzte. Als er aus dem Haus der Küstenschifffahrt getreten war, fand er sich in einer solchen Verwirrung, dass er überlegen musste, an welcher Seite der Fischauktionshalle er seinen Rekord geparkt hatte, und während er unschlüssig auf dem Kopfsteinpflaster hin- und hergelaufen war, hatte er sich den Fuß vertreten. Er fuhr zu schnell. Er fuhr nicht schnell genug. Frida allein mit der Nachricht „Die Pamir ist in Seenot“. Aber konnte die „Tagesschau“ die Nachricht schon haben? In der letzten Woche, in der die „Waltraud Thorborg“ auf der Werft lag, hat er nicht einen einzigen Abend mit seiner Frau ferngesehen. Niemand hatte das Recht, Frida mit der nackten Nachricht zu überfallen. Es war seine Aufgabe, seine Pflicht, es war seine Verantwortung allein, Frida zu sagen: „Mach dir keine Sorgen, die Pamir ist ein tüchtiges Schiff und der Kapitän Diebitsch ist ein erfahrener Kapitän – der Sturm kann ihnen nichts anhaben.“ Und das SOS? Jedes Schiff, das sich in Seenot wähnt, ruft um Hilfe. Hatte Frida das nicht selber erlebt an Bord der „Dieter Waltraud“ vor drei Jahren, als die Welle im Sturm gebrochen war, im Ärmelkanal?
Das Liebste wäre ihm gewesen, die Korrespondentreederei hätte nur ihm, dem Vater, hätte alle Väter der Jungen über den Hilferuf der „Pamir“, der ja auf dem ganzen Atlantik zu hören gewesen war, exklusiv informiert, eine strenge, eine nur um den Preis höchster Strafen zu verletzende Nachrichtensperre wäre verhängt worden, so lange, bis die Reederei oder die Stiftung den Vätern sagen könnte: „Die Pamir macht wieder ruhige Fahrt.“ Oder? Oder: „Die Pamir ist gesunken“? Nein, bis es Klarheit über das Schicksal des Schiffes gäbe. Schicksal? Über Schäden an der „Pamir“. Es ist, verdammt noch mal, die Aufgabe des Vaters, seine Familie über ein Unglück, das sie bedrohen könnte, zu informieren, mit seinen Worten, mit seinen Erklärungen, mit seinen Tröstungen, und es ist tausendmal mehr die Aufgabe des Vaters, wenn der ein Kapitän ist. Ein Kapitän zu großer Fahrt. Was geht eine solche Nachricht die Leute an, wenn sie doch nicht helfen können! Funkstille, absolute Funkstille – nur die Meldungen für die Helfer, für die hilfsbereiten Kapitäne auf den Atlantik-Routen und die Mannschaften der Küstenwachen, von denen es viele geben wird. Dummes Wunschdenken! Nein, die Abendnachrichten wären voll von den Spekulationen über das Schicksal des Schulschiffes. Das würde die Phantasie der Menschen bewegen, selbst wenn es nur eine Havarie mit Mast- und Schotenbruch auf ruhiger See durchgemacht hätte.
Er war zornig auf sich, er hätte doch versuchen müssen, sich Informationen zu beschaffen. Radio Norddeich? – nach Funksprüchen fragen. Die würden, heute, einem besorgten Vater keine Auskünfte geben wollen. Wäre die Reederei Zerssen nicht schon besser informiert gewesen als Funk und Presse? Kapitän Dominik? Bei Zerssen hatte sich niemand gemeldet. Er war auch zornig, nicht einmal die Telefonnummer von Kapitän Dominik in der Tasche zu haben. SOS – wer würde sich äußern wollen in diesen Stunden? Einen Augenblick wünscht er sich, die Polizei könnte ihn auf der Hamburger Straße stoppen – die sind funkgewandt, die sind von Minute zu Minute darüber informiert, was in der Stadt geschieht, die hätte er fragen können. Natürlich wusste Frida Bescheid. SOS. Die „Pamir“ in Seenot. Ihr Vater, der Schneidermeister, der über das Segelabenteuer seines Enkels nicht begeistert ist, wird längst am Telefon gewesen sein. Warum hatte er nicht in Breuers Büro mit Frida gesprochen? Unmöglich. Wenn sie noch nichts vom Notruf erfahren hatte – am Telefon? Unmöglich. „Ich muss es ihr und Waltraut sagen“. Es war das Einverständnis des Vaters gewesen, das den Jungen auf das Schiff gebracht hat. Nein, mehr, sein Wunsch.
Als Tappi, der Bordhund, ihm in seiner schier lebensbedrohlichen Begeisterung entgegengekläfft war, wusste er, dass seine Frau auf das Klappen der Autotür gewartet hatte. Sie stand in der Haustür und wusste alles, wusste, was an diesem Abend alle wussten, die Radio gehört, die ferngesehen hatten. Kapitän Thorborg, der Vater des Jungmanns, war einer von Millionen, die von einer Nachricht beunruhigt waren, von der keiner wusste, was sie bedeutete. Wusste Frida schon mehr? Sie weinte. Ehe er bei ihr war – sollte er sie umarmen? –, sagte sie: „Heinz, die Pamir. Was ist mit Dieter?“ Es war ihm nicht möglich gewesen, in dieser Stunde das Recht des ersten Wortes zu behaupten. Er empfand das als beschämend, ja erniedrigend. Die Nachricht hätte nur ihm gehören dürfen, ihm allein. Er hätte die Ungewissheit, über Stunden, über Tage allein tragen müssen. Er war „der Alte“, so hatte ihn Dieter genannt, als er in seiner großartigen Schularbeit seine Reise mit dem Kümo des Vaters beschrieben hatte.
Heinrich erfuhr, dass Frida von ihrem Vater angerufen worden war. Sie hatte versucht, ihren Mann im Verband zu erreichen, doch in Kapitän Breuers Büro hatte sich an diesem späten Sonnabend niemand gemeldet. Auch kein Besetztzeichen. Mussten nicht im Büro des Verbandschefs alle Leitungen belegt sein? Haben die Schiffseigner ihre Zusammenkunft – ging es nicht wieder um die Ausbildung der Schiffsjungen? – schon beendet? Es sei doch nicht möglich, hatte sie gedacht, dass ihr Vater besser informiert sei als die Kapitäne mit ihren Verbindungen in alle Welt. Dass ihr Mann sie nicht anrief, konnte nur einen Grund haben: er wollte ihr die Nachricht, die sie fürchtete, persönlich bringen. „Frida, die Pamir ist gesunken. Ich weiß nicht, ob Dieter sich retten konnte.“ Sie hatte Waltraut im Orchideencafé ausrufen und ihr die Botschaft übermitteln lassen, nach Hause zu kommen. Waltraut hatte sich in der U-Bahn im Gespräch mit Gisela Sorgen um den Vater gemacht, der ihr in der letzten Zeit recht angespannt vorgekommen war.
Waltraut und Gisela fahndeten auf allen Wellen nach Nachrichten, doch alle hatten nur den einen Kern, den an der englischen Küste aufgefangenen Funkspruch des gegen einen Hurrikan kämpfenden Schiffes, sonst nichts, außer den Informationen über das Schiff und seine Besatzung, seine Reise.
Der Kapitän nahm die gerollte Seekarte, auf der er die Position der „Pamir“ nach den laufenden Meldungen der Reederei Zerssen markiert hatte, aus der Lade seines Schreibtisches und breitete sie auf dem Tisch im Wohnzimmer aus. „Die Azoren sind nicht weit. Viele, viele Schiffe fahren im Azorengebiet, das ist ein Kreuzungspunkt vieler Routen. Stürme dort sind nichts Besonderes, das sind die üblichen Stürme der Tagundnachtgleiche. Die können der Pamir nichts anhaben. Die Pamir droht zu sinken? Wer sagt das? Das hat sie auf ihren vielen Fahrten ums Kap Hoorn schon oft erlebt. Der vorsichtige Kapitän Diebitsch muss SOS funken lassen. Der ist ein bisschen ängstlich, das muss er ja auch sein. Wann hat der schon seinen letzten großen Sturm erlebt? Der geht auf Nummer sicher. Das würde ich auch tun, wenn ich Schlagseite hätte oder mir Segel weggeflogen oder ein Mast gebrochen wäre. Er will nicht allein sein im schweren Sturm, da muss er wohl ein bisschen dramatisieren.“
Wenn nicht die großen, rund kullernden dunklen Augen im Schimmer eines Tränenfilms gewesen wären, die flammende Röte des Halses, die sich übereinander verkeilenden Finger. Er hörte keine Frage. Er war Waltraut dankbar, die mit warmer unaufgeregter Stimme sagte: „Typisch Dieter. Der braucht sein Abenteuer.“
Die Fernsehbilder der „Pamir“ sind hundertmal gesehen. Sie ist nicht irgendein Schiff, sie ist das Schiff der Jungen. Väter und Mütter haben ihm und seinem Kapitän 51 Söhne anvertraut. Jeder kennt das Schiff unter den vollen Segeln, sieht das Bild der in den Wanten kletternden Jungen, das Schiff der Sehnsucht. Es gibt kein schöneres Bild als das eines Schiffes in der Pracht und Kraft seiner geblähten dreißig Segel, in denen sich die Elemente gebändigt ballen. So ein Schiff kann nicht sterben. Doch die Nachrichten sind bedrohlich. Das Schiff hat offenbar einen großen Teil seiner Segel verloren, in einem schweren Hurrikan, wie Kapitän Diebitsch funken ließ. Die Schlagseite ist bedrohlich, bei 45 Grad. Ist, war? Der Kapitän spricht von der Gefahr des Sinkens. Hat es Wasser genommen? Noch tobt der Hurrikan. Lag die „Pamir“ in seinem Zentrum? Die Engländer haben den Funkspruch bei Bristol aufgefangen, gegen 15 Uhr Ortszeit, erst fünfundzwanzig Minuten später ließ der Kapitän SOS senden. Was hat das zu bedeuten? War, im schlimmsten Fall, genug Zeit, die Rettungsboote und Flöße zu Wasser zu bringen?
Das Fernsehen bleibt eingeschaltet, auch der NDR. Vielleicht kommen bald Sondermeldungen. Kapitän Thorborg trägt die im Funkspruch gemeldete Position in die Seekarte ein, 35 Grad 57 Minuten nördlicher Breite und 40 Grad 20 Minuten westlicher Länge. Er sieht das Erschrecken in Fridas Augen, als er auf ihre Frage, wie weit dieser Punkt von den Azoren entfernt sei, sagen muss (ja, ihm fehlt die Kraft der Lüge): das seien wohl sechshundert Seemeilen. „Und Kilometer?“ Wohl tausend. „Von Hamburg nach München“, sagt Frida. Das Meer ist groß, ist zu groß. Wann können die ersten Schiffe bei der „Pamir“ sein? Um Mitternacht? Zwei amerikanische Frachter sollen mit Volldampf den Standort der „Pamir“ – warum sagt das Fernsehen „Unglücksstelle“? – ansteuern, von den Azoren aus soll der riesige Hochseeschlepper „Zwarte See“ unterwegs sein. Das schnellste Schiff ist so ein Schlepper nicht. Auf den Azoren sind Seenotrettungsflugzeuge gestartet: sie haben Gummiflöße an Bord – aber ist das nicht nur eine Hoffnung für ruhige Küstengewässer?
Das Sicherheitssystem der „Pamir“ ist in Ordnung, geprüft und gesiegelt vom Lloyd. Der Kapitän erinnert seine Frau und seine Tochter über der ausgebreiteten Seekarte an das, was er ihnen, noch in Gegenwart Dieters, oft erklärt hat: das Rettungssystem der „Pamir“, von dem er sich selbst an Bord und in Gesprächen mit dem Segelschiffinspektor Dominik überzeugt hat, ist auf dem besten Stand. Es ist vor der Reise nach Buenos Aires komplett überarbeitet worden: die Life-Boote, sechs große Schaluppen, sind auf Schienen gestellt worden, die das Aussetzen der Boote leichter machen als früher. Schwimmwesten, Proviant und Wasser, Lebensmittel, Leuchtfeuer, alles tipptopp.
Immer wieder unterbricht er sich: „An die Boote müssen wir gar nicht denken. Die Pamir ist nicht gekentert.“ Und er versucht sogar einen Witz: eine Krängung von 45 Grad sei für dieses Schiff keine Kränkung. Er holt die unförmige Kogge mit ihren unregelmäßig sperrigen Ledersegeln vom Bücherschrank, setzt sie auf die Seekarte und zeigt den Frauen, wie eine Schlagseite von 45 Grad aussieht. „Wenn sich ein Segelboot auf der Alster bei Windstärke 8 in die Kurve legt, kommt sie leicht auf 45 Grad.“ Sind seine Erklärungen nicht doch zu leichtfertig?
Im Wohnzimmer hängt seit ein paar Jahren das Ölgemälde der „Kommodore Johnson“, die Arbeit eines holländischen Marinemalers, die er in Amsterdam, noch für die Kajüte der „Dieter Waltraud“, gekauft hatte. Er liebt dieses Bild, er liebt die Geschichte des Schiffes, er liebt die heroische Gestalt des Kapitäns Lehmberg, der sein Schiff vor zwanzig Jahren in schier auswegloser Lage aus dem Sturm geführt hat. Er hatte die Geschichte des unverwüstlichen Seglers schon manches Mal erzählt, in der Kajüte, aber auch hier in der Pseudokajüte seines Farmsener Hauses, das er vor drei Jahren gekauft hat. Die „Kommodore Johnson“, solide gebaut von der Vinnen-Familie, ist eine Viermastbark wie die „Pamir“, ausgerüstet wie sie mit einem Hilfsmotor. Das Schulschiff des Norddeutschen Lloyd in Bremen kam 1936 – „als wir uns verlobt haben, Frida, im Januar“ – aus Buenos Aires, es hatte 5000 Tonnen Weizen geladen – gut, die „Pamir“ fährt Gerste, aber ist das ein Unterschied? – und geriet im März jenseits der Azoren, „wie die Pamir“, in einen Orkan. „Der Herbst und das Frühjahr, das sind Sturmzeiten auf dem mittleren Atlantik, davon kann ich ein Lied singen.“ Das Schiff krängte gefährlich nach Backbord – „ja, das ist immer gefährlich, aber wer sagt denn, dass die Seefahrt nicht gefährlich ist“ –, auf 35 Grad und ging beim Überholen bis auf 45 Grad. „Wie bei der Pamir.“
Der Kapitän erzählte nicht, dass die Weizenladung, obwohl durch zweckmäßige Schottenführung gut gesichert, übergegangen war, eine fließende, schwappende, in sich zusammengesunkene Masse Spielraum für Turbulenzen gewonnen hatte, die wohl ursächlich für die Schlagseite gewesen waren. Von Kapitän Dominik wusste er, dass in Buenos Aires die Gerstenladung der „Pamir“ wegen eines Streiks der Hafenarbeiter von der Mannschaft und von Soldaten gestaut worden war, unter strapaziösen Bedingungen. Auch Dieter hatte diese Plagen in seinem Brief erwähnt.
Er hielt in seiner Erzählung inne und schaute auf Frida: hatte er seine Geschichte nicht schon manches Mal in ihrer Gegenwart erzählt und erinnerte sie sich daran, dass der Kapitän Lehmberg seine Crew bei tobender See in den Laderaum geschickt hatte, um durch das Umstauen von Getreidesäcken, die den lose geschütteten Weizen stabilisieren sollten, das Schiff wenigstens in seiner Schräglage zu halten? Schon hatte die Reling des Hochdecks bei einer Schlagseite von 50 Grad unter Wasser gestanden und waren die Wasserwände auf dem Deck zerbrochen. Auch ein Kapitän, der an die Unverwundbarkeit seines Schiffes und an sein seemännisches Können glaubt, würde in einer solchen Situation sein SOS in den Äther senden. So tat es Kapitän Lehmberg. „Schwere Havarie, wir treiben, bitte helfen.“ Fünf Schiffe hatten seinen Ruf aufgefangen. Sie eilten zur Hilfe.
„Ist das Schiff gekentert?“ fragte Frida.
„Nein, es ist nicht gekentert. Und fünf Schiffe kamen, um ihm zu helfen. Obwohl es sehr schwer war, das Schiff zu finden. Die Funker der Schiffe ersannen ein gemeinsames Funkmanöver, und so konnten sie die Kommodore ins Fadenkreuz ihrer Funkpeilungen nehmen.“
Kapitän Thorborg erzählte nicht, dass Lehmberg vor zwanzig Jahren sein Schiff um vierzig Tonnen Öl erleichtert hatte, um es backbords zu entlasten, und dass schließlich, nach vielen Stunden, die zur Hilfe herbeieilenden Schiffe Öl auf die Wellen gegossen hatten, um ihnen die gefährlichen Spitzen zu rauben. Es war wohl, dachte er, ein Glücksfall, dass die Schiffe in der Nähe und zwei Tankschiffe bei ihnen waren.
„Ein Segelschiff kann sich sehr lange auch in tobender See halten. Das ist seine Natur. Es ist in seiner Bauweise der Natur angepasst.“
„Kurz nach unserer Hochzeit ist dieses andere Schiff gesunken, das mit dem Namen dieses Admirals. Das war auch ein Schulschiff.“
„Das Schiff ist –“ beinahe hätte er gesagt: nicht gesunken. Die „Admiral Karpfanger“ war verschollen, schon vor dem Kap Hoorn von der Meeresoberfläche verschwunden, ohne eine Spur zu hinterlassen. „Das war anders als bei der Pamir. Das Schiff hat nicht gefunkt. Man konnte ihm nicht helfen, weil es nicht gefunkt hatte. Bei der Pamir weiß die ganze Welt, dass sie Probleme hat und wo sie sich befindet. Ihr kann man helfen, ihr wird man helfen. Das ist eine absolute heilige Ehrensache für die Seefahrt.“ Das Wörtchen „christliche“ hatte er von der Zunge heruntergezwungen. Er war kurz nach seiner Heirat aus der Kirche ausgetreten, zum Kummer Fridas. „Die ganze Seefahrt hat den Ehrgeiz, dem Schiff zu helfen. Du wirst einen Wettlauf der Hilfsbereitschaft erleben.“
Sollte er das Gemälde des Schiffes von der Wand nehmen und es vor den milchigen Schirm des Fernsehers stellen? Er hatte das Gerät ausgeschaltet, auf seinem Schreibtisch lief das Kofferradio, dessen Form an ein kleines Funkgerät erinnerte. Er verwarf den Gedanken als unsinnig, den Nachbarn Hermann Kobold, einen Funkamateur, der vor zwei Jahren auf der „Dieter Waltraud“ auf der Malmötour mitgereist war, zu bitten, seinen Äther nach Neuigkeiten abzugrasen. Das Besetztzeichen bei der Stiftung und der Reederei, unaufhörlich: die Familien von 86 Seefahrern wollen Nachrichten, die keiner hat, die Zeitungen, die Funkredaktionen. Es gibt keine. Wenn es einen neuen Funkspruch der „Pamir“ gäbe, würden die Sender es melden. Es gibt keinen. Wenn ein helfendes Schiff eine erlösende Botschaft hätte. Es gibt sie nicht. Noch nicht.
Der Kapitän fürchtete sich vor der Nacht. Er hatte oft die Wache ab Mitternacht getauscht, wenn die Nacht voller Dunst und Schwärze war, das Starren ins Dunkel auf der Brücke war für ihn nie eine Strapaze. Er liebte es, den Gedanken nachzuhängen, die Glut der Mercedes zwischen seinen Fingern, ihren aufsteigenden Rauch beizend vor den brennenden Augen, die Sinne voraus, immer voraus. Aber die kommende Nacht – gehört sie nicht dem 22. September? – fürchtete er. Nicht seine Schlaflosigkeit, Fridas. Das Schiff, ein Boot, eine Schwimmweste, ein Schwimmer, ein Körper, an ein Wrackstück gekettet – was ein schlimmer Traum sein könnte, wird zur grausamen Phantasie des Wachens. Nichts quält mehr als Ungewissheit im Schrecken. Ich, der Vater, habe dem Jungen geholfen, Schiffsjunge der „Pamir“ zu werden. Es war der Wille des Jungen. War es der Wille der Mutter, ihr Wunsch?
Tappi springt an der Türklinke hoch. Ein Kraftbündel, der goldbraune Spitz, er wird gleich in Exaltation zerspringen, wenn einer sich erhebt, das ist für ihn ein Signal des Ausgangs. „Ich gehe“, sagt Waltraut. Der Kapitän würde seine Tochter und ihre Freundin gern begleiten, aber er kann seine Frau nicht allein lassen. Tappi ist Dieters Freund, er sitzt ihm auf dem Schoß, wenn der seine Schulaufgaben macht, am Stubentisch, denn in seiner Kammer steht nur ein von ihm getischlertes anmutiges Mosaiktischchen auf zierlichen drei Beinen, das sich als Schreibtisch nicht eignet. Der Spitz folgt mit aufmerksamen Augen der Feder des Schreibenden oder dem Stift des Zeichners, und er weiß, dass ein hochgehobenes Lineal nicht zu apportieren ist.
Orkan
Waltraut spricht mit ihrer Mutter, oben im Schlafzimmer, sie hat einen Tee gekocht und sich auf das Bett des Vaters gelegt, noch in dem zauberhaften weißroten Kleid, in dem sie vor wenigen Stunden getanzt hat, hat schon zweimal im Gespräch mit ihrem Vater überlegt, ob sie den anrufen sollten. Hatte der Kapitän sich bei einem Gefühl der Erleichterung ertappt, eine Viertelstunde nicht mit seiner Frau sprechen zu müssen, als Giselas Vater mit seinem Auto erschienen war? Er weiß, dass seine Frau ein starker Mensch ist, weiß, dass sie keine Beruhigungsmittel braucht. Sie braucht die Worte, die er ihr nicht geben kann. Er ist der kundige Mann, der die See in vielen Jahren der Fahrenszeit in allen ihren Launen, Tücken und meteorologischen Heimsuchungen kennen gelernt hat, in Frieden und Krieg, auf großer und auf kleiner Fahrt, als Junge in der Kombüse vor schwappenden Töpfen wie als Master next to God, verantwortlich für Mensch, Schiff und Fracht.
Er hat oft den Sturm erlebt. Am Mast eines großen Seglers im Sturm hat er nie gestanden, vor dem Mast einer Bark hat er nie gelebt. Was sein Sohn erleben konnte an Bord einer Viermastbark, hat er nur auf den Seiten eines Buches erlebt, aus dem er, der Volksschüler aus dem Kehdinger Land, als Leichtmatrose auf Amerikakurs sein Englisch gelernt hat, des fabelhaften Abenteuerromans „Two Years Before the Mast“, in dem der Dana seine Reise auf der „Pilgrim“ erzählt, von Boston ums Kap Hoorn zur Westküste Nordamerikas.
Er sucht alle Worte in sich, die seine Frau beruhigen können, aus allem, was er über die „Pamir“ weiß, über ihren Kapitän und die Offiziere, über die Stiftung und die Klugheit ihres Inspektors Dominik, über den Seeverkehr im mittleren Atlantik, über moderne internationale Seerettungssysteme, über den erfolgreichen Kampf der „Kommodore“, über das Kommen und Gehen von Stürmen. Ist die „Pamir“ gekentert? Gesunken? Er glaubt es nicht, und das ist kein Hoffnungsglaube, sondern ein sachlicher Glaube – gibt es das? – , ein Überzeugungsglaube. Er ist ein redseliger Mann in geselliger Runde, wenn er erzählen kann, was er erlebt hat, er singt laut und kräftig über seiner Ziehharmonika, wenn der Rotspon ihn auf höhere Hitzegrade getrieben hat, er kann leidenschaftlich argumentieren und streiten, doch wenn er von Dingen sprechen soll, die er nicht kennt und von denen er nichts weiß, versinkt er in Wortkargheit. Er beneidet seine Tochter um ihre Fähigkeit, die Angst der Mutter in sich aufzunehmen und sie in ihrem optimistischen Temperament als Hoffnung zurückzustrahlen. „Typisch Dieter“. Sie vertritt ihren abwesenden Bruder bei der Mutter.
Und noch langsamer und schwerfälliger kommen die Worte, wenn sie die Zweifel, die in ihnen stecken, nicht verleugnen können. Hatte er nicht geflunkert, wenn er behauptet hatte, die Unglücksstelle – Unglücksstelle, nein! – läge in einer Zone dichten Schiffsverkehrs? Nein, die breite Straße des Verkehrs liegt näher zur afrikanischen Küste, auf dem Inselweg über die Kapverden und die Kanaren nach Madeira, das Azorengebiet liegt in einer Zone eher geringeren Verkehrs, und wie froh könnte Kapitän Diebitsch sein, hätte ihn der Sturm auf dem nordatlantischen Breitband zwischen der amerikanischen Ostküste und den europäischen Küsten erwischt.
Kapitän Thorborg weiß nichts vom Kampf in einem Rettungsboot für fünfundzwanzig Mann auf hochbewegter, vom Sturm gepeitschter See. Die harmlosen Manöver finden an Deck statt und auf glatter See. Er ist nie ins Meer gestürzt, ja, er gehört zu der altmodischen Sorte von Seeleuten, die nicht einmal schwimmen gelernt haben, weil die alten Boots- und Schiffszimmermänner den Schiffsjungen gesagt haben: das verlängere nur die Qual im Meer. Er könnte seiner Frau nur Märchen erzählen, die vor ihren zweifelnden Augen ganz und gar lächerlich wirkten.
Warum hat Kapitän Diebitsch in seinem Funkspruch von einem Hurrikan gesprochen? Sagt das ein alter Seemann über einen heftigen Sturm, würde er nicht von einem Orkan sprechen? Der kennt doch, als Segelschiffskapitän, seinen Schubart mit seiner praktischen Orkankunde genauso auswendig wie ich, der Kümoschiffer, der sie gar nicht auswendig zu kennen brauchte, weil er mit seinen Motorschiffen vor jedem, fast jedem aufkommenden Sturm in den nächsten Nothafen an den Küsten von Nordsee oder Ostsee fliehen kann, in viele Nothaltebuchten. Auch auf einem Küstenmotorschiff kann man Rasmus mit einem Kümmel auf sein Wohlverhalten nicht besänftigen. Stürme sind unberechenbar, oft tückisch. Aber man kann sie beobachten.
Heinrich fragt sich, ob sich Frida, heute, daran erinnert, dass er ihr im Fehmarnbelt, vom Schicksal der „Niobe“, berichtet hatte. Das hatte ihn als eben patentierten Steuermann erschüttert. Aus rasch verdunkeltem Gewitterhimmel, in Küstennähe, war eine Bö auf das Segelschulschiff gefallen und hatte es in die Tiefe gedrückt. Ja, natürlich erinnert sie sich, hatten doch die Zeitungen vor ein paar Wochen der fünfundzwanzigjährigen Wiederkehr des Katastrophentages gedacht, an dem 69 meist junge Menschen gestorben waren. Als sie nach Kiel gezogen waren, am Beginn des Krieges, haben sie einmal mit einem Kameraden, der zu den vierzig Geretteten gehört hatte, die Grabstätte der Opfer, die später aus dem Rumpf geborgen worden waren, besucht. Wie hatte sich Frida über den Zynismus der Militärs empört, dem Schulschiff den Namen der um ihre Kinder weinenden, der versteinerten Mutter zu geben!1
Er hatte die Tür des Bücherschranks zu heftig geschlossen, die Scheiben hinter dem zierenden Gitterwerk klirrten laut, und er horchte hinauf ins Obergeschoss. Würde Frida hinuntergehen, um zu schauen, was er unter den Büchern gesucht habe? Irgendein Buch, das helfen könnte, die quälende Armut an Informationen über das Geschick des Schiffes um ein Quäntchen zu verringern? Er lauschte vor dem Glas, bereit, Schubarts Orkankunde zurückzustellen, denn er würde Frida nicht erklären können, was er in ihr suchte.
Er bewundert dieses Buch, seit er Mitte der dreißiger Jahre in der Seefahrtschule Wesermünde sein Kapitänspatent erworben hatte. „Manövrieren im Sturm“ – das Wichtigste, das ein Kapitän zu lernen hat. Die praktische Orkankunde! Warum hat Kapitän Diebitsch in seinem Funkspruch von einem Hurrikan gesprochen? Für den Kapitän Schubart von der Deutschen Seewarte war Orkan das richtige Wort für den tropischen Wirbelsturm, und ein Hurrikan kam für ihn nur im westindischen Ozean vor. Gut, der Kapitän Diebitsch ist schon vor dem Krieg, dem ersten, mit der „Pamir“ über diesen Ozean nach Australien gesegelt. Aber geben die Wetterstationen an den Küsten nicht Orkanwarnungen? Was sagen die Amerikaner? Sprechen sie generell von Hurrikanen in ihren Warnmeldungen? Hatte die „Pamir“ keine Orkanwarnung empfangen? Stürme entstehen ja nicht aus dem Nichts, haben einen langen, oft berechenbaren Wanderweg, und der Kapitän, der ihn kennt, kann Schubarts wichtigsten Rat befolgen: vermeide es, die Bahn eines Orkans zu kreuzen.
Kapitän Thorborg legte das ölfleckige graupappige Buch auf seinen Schreibtisch, dessen glänzende Eichenplatte viel zu groß für das kleine schmale Haus war, nahm eine Mercedes aus der Blechschachtel, klopfte sie auf den Einband und schlug das Buch auf. Sein fotographisches Gedächtnis für alle die nützlichen, praktischen und doch so hochwissenschaftlichen Informationen fand die Seiten, die er befragen wollte, ohne Blättern. Der kleine Schöffler-Weis belehrte ihn, dass die amerikanischen Wetterwarten das Wort „Orkan“ nicht kennen, sie sprechen vom Hurricane. Der Kapitän Diebitsch und sein Funker haben das Wort aus den Funkmeldungen, die sie ja erhalten haben, schlicht übernommen. Kapitän Thorborg ist erleichtert: es gab Sekunden des Zweifels in seinem Herzen, ob der Kapitän Diebitsch, dem er seinen Sohn anvertraut hatte, das Wunderwerk von Schubart überhaupt kannte.
Ich lese im Schubart, und meinen Sohn habe ich mit einem über fünfzig Jahre alten Segelschiff in einen tropischen Wirbelsturm geschickt, dachte er. Die „Dieter Waltraud“ war auch fast fünfzig Jahre alt: und wie zuverlässig, wie stabil war sie gewesen in den drei Jahren, in denen er mit ihr fuhr, abgesehen von den Verschleißproblemen, die immer mal lästig sind. Auch die „Pamir“ ist zuverlässig und stabil. Ich Alter lese im Schubart, und mein Sohn, der Jungmann, hat sich vielleicht an den Mast eines mit 45 Grad krängenden, von haushohen Wellen hin- und hergeworfenen Schiffes gebunden oder er kämpft mit seinen Kameraden in einem Boot auf einer feindlich bewegten See. Ich trinke mein Becks. Hat Dieter etwas zu trinken? Ich lese im Schubart, und Dieter lebt ihn, seine Beschreibung der See jenseits der Windstärke 12. Er las mit leicht bewegten Lippen: „Die Wellenberge werden so hoch, dass in Sicht befindliche Schiffe so tief in die Wellentäler hineinsinken, dass sie sich zeitweilig aus Sicht verlieren. Das Rollen der See wird zum Getöse; die See ist mit weißem streifenförmig zur Windrichtung liegenden Schaum bedeckt, und der Wind verweht die Kanten der Wellenkämme zu Gischt. Von der Gewalt des Windes wird die Luft mit dem Gischt des verwehenden Meerwassers so angefüllt, dass keine Fernsicht mehr ist.“ Wie lange dauert es nach einem Orkanüberfall, bis sich das Meer beruhigt, bis nahende Schiffe die Nussschalen in zehn Meter hohen Wellen sehen können? Welche Lichter, welche Leuchtsignale können gesehen werden in Dunst und Nacht?
Das Bild der „Kommodore Johnson“ hat ihm immer gefallen. Er hatte auch sein erstes eigenes Schiff, die „Dieter Waltraud“, in Öl malen lassen für das Wohnzimmer in diesem Haus in Farmsen, das er zu dieser Zeit gerade erworben und aus einem ziemlich heruntergekommenen „Gartenhaus“ – das war das Urteil seiner Familie gewesen, die sich eine schönere Stadtwohnung gewünscht hatte – zu einem Schmuckstück ausgebaut hatte. Er musste seiner Frau Recht geben: ein Motorschiff, akurat steril gemalt, ist keine Zierde für eine Stubenwand. Aber dieser Segler, diese Bark!
Am Tage vor seinem Dienstantritt als 1. Offizier auf dem Dampfer „Annie Hugo Stinnes“, im März 1937, war die „Kommodore“ in den Hafen eingelaufen, hier in Hamburg, und hatte am Schuppen 76 festgemacht, nach wochenlanger Sturmfahrt, nach all den SOS-Berichten in den Zeitungen ergriffen und begeistert empfangen von den Angehörigen und Freunden der jungen Seeleute und den Hamburgern, und er hatte am Kai gestanden und das Schiff mit seinem schlanken Rumpf bewundert, mit Frida, seiner Verlobten, ja er hatte den als Helden gefeierten Kapitän Lehmberg an Deck gesehen und sich gewünscht, auf seinem neuen Schiff solch einen Kapitän anzutreffen.
Er wusste schon, dass die Fahrt auf dem Dampfer seine letzte große Reise sein würde, denn seine Bewerbung um diese lächerliche Kieler oder Husumer Landstellung als Zollschiffer lief bereits, leider mit Aussicht auf Erfolg. Das Staunen über die stolze, auch in den unaufhörlichen Stürmen der letzten Wochen kaum ramponierte Bark war sein trauriger Abschied von der Seefahrt gewesen, den er der Verlobten zuliebe genommen hatte.
Das Bild der „Kommodore Johnson“, dieses siegreichen Schiffes, war auch auf dem Foto zu sehen, das auf seinem Schreibtisch stand, einem Geschenk seiner Familie, das sie ihm nach Weihnachten, als er wieder nicht das Fest mit ihnen erleben konnte, nach Amsterdam geschickt hatte. Ein Bild als Mahnung. Es hatte ihm nicht gefallen. Frida, Waltraut und Dieter, der Tappi auf seinen Armen hält, vor ihrem Silberbaum, und den Kopf des Kapitäns hatte Dieters Freundin aus der Nachbarschaft, die beim NDR zur Cutterin ausgebildet wurde, in das Foto montiert, seinen kantigen, so überanstrengt wirkenden Kopf mit dem an den Schläfen hoch rasierten Haar und dem ihm selbst fremd erscheinenden Lächeln – als hätte sich ein Fremder in das Bild geschlichen. Er musste Dieter fragen, ob das Bild endlich von seinem Schreibtisch verschwinden dürfe.
Waltraut ertappt ihn bei seinem blinden Starren auf das Ausklappblatt im Schubart, der Manövriertafel für Segler und Dampfer im Orkan, auf der sich die Schiffsschemen entlang der kräftig gezeichneten Sturmlinie wie die Eisenfeilspäne auf einer Magnetplatte zu bewegen scheinen. Er erschrickt. „Mutti ist in Dieters Zimmer“, sagt Waltraut. Er wuchtet sich aus seinem hochlehnigen Eichenstuhl – „Thron“ sagt Dieter –, doch Waltraut drückt ihn mit ihren Händen auf seinen Schultern zurück. „Bleib lieber. Ich meine, Mutti möchte mit Dieter allein sein.“ Dieters Zimmer, die kleinste Mansarde unter der Schräge, hätte ihn jetzt erdrückt. Das Zimmer ist ihm fremd, er versteht nicht, warum junge Leute ihren Raum mit so düsteren Tapeten, die auch durch ein paar bunte Kringel und Tupfer nicht heller werden, verdunkeln können.
„Das sind“, sagt er, „für die südliche und die nördliche Breite an den Zugbahnen des Orkans die gefährlichen Viertel für den Segler – “, und er legte drei Finger auf die Kreissegmente. „Ob der Diebitsch sein Schiff da hineingesteuert hat? Unmöglich. Er kennt die Manöver, er kennt die befahrbaren Viertel im Sturm, er kannte die Wetterlage. Die Pamir wird sich irgendwo an den Rändern bewegt haben. Hier oder da – “ Seine Hand liegt auf dem Blatt und bewegt sich schwer auf ihm, als wollte sie den Sturm besänftigen.
Das Telefon, zum ersten Mal an diesem Abend. Waltraut legt ihre Hand auf den Hörer: „Willst du?“
„Nur wenn es eine Nachricht von Dieter ist.“
Es ist Karl Karstens, sein ältester Freund. Ein Hoffnungsfunke: der ist Hauptkommissar bei der Wasserschutzpolizei, vielleicht hat er Nachrichten. Von oben ruft Frida: „Hast du was gehört, Heinz?“ Nein, nur Kuddel, ein treuer, ein ahnungsloser Freund, der ein paar beruhigende Worte sprechen will. Er ist nach der Seefahrtschule und dem Patent nie zur See gefahren, er wurde, wie er selbst gescherzt hatte, „Wasserbeamter“. Aber sie hatten oft über die „Pamir“ und Dieters Entscheidung, auf ihr seine seemännische Laufbahn zu beginnen, gesprochen. Ihm verzeiht der Kapitän, ihn an diesem Abend ohne eine lebenswichtige Information angerufen zu haben. „Wir sitzen alle am Apparat und warten auf Nachrichten“, sagt der Freund.
„Gehe jedem tropischen Orkan aus dem Weg, falls es möglich ist.“ Das ist für Schubart der wichtigste Grundsatz. Oder ist er nur banal? Der Kapitän versucht, seiner Tochter die Methoden zu erklären, mit denen eine Schiffsführung die Lage erkennen kann, den Ort, an dem das Zentrum eines Orkans sich befindet, den Weg, auf dem er wandert, und die Geschwindigkeit, mit der er es tut. Waltraut ist keine geduldige Zuhörerin. Sie geht ans Radio in der Fernsehtruhe und lässt den Sendersucher wandern. Was ebenso vergeblich ist wie sein Stöbern auf den Seiten des Schubart, auf denen der Nautiker und Beobachter aus den Schiffsmeldungen von Jahrzehnten seine Ratschläge entwickelt hat, für alle Schiffe, doch in allem, was er sagt, tritt seine große Liebe zu den Segelschiffen hervor: ihnen gilt seine Sorge.
Rührend, wie er sich zu seiner Neigung bekennt: fragen könne man, ob es noch einen Zweck habe, Anweisungen für Segelschiffe zu geben, denn große Segler gebe es nur noch wenige. Es gelte, Erfahrung und Regeln vor dem Vergessenwerden zu schützen, denn niemand könne wissen, was die Zukunft bringt. Sollen Schraubendampfer und Motorschiffe die Kraft verspotten, die in den Passaten, Monsunen und den braven Westwinden ungenutzt über das Meer dahin wehen – vielleicht aber werde der Wind als billiger Kraftspender wieder in seine Rechte treten. Die Männer, die persönlich mit einem Segler im Orkan manövriert haben, werden selten geworden sein. Umso wichtiger sein Buch. Manövrieren nach einem Buch? Ich habe im Schubart gelesen wie mein Großvater in seinem Kehdinger Moordorf in seiner Bibel, doch könnte ich eine Bark mit ihren dreißig, vierzig Segeln an vier hohen Masten manövrieren? Schubart entwickelt seine Ratschläge für das gefährliche Viertel, in dem ein Schiff an den Wind luven muss, im Gefühl eines Autors, der glücklich ist, wenn sein Buch für den letzten Leser nützlich sein könnte. „Man halte voll und führe Segel, solange es möglich ist.“ Der Funkspruch der „Pamir“ sagt, dass alle Segel verloren seien.
Der September ist der Rekordhalter für Orkane, sechzig Stürme mit Orkangewalt im Nordatlantik, der das sturmreichste Gebiet auf dem Globus ist, fast hundert, wenn man auch die schweren Stürme zählt.
Der junge Kapitän hatte immer wieder in der Orkankunde gestöbert, voller Heimweh nach den ortslosen Schiffen, auf denen er glücklich war, hatte immer wieder die vielen Wetterkarten, mit Stift und Zirkel in der Hand, studiert, als er schon längst der Husumer Zollschiffer mit seinem lächerlichen Gehalt war. In einem Kapitel über die Sturmgeburten hatte er ein paar Sätze am Rande kräftig mit einem Kopierstift markiert: in ihm war es um eine Höhenwetterkarte vom 26. auf den 27. April 1939 gegangen. Am 28. April war sein Sohn geboren worden – auch seinen Namen Klaus-Diedrich hatte er an den Rand geschrieben.
Der Kapitän knipst die Beleuchtung des Globus’ an, der auf einer Ecke seines Schreibtisches wie eine Leselampe steht. Das fettgedruckte T, das auf Schubarts Karte den Ort eines kräftigen Sturmtiefs kennzeichnet, liegt auf 35 Grad nördlicher Breite, 40 westlicher Länge. Der Kapitän erschrickt: dort etwa kämpft Dieter in Seenot, auf dem Schiff, im Rettungsboot. Kapitän Thorborg hat sich immer zu seinem Aberglauben bekannt, dem alten seemännischen und dem der Moorleute, den er in seiner Familie eingesogen hat: was er auf dieser Seite, in diesem meteorologischen Dokument aus dem April 1939 gefunden hat, wertet er als ein Zeichen, das für seinen Sohn spricht. Er überlegt, ob er Frida und Waltraut in seine Entdeckung einweihen soll.
„Mutti liegt auf ihrem Bett“, sagt Waltraut. „Ich lege mich auch hin.“ Kapitän Thorborg will seine Wache an Schreibtisch und Radio fortsetzen. Die Glasenuhr, die er nach dem Verkauf der „Dieter Waltraud“ im Juni aus der Kajüte genommen hatte, schlägt in ihrem eigenartig zirpenden Klang viermal.
1Zu-Satz aus der Zukunft: Frida Thorborg erinnerte sich an ihr Gespräch über die „Niobe“, als sie las, dass man dem Marine-Segelschulschiff „Gorch Fock“, das drei Tage nach dem Tod ihres Mannes vom Stapel gelaufen war, den Albatros als Galionsfigur gegeben hatte. Der Albatros verkörpert im Seemannsglauben die Seele der verstorbenen Seeleute, und aus diesem Grund habe Professor Gerhard Marcks, meinte sie, den Vogel über der von ihm geschaffenen Gedenktafel für die Opfer der „Pamir“ in der Hamburger Hauptkirche St. Katharinen schweben lassen, nicht weil er, wie es in der Zeitung hieß, das Symboltier der Cap Horniers sei.
Lichtsignale
Kann die eine Zeitung mehr wissen als die andere? Und können die beiden mehr wissen als das, was im Radio die ganze Nacht zu hören war? Um Mitternacht sollen die „President Taylor“ und die „Penn Trader“ im Standortgebiet der „Pamir“ gewesen sein, nach langer, langer Fahrt. Der amerikanische Truppentransporter – das werden schwerfällige Schiffe sein! – hat Lichtsignale am Horizont gesehen. Durch sie war die Nacht in Farmsen heller geworden. Ein Brite, die „Manchester Trader“, hat ein schwaches Funksignal empfangen: die Fock der „Pamir“ ist gebrochen. Vielleicht hat die herabstürzende Takelage die Antenne und die Funkkabine zerschlagen. Leuchtraketen vom Schiff, Lichter aus den Booten? Hat sich die Sicht verbessert, ist der Wellengang flacher? Ist der Wirbelsturm rasch weitergezogen?
Der Kapitän hatte den Wagen in der Garage gelassen. In seiner Ermüdung und Erregung fürchtete er, den Rekord nicht heil durch Tor und Pforte bugsieren zu können. Dieter war es gewesen, der beim Umbau des Hauses vor drei Jahren kopfschüttelnd die eben geschütteten Fundamente der Garage betrachtet und gemeint hatte, sie sei nicht groß genug für den Kapitän – für den Opel Kapitän, den er fuhr, ehe er ihn am Hafen an einen Poller gesetzt hatte –, er hatte die Garage glücklicherweise vergrößern lassen. Waltraut, die ihn fahren wollte, sollte bei ihrer Mutter bleiben. Ausschreiten, tausend Schritte tun. Atmen, tief atmen, wie an Bord nach der Wache, ehe es in die Kajüte zum sensiblen Schlaf ging. Er wusste nicht, wann der Bahnhofskiosk am Sonntag geöffnet hat.
Die „Bild am Sonntag“ weiß, was alle wissen, nur in größeren Buchstaben: die PAMIR droht zu sinken. Der Vormast gebrochen. Die „Welt am Sonntag“ weiß auch nicht mehr. Wie könnte sie auch. Die Geschichte der „Pamir“ ist tausendmal erzählt. Nein, nicht 91 sind an Bord, es müssen 86 sein. Wie kann die „Pamir“ gefunden werden, wenn sie nicht mehr senden sollte? Die „Pamir“ unter vollen Segeln, auf glatter, leicht gekräuselter See, ein schönes Motiv für die Marinemaler. Der Kartenausschnitt, den er gestern Abend mit seinen Fingern auf dem Globus betupft hat.
Es gibt keine Nachrichten, außer den Vermutungen, die sich aus dem Notruf von gestern ergeben, aus Bruchstücken von Meldungen: „fourmastbark broken“. Fock, Untermars, Obermars, Bramsegel unten und oben, die Royal und Stengestag und Bramstag und die Königin, das große Royalstagsegel. Er murmelte die Namen der Segel vor sich hin auf seinem Weg zurück, wobei er die beiden gerollten Zeitungen auf seinen Schenkel schlug. Dieter will immer alles ganz genau wissen, wie für seine Schulreportagen, will alles viel früher lernen, als es in Schulen oder an Bord möglich ist. Er hatte seinen Sohn abgehört, wie man Vokabeln abhört, und Dieter waren die vierunddreißig Namen leichter von den Lippen gekommen als die englischen Vokabeln, die nicht seine Stärke sind. „Besam Stengestagsegel“ – das braucht einer auf einem Kümo nicht.
Diebitsch, der ja ein sehr strenger Ausbilder sein soll, wird seine Freude an Dieters Wissen haben. Nun ja, ein Kapitänssohn eben. „Der Kapitän und der Kadett“, hatte Waltraut gesagt, nicht korrekt, denn Kadetten gibt es nur auf militärischen Ausbildungsschiffen. Schiffsjunge, Jungmann – klingt auch ein bisschen alltäglicher. Aber alle Welt spricht von Kadetten, von „schmucken“.
Jedes Wort auf der ersten Seite der Sonntagszeitungen wird von Frida und Waltraut gelesen, während er telefoniert. Es ist peinigend für ihn, ihnen nicht mehr sagen zu können als die Zeitungen, nicht klüger, nicht sicherer, nicht vorausschauender die spärlichen und doch so grausam klaren Nachrichten deuten zu können. „Die Pamir ist nicht gesunken!“ Wie soll er seine Gewissheit begründen? „Das ist ein Cap Hornier, das ist ein Schiff mit den Erfahrungen langer, auch gefährlicher Reisen in jeder Planke, in mehr als fünf Jahrzehnten.“ Jedes Schiff ist eine Nussschale im Atlantik und ist noch kleiner in einer vom Wirbelsturm aufgewühlten See. „Carrie“ heißt der Widersacher.
An den Namen des Reporters des „Hamburger Abendblatts“, der vor drei Jahren durch Vermittlung des Verbandes auf der „Dieter Waltraud“ bis Brunsbüttelkoog gereist ist, kann er sich nicht erinnern. Das Blatt hat die beste Schifffahrtredaktion der Welt! Die beiden Redakteure, mit denen er verbunden wird, sind rührend in ihrer Hilfsbereitschaft, doch was wissen sie? Sie sprechen von den Flugzeugen, die gestern schon und heute wieder von den Azoren aus aufgestiegen sind, spezialisierte Retter. „Flugzeuge?“ sagt er atemlos laut in die Muschel. „Flugrettungsgruppe“, ruft er, und er sieht in den großrunden Augen Fridas, die voller unausgesprochener Fragen sind, die Bewegung, die sie seit dem frühen Morgen verloren haben. „Die Sicht wird besser –“ spricht er nachdenklich, als wiederholte er eine Auskunft, die er gerade von einem allwissenden Redakteur erhalten hat. Nein, die See war so stürmisch und die Sichtverhältnisse so schlecht, dass die Flugzeuge ihre Operationen abbrechen mussten. Er setzt seine Hoffnung auf die Flieger. Das Meer wird sich beruhigen, die Flugzeuge sind schnell und beweglich, lässt der Sturm nach, können sie tiefer fliegen. Wo das Schiff ist, wo Boote sind – sie werden sie sichten.
„Glaubst du, dass sie das Schiff finden?“ fragt Frida. „Da waren doch Lichtsignale. Raketen. Die müssen von den Flugzeugen doch gesehen worden sein. Auch bei schlechter Sicht.“
„Die Jungs werden die Maschinen gehört haben. Sie wissen, dass sie wiederkommen, dass sie Hilfe rufen. Sie können die Schiffe, die zur Hilfe kommen, dirigieren.“ Er hat die wendigen Tiefflieger vor Augen, die er in Norwegen, mit seinem Mienensucher vor der Küste liegend, gesehen hat. „Die können sehr tief fliegen.“ Das weiß auch Frida, denn sie hat sie bei Kriegsende über den Kehdinger Mooren gesehen, als sie mit den Kindern zu den Eltern ihres Mannes geflüchtet war.
Aber das Schiff mit seinem großen Rumpf müssten Flieger auch im Schaumchaos des verwirbelten Meeres unter Gischtvorhängen, in der Dämmerung, sichten können. Ist das Schiff doch gesunken? Der Gedanke trifft ihn wie ein heftiger Schlag in den Leib, die Flugzeuge könnten über ein Boot, ein Floß, ein Wrackteil blind hinwegfliegen, an dem Dieter mit seinen Kameraden, gestützt nur auf eine Schwimmweste, in einer Wasserhölle um sein Leben kämpft. Sein Arm wird so kraftlos, dass er den Telefonhörer auf den Lederdeckel seiner Schreibmappe, in den der Kürschner eine Kogge getrieben hat, legen muss.
Er vermutet den Inspektor Dominik in der Korrespondentreederei Zerssen, hört aber, dass er beim Vorstand der Stiftung am Ballindamm sei. Mit Kapitän Dominik hat er oft über das Schiff gesprochen. Der Anschluss bei der Stiftung ist besetzt. „Ich fahre zu Dominik“ ruft er, „wenn einer etwas weiß, dann er. Ich muss ihn sprechen!“ Hat Waltraut seinen Schwächemoment beobachtet? Sie will ihm die Fahrt in die Stadt ausreden, oder sie möchte ihn fahren, will aber die Mutter nicht allein lassen. „Wir bleiben alle drei am Radio. Alle sorgen sich um die Pamir, und wenn es neue Nachrichten gibt, dann hören wir sie im Radio.“
Ist das so? Soll er Waltraut und Frida sagen, was Kapitän Dominik ihm einmal gesagt hat, als er ihn – aus rein technischer Neugier – nach der Funkkommunikation zwischen der Reederei und dem Schiff auf ihrer langen Reise von Hamburg an die La Plata-Mündung gefragt hatte? Auch der Korrespondentreeder Thorborg und die beiden Partengesellschafter der „Frida Thorborg“ und der „Waltraud Thorborg“ legen großen Wert auf die aktuellsten Meldungen ihrer Kapitäne, so detailgenau wie möglich, ja wie nötig, wie er sie brauchte, stünde er selbst auf der Brücke, mit der vollen Verantwortung für das Schiff. Kapitän Dominik hatte gelacht: „Wir können unserem Kapitän Diebitsch nicht helfen, wenn er raus ist aus Buenos Aires und Probleme hat. Er weiß, was zu tun ist, wie jeder Kapitän. Und wenn es außerordentliche Vorkommnisse gibt, muss er mit seinen Meldungen an uns vorsichtig sein. Ein Schulschiff, Herr Thorborg! Das ist eine Schule. Mit einem halben Hundert besorgter Eltern. Da muss der Master seine Meldungen verschlüsseln wie die Kriegsmarine. Ein Mastbruch, der Ausfall des Hilfsmotors, ein Leck und sei es noch so harmlos – was meinen Sie, was los ist hier bei uns, wenn die Presse davon Wind bekommt. Wenn Ihr Kümo eine kleine Havarie hat, kräht kein Hahn danach.“ Ist es sicher, dass die Stiftung wirklich alle Meldungen, die in dieser Nacht eingelaufen sind, an Funk und Presse gegeben hat?
„Nein“, sagt Heinrich Thorborg, „ich muss mit der Stiftung sprechen. Ich muss. Das bin ich allen Eltern schuldig. Ich bin Kapitän und ich bin in Hamburg. Ich kann nicht vor dem Radio warten. Ich fahre hin. Ich rufe euch an.“ Wird er froh sein, die fragenden Augen Fridas nicht mehr sehen zu müssen? Er war der Mann, Antworten zu geben, in jeder Situation. Er müsste sie sicher geben, stark, müsste unanfechtbar überzeugend sein in seinem Wissen „Der Junge kommt wieder!“, so dass alle Angst von der Mutter und der Schwester abfiele. Und von ihm selbst.
Auf dem Schreibtisch liegt die letzte Karte des Korrespondentreeders, eine Woche alt, die Schiffsmeldungen vom 9. 9. und vom 13. 9. auf dieser Reise 6, heimkehrend: südwestlich und nordwestlich der Cap Verdischen Inseln stand die „Pamir“ an diesen Tagen. "Voraussichtliche Ankunft in einem deutschen Hafen Ende September/Anfang Oktober 1957.“ Er blättert in allen Meldungen im Briefständer. Als einen Geburtstagsgruß hatte er die Karte vom 16. Juli gelesen, die das Schiff „ausgehend“ südwestlich von Rio de Janeiro und ostwestlich von Porto Alegre gemeldet hat.
Heimkehrend. Das Schiff kehrt heim!
Er kramt in der Schublade, als suchte er für seinen Besuch in der Stiftung oder der Reederei noch einige Papiere zusammen, Unterlagen für ein sachliches Gespräch, hält auch zwei ausgefüllte Überweisungsaufträge für die Westbank in den Händen, legt sie aber zurück, als ihm klar wird, dass Sonntag ist. „Was suchst du denn, Heinz?“ fragt Frida. „Wolltest du nicht mit Kapitän Dominik sprechen?“ Er ruft noch einmal an – immer noch, schon wieder das Besetztzeichen. „Ich fahre“, ruft er, „ich rufe euch an.“ Jetzt scheint Frida einverstanden zu sein.
Der 22. Die Tagundnachtgleiche. Zeit der Stürme. Im September vor zwei Jahren hatte Dieter auf der „Dieter Waltraud“ auf der Höhe der Insel Texel einen Sturm der Stärke 9 erlebt. Das Schiff hatte die Mucken, immer wieder nach Steuerbord überzuholen, und Dieter hatte sich an die Brüstung gestemmt und laut in den Wind gelacht und geschrien, fern vom leisesten Anflug der Seekrankheit, die seine Schwester immer wieder erbarmungslos gepackt hat, wenn Feuerschiff Elbe 1 passiert war. Tag- und Nacht-Gleiche. War gestern noch ein heller Tag, wird heute eine lange Nacht kommen? Wann spätestens müssten Schiffe die Boote finden, um die Jungen gesund bergen zu können? Er hatte nie einen Schiffbruch erlebt. Die Rettungsboote der „Pamir“ sind in tadellosem Zustand und ausgerüstet mit allem Notwendigen. Und der Orkan wird im Fortwandern rasch abflauen.
Wenn Kapitän Dominik Nachrichten hätte, Bruchstücke von Nachrichten, die mit haltbaren Vermutungen verknüpft waren, wenn er Befürchtungen hätte, die durch aktuelle Meldungen Futter hätten, wenn er etwas wüsste über Schwachstellen2 des Seglers, die im Sturm problematisch sein könnten und wenn er dies der Öffentlichkeit gegenüber verhehlen würde wie der Verkäufer die Macken eines gebrauchten Autos gegenüber einem Interessenten – ihm, dem Vater Klaus-Diedrichs, würde er es sagen. Der Fritz Dominik hatte Dieter in sein Herz geschlossen. Er hatte ihn spät auf seine Schiffsjungenliste genommen, als er sein kluges, witziges, bunt illustriertes Buch „Die Reise mit einem ‚Kümo’“ gelesen hatte, die Hunderte der handschriftlichen Zeilen, in denen jeder kühne Schnörkel dem Leser gesagt hatte: hier schreibt einer, der unbedingt Seemann werden will. Seafarer. Und Kapitän, natürlich.
Wo tagt der Krisenstab, bei der Stiftung im Hapag-Haus oder bei Zerssen? Er parkt den Wagen irgendwo am Ballindamm und geht zunächst zu Zerssen. Er steigt nicht in den Paternoster, sondern nimmt die Treppen, und von Stufe zu Stufe wird der Schritt verhaltener, als wachse auf jeder das Wissen: nichts wirst du erfahren. Warum sollte ausgerechnet Fritz Dominik, der Dieter – vielleicht gegen Widerstände, vielleicht über den Kopf Kapitän Diebitschs hinweg – in die Schiffsgemeinschaft aufgenommen hatte, der ihm, dem Kapitänskameraden, einen Gefallen getan hatte, ihm etwas sagen, was ihn auch nur im geringsten beunruhigen konnte? Er rechnete nicht damit, bei Zerssen die beruhigende Nachricht zu hören: das Schiff ist gefunden, ohne Segel, ohne Fock, lädiert, aber schwimmend, auf Schlepper, mag ihre Reise noch so weit sein, wartend.
Der Bevollmächtigte lässt sich aus einem Sitzungszimmer rufen, doch er kann nur sagen, dass mit dem Vorstand der Stiftung – und Kapitän Dominik sei gerade mit ihm zusammen – vereinbart sei, die Familien und die Öffentlichkeit nur über Entwicklungen zu informieren, die von einem Schiff, das im Unglücksgebiet die Bark oder ihre Boote gesichtet habe, bestätigt seien. Und mittlerweile beteiligten sich viele Schiffe an der Suche, die von den amerikanischen Schiffen und der Küstenwacht professionell wirkungsvoll koordiniert werde. „Aber noch keine Spur, Kapitän, wir müssen uns alle gedulden. Heute, morgen – alles ist wünschbar, alles ist denkbar. Aber erwarten Sie, bitte, keine Informationen jetzt, von uns oder der Stiftung.“ Heinrich Thorborg wusste, dass auch Kapitän Dominik ihm keine andere Antwort geben konnte. Er würde ihn nur in Verlegenheit bringen, wenn er ihn im Hapag-Haus belagerte. „Wir haben gerade eine Rufnummer bei der Stiftung eingerichtet. Ich notiere Sie Ihnen. Hier – 32 15 81. Wir wollen alle Fragen aufnehmen, aber Antworten können wir jetzt noch nicht geben.“ Aus dem Unglücksgebiet –
Der Kapitän überlegt, ob er an die Große Elbstraße zu seinem Schiffsmakler Tietjen fahren solle. Der hat seine Antennen immer in alle Himmelsrichtungen ausgefahren, bei dem ist ein Gerücht oft genug eine Nachricht. Er könnte auch noch ins Haus der Küstenschifffahrt schauen, vielleicht säße der unermüdliche Geschäftsführer Rauscher an diesem Sonntag, der voller Fragen ist, an seinem Schreibtisch. Er hält am Stephansplatz an einer Telefonzelle, vor der er feststellt, dass er sein Portemonnaie nicht eingesteckt hat. Ist der Tank noch voll? Nicht nach Altona. Zurück nach Farmsen. Er schämt sich. Er ist losgestürmt auf der Suche nach Nachrichten und hat sich nicht um die Münzen gekümmert, die einer braucht, um an irgendeiner Stelle eine Nachricht, die aus den Wolken schlägt wie ein erlösender Blitz, weiterzuleiten an die, die sie am meisten brauchen. Der Kapitän und Reeder, der stolz darauf ist, die leistungsfähigsten Funkanlagen an Bord seiner Schiffe zu haben, hat in seinem Opel Rekord kein Radio.
„Wir suchen“, melden die Schiffe, die amerikanischen, die britischen, im Laufe des Vormittags. Die Flugzeuge können bei dem schlechten Wetter noch nicht aufsteigen. Mit diesen Nachrichten empfangen ihn Frida und Waltraut.
Frida ist so erregt, dass Waltraut sie immer wieder um die Schulter fasst und sie an sich zieht. Ein Reporter und ein Fotograf hatten vor dem kleinen Flurfenster, das sie öffnet, wenn es klingelt, gestanden und nach dem Kapitän Thorborg gefragt. Als sie gehört hatten, er sei nicht anwesend, hatten sie geradezu gebettelt, hereingelassen zu werden. Sie sprächen mit allen Hamburger Pamireltern, die von dem großen Unglück betroffen seien. „Pamireltern! Unglück! Wovon reden die?“ rief Frida. Sie habe das Fenster, sagte Waltraut, so heftig zugeschlagen, dass selbst der wild zeternde Tappi vor Schreck verstummt sei. Hatte der Reporter nicht ihr Gesicht im offenen Fenster fotografiert? Den Holzdeckel des in die Wand eingelassenen Briefkastens, der die Post auf den Flur rutschen lässt, hatten die Reporter gehoben, um ihre Fragen wie durch das Sprachrohr auf dem Kümo zu wiederholen: „Wo ist Ihr Mann, Frau Thorborg, ist er auf seinem Schiff? Wir müssen mit dem Kapitän sprechen.“
Zorn schoss hoch in Heinrich Thorborg. Bei Zerssen hatten sie ihn abgespeist mit ihrer Nachrichtensperre im wohlverstandenen Interesse der Angehörigen. Und von wem hat die Zeitung ihre Informationen? Aus dem Telefonbuch doch wohl nicht. Er wollte Frida beruhigen. „Vielleicht denken die Reporter, wir hätten neue Nachrichten von der Stiftung.“ Unsinn. Zerssen würde die Presse informieren, wenn es Neues gäbe, nicht die Eltern. Oder hatten die Reporter etwas gewusst? Vielleicht hätte Frida doch mit ihnen sprechen sollen? „Frida, das war richtig von dir, mit den Zeitungen sollten wir nicht sprechen. Und dafür gibt es auch überhaupt keinen Grund.“
Die Funker von Norddeich-Radio sind geduldig. Wahrscheinlich sollen sie Hunderten Auskunft geben, nicht nur Vätern und Müttern, auch den Journalisten und den vielen, die dem Sog eines ungewöhnlichen Ereignisses nicht widerstehen können. Sie stehen mit ihren Kollegen an der englischen Küste, mit Portishead Radio, die noch dichter am Geschehen sind, in enger Verbindung.