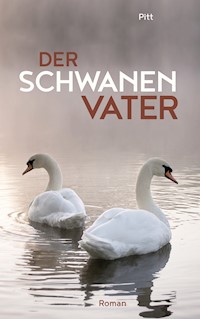6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
In 44 Reportagen erzählt Pitt von seinen Begegnungen und Erlebnissen in U-Bahnen, S-Bahnen, Stadt- und Straßenbahnen und Bussen in den Nahverkehrssystemen verschiedener Städte und Regionen. Er ist seit Jahrzehnten ein passionierter Nutzer des so genannten ÖPNV, des öffentlichen Personennahverkehrs, und genießt seine kurzweiligen Reisen. Es ist erstaunlich, wie nah sich fremde Menschen in Bahnen und Bussen kommen und wieviel sie voneinander erfahren. Der Autor wirbt auch für die Fahrten im Nahverkehr, der nach dem Willen aller Ökologen seinen Anteil am gesamten Verkehr, der die Umwelt stark belastet, wesentlich erhöhen soll. Die alltäglichen Fahrten für Beruf, Einkauf, Sport, Freizeit und Kultur werden in Pitts Beobachtungslust spannend und vergnüglich. Aus der Neugier auf die Mitreisenden entwickeln sich sympathische Elemente einer Philosophie der Verträglichkeit.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 328
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
Der Zugvogel
Die Warnung
Eine Schuldfrage
Ein Frauenfeind
Von der Anmut des Empfangens
Die Galgenpredigt
Menschen im Raum
Bushaltestelle
Die 32. Woche
Der Sündenbock
Das Interview
Ehepaare
Ein namenloser Freund
Ein zorniger junger Mann
Sonnentag
Erinnerung an die Klassengesellschaft
Der Flachmann
Der Heilige
Z-U-G-L-U-F-T
Der Stammplatz
Streit der Kulturen
Doppelgänger
Stern-Stunde
Augenspiele
Echo
Ein Zufall
Die Visitenkarte
Who’s next?
Der Mitleser
Die sanfte Sensation
Nahverkehr, persönlich
Kurz und nah
Schwarzfahrer wider Willen
Untergrundkunst
Necropolitan Transit
Im Märchenland
Eine Ohrfeige, bitte
Eine Rettungstat
Ist Jungheinrich ein Kauf?
Das Manuskript
Mit sich allein in Gesellschaft
Standpunkte zur Pünktlichkeit: starten oder warten
Ein metaphysisches Rätsel
Nächstenliebe im Gedränge
Der Zugvogel
Der Junge mit dem Vogelgesicht war Pitt schon am Hauptbahnhof aufgefallen, vor der Fahrplantafel. Er hatte den schmalen Kopf weit in den Nacken zurückgelegt, ja, seine Schnabelnase, sein ramponierter Rucksack, seine zerfetzten Jeans, erinnerten an eine Amsel, die ihr Kleid geplustert hat. Da die S 1 eingelaufen war, hatte Pitt seinen Impuls, dem jungen Mann seine Informationshilfe anzubieten, unterdrücken müssen. Er war eingestiegen, und der junge Mann war ihm gefolgt, hatte sich jedoch, umkehrend, gegen die Traube der Einsteigenden auf den Bahnsteig am Gleis 2 gedrängt, war ein paar Schritte unschlüssig hin und her gehastet und, wie von blitzartiger Eingebung erhellt, zwischen die zusammenschnappenden Türflügel in den Waggon gesprungen. Sein Rucksack hatte sich verklemmt, doch der Gefesselte hatte sich erfolgreich losgerissen und den zwei hilfreichen Fahrgästen, die sich an den Türgriffen zu schaffen gemacht hatten, mit einem verwirrten Lächeln gedankt.
Wirklich, ein Vogelgesicht. Ein dunkler, zum Hahnenkamm getrimmter Schopf mit spröden Seitenfedern und gespreizter Halskrause, eng zusammenstehende, von schweren, wimpernlos wirkenden Lidern beladene schwarze Augen, der schmallippige Mund in tiefen Wangenkerben und schwarzen Bartstoppeln eingesunken. Die Figur schmal zierlich, schier ohne Hüften, die Flamingobeine in Jeansröhren, die über den Eulenspiegelschuhen wie das Beingefieder eines Mäusebussards ausfransten.
Die vogelartige Erscheinung in seinem Blickfeld faszinierte Pitt. Sie bestätigte seine Erfahrung, dass der Mensch in seiner körperlichen Erscheinung Ausdruck eines inneren seelischen Formprinzips sei, das allen Einzelzügen vom Scheitel bis zur Sohle eine zusammenklingende, in ästhetischer Logik zusammenpassende Prägung gibt, in der kein Detail anders geformt sein könnte, ohne die Erscheinung zu stören.
Der Junge spähte zum Fenster hinaus, blickte Fahrgästen fragend fordernd und doch ausweichend ins Gesicht, schaute zur Decke und zum Boden und studierte grimassierend den Netzplan an der Decke. Hinter dem Berliner Tor holte er schließlich einen zur Losgröße gerollten Zettel aus der Brusttasche, entfaltete ihn, glättete ihn zwischen der langknochigen Hand und dem kantigen Oberschenkel und hielt ihn dem neben ihm stehenden Fahrgast vors Gesicht. Pitt konnte nicht hören, was er sagte. Der angesprochene Fahrgast schüttelte bedauernd den Kopf.
Vielleicht ein gerade eingetroffener Wanderarbeiter aus dem Ausland? Man trifft sie ja nicht selten im Nahverkehr: Sie haben einen Zettel mit einer oft unleserlichen Adresse in der Hand, hingeschmiert mit einem Bleistiftstummel, die Schrift verwischt durch häufiges Betasten. Selten finden sich Fahrgäste, die auf Anhieb einen Straßennamen mit einer S-, U- oder Busstation in Verbindung bringen können. Sie beugen sich über den Zettel, rätseln beratschlagend. Ist der Fragende im falschen Zug: wie ihm erklären, wo er aus- und umsteigen, zurückfahren, welche Linie er zu suchen oder zu erfragen habe. Das wird konfus, wenn eine Fremdsprache ins Spiel kommt. Nie erleben Menschen es schmerzlicher, keine gemeinsame Sprache zu haben, als wenn sie in die Rolle eines Fremdenführers gedrängt werden, der sie kommunikativ nicht gewachsen sind.
Auch Pitt sah sich zur Orientierungshilfe aufgerufen, hoffte aber, ein anderer Fahrgast möge sich des jungen Mannes annehmen, so wie man Ausschau hält nach einem Jüngeren, der vielleicht so sportlich ist, einem älteren Menschen den Platz anzubieten, den man selbst nicht so gern preisgeben möchte. Er fühlte sich erleichtert, als er sah, dass sich der Junge mit seinem Zettel an eine ältere Dame wandte, die, während sie in der Handtasche nach der Brille suchte, mehrere Male laut und etwas erregt fragte: „Parlez-vous français?“ Die glückstrahlende Antwort als jubelnder Vogellaut: „Oui, oui, Madame, je suis français!“ Er beugte sich zu der Dame, die sich den Anschein der Ortskunde gegeben hatte, in erwartungsvoller Haltung hinab, streifte mit seinem Hahnenkamm fast die Krempe ihres Hutes und wurde von einer leichten Bewegung der Hand, in der jetzt eine Brille lag, zurückgescheucht. Die Dame studierte den Zettel und ihre Brauen schoben sich hoch hinauf in den Hut. „Vous“, sagte sie, „vous“, noch einmal „vous“, suchte mit mahlenden, sich pressenden Lippen ein passendes Wort, suchte es irgendwo am Fensterrahmen, lächelte hilflos und unternahm laut einen neuen Anlauf in einem Geprassel platzender Silben: „vous, vous, vous …“ Vielleicht machte sie zum ersten Mal in ihrem Leben von Schulkenntnissen Gebrauch, vielleicht traute sie sich nicht, ihre in acht Semestern in intim-geselliger Runde an der Volkshochschule erworbene Geläufigkeit in der französischen Sprache auf öffentlicher Bühne zur Schau zu stellen, leider, die Hemmung blieb unüberwindbar. Angstvoll spähte der Junge mit dem Vogelgesicht in das Gesicht der Dame, die ihre Brille jetzt beschämt abweisend in die Handtasche zurückschnappen ließ. Er zog sich, rückwärts gehend, zurück: ein Vogel, vielleicht eine Ente, die vor dem Gebell eines gutmütigen Hundes unsicher das Weite sucht. Er zog sich weit aus der Gefahrenzone zurück und kam erst neben Pitts Platz zum Stehen. Stumm hielt er Pitt seinen Zettel hin. In großen Buchstaben: BALE, nichts als BALE. Was heißt BALE?
Pitt legte den krumpeligen Zettel wie ein Lesezeichen in sein Buch und grübelte. Ein Firmenname? Eine Straße eher, ja. Der karierte Zettel war ein Ausriss: sollte sich die Bedeutung von BALE aus einer verlorenen Zettelhälfte erklären? Vielleicht ein verballhorntes Blankenese, ein Ballindamm, oder? „Bale“, sagte Pitt, und er zog die Luft tief ein, als wollte er das Aroma dieses seltsamen Wortes voll auskosten. „Oui, bale“, antwortete der Junge freudig erwartungsvoll. Ein einsilbiges Wort.
„Geben Sie mal her“, sagte die Dame, die neben Pitt am Fenster saß. Sie hatte ihm ihren grauen Bubikopf, der so konzentriert in den großformatigen ZEIT-Blättern gesteckt hatte, schon während seiner Grübelei in belustigtem Lächeln zugewandt. Sie nahm den Zettel aus Pitts Buch und warf einen streng prüfenden Blick darauf. „Bale, le nom d’un hôtel, n’est-ce pas?“ und, halb Pitt zugewandt, „Basler Hof, an der Esplanade“. Der Junge mit dem Vogelgesicht, der die findige Dame anstrahlte, protestierte entgegenkommend: „Non, Madame, Bâle, Suisse!“ Die Dame nahm die Korrektur so gelassen hin, als sei sie zwischen Hasselbrook und Landwehr nach dem Weg zum Bahnhof, nicht dem nach Basel gefragt worden.
Die ZEIT-Leserin griff über Pitt hinweg, packte den jungen Mann am Handgelenk, zog ihn zu sich herüber und drückte ihn auf den ihr gegenüberliegenden Sitz. Sie überschüttete ihn mit Fragen in einem leicht hinfließenden Französisch, dem ihr offensichtliches Amüsement noch mehr Schwung verlieh. Wie beneidete Pitt seine Nachbarin! Die Antworten des Jungen, die aus seinem kaum bewegten Schnabelmund kamen, verstand Pitt nicht, nur wenn seine Nachbarin die Antworten fragend nachdenklich wiederholte oder in neuen Fragen aufnahm, konnte er dem Frage-und-Antwort-Spiel folgen. Er verstand, der Junge, ein achtzehnjähriger Koch aus Reims, sei auf dem Weg zu einem Freund in Basel, der ihm eine verheißungsvolle Stelle in der berühmten Schweizer Gastronomie in Aussicht gestellt habe. Auto-stop, hörte er. Auch wenn er sich vorstellen konnte, dass man als Anhalter – er hatte es nie ausprobiert – nicht immer die freie Wahl der Route, der Zeit, des Fahrzeugs hatte: warum jemand per Autostop von Reims nach Basel über Hamburg-Hasselbrook fährt, fand er nicht leicht begreifbar.
„Sagen Sie, der junge Mann stellt sich wohl am besten an die Autobahn, wie?“ Wahrscheinlich. Aber wo? Dass es so viele leichte Fragen gibt, die so schwer zu beantworten sind! Richtig, Autobahn. An der Auffahrt soll die Anhalterei verboten sein, hatte Pitt gehört. „Die meisten Anhalter stehen an der Raststätte Stillhorn“, sagte er, „meine ich.“ „So. Meinen Sie? Stillhorn? Wie soll er da hinkommen?“ Und laut fragte sie in den Waggon hinein: „Wie kommt man nach Stillhorn, zur Raststätte?“
Es ist in allen Großstädten, die über ein gut ausgebautes, verzweigtes, subtil verflochtenes Nahverkehrsnetz verfügen, ein beliebtes Gesellschaftsspiel an der Kaffeetafel, seltener am Stammtisch oder an der Kegelbahn, über zeitlich, räumlich und wirtschaftlich optimale Bahn- und Busverbindungen zu diskutieren. Viel Hilfsbereitschaft, viel Besserwisserei, viel Schadenfreude spielen mit, wenn es darum geht, jemandem zu beweisen, dass er das Labyrinth der Linien nicht souverän über- und durchschaut habe und der Netzlogik nicht auf die Schliche gekommen sei. Und wenn einer sich verspätete! – „hättest du doch den Bus X genommen, wärst du doch in Y umgestiegen, warum den langen Tunnel am Z?“ Zu diesem spontanen Spiel versammelten sich jetzt ein paar Fahrgäste um die Dame, den jungen Mann und Pitt und fanden nach einem nicht eben langwierigen Diskurs die beste Verbindung heraus. „Haben Sie einen Zettel?“, fragte die Dame Pitt. Der konnte sich nicht entschließen, ein leeres Blatt aus seinem Buch herauszureißen. „Also nicht.“ Sie riss aus einer der Anzeigen ihrer Zeitung einen großen Fetzen heraus, nahm Pitts Buch als Schreibunterlage zur Hand und malte groß: „Anhalter nach Basel. In die S-Bahn nach Wilhelmsburg setzen, in den Bus Nr. 13 nach Kirchdorf, Raststätte Stillhorn.“ Sie machte dem jungen Mann klar, dass er zurückfahren müsse zum Hauptbahnhof und dort seinen Wegweiser zeigen solle. Ob er eine Fahrkarte habe?
„Non, Madame, pas de billet.“ Ob er denn überhaupt Geld habe? „Non, Madame, pas d’argent“. Braucht man Geld, fragte sein Lächeln. Pitts Nachbarin hatte nur größere Scheine in ihrer Handtasche, und so kramte Pitt ein paar Geldstücke aus seinem Portemonnaie, die der Junge mit einem fröhlichen „merci“ in seine Brusttasche klingeln ließ.
Das letzte Markstück betrachtete er aufmerksam, und seine Augen verrieten schon wieder die Ratlosigkeit, die sie über seinem kryptischen Zettel gezeigt hatten. Die Szene, die Pitt erlebte, spielte im letzten Jahr der grandiosen D-Mark-Epoche, im ersten Jahr des neuen Jahrhunderts, das in Weltwährungsblöcken denkt; hätte er dem Vogelmann einen Euro in die Hand gedrückt, wäre ihm eine Überraschung entgangen.
„O Madame“, kam es verwundert aus einem runden ungläubigen Mund, „Deutschland?“
„Mehr braucht der doch nicht, oder?“, fragte Madame X.
„Est-ce que je ne suis pas Danemark donc?“
Wie gesagt, Pitt hatte gewisse Schwierigkeiten, die Gründe für die Odyssee des Jungen mit dem Vogelgesicht zu erfassen. Seine Verblüffung über die schlafwandlerische Ahnungslosigkeit, die den Jungen durch Europa führte, wich einer neuen Verblüffung: der über das unbändige Lachen seiner Nachbarin, die mit geschlossenen, wie im Schmerz zusammengekniffenen Augen die ZEIT in ihren Händen zerknüllte. Mit einem Ruck erhob sie sich: „Ich muss den jungen Mann in den richtigen Zug setzen. Erst glaubt er, er ist in Dänemark, dann landet er mir noch am Nordpol.“ Wandsbeker Chaussee. Bitte, bleiben Sie doch, wollte Pitt rufen, wie kommt der Junge in die S-Bahn nach Poppenbüttel, wenn er nach Basel will, und wie kommt er auf die Idee, dass er eigentlich in Dänemark sein müsse? Pitts Nachbarin stopfte die ZEIT in einen Kaufhof-Beutel und fasste den Jungen am Arm. „Oiseau de passage, mon petit“, sagte sie. Der Zug hielt.
„Bitte!“ Pitt war auch aufgestanden: „Was für ein Vogel, bitte?“
„Ein Zugvogel. Er hat sich verirrt. Kommt von Reims, will nach Basel, ist in Wandsbek und glaubt, er sei in Dänemark. Er hat sich verflogen.“ Im Nahverkehr erleben wir es oft, dass Menschen in dem Augenblick, in dem das Interesse an ihnen einen Höhepunkt erreicht, den Zug verlassen.
Pitt sah noch ein paar Augenblicke Madame X und dem jungen Mann, dessen Gang jetzt etwas Flatterndes hatte, auf dem Bahnsteig nach. In sein Buch fand er nicht mehr zurück. Nicht nur die äußere Erscheinung in ihren Einzelheiten, nicht nur Mimik, Gesten und Haltung, auch das Verhalten scheinen in der geheimnisvollen phänomenologischen Einheit der Person gebunden zu sein.
Die Warnung
Das Mitteilungsbedürfnis des älteren, leicht fettleibigen, etwas kurzatmigen Mannes war unverkennbar. Pitt späht bei der Suche nach einem Sitzplatz immer nach Anzeichen eines latenten kommunikativen Dranges bei den Fahrgästen: mal schreckt er ihn, mal verspricht er sich von ihm eine kurzweilige halbe Stunde. Der Mann sah Pitt offen an, nicht starrend, nicht ungeniert, in einer erwartungsvollen Versonnenheit, seine leicht tränenden Augen schimmerten in einem kontaktsuchenden Lächeln. Er musste zum Sprechen ermuntert werden, in dieser Augensprache, die Gesprächsbereitschaft signalisiert.
Der Mann beugte sich vor, schob seinen haltlos wirkenden Körper in einem Moment der Anspannung auf den Rand seines Sitzes, so dass sein Knie fast Pitts berührte, und teilte mit, eindringlich, beschwörend, vor der Wichtigkeit seiner Botschaft die Stimme zu einem Flüstern gesenkt: „Die Schutzpolizei wird abgeschafft.“
Es muss Unglauben in Pitts Blick gelegen haben, denn der Mann wiederholte, noch eindringlicher, sorgfältig und betont artikulierend, den Triumph in der Stimme, zu dem jede wirklich überraschende und wichtige Botschaft berechtigt, dass die Schutzpolizei abgeschafft werden solle.
„Davon habe ich noch nichts gehört“, sagte Pitt mit dem gutmütigen Ton in der Stimme, den man wählt, wenn man vermuten muss, ein Gesprächspartner sei nicht recht ernst zu nehmen. Der Mann blickte ihn unverwandt an. In der Gewissheit der Wahrheit und Dringlichkeit seiner Botschaft wartete er auf Wirkungen, die ihn noch nicht zu befriedigen schienen. Er wusste schon, dass er einen Köder an der Angel hatte, nach dem sein noch gleichgültiges Gegenüber schnappen würde.
„Wer will denn die Schutzpolizei abschaffen?“
„Der Senat. Ein schrecklicher Senat. Der schlechteste, den es gibt. Die Schutzpolizei will er abschaffen!“
„Vielleicht haben wir ja wirklich zu viele Polizisten?“ Pitt ist ein unverbesserlicher Parteibürger und wollte eine Maßnahme des Senats rechtfertigen, von der er noch gar nichts wusste.
Der Mann warf sich in dramaturgisch geschickter Entrüstung gegen die Rückenlehne. Aus seinen wässerigen Augen rann ein Tropfen Nasses über die lilageäderte Wange hinab zum Mundwinkel, in der sich eine leicht schaumige Feuchtigkeit gesammelt hatte. „Polizisten zuviel? Mörder, Räuber, Mädchenschänder – davon haben wir zuviel! Viel zu wenige Polizisten. Und jetzt wird die Schutzpolizei abgeschafft. Dieser Senat!“
Eine große Neigung, die Sorge des Mannes zu zerstreuen, verspürte Pitt nicht. In seinem parteilichen Engagement hatte er oft genug an den Infoständen in den Einkaufspassagen und auf den Marktplätzen das halb beleidigte, halb verschwörerische Perorieren von Weltverbesserern, von Kassandren aller Art, von Monomanen, die zum Gespräch unfähig sind, ertragen müssen. Er hatte sich schon auf seine Zeitung konzentriert und sagte in gespielter Geistesabwesenheit: „Niemand will die Schutzpolizei abschaffen.“ Wirkungsvolle Abwehr: der Mann blieb still.
In Hoheneichen setzte sich ein junger Mann neben den alten mit seinem brodelnden Wissen. Der Ankömmling wurde mit dem Verlangen eines Mitteilsamen von der Seite gemustert, doch er bot keine Chance für einen Blickkontakt. Pitt sah, wie sich der ältere Mann langsam an den jüngeren heranschob. Die Grenze – die Körper berührten sich fast – wurde respektiert. Der Mann mit der Botschaft zog eine stramm gefaltete Zeitung aus der Innentasche seines Blousons. Er hielt sie, als wolle er seinen Nachbarn mit ihr in die Rippen stupsen. Der junge Mann warf einen schrägen Blick auf ihn.
„Die Schutzpolizei wird abgeschafft. Wussten Sie das schon?“ Er fächerte mit der sich entrollenden Zeitung vor dem Gesicht des jungen Mannes, der den lästigen Arm unbeeindruckt beiseite schob. „Das ist ja großartig!“ Der Arm mit der Zeitung sank in einer Geste der Mutlosigkeit. Der Mann drückte seinen Körper an die Fensterlehne. Pitt hatte mit dem jungen Mann kurzen, verständnisinnigen Blickkontakt.
Eine Frau, die schwer an ihrer Tasche trug, setzte sich ab Ohlsdorf neben Pitt. Sie wollte die Tasche unter dem Sitz verstauen, was sich als unmöglich erwies. Der Mann nahm die Tasche, stellte sie ans Fenster und sagte strahlend: „Hier ist Platz!“ Die Frau dankte ihm mit einem herzlichen Lächeln. „Die Schutzpolizei wird abgeschafft. Wussten Sie das schon?“ Der Mann genoss die Wirkung seiner Worte. „Nein?“ Große, ungespielte Überraschung. „Abgeschafft. Die Polizei?“
Der Mann lehnte sich befriedigt, mit hoheitsvoll gerecktem Rücken zurück. „Der Senat! Der schlechteste, den es gibt. Er schafft die Schutzpolizei ab.“
„Ja, wo gibt es denn so was! Die Polizei kann doch nicht abgeschafft werden.“ Der Mann sah seine aufnahmebereite Gesprächspartnerin wohlwollend an. „Nicht die Polizei“, sagte er nachsichtig, „die Polizei wird nicht abgeschafft. Nur die Schutzpolizei.“ „Nur die Schutzpolizei?“ „Nur? Nur? Denken Sie an die Mörder, die Räuber, die Mädchenschänder! Natürlich, die Verkehrspolizei – die brauchen sie noch, die wird nicht abgeschafft.“
„Nicht. Gott sei Dank! Mein Schwiegersohn ist bei der Verkehrspolizei. Das wäre ja schrecklich, wenn die abgeschafft würde.“ Die Frau sah den Informanten dankbar herzlich an. „Die sichere Arbeit, die schöne Pension! Das hätte ich meiner Tochter ja gar nicht erzählen können.“ Bis Barmbek versuchte die Frau wiederholt, den Mann über die Vorteile aufzuklären, die einer hat, wenn er bei der Verkehrspolizei und nicht bei der Schutzpolizei ist. In verzweiflungsvoller Stummheit blickte der Mann über sie hinweg, wohl hoffend, der Platz würde bald für einen neuen Gesprächspartner geräumt werden. Pitt dachte über den Begriff der Schutzpolizei nach, mit dem er nichts anzufangen wusste. Aus seiner Kindheit konnte er sich an die Schupos mit den hohen, schwarzglänzenden, den Hinterkopf so bizarr auswölbenden Tschakos erinnern, aber die hatten doch auch den Verkehr geregelt? Der Mann nickte ein paar Mal ergeben, doch es interessierte ihn nicht, dass der Arbeitsplatz eines Schwiegersohns sicher sei.
In Barmbek Fahrgastwechsel. Neben Pitt saß nun ein jüngerer Postbeamter, in ein Kreuzworträtsel vertieft. Der mitteilsame Mann starrte auf die Rätselzeitung. Seine Erfahrung schien ihn belehrt zu haben, man könne jedermanns Aufmerksamkeit erzwingen, wenn man auf seine Zeitung oder auf sein Buch blickt; diese magische Nötigung wirke stärker als der Laserblick im Nacken. Doch der Postbeamte hielt das aus. Er heftete seine Augen gelegentlich auf ein Plakat, als suchte er dort eines vier- oder fünfbuchstabigen Rätsels Lösung. Wenn Pitt sogar in die Versuchung geriet, ihm seine Unterstützung anzubieten – wie mochte es dann dem Mann zumute sein, der immer unruhiger wurde, schweratmend seufzte und schließlich, etwa ab Friedrichsberg, Unverständliches murmelte. Auch damit rief er nicht die Zuwendung des Postbeamten hervor. Die Spannung wurde lastend, ja lästig, und Pitt erwog, seinerseits dem Postbeamten mitzuteilen, dass die Schutzpolizei – offenbar – abgeschafft werden solle.
Ab Hasselbrook fand der Mann einen neuen Sitznachbarn, der die gleiche Zeitung aufschlug, die unter seinem unförmigen Blouson knitterte. Als der Neue umständlich seine Zeitung zur Lektüre handlich machte, sprang ihm der Mann ins Blatt: „Die Schutzpolizei wird abgeschafft. Da.“
„Wie? Wo?“
„Da oben. Links. Darüber wird schon lange verhandelt.“
Gemeinsam lasen die Nachbarn die Nachricht über die Abschaffung der Schutzpolizei, die nur kurz zu sein schien, auf keinen Fall der Bedeutung der verhängnisvollen Entscheidung angemessen. „Rationalisiert“, sagte der Mann mit der Zeitung, „nicht abgeschafft.“
„Da lacht doch jeder!“ Tatsächlich lachte der alte Mann, schüttelte dabei, betroffen von so viel Ahnungslosigkeit, heftig seinen Kopf. Rötete sich das Gesicht nicht bedenklich in seiner wabernden Erregung? Erstickt, prustend: „Rationalisiert, ja, so nennt man das. Der Senat. Dieser Senator. Kennen Sie den?“
„Ja, denk’ ich doch – “
„Das ist ein Sozi. Die brauchen Geld für ihre Propaganda. Sie holen es sich bei den Wachen, schaffen die Wachen ab. Rationalisiert! Lachhaft. Glauben Sie das?“
„Ich glaube gar nichts.“ Das kam knapp und abweisend, das war das Fallbeil aufs kommunikative Band. Entspannt, friedlich, sanft erklärte der Zurückgewiesene: „Der Senator lässt sich beraten bei seiner so genannten Rationalisierung. Von wem? Na, von wem? Lesen Sie genau!“
Blickte der stumme Leser noch einmal auf die Nachricht oben links? Er brauchte es nicht. „Er lässt sich beraten von Amerikanern und Juden!“ Der Mann mit der Zeitung wehrte unwirsch ab. Doch jetzt sah der alte Mann, dass sein erster Gesprächspartner wieder auf ihn aufmerksam geworden war. Es klang jetzt wie eine Ansprache an eine große Allgemeinheit: „Beraten lässt er sich von Amerikanern und Juden. Knight Wegenstein. Unternehmensberatung, dass ich nicht lache. Die schwatzen den dummen Sozis die Revierwachen ab, die versprechen ihnen Geld für ihre Propaganda und dann machen sie uns fertig.“ Die leicht ruckelnden, schuckelnden Schultern sollten das unbändige Lachen symbolisieren, mit denen man solche Rosstäuschermethoden zurückweisen müsste.
„Die Sozis machen uns fertig?“
„Die Mörder, die Räuber, die Mädchenschänder. Fertig machen die uns. Wenn sich keiner mehr auf die Straßen traut, dann …“ Der Mann befeuchtete aus dem Reservoir der Mundwinkel noch einmal die Lippen, die er in einer furchteinflößenden Grimasse gegeneinander wetzte – „dann kommen die Russen.“
Doch der Mann mit der sensationellen Nachricht schien die Russen gar nicht zu fürchten. Kein Wort über die Folgen ihrer Invasion. Kein Versuch mehr, die beiden Gesprächspartner durch unerhörte Nachrichten weiter zu erschrecken. Das Aufklärungswerk war getan. Der Mann hatte die Arme über den Blouson verschränkt, als wolle er der Kommunikation ein Ende setzen. Der Kopf bewegte sich leicht nicht nur im Fahrtrhythmus, das Gesicht wirkte hell und bewegt nicht nur wegen der durch die Baumkronen am Bahndamm gesprenkelt hereinfallenden Sonnenstrahlen. Er wirkte zufrieden. Pitt blickte ihn forschend an, in der Hoffnung, noch mehr Phantastisches über die mörderische Allianz zu erfahren. Kein Wort mehr, die Wahrheit war am Licht. Der Mann stieg am Berliner Tor aus. Ohne eine letzte Warnung, ohne einen Appell an die öffentliche Wachsamkeit, stieg einfach aus, grußlos.
Pitt sah die blechfarbene Fassade des Polizeihochhauses in seiner drohenden Gitterarchitektur und bedauerte, dass dieser Anblick den Mann, der sich um die Schutzpolizei sorgte, nicht mehr beruhigen konnte. Vielleicht war er ja auch ausgestiegen, um hier in der Bannmeile dieser unübersehbaren Schutz- und Trutzburg gegen die Mörder, Räuber und Mädchenschänder seine verdienstvolle Aufklärungsarbeit fortzusetzen. Eine Bahnfahrt lang hatte er das Glück, die Qual, die Befriedigung der Meinungsfreiheit erlebt, wieder einmal, wie gewiss schon oft. Wieder einmal hatte er sich von Ahnungslosen und Gleichgültigen belächeln lassen, war er abgewiesen, war er zurückgestoßen worden. Sprechen die modernen Philosophen nicht vom kommunikativen Handeln? Er hatte es versucht. Dass seine Mitreisenden sich auf die Warnungen nicht eingelassen haben – so ist das eben, die werden schon sehen.
Eine Schuldfrage
Deutschland einig Vaterland lag noch in der Ferne, es ereignete sich gelegentlich auf Bahnsteigen, auf denen Wiedersehen gefeiert wurden. Zwei Frauen, Rentnerinnen, in ein Schwarz gekleidet, das ihre vollen weichen, knitterigen Gesichter nonnenbleich erscheinen ließ, offenbar Schwestern, hatten sich nach langer Zeit wiedergesehen aus dem Anlass, der das Schwarz verlangt. Um 17 Uhr 35 war auf Gleis 4 der D-Zug aus Dresden eingelaufen, um 17 Uhr 45 war die S-Bahn von Gleis 3 ausgelaufen. Pitt hatte den Koffer der Dresdner Schwester auf den Gepäckhalter gehoben, und die beiden Frauen saßen ihm gegenüber, erleichtert, erschöpft, erregt von der Begegnung auf dem Bahnsteig, von der Spannung des Ankommens. Auch hatte es wohl ein Missverständnis über den Treffpunkt gegeben. Sie lächelten Pitt zu, weil er ihnen geholfen hatte, aus dem Gedränge des Bahnsteigs sicher in das imaginär abgeschirmte Stübchen der S-Bahn zu gelangen.
Ein Todesfall hatte die Schwestern nach drei Jahren wieder einmal zusammengeführt. Der Mann der Hamburger Schwester war gestorben, schon am übernächsten Tag, 12 Uhr, war die Beerdigung auf dem Ohlsdorfer Friedhof. Da die Witwe das Hamburger Abendblatt vom Vortag aus der Tasche nahm und mit ihrem Finger auf die beiden Anzeigen unten rechts wies, konnte Pitt zuhause den Namen und den Beruf des Verstorbenen, der nur 64 Jahre alt geworden war, recherchieren. Kapelle 13 – das machte Pitt hellhörig. Dieses Areal des angeblich größten Friedhofs der Welt würde auch für das Pittpaar einmal die Endstation sein. Die Dresdner Schwester war in der Anzeige auf zwei Namen in der Liste der Trauernden gestoßen, die ihr nicht vertraut waren, und so gewann Pitt an seinem halben Ohr auch Einblick in genealogische Bewandtnisse.
„Aber Wilma, den musst du doch kennen, weißt du noch, auf der Silberhochzeit von Gretel, der Kleine, der immer so lustig ist. Karl und Ewald waren abends noch da gewesen, die spielen freitags immer Skat, und Lotti kommt dann auch immer mit, damit ich nicht so allein dasitze. Wir haben ferngesehen. Um elf habe ich gesagt, dass sie aufhören sollen, die können nie ein Ende finden, um halb zwölf haben sie aufgehört, und Henry, der ist so abgespannt gewesen, das hat mich so beunruhigt, das ist sogar Ewald aufgefallen. Ich bin richtig ärgerlich geworden, weil Henry nicht ins Bett wollte, und dann hat er sich noch vor den Fernseher gesetzt. Ich bin ins Bett gegangen, ich habe ihn immer gerufen, zweimal bin ich noch aufgestanden, und dann habe ich noch gehört, wie er sich ein Bier aus dem Kühlschrank geholt hat, der schließt nicht richtig, weißt du, den hört man in allen Zimmern, so knallt der, dann bin ich richtig wütend geworden, so abgespannt und dann so unvernünftig. Aber er muss es wohl geahnt haben. Er wollte nicht ins Bett, das kenne ich gar nicht von ihm, der kuckt nie fern so spät, auch wenn gute Filme laufen. Ich muss wohl eingeschlafen sein, ich weiß auch nicht, ich kann sonst nicht schlafen, wenn Henry in der Stube sitzt, ich hatte sogar noch das Licht brennen. Dann bin ich aufgewacht, um zwei. Ich habe eine richtige Wut gekriegt, weil Henry immer noch nicht im Bett war. Ich bin in die Stube, und da hat Henry im Sessel gesessen, und der Fernseher war noch an, der flimmerte nur so, na, ich habe gedacht, Henry ist eingeschlafen, ich habe ‚Henry‘ gerufen, ‚kommst du wohl endlich‘, und dann habe ich ihn an der Schulter geschüttelt. Da habe ich gleich gemerkt, dass was nicht stimmt, er hat so komisch dagesessen, das kann ich dir gar nicht beschreiben, und dann habe ich gesehen, dass er die Augen offen hatte. Henry, habe ich gesagt, du, und er hat nichts gesagt, nur so ein bisschen, wie soll ich sagen, geseufzt, das hat er noch nie gemacht. Er hat sich überhaupt nicht bewegt, nur die Hand ist hochgekommen, als wenn er sich bei mir festhalten wollte, und die Augen haben sich bewegt. Ich habe so einen Schreck gekriegt. Ich habe gleich gewusst – Wilma, das war so furchtbar, der große, starke Mann, und kommt nicht hoch aus dem Sessel und kuckt immer so. Ich habe meine Arme um seinen Rücken gelegt, ich wollte ihn hochziehen, aber das ging nicht, und da hatte ich das Gefühl, dass ich ihm weh tue dabei. Wilma, du kannst dir das nicht vorstellen. Ich allein mit Henry, in der Wohnung, mitten in der Nacht, ich wusste gar nicht, was ich tun sollte. Ich komm gleich wieder, Henry, habe ich gesagt, mach dir keine Gedanken, dann habe ich den Morgenmantel angezogen, ich habe noch gedacht, ob er mich überhaupt noch hören kann, und bin runter zu Wiebkings, die wohnen unter uns, weißt du, die kennst du doch, er ist immer so freundlich, wir haben doch kein Telefon. Ich konnte gar nichts sagen, da ist er mit raufgekommen, er hat nur gesagt ‚schnell einen Arzt‘, aber er hat gleich den Rettungswagen gerufen. Ich habe Henry immer gestreichelt, ich wusste gar nicht, was ich einpacken sollte, aber Herr Wiebking hat gesagt, das ist nicht so wichtig. Ich glaube, hat er gesagt, Ihr Mann hat einen Schlaganfall, haben Sie nur keine Angst, das ist alles nicht so schlimm heute, er muss nur gleich ins Krankenhaus, die kriegen das wieder hin. Sein Vater hat auch einen Schlaganfall gehabt und nachher sogar wieder im Garten gearbeitet. Ich habe immer nur leise Henry, Henry gerufen, und einmal habe ich gefühlt, dass er mich gehört hat. Seine Augen, Wilma, seine Augen! Ob er wohl gewusst hat, was passiert ist? Herr Wiebking sagt, nein, der Arzt sagt auch nein. Der Arzt vom Rettungswagen hat gar nichts gemacht, nur so gekuckt. Ich habe immer die Hand von Henry festgehalten, ich wollte ja mit, aber der Arzt hat gesagt, das hat keinen Zweck, ich sollte morgen früh kommen und sollte mir keine Sorgen machen. Ich habe kein Auge zugekriegt, und als der Wagen weggefahren war, habe ich nur gedacht, ob ich ihn wohl noch einmal zu sehen kriege. Herr Wiebking hat Gerti angerufen, aber die hat sich nicht gemeldet. Wilma, das war eine schreckliche Nacht, so was wünsche ich keinem. Ich habe immer gedacht, wärst du doch bloß nicht ins Bett gegangen. Henry ganz allein in der Stube, so abgespannt wie der war, und ich im Bett, und dann passiert das, und Henry sitzt da ganz allein und kann sich nicht bewegen.“
Im Nahverkehr gibt es den Zwang zum Zuhören, nicht erst seit dem Anbruch der Smartphone-Ära. Soll man aufstehen und sich einen anderen Platz suchen? Man kann sich noch so stark auf die Zeitung konzentrieren und sie hochhalten, als errichtete man eine akustische Schutzwand, auch ein Buch kann noch so fesselnd sein, das Gespräch, das man mit seinem inneren Selbst oder mit einem anderen führt, mag noch so anregend sein: du wirst in das Gespräch der Fremden hineingezogen. Laute, Lärm und Stimmen sind die aufdringlichsten Eindrücke, die unsere Sinne treffen, nichts gibt es, um sie vor ihnen zu schützen. Wo artikuliert gesprochen wird, wo eine Melodie oder ein Rhythmus sich akzentuiert zur Stelle meldet, kannst du die tönenden Elemente nicht durcheinanderschütteln wie Scrabble-Lettern im Beutel, denn im Synapsenwirbel unseres Hirns gewönnen sie blitzschnell ihre Gestalt zurück und würden dich heimsuchen in ihrer grellen Unmissverständlichkeit. Ist das unfreiwillig Gehörte gar der Monolog einer verzweifelten Stimme und hat er ein Thema, das in seiner Menschlichkeit tief vertraut ist, bist du zum Zuhören verurteilt. Vielleicht überschreitest du die Grenze zur Taktlosigkeit nur dann, wenn du ihn oder ein Gespräch im Geiste protokollierst. Doch aufdringlich kann ein zufälliges Dabeisitzen nicht sein. Du musst nicht fliehen, wenn du im öffentlichen Raum, der nirgendwo Wände hat, in den privaten Kreis hineingezogen wirst und sich plötzlich eine Intimsphäre vor dir auftut wie die Seitenkapelle des Doms mit den betenden Menschen, die der Tourist in seiner profanen Ahnungslosigkeit auf seinem Rundgang unversehens betritt.
Pitt will aber gestehen, dass seine Aufmerksamkeit – oder war es Neugier? – hochgradig war. Während die Witwe mit ihrem Taschentuch die Nasenflügel betupfte und dabei weitersprach, sah sie ihn an. Sie musste sehen, dass er ihrem Gespräch lauschte, ob unwillentlich oder nicht. Hatte sie die Stimme gesenkt, das Gesicht etwas näher an das Ohr der Schwester geführt, um das Zuhören der Anderen zu erschweren oder zu signalisieren, sie wünsche, in ihrer privaten Kommunikation allein gelassen zu werden? Dass sie den Lauscher an der unsichtbaren Wand verurteile? Sie sah nicht nur Pitt an, während sie das Tüchlein in die Tasche steckte, auch andere Fahrgäste, die hinübersahen zu den schwarzgekleideten Frauen mit Blicken und Mienen, die verrieten, auch sie seien teilnehmende Zuhörer. In den Bussen und Bahnen des Nahverkehrs kann man oft beobachten, vor allem bei den Schülerinnen, die sich Wochenenderlebnisse oder Aufregendes aus der Disco- und Partywelt erzählen, dass der Zuhörerkreis zielstrebig über die zufälligen Gesprächspartner hinaus ausgeweitet wird.
Die Witwe hatte erzählt, wie sie nach vergeblichen Versuchen, ihre Tochter in der Nacht zu erreichen, am frühen Morgen ins Krankenhaus Barmbek gefahren war, wie es ihr, nach langem Warten und empörenden Zurechtweisungen doch schließlich gelungen sei, mit Hilfe eines Arztes zu ihrem Mann vorzudringen. „Er hat noch genau so gekuckt wie in der Nacht. Die Augen haben sich bewegt und die Hand. Ich habe ihm die Hand gestreichelt, ich habe geglaubt, er hat mich erkannt. Er hat immer so gekuckt. Seine Stirn war ganz feucht. Ich habe ein Handtuch gesucht, dann habe ich mein Taschentuch genommen, ganz vorsichtig. Henry hat immer nur so gekuckt, einmal habe ich geglaubt, dass er seinen Mund bewegen wollte, aber ich weiß nicht. Wenn ich nur wüsste, ob er mich erkannt hat. Ich habe gesagt, dass es mir so leid tut, dass ich so ärgerlich war und wenn ich gewartet hätte, wenn ich nicht gleich eingeschlafen wäre, wenn ich in der Stube geblieben wäre, das habe ich ihm alles gesagt, aber ich weiß wirklich nicht, ob er mich gehört hat. Der Arzt sagt ja, er wäre bei vollem Bewusstsein, nur Sprechen, das geht nicht, aber das könnte besser werden, er hätte schon viele Fälle gehabt, wo’s besser geworden ist, auch wenn das jetzt gar nicht gut aussieht. Henry, habe ich gesagt, Henry, kannst du mich hören, Gerti kommt auch, sie war nicht zu Hause. Soll ich dir was mitbringen, Henry, brauchst du was? Ich habe immer seine Hand gestreichelt, und Henry hat immer so gekuckt, genauso wie im Sessel. Wilma, du kannst dir das nicht vorstellen, nicht zu wissen, ob dein Mann dich versteht. Vierzig Jahre, im Mai sind wir vierzig Jahre verheiratet, am zehnten, er ist nie krank gewesen, nur einmal mit dem Blinddarm, und als das mit dem Arm war, und jetzt, wo’s so schlimm ist, sitze ich rum und weiß nicht, was ich machen soll. Weiß nicht, ob er mich hört. Ich habe ihm immer die Stirn abgetrocknet. Bis die Schwester kam, ich wollte aber noch nicht weg. Wenn er mir doch gezeigt hätte, dass er mich erkennt. Wir haben uns nie gestritten, das weißt du doch, Wilma, ausgerechnet Freitag, wo er schon krank war, er sagt, abgespannt, aber das war schon der Anfang, ich hab’s nicht wissen können. Ich wäre doch nicht ins Bett gegangen, ich hätte doch nicht mit ihm geschimpft. Vielleicht war er wütend, dass ich so ärgerlich war, aus Trotz ist er sitzengeblieben, wo er doch sonst nie fernsieht so spät. Den Fernseher kann ich gar nicht mehr sehen in der Stube, der soll da weg, da stelle ich die Blumenbank hin. Gerti habe ich noch gar nichts gesagt, von unserem Streit, was würde sie denken, ich habe es doch nur gut gemeint, ich kann doch nicht wissen, dass Henry so krank ist. Der Arzt sagt, das kommt ganz plötzlich, das weiß man nie vorher, aber er war auch schon so abgespannt. Ewald hat gesagt, Henry war ganz normal beim Skat, er hat sogar gewonnen, Gott, war der versessen auf Skat, davon konnte er nie genug kriegen. Vielleicht wenn sie weitergespielt hätten, wenn ich nichts gesagt hätte vom Aufhören. Das macht doch nichts, wenn sie bis zwölf spielen, aber Henry war doch so abgespannt, er musste doch seine Ruhe haben. Die Schwester hat dann gesagt, ich müsste jetzt gehen. Ich habe Henry noch einen Kuss gegeben, er hat das wohl gar nicht gemerkt.“
Die Witwe sprach weiter, die Schwester hörte zu, ohne viel zu sagen, nickend, kopfschüttelnd, Überraschung oder Bekümmerung auf dem Gesicht. Es hatte Schwierigkeiten mit der Krankenkasse gegeben, es war von Rente die Rede, es ging um das Dekor der Beisetzungsfeier, auch um gewisse Differenzen, die sich daraus zwischen Mutter und Tochter ergeben hatten und durch die Einmischung des Schwiegersohns verschärft worden waren.
Der Schuldvorwurf blieb allgegenwärtig, lugte aus jedem dritten Satz, drängte sich in Andeutungen in jede Sequenz der gleichförmig sprudelnden Erzählung, hielt alle Ereignisse in feinster Spur zusammen wie der rote Faden in den dicken Schiffstauen der britischen Marine. Der ließ sich auch durch beschwichtigende Einwendungen der Schwester nicht durchschneiden. Im Verhältnis zu denen, die wir lieben und für die wir Verantwortung tragen, fühlen wir uns wie kleine Götter: wir meinen, dass unser Tun und Unterlassen, unsere Gefühle und unsere Wünsche in mächtiger Ursächlichkeit auf das Leben der uns anvertrauten Menschen wirken, ihren Weg beeinflussen, und in der Zufallskette der Gründe, die einen unserer Lieben in eine katastrophale Situation zerrt, meinen wir, in unserem Tun ein besonders wichtiges, gewichtiges Glied sehen zu müssen, ohne das sich die Dinge ganz anders entwickelt hätten. Wir glauben immer, reichlich größenwahnsinnig, der schwere Tropfen zu sein, der das Fass zum Überlaufen bringt. Wir sind es nicht. Wir sind Elemente in der Welle der Wirkungen, die eine Existenz umfließen. Sofern wir guten Willens sind.
Da war dieser Gewissensbiss: diese nicht aus dem Sinn zu bannende Tatsache, dass die Frau nach vierzigjähriger Ehe unter Verletzung aller Gewohnheitsgesetze, verstimmt darüber, dass der Mann ihr nicht ins Bett gefolgt war, ihn allein in der Stube hatte sitzen lassen, schlimmer noch, eingeschlafen war, ohne sich um den Mann zu kümmern, ihn, dessen Abgespanntheit ihr hätte zu denken geben müssen, vor der nahenden Katastrophe im Stich gelassen hatte, wobei nicht auszuschließen war – auch diesen Verdacht deutete die Witwe an und sie würde ihn in zwei, drei Tagen oder auch nach einem Jahr gewiss krass aussprechen –, dass die Verärgerung des Mannes über die Verärgerung der Frau eine Ursache des Zusammenbruchs gewesen sei, vielleicht die Ursache überhaupt, wenigstens ein den natürlichen Prozess negativ beeinflussender Faktor, denn man darf ja in Herz und Hirn keine kleinen Maschinen sehen, sondern sie sind empfindliche Gefäße der Seele, in denen Wirbel nie ohne Wirkung, ja Strafe entfacht werden.
Indem die Witwe unablässig ihr als schmerzlich empfundenes Versagen in entscheidender Stunde vergegenwärtigte, wuchs der Gedanke der Schuld, und der stille Selbstvorwurf hatte längst den Grad offener Selbstbezichtigung vor einem öffentlichen Tribunal erreicht. Vielleicht hatte er schon die Trauer verdrängt. Uns fehlt der Begriff für die Trauer, die sich mit Schuldvorwürfen mischt. Sie ist die traurigste Trauer, die sich am längsten das Labsal des Vergessens versagt. Nicht der Tod des Mannes, die Trauernde selbst war zum Problem geworden. Pitt zweifelte nicht, in ihrer Schilderung des Todesweges vom Sessel in der Stube bis in den Sarg Zeuge einer Selbstanklage geworden zu sein, die alle Welt einlud zu urteilen, zu richten und – diese Hoffnung blieb – zu verstehen und zu verzeihen.
In Ohlsdorf wurden die Reisenden in diesem verkürzten Zug aus Richtung Altona durch den Lautsprecher aufgefordert, den Zug zu verlassen, um am gegenüberliegenden Gleis auf den Zug nach Poppenbüttel zu warten. Pitt hob den Dresdner Koffer aus der Ablage und trug ihn hinaus. Die meisten Fahrgäste, die in Ohlsdorf den Zug wechseln müssen, bewegen sich auf dem Bahnsteig nicht von der Stelle – das hastige quirlige Wechseln der Waggons gibt es erst seit der Eröffnung der Strecke zum Flughafen Fuhlsbüttel. Auch Pitt blieb stehen, obwohl er gewöhnlich bis zur Litfaßsäule geht, weil dort der letzte Waggon hält, von dem aus es an der Endstation Poppenbüttel nur ein paar Schritte zum Treppenaufgang sind. Er trug den Koffer aus Dresden wieder in den Wagen und verstaute ihn über den Sitzen, auf denen er zwanglos in der Nähe der alten Damen Platz nehmen und seine Zeitung als Tarnmaske aufschlagen konnte.
Herr Wiebking hatte Gerti gegenüber seiner Verwunderung Ausdruck gegeben, den Vater noch mitten in der Nacht im Sessel vor dem Fernseher gefunden zu haben, und auch Ewald hatte sich erstaunt darüber gezeigt, denn die Skatrunde hatte doch schon, wegen des Unwohlseins des Hausherrn, gegen 11 Uhr ihr frühes Ende gefunden. Der Zug war ausgelaufen und rollte nun am hohen Zaun des Ohlsdorfer Friedhofs entlang, wo der Blick in seine Rumpelkammer fällt, auf Gartengeräte, Schuppen, Fahrzeuge, den Steinbruch der abgelegten Grabmale, die Gärtnerei, die Komposthaufen der welken Kränze, wo er aber auch über die Baumkronen hinweg auf den Turmgiebel des Krematoriums trifft, und, vor allem bei Sonnenschein, angezogen wird von den goldglänzenden Ziffern der Uhr, auf der der Zeiger zweimal täglich über ein schimmerndes Memento mori läuft, das die Phantasie jedes Vorüberfahrenden in Bewegung setzt. EINE VON DIESEN – sind Stunden gemeint, Minuten, Sekunden? Jeder Tod ist ein Sekundentod. Der Zeiger ruckt, ruckt, ruckt, bewegt im Ineinander von drängenden Federn und hemmender Unruh, und plötzlich steht er. Der Zeitbegriff in seinem beklemmenden Ausdruck: eine von diesen. Es könnte, wenn das große Ziffernblatt genug Platz bieten würde, auch heißen: du kannst nicht entrinnen, deine Stunde ist dir bestimmt.