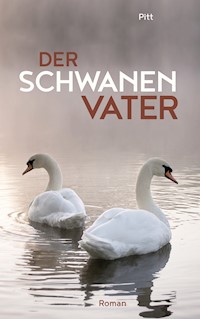Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Das Schlüsselwort Sorge: Von großer Vielfalt sind die Erscheinungsformen der Sorge, die das Leben begleitet, von seinem Anfang bis zu seinem Ende. Unsere Sprache kennt viele Wörter, in denen sich die Sorge in Gefühlen und Gedanken, im Tun und Planen ausdrückt. Im Zusammenleben wie im Leben des Einzelnen ist die Sorge ein Grundwort der Lebensgestaltung und -meisterung. Ebenso vielfältig sind die Formen des Dienens, die der Sorge umsichtig tätig begegnen. Kätchen Einsporn ist in ihrer Familie und in ihrem hauswirtschaftlichen Beruf eine Dienerin der alltäglichen Sorge. Im Alter wird die allein stehende Frau, die stets um ihre Unabhängigkeit gekämpft hat, selber ein Sorgenfall, und sie wehrt sich dagegen, es zu sein.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 307
Veröffentlichungsjahr: 2014
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
„Sorge ist immer …Besorgen und Fürsorge“
Martin Heidegger, Sein und Zeit §41
Inhaltsverzeichnis
Eins: Die Schilder
Zwei: Die Schlüssel
Drei: Die Tasche
Vier: Der Stein
Ein wirklich notwendiges Vorwort
Im Jahr unserer goldenen Hochzeit haben wir Pitt beauftragt, den Roman des Dienens zu schreiben, auf der Basis von Informationen, die wir ihm vermittelt haben. Dieser Autor ist qualifiziert für die Aufgabe, denn er hat schon den Roman einer gemeinwirtschaftlichen Dienstleistungsgruppe, ein Buch über den Staatsdiener Goethe und eine Studie über die Redenschreiber, den dienenden Beruf schlechthin, geschrieben. Natürlich ist auch ein altes Ehepaar wie wir berufen, mit dem Autor über das Dienen nachzudenken, denn eine Lebensgemeinschaft kennt natürlich auch das wechselseitige Dienen.
Die Protagonistin des Romans ist, wie in vielen dienenden Berufen früher und heute, nicht verheiratet, und das hat Pitt angeregt, mit unserem Buch auch ein Lebenszeugnis für einen Single, dessen Weg immer von starkem Eigensinn geprägt ist, zu schreiben.
Wer erinnert sich an den NDR-Dokumentarfilm „Nachrede auf Klara Heydebreck“? Wir haben Eberhard Fechners Meisterwerk vor über fünfzig Jahren einmal gesehen und es nie wieder vergessen. Ein Wunder. Wir haben die Bilder dieses so sorgfältig rekonstruierten Lebens einer unscheinbaren Frau Pitt als Muster empfohlen.
Wir haben ihm noch ein anderes Buch in den Rucksack gesteckt: „Sein und Zeit“ (14. Auflage, Tübingen 1977) von Martin Heidegger, der vor 125 Jahren geboren wurde. Die Dienerinnen und Diener sind Spezialisten der Sorge, die in Heideggers Werk einen Zentralplatz einnimmt („Das Sein des Daseins ist die Sorge“, § 58). Was ist ein philosophisches Werk, wenn man es nicht in die Alltäglichkeit von Sein und Zeit am Kleinen Schäferkamp herunterbrechen kann?
Pitt hat unseren Auftrag gern angenommen. Denn er war als junger Mann einmal Technischer Berater der Gewerkschaften in zwei Internationalen Arbeitskonferenzen der Genfer ILO. Und die hat nach fünfzig Jahren, auf ihrer 100. Tagung, das Übereinkommen Nr. 189 über menschenwürdige Arbeit für Hausangestellte beschlossen, das von Deutschland 2013 ratifiziert worden ist. Mit ihr werden all die lebensnotwendigen fürsorglichen Tätigkeiten – wie Putzen, Kochen, Einkaufen, Betreuung von Kindern und Alten und unendlich viel mehr – als Arbeitsfeld mit klaren Regeln und Ansprüchen aus dem „Schattendasein ins Rampenlicht internationaler Politik“ (DGB-Vorsitzender Michael Sommer) geholt. Es ist zu hoffen, das alle Staaten der Welt das Übereinkommen ratifizieren, damit die Schutzrechte für die Helferinnen und Helfer des Haushalts, deren Arbeit, wie die ILO sagt, „nach wie vor unterbewertet und unsichtbar“ ist, überall wirksam werden und die vielerorts an Sklaverei grenzende Ausbeutung und die Unsicherheit sorgender Menschen auf prekären Arbeitsplätzen beendet wird.
Armin und Waltraut Peter
Die Schilder
1
„Hat dagegen das Bedrohlicheden Charakter des ganz und gar Unvertrauten,dann wird die Furcht zum Grauen“.
Sein und Zeit § 30
Saskia Thormählen schaute zurück auf die Tür, die sie nie wiedersehen würde. „Ich habe das Schild vergessen“. Sie hatte die Wohnung besenrein gemacht, hatte nur einige Lampen, Vorhänge und Gardinen zurückgelassen, weil der neue Mieter, das junge türkische Paar, sie darum gebeten hatte. An das Schild, draußen an der Tür, hatte sie nicht gedacht.
Aus der Fensterluke in der Dachschräge fiel die wirbelige Sonnensäule in das dunkle Treppenhaus und ließ das Messingschild in Gold leuchten: Friedrich Einsporn, Schneidermeister. „Das Schild nehme ich mit“. Der Blechkasten mit den Werkzeugen, die in einer Vier-Zimmer-Wohnung gebraucht werden, war gestern vom Trödler abgeholt worden. In ihm hatte der lange Schraubenzieher gelegen, mit dem sie den von den Feuerwehrleuten verbogenen, halb abgerissenen Türbeschlag entfernt hatte. Sie blickte auf das glänzende Schild, das der unsichtbare Beleuchter anstrahlte wie vor dreißig oder vierzig Jahren, wenn sie die drei steil gewundenen Treppen hinaufgestürmt war und das magische Signum der großväterlichen Herrlichkeit, dessen Reinheit die Großmutter durch tägliches Polieren bewahrt hatte, sie zu einem respektvollen Stillstand nötigte.
Saskia musste die Arme hoch anwinkeln, damit der Koffer und die Tasche mit den Papieren der toten Tante nicht auf die hohen Stufen schlugen. An der Tür des Ehepaars Lopez, das die Matratzen aus der Wohnung über ihm übernommen hatte, klingelte sie. Der Schäferhund, der seinen durchhängenden Bauch immer so Mitleid erregend über die Stufen schleppt, schlug heiser an, doch niemand kam an die Tür. In diesem Haus konnte sie nur die Familie Lopez um einen Schraubenzieher bitten. Die anderen Hausbewohner mochte sie nicht fragen, denn die hatten teilnahmslos, in vulgärer Neugier, in ihren Türen gestanden, als vor sechs Wochen die Feuerwehrmänner und das Polizistenpärchen die Treppen zur Wohnung der Tante hinaufgepoltert waren, um die Tür aufzubrechen.
Sie suchte in ihrer Umhängetasche nach dem Nageletui und nahm die Feile heraus. Ihre Spitze passte in den Schlitz der Schraubenköpfe, als der verkrustete Putzschmutz von Jahrzehnten, auch mit Hilfe des Daumennagels, herausgekratzt war. Mit Mühe ließen sich die Schrauben im Holz bewegen. Das Schild pendelte an der letzten Schraube, und Saskia sah einen fingerlangen Papierstreifen. Im Flur war es jetzt so dunkel, dass sie die Schrift auf ihm nicht entziffern konnte. Sie löste die letzte Schraube aus dem Holz, legte das Schild behutsam auf die Matte, schaltete das Flurlicht ein und las die Aufschrift des verborgenen Schildes: Kätchen Einsporn, Hauswirtschafterin.
Der Zettel war mit dem hellen Lack unter dem ornamental prunkvollen Schild verschmolzen. Saskia konnte den Streifen nicht abziehen, sie behauchte ihn, wie es der Großvater getan hatte, wenn er seine Briefmarken vom Kuvert löste, nahm die Feile zur Hilfe, doch die hatte sich in den Schlitzen der widerständig verwurzelten Schrauben schartig verformt. Es tat ihr weh, die Schildminiatur unter dem Prunkschild des Handwerksmeisters zerstören zu müssen. Der neue Mieter, die Familie Zukra, würde mit ihrem Schild den zerkratzten Fleck überdecken.
Im Foyer, dessen braungelb marmorierte Wandfliesen dem Vandalismus der Zeit besser widerstanden hatten als die Haustür, öffnete sie das verbogene Türchen des Briefkastens, nahm die Prospekte heraus und entfernte das Namensschild „K. Einsporn“ unter dem Plexiglas. Der Name neben dem Klingelknopf draußen war zur Unleserlichkeit zerkratzt – „soll der Hausmeister ihn herausnehmen“.
Auf dem Parkplatz, dem Trümmergelände einer ehemaligen Tankstelle, stellte Saskia Thormählen vor der Müllhalde noch einmal ihr Gepäck ab. Hier war der einzige Standort, von dem sie über die Kronen der Eschen hinweg einen Blick auf die Wohnung im dritten Stock des Hauses Kleiner Schäferkamp 15 hatte. Den Balkon hatte die Tante nie betreten, denn sie hatte seine Tür durch meterhohe Stapel vieler Jahrgänge des doppelbändigen Hamburger Telefonbuchs zugemauert. Am Fenster hatte sie gesessen, wenn sie zum Abschied gewinkt hatte.
Wie eine lange Verschollene war Kätchen Einsporn erst vor wenigen Jahren in Saskias Leben getreten. Die älteste Schwester ihrer Mutter hatte nach dem Tod der Großmutter Einsporn, vor dreiundzwanzig Jahren, mit ihrer Familie gebrochen. So ein Bruch, halb Rückzug, halb Angriff, vollzieht sich nicht selten in Familien. Vielleicht hätte Saskia den Kontakt zur Dissidentin der Familie gesucht. Doch sie wohnte seit langem in Wiesbaden, und Hamburg war ihr auf die Siedlung in Berne geschrumpft, in der ihre Mutter lebte. Eine Fremde war ihr die Tante am Kleinen Schäferkamp nicht, wenn auch ihr Name in der Berner Stube, in der die Mutter mit den Familien ihres Bruders und einer jüngeren Schwester die Geburtstage feierte, selten genannt wurde. Auch Saskia hatte diesen Ausgrenzungskonsens nie in Frage gestellt, aus Gleichgültigkeit, und dachte sie einmal an die Tante, die ihr aus ihrer Kindheit vertraut war, so empfand sie Sympathie für sie und ihre kantige Sturheit, die von den Verwandten als Kriegswille wahrgenommen wurde.
Die Beisetzung der Mutter, vor sechs Jahren, hatten Nichte und Tante in der Kapelle 13 des Ohlsdorfer Friedhofs im „Seehof“ am Bramfelder See zusammengeführt. In der Kapelle hatte Kätchen Einsporn in einer der hinteren Reihen gesessen. Am Grab hatte sie Saskia nicht angesprochen, und Saskia musste ihren Lebensgefährten, den Pitt, bitten, ihr hinterherzulaufen, um sie in den „Seehof“ zu bitten. Sie wunderte sich immer noch darüber, dass die Tante der Einladung aus dem Munde des ihr unbekannten Mannes, der sie als „Tante Käte“ angesprochen hatte, gefolgt war. Erst während des Mittagessens hatte Saskia, die sich als Gastgeberin einer großen Trauergesellschaft überfordert fühlte, ihre Tante begrüßt. „Das finde ich lieb, dass du zu Muttis Beerdigung gekommen bist“. Sie traute sich nicht, die alte Dame, die sich an einen fast leeren Tisch gesetzt, ihren Kamelhaarmantel mit dem Trauerflor am Ärmel nicht abgelegt und die Hände überm Bügel der großen Handtasche auf ihrem Schoß verschränkt hatte, an den Familientisch zu bitten. Niemand aus der Familie half ihr, die Sperre von Fremdheit zu durchbrechen. „Ich werde doch wohl zur Beerdigung meiner Schwester gehen!“ hatte die Tante gesagt.
Erst als die Suppe aufgetragen worden war, hatte Saskia die Tante bewegen können, ihren Mantel abzulegen und ihn dem Pitt in die Hände zu legen. Der hatte sich, amüsiert, dem steinernen Gast als Tischherr angeboten. Sie saß da in ihrer distanzierenden Frostigkeit, und jeder Blick, jeder Anflug eines krampfhaften Lächelns, der vom Familientisch zur ihr hinüberwanderte, war mit einem deutlichen Vorstrecken des Kinns beantwortet worden. Das einzige, was die Gesellschaft von ihr hörte, war das Klappern des Bügels ihrer Tasche, wenn sie das Taschentuch hineinlegte. Das Angebot eines der Neffen, sie nach Hause zu fahren, hatte sie abgelehnt. Doch als Saskia am nächsten Tag die Tante anrief, hörte sie zu ihrer Überraschung, dass ihr Besuch willkommen sei.
Vor drei Jahren hatte Saskia begonnen, das leer stehende Elternhaus in Berne umzubauen. Die Arbeiten an dem alten Haus, das nicht nur modernisiert, sondern auch erweitert werden sollte, waren kompliziert und zogen sich in die Länge, und auf ihren Fahrten in die Stadt, auf der Suche nach Einkaufsquellen für die Ausstattung, nach nervenden Gesprächen mit den Handwerkern und dem Architekten, war sie häufig zur Tante auf eine Tasse Tee hinaufgesprungen.
An ihrem 85. Geburtstag hatte Kätchen Einsporn ihrer Nichte von ihrem Fenster aus zum letzten Mal nachgewinkt. Es war ein Zeichen der Schwäche gewesen, dass sie an ihrem Geburtstag die Wohnung nicht verlassen wollte. Saskia hatte sie zu einer Bootsfahrt auf der Alster und einem Essen in einem der Restaurants am Ufer eingeladen. Den Geburtstag im Jahr davor, im frühen Juni, hatten sie noch auf einem Ausflug nach Schulau zum Willkomm Höft gefeiert, und sie hatten lange im krächzenden Lärm der Nationalhymnen zum Gruß der ein- und ausfahrenden Schiffe unter der weittragenden feierlichen Stimme des Lautsprecherkapitäns gesessen. Saskia hatte sich über die Gesprächigkeit der alten Frau gefreut, wenn auch der Nachmittag in einem Misston ausgeklungen war: nein, einladen, das komme nicht in frage. „Ich zahle immer selbst“.
An einem Augustabend in Altenahr, müde von einem langen Marsch auf dem Rotweinwanderweg, einem Essen und ungewohntem Weingenuss, hatte Saskia die Tante angerufen, wie sie es an jedem Tag tat. Die Tante hatte sich nicht gemeldet. Oft war es vorgekommen, dass sie den Hörer abgenommen und ihn nach einem Moment des Lauschens ohne einen Laut aufgelegt hatte. Der Schock eines tagelangen wortlosen Telefonterrors, dessen Urheber sie bei feindseligen Nachbarn vermutete, wirkte immer noch nach, aber auch das Misstrauen, dass eine beginnende Schwerhörigkeit schürt, hatten sie vor ihrem Apparat stumm gemacht. Doch den Hörer hatte sie immer abgenommen.
In der Weinstube Altenahrs hatte Saskia den Gedanken an ein Unglück verscheucht, und sie war darin durch ihren Lebensgefährten bestärkt worden, der gemeint hatte, die Wunderlichkeit alter Leutchen sei kein Grund, einen Sommerabend mit Sorge zu beladen. Am Morgen hatte es wieder keine Reaktion auf ihr Läuten gegeben, auch mittags nicht. Saskia telefonierte mit den Johannitern in Hamburg. Mit ihnen war Kätchen Einsporn auf Saskias Anraten durch einen SOS-Ruf, ein Signalgerät, verbunden. Die Johanniter hatten keinen Ruf empfangen.
Saskia hatte an die unbenutzten Geräte in der Wohnung am Schäferkamp gedacht, an den ewig stummen neuen Fernsehapparat, die nie berührte Waschmaschine, den leeren Kühlschrank. Eine neue Telefonanlage hatte Saskia kürzlich installieren lassen, der eine Regulierung der Lautstärke erlaubt und statt der Wählscheibe die Tastatur hatte. Ob die Tante ihre Abneigung gegen die Vehikel einer für sie nutzlosen Modernität auf das Telefon übertragen hatte?
Auf dem Heimweg nach Wiesbaden, während des Essens im Kloster Maria Laach, das auf ihrem Reiseprogramm stand, hatte Saskia noch einmal telefoniert, vergeblich. In Wiesbaden hatte sie am Nachmittag ihren größten Koffer vollgestopft, nach kurzem Zaudern auch das dunkle Kostüm hineingelegt und sich von ihrem Lebensgefährten nach Frankfurt fahren lassen, um dort den ICE nach Hamburg zu nehmen.
Sie klingelte. „Tante Käte!“ rief sie. Sie schlug mit den Handballen gegen das Holz, sie rief durch den verstopften Briefkastenschlitz. Das Ehepaar Lopez stand unten an der Treppe. „Wir haben Frau Einsporn seit einer Woche nicht mehr gesehen“. Ungläubig starrte Saskia auf die beiden hinab. Seit sieben Tagen! Es sei ihre Absicht gewesen, rief Frau Lopez, Saskia zu verständigen, wenn sie bis Montag von der alten Dame nichts gehört hätten. Saskia trommelte mit beiden Fäusten gegen die Tür. Schon einmal, während ihres letzten Besuchs vor drei Wochen, hatte sie klingelnd, pochend, rufend vor der Tür gestanden: die Tante hatte lange nicht geöffnet, als Saskia von einem Einkauf zurückgekommen war. Einen Schlüssel hatte die Tante Saskia nicht überlassen.
Aus der Lopezschen Wohnung rief Saskia den Johanniter-Dienst. Der Zivildienstleistende hatte den Schlüssel, konnte aber nicht öffnen, da der von innen steckende Schlüssel das Schloss blockierte. Herr Lopez hatte schon Hammer und Stemmeisen in der Hand. Nein, das müsse die Feuerwehr tun, wusste der Zivi, auch sei die Polizei zu rufen.
Ein Hieb auf das unter die Tür geschobene Eisen hatte genügt, um den Riegel aus der Fußleiste heben und die Flügeltür aufdrücken zu können. „Sie bleiben hier stehen“, sagte der ältere Feuerwehrmann, „da kann man sich manchmal erschrecken“. Durch die Tür sah Saskia das Licht in der Schlafkammer aufscheinen. „Hab’ keine Angst, Tante Käte“, rief Saskia, „ich bin es, Saskia, ich will dich besuchen“. Da hörte sie die Stimme der Tante. In diesem Augenblick wusste Saskia, dass sie erwartet hatte, ihre Tante tot vorzufinden.
Wie lange hatte die Greisin vor ihrem Bett gelegen? Zwei Tage, drei Tage? War sie gefallen? Verletzt war sie offenbar nicht: sie stand zwischen den beiden Feuerwehrmännern, die sie an den Unterarmen stützten. Sie hatte die Steppdecke vom Bett zu sich auf den Boden gezogen, hatte auf ihr gelegen oder sich in sie eingehüllt. Sie trug ihr Nachthemd. Vielleicht war sie gar nicht gefallen, vielleicht hatte sie sich vor das Bett gelegt, auf den schmalen Gang zwischen dem Kleiderschrank und dem Toilettentisch, der am Fußende der an die Wand geschobenen Doppelbetthälfte stand. „Es hat geklopft. Es hat immer geklopft. Von oben“. Mehr sagte die Tante nicht.
„Muss das denn sein?“ blaffte Saskia die junge Polizistin mit den kindlichen blonden Kräusellocken unter der Mütze an, die ohne Regung auf die dürre, verstörte Greisin geschaut und Saskia zum dritten Mal aufgefordert hatte, ihren Personalausweis zu zeigen. „Sie müssen sich ausweisen, wir wissen ja nicht, wer Sie sind“. Als ich geklingelt, gerufen, geklopft habe, ist sie bei Bewusstsein gewesen, dachte Saskia, sie hat nicht geantwortet, weil sie sich fürchtete. Die kleine SOS-Box der Johanniter war nirgendwo zu sehen: sie hat sie nie auf der Brust getragen, dachte Saskia, als sie endlich den Ausweis in ihrer Umhängetasche gefunden hatte.
Kätchen Einsporn lag auf ihrem Bett und schlürfte das Leitungswasser aus der Tasse in den ausgedörrten Körper. Während sie mit der rechten Hand die Tasse führte, umklammerten die knochig überlangen Finger der Linken den Bügel der Handtasche, die an der Wand stand.
„Wir gehen“, sagten die Feuerwehrmänner, „wir können nichts mehr tun hier“. Saskia protestierte: ob sie nicht sähen, wie schlecht es ihrer Tante gehe, sie müsse ins Krankenhaus, sofort. Die Frau sei kein Fall fürs Krankenhaus, ein paar Tage Pflege, gut essen und trinken und sie sei wieder in Ordnung. „Und das können Sie entscheiden!“ – das könnten sie, solche Fälle sähen sie oft genug. „Aber in ihrer Wohnung kann die alte Frau nicht bleiben, das sehen Sie ja“, sagte der jüngere Mann, hob schnüffelnd die Nasenflügel und kickte ostentativ angewidert die Brotrinden, die auf dem Linoleum des Flurs lagen. Das Polizistenpärchen nickte.
„Saskia!“ rief die Tante. „Sind die Menschen weg? Wer war das?“ Ihre Stimme war etwas fester. „Es klopft. Von oben“. Saskia hörte Geräusche aus einer Nachbarwohnung, die wahrscheinlich renoviert wurde. „Das sind Handwerker nebenan. Ich bin jetzt da“.
Die Notärztin war sehr schnell gekommen. „Lassen Sie das!“ rief Kätchen Einsporn, als die Ärztin ihren Körper, der in einer verdreht starren Haltung auf dem grau-grobwandigen Laken lag, bewegen wollte, um nach Verletzungen zu tasten. „Es ist nichts, nur ein bisschen Pflege. In welcher Krankenkasse ist Ihre Mutter?“ Wohl AOK. „Das wissen Sie nicht?“ Der Vorwurf war unüberhörbar, doch Saskia erklärte nicht, dass die alte Frau nicht ihre Mutter sei. Verzweifelt suchte sie nach Argumenten, um die Ärztin zu bewegen, die Tante in ein Krankenhaus zu überweisen. „Aufpäppeln. Das können sie besser als jedes Krankenhaus. Oder können Sie sich nicht um Ihre Mutter kümmern?“
Saskia stand vor dem Vertiko auf dem Flur und überlegte, wie sie aus dem grotesken Lebensmittelvorrat, der sich in Dosen und Paketen auf ihm türmte, eine Mahlzeit zubereiten könnte, die einer schier verhungerten uralten Frau bekömmlich wäre. Die Greisin saß auf der Bettkante und wollte aufstehen. „Es klopft. Es klopft von oben“. Saskia musste alle ihre Kraft, die sich in der Erregung der letzten Stunden aufgezehrt hatte, aufbieten, um den zerbrechlich angespannten Körper auf das Bett zu drücken. Die Tante war in einen Halbschlaf gesunken, ihre Lippen bewegten sich. Sie stirbt, dachte Saskia.
Wieder wählte sie die Nummer der Feuerwehr. „Ihre Tante ist kein Notfall. Wir brauchen eine ärztliche Einweisung ins Krankenhaus“. Noch einmal der notärztliche Dienst: eine teilnahmsvolle, warm-väterliche Stimme, die nach Ereignissen und Symptomen fragte. Dieselbe Ärztin erschien, und sie hatte ihre erste Entscheidung überdacht. „Wir bringen Sie ins Krankenhaus, Frau Einsporn, nur für ein paar Tage, bis Sie wieder zu Kräften gekommen sind“. Kätchen Einsporn war hellwach, und ihre grauen Augen, die klein und tief in den umdunkelten Höhlen lagen, funkelten zornig. „Ich will nicht ins Krankenhaus. Es klopft. Es klopft von oben“. Die Ärztin schrieb die Einweisung. „Es warten so viele Patienten“, sagte sie entschuldigend, als Saskia sie bat, bis zum Eintreffen des Krankenwagens zu warten.
Die jungen Männer unternahmen nur einen einzigen Versuch, die alte Frau aus ihrem Bett zu heben. „Lassen Sie das, lassen Sie das!“ rief die Tante und krallte die rechte Hand ins Laken, „ich will nicht ins Krankenhaus, ich habe Sie nicht gerufen“. Ohne die Einwilligung der Patientin kein Transport, sie könnten niemand zwingen. „Und wenn sie bewusstlos wäre?“ rief Saskia empört. „Das ist offensichtlich nicht der Fall, wir können sie nicht zwingen. Wir sind keine Menschenräuber“. Der junge Mann schlug sich auf den Mund, als die alte Frau rief: „Räuber! Räuber!“
Sie wird sterben, dachte Saskia. Man hatte sie allein gelassen mit einer Sterbenden. Wie soll ich sie füttern? Sie wird nichts essen. Von drei Schlucken Leitungswasser nach Tagen des Dürstens und Hungerns kann ein Körper nicht leben. Ich müsste sie waschen. Ihre Augen maßen die Entfernung zwischen den Türen der Schlafkammer und des Bads. Es war spät geworden an diesem Sonnabend am Kleinen Schäferkamp, elf vorüber. Nirgendwo würde sie Hilfe finden, wenn die Kranke, von ihren Klopfalben gepeinigt, das Bett verlassen, straucheln, stürzen, sich verletzen würde: sie würde sie nicht tragen können. Saskia fühlte sich erschöpft und todmüde. Musste sie wachen am Bett der Verwirrten? Die Wohnungstür ließ sich nicht verschließen, die Sperrkette war zerrissen. Sie fror, und es trieb sie dennoch dazu, das Fenster in der Küche weit zu öffnen. „Saskia, bis du da? Es klopft. Es klopft von oben“.
Saskia hatte das Licht ausgeschaltet und sich auf den Stuhl, auf den harten Ledersitz, die schnörkeligen Stäbe kantig im Rücken, ans Fußende des Bettes gesetzt. Schläft Tante Käte? Der Blick aus dem Kammerfenster ging an schwarzen fensterlosen Schachtwänden entlang, ehe er ins Freie fand. Dort stand der Fernsehturm in seinen blinkenden und statischen Rotlichtern, bekränzt von der weißstrahlenden Plattform des Restaurants, in dem Saskia vor Jahren einmal mit ihrer Tante gesessen und ihr die Fenster ihrer Wohnung gezeigt hatte. Der lange Tag lag schwer in den Beinen und Armen. Schläft sie? Ja, es klopfte: jemand nagelte Leisten, auch ein Gerumpel wie von einem Schrankrücken und das Klappen von Türen waren zu hören. War da nicht ein Getrappel auf dem Dachboden?
2
„Als Sorge ist das Daseinwesenhaft sich-vorweg“.
Sein und Zeit § 68
Das golden schimmernde Namensschild am hellen Eichensarg war nicht viel breiter, nicht viel höher als das Zettelchen an der Tür im Kleinen Schäferkamp, das wohl dreißig Jahre lang unterm Schild des Schneidermeisters Einsporn verborgen war. Es leuchtete in der Septembersonne. Vier Personen, die hinter dem Sarg hergingen, sahen es, nach einem langen Leben das erste Schild, das Kätchen Einsporn offen als Inhaberin einer Wohnung auswies: sie hatte es an eine Tür schrauben lassen, die sie nie mehr öffnen müsste.
Eine winzige Trauergemeinde: Pastor Kaminski von der Christuskirche, Saskia Thormählen und ihr Lebensgefährte, der Neffe Joachim Einsporn, der Mitarbeiter des Bestatters und die Träger zählen wohl nicht. Fast gleichzeitig, um 13 Uhr, waren die drei Autos auf der Mittelallee vor der Kapelle 13 eingetroffen. Saskia war durch das Erscheinen ihres Vetters überrascht worden, denn die Tante hatte mit seinem Vater bis zu seinem Tod in einem besonders grimmigen Zwist gelegen. Sie war froh über seine Teilnahme, beginnt doch eine richtige Gemeinde mit dreien.
Pastor Kaminski hatte in einem Seitenraum der Kapelle 13 den Ornat angelegt, und aus einem anderen Seitenraum kam die Rollbahre mit dem Sarg, an beiden Seiten geschoben von je drei Männern in stattlichen faltreichen Talaren mit weißen gehäkelten Schultertüchern und Baretten. Man hätte sie für althanseatische Senatoren halten können, hätten die wallenden Kostüme die zerknautschten Hosenbeine und das ausgetretene Schuhzeug verdeckt.
Der Sarg war mit rot-weißen Nelkengebinden geschmückt. Der Träger bewegten sich rhythmisch gemessen, und wäre der in ein schwarzes, von Silberbrokat verziertes Festgewand gehüllte Wagen in der Fichtenallee nicht ab und an über aufgeworfene Platten und Baumwurzeln ins Holpern geraten, hätte man meinen können, der Sarg würde von den würdigen, in ihren Mantillen hängenden Männern getragen. Im gesprenkelten Licht, das aus dem Geäst fiel, flackerte der Glanz des Schildes: Kätchen Einsporn. Zwei Eichhörnchen im grauen Trauerkleid blickten, die Pfoten erhoben, aufmerksam herüber.
Saskia Thormählen hatte ihre Tante in ihrem Vorhaben bestärkt, als die ihr kurz nach ihrem 84. Geburtstag am Telefon gesagt hatte, sie habe im Hamburger Abendblatt gelesen, immer mehr Leute schlössen mit den Bestattungsunternehmen Verträge über ihre Beisetzung ab: das wolle sie auch tun. Spontan hatte Saskia gesagt: „Ich helfe dir, warte noch, bis ich wieder in Hamburg bin“. Ihr war eingefallen, dass die Bestattungsvorsorge ja wohl vor dem Ernstfall zu bezahlen sei, und sie hatte die Tante behutsam gefragt, ob sie ihr Planbegräbnis bezahlen könne. „Das Geld hab’ ich“, hatte die Tante gesagt, nicht ohne eine Spur der Entrüstung. So saß Saskia ein paar Wochen später mit ihrer Tante dem Bestatter gegenüber, der fachmännisch sachlich die bebilderten Angebote in seinen Katalogen beplauderte.
Beklommen hatte sie im Gesicht der Tante nach Zeichen von Irritation oder Betroffenheit gespäht, doch das volle, faltenlose Gesicht der alten Frau hatte in geschäftiger Erregung geglüht, und die grauen kleinen Augen hatten den Bestatter gnadenlos kritisch durchbohrt, als es um die Massivität des naturhellen Eichensargs mit den galvanischen Gussbeschlägen ging, um die Stabilität der Verschraubungen und Truhenfüße, um die Qualität der Sargeinlage und die Eigenschaften von Laken, Kissen, Decke und Sterbehemd. „Ja, sechs Träger, im schwarzen Chorrock, ja“. Die Ruhezeit für das Grab der Eltern, in das sie einziehen wollte, musste verlängert werden: mindestens bis zum Jahre 2018, hatte sie vorgerechnet, wenn sie noch in diesem Jahr sterben würde. „Das wäre doch günstig für Sie?“ – aber der Bestatter war milde lächelnd auf die Frage ausgewichen, wie sie es mit der Trauerfeier halten wolle. „Wozu?“ hatte die Kundin gefragt, „ich bin allein“.
Die Grabrede sollte der Pastor von der Christuskirche halten. Seinen Namen wusste sie nicht. Saskia hatte eingewandt, der sei nicht zuständig, sie gehöre zur Gemeinde der Gnadenkirche, und deren Pastor gratuliere ihr doch seit vielen Jahren brieflich zum Geburtstag. „Schreiben Sie auf, der Pastor von der Christuskirche, sonst mach ich keinen Vertrag“. Kann man einen nicht zuständigen Pastor verpflichten? hatte sich Saskia gefragt und geschwiegen. Nachdem die Frage des Sargschmucks, auch des Gruftschmucks, geklärt und die vielfältig fällig werdenden Gebühren erläutert, der Service zur Erledigung aller Formalitäten beschrieben worden waren, hatte der Bestatter seiner Kundin ein Kärtchen gegeben, auf dem zu lesen war, dass im Falle des Ablebens seiner Inhaberin das Beerdigungsbüro Bock zu verständigen sei: das solle sie am besten an ihren Personalausweis heften. „Mein Beerdigungsausweis“, hatte Kätchen Einsporn gesagt und sich verärgert über den neuen Plastikausweis gezeigt, der es ihr nicht erlaube, den Beerdigungsausweis in die Kennkarte hineinzulegen, wie das bei den alten Klappheftchen möglich gewesen wäre.
Kätchen Einsporn unterschrieb den Vertrag, faltete ihn und legte ihn mit dem Ausweis in ihre Handtasche. „Der Vertrag wird aber erst gültig, liebe Frau Einsporn, wenn die Kosten bezahlt sind. Es sind fast elftausend Mark, Frau Einsporn“. Der Bestatter hatte Saskia angeschaut und seine Blicke durch die Wohnung wandern lassen, und Saskia hatte ihre Tante angeschaut: sie erwartete den Ausdruck eines Erschreckens im Gesicht der Tante. Die aber blätterte in den Katalogen, als suchte sie noch eine Tapete für den Flur, nachdem sie für die Stube das richtige Muster gefunden hatte, und sagte: „Das regele ich mit meiner Sparkasse. Heute“.
Der Bestatter hatte einen Steinmetz für den Grabstein empfohlen, der ebenfalls im Wege des Vorsorgevertrages zu beauftragen war. „Das Schild“, sagte Tante Käte, „auf dem Sarg muss ein Schild sein. Kätchen Einsporn, mein Name“. Selbstverständlich. Mit den besten Wünschen für Gesundheit und Zufriedenheit und mit dem Dank für das entgegengebrachte Vertrauen hatte sich der Unternehmer verabschiedet. Der Zwölf-Uhr-Schlag der Wanduhr in seiner Big-Ben-Melodie begleitete ihn bis zu Tür. „Eine von diesen“, dachte Saskia, als die Tür zuklappte und die Tante energisch den Schlüssel drehte. Eine von diesen: so steht es unter der Turmuhr am Krematorium des Ohlsdorfer Friedhofs, die man aus der S-Bahn am Ohlsdorfer Bahnhof sehen kann. Saskia war froh gewesen, dass die Tante den Vertrag abgeschlossen hatte. Sie ist ein Willensmensch, hatte sie gedacht, sie lässt nicht gern andere für sich entscheiden. Ich werde auch einen solchen Vertrag abschließen. Später.
Der Bahrwagen kreuzte jetzt den Weg, an dem Saskias Eltern ruhen. Dort hatte sich Kätchen Einsporn vor sieben Jahren mit ihrer toten Schwester versöhnt. Halt! wollte Saskia den Trägern zurufen, wir machen einen kleinen Umweg, rechts herum. Aber die Träger schauten auf den Bestatter, der dem Sarg voraus schritt, weil er den Weg zum Grab kannte. Saskia sah die Birke, die ihr viele Jahre lang den Weg zum Grab der Großeltern im eng besiedelten Gräberfeld gewiesen hatte, sie erblickte die Myrtenhecke links neben dem Stein, die bei ihrem letzten Besuch so ausgewuchert war, dass sie versucht hatte, sie mit den Fingern und der Nagelschere zu stutzten, wobei die Nägel zersplittert waren und die Schere sich verbogen hatte. Die Blumen, dachte sie, ich hätte noch viel mehr Blumen bestellen müssen, unsere Kränze werden den hässlichen Lehmhügel nicht bedecken. Die Tante hätte wohl gesagt: „Das sieht doch keiner“. Saskia lächelte, und Pitt lächelte auch. Sie blickte auf die Wälle der Rhododendren, die den Friedhof im Frühjahr mit Blütenwogen überschwemmen: dann wäre das Grab der Tante schon mit den Blumen bepflanzt, wie sie es vertraglich mit den Genossenschaftsgärtnern vereinbart hatte.
Zum ersten Mal nahm Saskia an einer Beisetzung ohne eine Trauerfeier teil. Die Feiern für ihre Eltern hatte sie gestaltet. Ende der fünfziger Jahre war der Vater jung verstorben, der Kapitän und Reeder Petersen, um dessen Sarg sich eine unüberschaubare Trauergemeinde in der Kapelle 13 versammelt hatte, zum Largo und dem Air, und dem Pastor hatten die Repräsentanten des seemännischen Lebens mit ihren Nachrufen assistiert. Knapp drei Jahrzehnte später hatte ein großer Familien- und Freundeskreis von der Mutter Abschied genommen. Ein Single, dachte Saskia, ein absoluter Single, seit dem Tod der Großeltern, Mitte der sechziger Jahre, hat er allein gelebt. Bis in ihr siebzigstes Jahr hatte die Tante gearbeitet, aber Kolleginnen, Freundinnen aus dieser Zeit wird es nicht gegeben haben. Der Arbeitsplatz, der fremde Haushalt, ist nicht kontaktgeneigt. Vertraute Nachbarn sind ausgestorben, die neuen fremd. Wer mit 85 stirbt, ohne Matriarch zu sein, ist vergessen, für den ist ein Geleit von drei, vier Menschen groß.
Saskia erkannte, dass sie eine Rolle im späten Leben ihrer Tante gespielt hatte, vielleicht eine wichtige. Sie war Familie, Bekanntenkreis, ja die auf eine Person geschrumpfte Gesellschaft gewesen. War sie dieser Rolle gerecht geworden? Na schön: ihre gelegentlichen Besuche am Kleinen Schäferkamp, ein gemeinsamer Gang in die Stadt mit kleiner Ruhepause auf einer Bank oder im Eiscafé in Planten un Blomen, eine Alsterfahrt, ein Autoausflug nach Ohlsdorf, an die Elbe oder an die Ostsee. Einmal hatte Saskia den Versuch unternommen, die Tante mit ihrer jüngsten Schwester, die als Witwe in Buxtehude lebte, zu versöhnen, war einfach mit ihr in das Reihenhaus gefahren – „wir wollten mal hereinschauen“ –, aber uralte Konflikte waren nach kurzem, bemühten Gespräch so leidenschaftlich-heftig aufgebrochen, dass an eine Übernachtung, auf die sie gehofft hatte, nicht zu denken war und sie sich schließlich mit der zornbebenden Tante in der Dunkelheit auf die Straße gesetzt sah. Ein Single, ein absoluter Single. Sie hat zufällig noch eine Nichte, hat auch noch die Teilnahme eines Neffen gefunden, der seine Tante als Konfirmand zum letzten Mal gesehen hat: das ist die Trauergemeinde von – immerhin – drei Personen, und ein Pastor, der am Grab nicht ohne Ergriffenheit seinen Dienst versieht.
Diesen Mann bewunderte Saskia. Als Gesandter seiner christlichen Gemeinschaft steht er unerschrocken vor einer in sozialer Gleichgültigkeit zerfallenden Welt. Er hebt sein Gesicht vor der Grube ins Weite, als spräche er zu einer großen Schar. Pastor Kaminski hat die Tote nicht gekannt. Oft wird es ihm so ergangen sein: die Gemeindemitglieder haben sich in Listen verflüchtigt, aus denen sie nur im Tode auferstehen. Sie sind getauft, konfirmiert und haben ihre Kirchensteuer bezahlt, und auch das häufig nicht. Er holt die Toten zurück in die Gemeinschaft in einem Augenblick, in dem sie sie unwiderruflich verlassen haben. Diese Tote zu seinen Füßen gehörte nicht einmal zu seiner Gemeinde, aber er hat nicht einen Augenblick gezögert, den Abschiedsdienst zu übernehmen, als Saskia ihm erklärt hatte, warum die Tote an ihrer Christuskirche hing.
Der Pastor spricht den unbekannten Christenmenschen in seinem Sarg mit seinem Namen an: Kätchen Einsporn, nicht weil er auf dem Schild am Sarg zu lesen war, sondern weil er in einer Taufe empfangen worden ist. Er hat sich bei Saskia über das Leben der alten Frau kundig gemacht, und so kann er jetzt an ein hartes Arbeitsleben, an Pflichterfüllung und Disziplin, an die Tapferkeit der Lebensführung im Alleinsein erinnern, kann er die Konsequenz eines Lebens beschwören: siebzig Jahre, achtzig, wenn es hoch kommt, Mühe und Arbeit, und vom Köstlichen dieses Lebens spricht er leise, tonlos, als sei in diesem schönen, unglaubwürdigen Wort ein Geheimnis gebunden, das sich nur in der Zwiesprache mit der Toten enthüllt. Er spricht – einmal sagt er sogar „Frau Einsporn“ – mit dem alten Single, als habe er in seiner Kirche in jeder Predigt nach ihm Ausschau gehalten. Wem sagt er das alles? – den drei Trauergästen? Er sagt es der Toten, er stellt ihr ein Zeugnis aus, ein gutes, das man vorzeigen kann, wer weiß, wo.
Saskia Thormählen hatte manchmal mit dem Gedanken gespielt, auszutreten aus der Kirche. Gut, dass ich es nicht getan habe, man darf doch einen Pastor in seiner heroischen Sorge um den in die kleinste Zelle eingesperrten Menschen am Kleinen Schäferkampf nicht allein lassen. Die Hortensienblüte, die sie in die Grube wirft, hätte sie am liebsten dem Pastor Kaminski geschenkt.
Der Vetter Joachim, ein vielbeschäftigter Anwalt, blieb – man hatte sich lange nicht gesehen – noch ein Stündchen im „Seehof“. Seine Mutter, die von Saskia vom Tode ihrer Schwägerin verständigt worden war, hatte ihre Söhne über den Tod der Tante mit den Worten „Zur Beerdigung muss keiner von uns gehen“ informiert. Aber Joachim Einsporn war gegangen, aus Pietät gegenüber seinem verstorbenen Vater, dem Bruder der Toten, vielleicht auch bewegt von dem archaischen Gefühl, in der männlichen Linie der Einsporns das Familienhaupt darstellen zu müssen.
„Ich finde es schön, dass du gekommen bist“, sagte Saskia. „Sie ist zur Beisetzung meines Vaters nicht gekommen“, sagte Joachim Einsporn, als wollte er das Fernbleiben der übrigen Familienmitglieder entschuldigen. „Doch“, sagte Saskia, „sie war da, später“. In der Handtasche der Tante hatte sie einen Brief der Friedhofsverwaltung als Antwort auf ein Auskunftersuchen der Tante gefunden, ihm beigefügt war ein Wegweiser des Kapellenfeldes 9, auf dem das gesuchte Grab des Bruders schraffiert worden war. „Sie ist da gewesen, das ist sicher“. Saskia war davon überzeugt, dass die Tante auch an der Beisetzung des Bruders teilgenommen hatte, in einiger Distanz irgendwo hinter einem Grabmal oder einem Rhododendronbusch verborgen. Sie sprach ihre Vermutung aus, stieß aber bei ihrem Cousin auf Unglauben. „Das Bild deiner Eltern und deiner Geschwister hat auf ihrem Tisch in der Stube gestanden“. Joachim Einsporn kannte seine älteren drei Geschwister nur von diesem Foto, denn sie hatten im Gomorrha-Sturm des Juli 1943 in der Bartelsstraße gemeinsam ihr Leben verloren und auf dem Bombenopferfeld der Kapelle 13 ein nur symbolisches Grab gefunden, am Rande der Massengräber, auf deren Hügeln keine Kreuze mit Namen, sondern schwere Balken mit den Namen der Ortsteile Hamburgs stehen. Er schluckte. „Ich bin so lange nicht in der Wohnung gewesen, ich kann mich an das Bild nicht erinnern, aber wir haben es zuhause. Mein Gott, dieser verrückte Familienkrach“.
Zweimal war Saskia ihrer Tante in den Jahren nach der Spaltung der Kernfamilie begegnet. Davon erzählte sie ihrem Vetter. Als sie noch in Hamburg, in Sasel, wohnte, hatte sie vom Fenster in der Essecke ihrer Wohnung eine Frau auf der Straße gesehen, in der sie sofort, wenn auch voller Unglauben, die Tante erkannt hatte. Sie war hinuntergelaufen. Die Tante stand schon an der Bushaltestelle am Saseler Mühlenweg. „Tante Käte!“ und „Ja, so komm doch herauf, ich wohne hier. Stell’ dir vor, ich wohne hier“. Die Tante hatte die Einladung schroff abgelehnt und mürrisch erklärt, sie habe eine Bekannte besucht, jetzt habe sie keine Zeit, sie müsse zur Arbeit. Der Nachbarin im Erdgeschoss, die am Fenster stand, sagte Saskia, noch verwirrt von der Begegnung: „Stellen Sie sich vor, ich habe meine Tante aus dem Fenster gesehen, ganz zufällig, ich habe sie fast zehn Jahre nicht gesehen“. Die Frau in dem hellen Kamelhaarmantel? Die habe sie beobachtet, sagte die Nachbarin, die habe sehr aufmerksam die Namenschilder am Klingelbrett gelesen, habe dabei sogar eine Brille aufgesetzt.
Ein paar Jahre später hatte Saskia – sie lebte schon in Wiesbaden – mit ihrer Mutter den Gedenkgottesdienst für die Mannschaft des Segelschulschiffs „Pamir“, zu der ihr Bruder gehörte, in der Katharinenkirche besucht. Beim Verlassen der Kirche hatten sie vor sich in der Menge die Tante erkannt. Sie waren ihr nachgelaufen und hatten „Käte! Tante Käte!“ gerufen. Die Tante hatte zurückgeblickt und mit beiden Händen eine abwehrend-wegwerfende Bewegung gemacht und ihren Schritt beschleunigt. Schon beim Betreten der Kirche hatte Saskia im Blumenmeer vor der Gedenktafel unter den Schwingen des Albatros die Hortensie gesehen, und ihr war der Gedanke gekommen, ihre Tante sei in der Kirche, sie hatte sie aber in der dichtgedrängten Menge nicht gesehen. Keine hatte ein Händchen für die zartblaue Schönheit der Hortensien wie sie. „Ah, die Hortensie“, sagte Pitt und zog Saskia, deren Stimme zittrig geworden war, an den Schultern zu sich. „Mein Gott“, sagte Joachim Einsporn, „das ist doch verrückt. Wie können Familien kompliziert sein“. Ein Single, dachte Saskia, ein absoluter Single.
Nur zwei Tage lang hatte das Schildchen „Kätchen Einsporn“ im Wechselrahmen an der Tür des Zweibettzimmers Nr. 129 im Elisabeth-Alten- und Pflegeheim gesteckt. Saskia war sehr glücklich gewesen, den Heimplatz für die Tante so rasch gefunden zu haben. Viele Tage war sie durch Hamburg gefahren und gelaufen und hatte Senioren- und Pflegeheime besichtigt.
Noch hatte Kätchen Einsporn die Alternative, ihre Wohnung zu verlassen, strikt zurückgewiesen. Zwar hatte sie früher – als rüstige Hausherrin in ihrer Vier-Zimmer-Wohnung – gelegentlich in vorsichtig formulierten, sich an vielen „wenn“ und „könnte“ und „aber“ entlang schleichenden Gedanken die Übersiedelung in ein Heim nicht ausgeschlossen, aber nach der Katastrophe in ihrer Kammer hatte sie auf Saskias Andeutungen feindselig schroff reagiert. „Ich kann nicht immer in Hamburg bleiben, Tante Käte“. Sie könne ja gehen. „Ich bleibe in meiner Wohnung. Ich kann das allein“. Das sagte sie noch vier Tag vor der Übersiedelung in das Elisabeth-Heim: sie saß am Küchentisch, starr aufgereckt und doch kraftlos in der welken Hinfälligkeit ihres fast verhungerten Körpers, dem sie trotz ihres fahrig flackernden Lebenswillens seit zehn Tagen fast alle Nahrung verweigert hatte. Sie hatte versucht, den Beutel des Hagebuttentees aus der Kanne zu ziehen, hatte sie umgestoßen und sich in der heißen Lache auf der Wachstuchdecke die Hand verbrannt. „Ich habe immer allein gelebt. Ich kann das“. Wenn ich ein nettes, ansprechendes Heim gefunden habe, dachte Saskia, werde ich es ihr zeigen, und dann wird sie „ja“ sagen. Und gleichzeitig: wie soll das gehen? Sie wird jeden Tag schwächer.