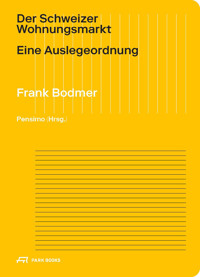
4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Park Books AG
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Die Immobilienmärkte sind international seit vielen Jahren in den Schlagzeilen. Das aktuell erreichte Preisniveau weckt auch in der Schweiz Befürchtungen vor einer neuen Immobilienkrise und schränkt den Zugang weiter Teile des Mittelstands zu Wohneigentum ein. Am Mietwohnungsmarkt konnten die Verwerfungen früherer Boomphasen zwar vermieden werden. Politische Eingriffe bedrohen jedoch dessen gute Funktionsweise, womit nicht zuletzt die Versorgung einer wachsenden Bevölkerung mit qualitativ hochwertigem Wohnraum gefährdet ist. Trotz der Aktualität dieser brennenden Fragen fehlt es an Texten zum Wohnungsmarkt in der Schweiz, die das Thema umfassend aufarbeiten. Diese Lücke schliesst das neue Buch des in Basel lehrenden Wirtschaftswissenschaftlers Frank Bodmer. In klar strukturierten Kapiteln und mit zahlreichen anschaulichen Visualisierungen werden in diesem innovativen Grundlagenwerk die Entwicklungslinien nachgezeichnet, das statistische Material aufbereitet und die wirtschaftlichen, gesellschaftlichen und regulativen Rahmenbedingungen analysiert.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 171
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Vorwort
1 Umstrittener Wohnungsmarkt
Steigende Preise
Steigende Mieten
Bodenknappheit
Herausforderungen für die Politik
Eine einfache volkswirtschaftliche Analyse
2 Wohnraum und Bodennutzung
Bestand an Wohnungen
Flächenbedarf für das Wohnen
Flächenbedarf und Wachstum
Bodennutzung
Bodenmarkt
Bodenpreise und Bodenrente
3 Der Markt für Wohnimmobilien
Investitions- und Nutzungsmarkt
Das Modell von DiPasquale und Wheaton
Angebotsseite
Auswirkungen sinkender Zinsen
Auswirkungen von Wachstum
4 Zyklen im schweizerischen Wohnungsmarkt
Booms und Krisen seit Beginn des 20. Jahrhunderts
Preise und Mieten seit 1970
Neubautätigkeit
Entwicklung der Leerwohnungsziffer
Zinsentwicklung
Boom der 1980er-Jahre
Boom der 2000er-Jahre
Appendix: Vergleich verschiedener Preisindizes
5 Mietwohnungsmarkt und Mietzinsregulierung
Funktionsweise des Mietwohnungsmarktes
Mietzinsentwicklung
Anbieter im Mietwohnungsmarkt
Nutzungskosten
Rendite und Marktmiete
Systeme der Mietzinsregulierung
Mietzinsregulierung in der Schweiz
Kostenmiete nach Obligationenrecht
Einschätzung der schweizerischen Mietzinsregulierung
6 Wohneigentum
Bewohnertyp: Miete, Eigentum, Genossenschaft
Vor- und Nachteile von selbstbewohntem Eigentum
Staatliche Förderung und Nutzungskosten für Wohneigentümer
Auswirkungen der Förderung auf den Wohnungsmarkt
Systeme der Wohneigentumsbesteuerung
Das schweizerische System
Folgen der Wohneigentumsförderung
Tragbarkeitsregeln als Hindernis für Wohneigentum
7 Gemeinnütziger Wohnungsbau
Problem der Erschwinglichkeit
Bedeutung des gemeinnützigen Wohnungsbaus
Kostenmiete im gemeinnützigen Wohnungsbau
Staatliche Fördermassnahmen
Tieferer Flächenverbrauch
Wertsteigerungen
Zukünftige Bedeutung des gemeinnützigen Wohnungsbaus
8 Regulierung einzelner Marktsegmente
Ausländer als Investoren
Touristische Nutzung von Mietwohnungen
Zweitwohnungen
Lex Koller
Regulierung der touristischen Nutzung
9 Raumplanung und Bodenbedarf
Standortattraktivität
Wo seit 2020 gebaut wurde
Ein grundlegender Konflikt
Umnutzung von Geschäfts- und Privatliegenschaften
Raumplanung und Föderalismus
10 Gebäude und Energieverbrauch
Qualitätsunterschiede bei Gebäuden
Renovationen bei Mietwohnungen
Energetische Renovationen
Reduktion der CO2-Emissionen
11 Herausforderungen für die schweizerische Wohnungspolitik
Bevölkerungswachstum und Flächenbedarf
Schutz des unbebauten Bodens oder tiefe Bodenpreise
Bedrohter Mietwohnungsmarkt
Reduktion der Klimaemissionen
Wohnungsmarkt zwischen Markt und Plan
Literaturverzeichnis
In der vorliegenden Publikation untersucht Frank Bodmer die Struktur und Entwicklung des Schweizer Wohnungsmarktes. Im Vordergrund seiner Arbeit steht eine ökonomische Auslegeordnung. Bodmer sortiert aus, wo die «Baustelle Wohnungsmarkt» funktioniert, wo sie Defizite und Schwächen aufweist und welche Herausforderungen damit verbunden sind.
Die Produktion und Allokation von Wohnraum über den Markt haben in der Schweiz eine lange Tradition. Effiziente regionale Märkte sind massgebliche gesellschaftliche und volkswirtschaftliche Pfeiler: Sie tragen dazu bei, eine gute Versorgung mit Wohnraum für breite Bevölkerungsgruppen sicherzustellen; sie unterstützen zudem die Mobilität der Arbeitskräfte und die Wirtschaftsentwicklung.
Im internationalen Vergleich gilt der Schweizer Wohnungsmarkt als gut funktionierend – trotz oder vielleicht gerade wegen der weltweit tiefsten Wohneigentumsquote. Allerdings nicht unbedingt dort, wo das kantonale Recht vorschreibt, dass Mieten nach der Sanierung von Wohnraum amtlich kontrolliert werden, nachdem sie zuvor im Rahmen des Baubewilligungsverfahrens behördlich fixiert worden sind.
Gemäss Umfragen sind rund drei Viertel der Wohnungsmietenden zufrieden oder sehr zufrieden mit ihrer Wohnsituation. Dies ist u. a. auch ein gutes Attest für institutionelle Anleger wie Anlagestiftungen oder Pensionskassen, die meist qualitativ gute Mietwohnungen zu fairen Preisen anbieten – und gleichzeitig zur Sicherung der Altersvorsorge beitragen. Allerdings dürfte deren Investitionsneigung in den Immobiliensektor in den kommenden Jahren aufgrund steigender Zinsen eher abnehmen, zugunsten von Investitionen in Nominalwerte. Wenn weniger Kapital in den Immobilienmarkt fliesst, könnte dies einerseits den bestehenden Sanierungsstau des Schweizer Gebäudeparks in Richtung Netto-Null verstärken, andererseits angebotsseitig zu einer Verringerung der Wohnungsproduktion und damit zu höherer Wohnungsknappheit in den nachfragestarken Agglomerationen führen, wo aktuell noch zu wenig stark verdichtet wird.
Der Wohnungsmarkt ist ein komplexes Gebilde, das stark von nachfrage- und angebotsseitigen Faktoren geprägt ist. Dabei manifestieren sich diverse Abhängigkeiten, Widersprüchlichkeiten wie auch Marktverzerrungen. Zudem wird der Mechanismus des Wohnungsmarktes in nicht unerheblichem Masse durch politische Verteilkämpfe und ideologische Wohnraumpolitik von Mietern und Eigentümern geprägt. Der Wohnungsmarkt ist heute mehr denn je umstritten, wie auch der Bodenmarkt.
Frank Bodmer unternimmt mit seinen Lektionen in elf Kapiteln eine «Spurensuche» aus einer wirtschaftswissenschaftlichen Perspektive, ohne den sozialen Blickwinkel und das gesellschaftliche Konfliktpotenzial zu vernachlässigen. Um das Buch einem breiten Leserkreis zugänglich zu machen, ist die Einführung in den Schweizer Wohnungsmarkt didaktisch aufgebaut und gut verständlich geschrieben. Sie stützt sich dabei auf das renommierte mikroökonomische Modell kausaler, raumwirksamer Zusammenhänge von Denise DiPasquale und William C. Wheaton.
Pensimo Management AG
Michel Schneider
1 Umstrittener Wohnungsmarkt
Noch im Jahr 2022 befand sich der schweizerische Wohnungsmarkt in einer Boomphase, die zwanzig Jahre dauerte. Der Boom war von steigenden Preisen und einem starken Anstieg des Angebots gekennzeichnet und widerstand schweren wirtschaftlichen Krisen wie der Finanzkrise von 2008 oder der Coronakrise von 2020. Verantwortlich für den Preisanstieg waren neben einem insgesamt soliden Wachstum von Wirtschaft und Bevölkerung vor allem die tiefen Zinsen. Diese senkten die Finanzierungskosten für Eigenheimbesitzer1, machten Immobilienanlagen für Investoren sehr attraktiv und beflügelten so die Ausweitung des Angebots. Hohe Inflationsraten haben die Zentralbanken im Laufe des Jahres 2022 aber dazu veranlasst, die Zinsen zu erhöhen, weitere Erhöhungen dürften folgen. Steigende Zinsen und ein schwächeres wirtschaftliches Wachstum könnten einen Preisrückgang am Wohnungsmarkt und eine Reduktion der Neubautätigkeit auslösen. Zu Beginn des Jahres 2023 bestehen erste Anzeichen für eine solche Abkühlung, wobei allerdings auch eine weitere Verlängerung des Booms als möglich erscheint.
Im Vergleich zu früheren Boomphasen kann die Lage am Mietwohnungsmarkt dagegen nach wie vor als entspannt bezeichnet werden. Die durchschnittlichen Mieten sind zwar ebenfalls gestiegen. Die Zahl der freien Wohnungen ist aufgrund der Zunahme des Angebots insgesamt aber hoch geblieben, auch wenn sie in den letzten beiden Jahren deutlich gesunken ist. Es kann damit nach wie vor nicht von Wohnungsnot gesprochen werden. Von einer Entwicklung wie Ende der 1980er-Jahre, mit stark gestiegenen Mieten und sehr tiefen Leerstandsquoten, war der schweizerische Wohnungsmarkt im Jahre 2022 also weit entfernt.
Eine Ausnahme bildet die Situation in den grossen Städten. Hier haben die hohe Nachfrage und das knappe Angebot zu einem starken Anstieg von Mieten und Preisen geführt. Eine günstige Wohnung zu finden ist für Familien mit Kindern und für Haushalte mit tiefen Einkommen vielerorts sehr schwierig geworden. Auch für Haushalte mit höheren Einkommen, die Wohneigentum erwerben wollen, liegen die Preise inzwischen auf einem unerschwinglichen Niveau. Deshalb sahen sich in den letzten Jahren viele dazu veranlasst, die Städte zu verlassen und in die Agglomerationen oder in ländliche Gebiete zu ziehen. Das trug zur Zersiedlung und zu einem weiteren Verlust an Kulturland bei, der auf breiten politischen Widerstand stösst. Eine verdichtete Bauweise wäre die Alternative zu einer weiteren Ausdehnung der bebauten Fläche. Wie diese Verdichtung in der Praxis erreicht werden könnte, ohne noch stärker steigende Preise zu provozieren und ohne die Funktionsweise des schweizerischen Wohnungsmarktes grundlegend zu stören, ist allerdings nicht klar.
Der schweizerische Wohnungsmarkt steht damit vor einer Reihe fundamentaler Herausforderungen. Zu Beginn des Jahres 2023 bedrohen steigende Zinsen das Preisniveau, mit Risiken für Eigentümer, Investoren und Banken. Die Neubautätigkeit könnte gedrosselt werden, mit einer Abnahme des Angebots als Folge. Politische Vorstösse könnten diese Angebotsreduktion noch verschärfen, sei es über ein strengeres Mietrecht, sei es über eine Verknappung des Baulandes. Das wäre nicht zuletzt deshalb problematisch, weil die Schweizer Bevölkerung in den nächsten Jahrzehnten weiterhin kräftig zunehmen dürfte. Eine ausreichende Versorgung der wachsenden Bevölkerung mit bezahlbarem Wohnraum muss ein zentrales Gebot für die schweizerische Politik sein.
Steigende Preise
Tiefe Zinsen und hohe Renditen lockten in den letzten Jahren viel neues Geld in den Immobilienmarkt. Insbesondere Versicherungen, Immobiliengesellschaften, Pensionskassen und Anlagestiftungen haben Wohnimmobilien gekauft, in Erwartung von attraktiven Mieterträgen und weiteren Preissteigerungen. Das ging mit einer soliden Bautätigkeit und einer kräftigen Ausweitung des Angebots einher. Als Folge stieg der Bestand an Mietwohnungen in einzelnen Regionen so stark an, dass die Leerstände ein für Boomphasen unüblich hohes Niveau erreichten.
Die rekordtiefen Zinsen würden es im Prinzip auch vielen Privatpersonen ermöglichen, Immobilien zu erwerben. Dem stehen allerdings strenge Vorschriften bei der Vergabe von Hypotheken im Weg. Um die finanziellen Risiken für Haushalte und Banken zu reduzieren, wird von den Schuldnern relativ viel Eigenkapital und die Fähigkeit erwartet, die Hypothek auch bei einem deutlichen Zinsanstieg noch bedienen zu können. Anstelle eines Hypothekarzinssatzes von rund 1 %, wie er lange üblich war, müssen die Käufer in der Lage sein, einen hypothetischen Zins von 4,5 % bis 5 % zu bezahlen. Dazu kommen noch 1 % Unterhaltskosten plus 1 % Amortisation der zweiten Hypothek. Bei einem Preis von einer Million Franken, wie er für neue Eigentumswohnungen und Häuser inzwischen gang und gäbe ist, wäre ein Einkommen von über 150 000 Franken nötig – ein Einkommensniveau, das nur rund ein Viertel der Schweizer Haushalte erreicht.
Aufgrund der steigenden Preise konnten sich deshalb viele Haushalte kein Wohneigentum mehr leisten. Der seit 2015 verzeichnete Rückgang der Wohneigentumsquote hat die Politik aufgeschreckt. Politische Vorstösse versuchen, Wohneigentum zu fördern, vor allem über steuerliche Erleichterungen wie eine Elimination des Eigenmietwerts. Solche Vorschläge ändern am grundlegenden Problem – der fehlenden Tragbarkeit – allerdings nichts. Für die Förderung des Eigentums zielführender wären Änderungen, welche die Anforderungen an das Eigenkapital reduzieren, was aber mit neuen Risiken verbunden wäre. Es stellt sich die Frage, ob der Erwerb von Wohneigentum zu aktuellen Preisen überhaupt staatlich gefördert werden sollte. Immerhin riskieren Haushalte, die zu hohen Preisen kaufen, bei einer Preiskorrektur grosse finanzielle Verluste. Tiefere Preise würden das Tragbarkeitsproblem dagegen auf nachhaltigere Art und Weise lösen.
Steigende Mieten
Trotz rekordtiefen Zinsen und hohen Leerstandsquoten sind die durchschnittlichen Mieten in den letzten Jahren weiter gestiegen. Auf Basis der Kostenformel im schweizerischen Mietrecht hätten die sinkenden Zinsen eigentlich zu sinkenden Mieten führen sollen. Dass dies nicht geschah, ist der Mieterseite ein Dorn im Auge. Den Vermietern wird vorgeworfen, mit Mietobjekten ungerechtfertigt hohe Renditen zu erzielen. Effektiv waren die letzten zwanzig Jahre für die Eigentümer von Immobilien sehr gute Jahre. Diesen guten Jahren gingen allerdings zehn sehr schlechte Jahre voraus, beginnend mit dem Immobiliencrash der frühen 1990er-Jahre. Auch heute ist ein Markteinbruch möglich, womit die hohe Rendite (der Vergangenheit) das eingegangene Risiko kompensieren würde.
Aus einer hohen Rendite allein folgt zudem noch nicht, dass die Mieten überhöht sind. Legt man den Berechnungen Einstandspreise zugrunde, ist das zwar oft der Fall. Insbesondere bei Immobilien, die sich lange in gleicher Hand befanden, liegt eine auf Einstandspreisen basierende Kostenmiete weit unter dem aktuellen Marktniveau. In einem freien Markt sollten Preise und Mieten aber nicht die Kosten, sondern die Knappheit eines Gutes reflektieren. Werden die Mieten staatlich tief gehalten, drohen eine Reduktion des Angebots und eine Erhöhung der Nachfrage. Der resultierende Mangel an Wohnraum ist ein typisches Merkmal von streng regulierten Mietwohnungsmärkten.
Die steigenden Mieten stellen insbesondere in den Städten für Haushalte mit tiefen Einkommen und für Familien mit Kindern ein Problem dar. In einigen Städten wie in Zürich besteht zwar ein grosses staatliches und genossenschaftliches Angebot, das Wohnungen deutlich unter dem Marktniveau anbietet. Dieses Angebot ist allerdings begrenzt und kommt nicht immer denjenigen Haushalten zugute, die es am nötigsten hätten.
Bodenknappheit
Im langfristigen Trend wurden Immobilien in der Schweiz immer teurer. Das hat vor allem mit der Knappheit des Bodens zu tun. Mit dem Wachstum von Wirtschaft und Bevölkerung steigt der Bedarf an Wohn-, Gewerbe- und Infrastrukturflächen. Während die Kosten von Gebäuden und der Innenausstattung mehr oder weniger mit der allgemeinen Teuerung steigen, wird der Boden knapper und damit im Vergleich zu anderen Gütern teurer. Steigende Preise und Mieten stellen ein wichtiges Signal für die Marktteilnehmer dar und tragen in der Regel dazu bei, den Flächenbedarf einzuschränken. In den letzten zwanzig Jahren stieg die durchschnittliche Wohnfläche pro Person aber trotz steigender Preise und Mieten weiter an, vor allem als Folge der steigenden Einkommen.
Mit einer Verdichtung des Bauens, wie sie auch vom Bund im Rahmen der Raumplanungsgesetzgebung gefordert wird, könnten die Auswirkungen des Bevölkerungswachstums auf den Bodenverbrauch gemildert werden. Verdichtung wird durch die hohen Bodenpreise begünstigt. In der Praxis bestehen allerdings erhebliche Hindernisse. Weniger Abstand oder mehr Geschosse können subjektiv zu einer Minderung des Wohnkomforts führen. Verdichtung stösst deshalb oft auf lokalen Widerstand. Es wird befürchtet, dass das Ortsbild oder die Attraktivität eines Quartiers leiden oder dass einkommensschwache Haushalte angezogen werden. Verdichtung findet zwar statt, allerdings nicht in einem Ausmass, das einen weiteren Verlust an Kulturland verhindern könnte.
Steigende Bodenpreise stellen zudem eine zweischneidige Sache dar. Sie sind einerseits ein wichtiger Mechanismus, um der Bodenknappheit zu begegnen. Andererseits veranlassen höhere Preise viele Haushalte, die Zentren zu verlassen, was dem grundlegenden Ziel eines Stopps der Zersiedlung zuwiderläuft; und politisch stossen höhere Preise insbesondere dann auf erheblichen Widerstand, wenn sie mit höheren Mieten einhergehen. Dies zeigt die aktuelle Diskussion um überhöhte Mietzinse auf exemplarische Art und Weise.
Oft zu hören ist deshalb der Ruf nach staatlichen oder staatlich geförderten Bauprojekten, die aufgrund der impliziten oder expliziten Subventionierung nach anderen Kriterien durchgeführt werden können. Ein solcher staatlich gesteuerter Wohnungsbau ist in der Schweiz in grossem Stil allerdings kaum vorstellbar und wäre mit neuen Verwerfungen verbunden, wie nicht zuletzt die Probleme bei der Allokation von Wohnungen in Städten wie Zürich oder Genf zeigen.
Herausforderungen für die Politik
In den letzten Jahren trugen die tiefen Zinsen zu einer Entschärfung des Problems der steigenden Mieten bei. Neben der Mietzinsregulierung half insbesondere der Ausbau des Angebots, die Mietzinserhöhungen in Grenzen zu halten. Dies hebt sich positiv von der Situation in der Boomphase der 1980er-Jahre ab, als das Angebot an Wohnungen sehr knapp war und die Mieten stark stiegen. Angesichts des kräftigen Bevölkerungswachstums der letzten zwanzig Jahre ist dies erfreulich. Laut Bevölkerungsszenarien wird dieses Wachstum in den nächsten dreissig Jahren anhalten. Bis 2050 benötigen laut dem Basisszenario des Bundes rund 1,8 Millionen zusätzliche Einwohner eine Wohnung.
Bereits ein deutlicher Zinsanstieg könnte das Angebotswachstum bedrohen. Höhere Zinsen würden nicht nur den Eigentumsmarkt unter Druck setzen, sie könnten mit dem Ende von Anlagenotstand und steigenden Preisen auch den Anreiz für Investoren mindern, zusätzliche Mietwohnungen bereitzustellen.
Die Mietzinsregulierung stellt eine weitere Gefahr für den Mietwohnungsmarkt dar. Sie weist ein unbequemes Nebeneinander von Markt- und Kostenelementen auf. In der Praxis war bisher mittel- bis langfristig eine Anpassung der Mieten an das Marktniveau möglich. Eine Stärkung der Kostenelemente würde diese Anpassung in Frage stellen. Mieten, die durch die Regulierung deutlich unter das Marktniveau gedrückt werden, könnten den Neubau und die Instandhaltung von Mietwohnungen empfindlich treffen.
Ob das Angebot in Zukunft weiter mit der Nachfrage Schritt halten kann, hängt ausserdem von der Raumplanung ab. Der Ausbau des Angebots ging bisher mit einer Ausweitung der Bodennutzung für Wohnbedarf und Verkehrsinfrastruktur einher, auf Kosten der landwirtschaftlichen Nutzung. Der Druck ist gross, diesen Verlust an landwirtschaftlichem Boden zu stoppen. Damit besteht aber die Gefahr, dass der schweizerische Wohnungsmarkt gewissermassen auf den Kopf gestellt wird. An die Stelle eines ausreichenden Angebots bei moderat steigenden Preisen und Mieten könnte eine Knappheit des Angebots bei deutlich steigenden Preisen und Mieten treten. Die Entwicklung in Ländern wie Grossbritannien zeigt die möglichen negativen Konsequenzen eines solchen Strategiewechsels.2
Eine einfache volkswirtschaftliche Analyse
Der Fokus der folgenden Analyse liegt auf den grundlegenden volkswirtschaftlichen Zusammenhängen. Es soll analysiert werden, welche Faktoren das Angebot und die Nachfrage bestimmen, was die daraus folgenden Resultate für Preise und Mieten sind und welchen Einfluss die verschiedenen Formen staatlicher Regulierung haben.3 Nicht berücksichtigt werden dagegen die Zusammensetzung der Immobilienbranche oder ihre volkswirtschaftliche Bedeutung.4
Die verschiedenen Fragen lassen sich in einem einfachen und einheitlichen methodischen Rahmen analysieren. Den Immobilienmarkt unterscheiden zwei zentrale Eigenheiten von anderen Märkten. Die erste Eigenheit ist die Bedeutung des Bodens als eines nicht vermehrbaren Gutes, das die Ausweitung des Angebots bremst. Die zweite Eigenheit ist die doppelte Funktion von Immobilien: Sie stellen einerseits eine Einkommensquelle für die Eigentümer dar, andererseits generieren sie eine Dienstleistung in Form von Wohnraum. Daraus ergeben sich zwei Märkte, die miteinander verbunden sind, aber sehr unterschiedlich funktionieren. Die beiden Aspekte werden durch das bekannte Modell von Denise DiPasquale und William Wheaton erfasst, das einen Investitions- und einen Nutzungsmarkt unterscheidet.5 Varianten dieses Modells bilden die Basis für einen Grossteil der Analyse in diesem Buch.
Kapitel 2 beginnt mit einer Übersicht zur Entwicklung der Mengen am Wohnungsmarkt. In der Nachkriegszeit stieg die nachgefragte Menge an Wohnraum sowohl aufgrund des Wachstums der Bevölkerung als auch aufgrund einer höheren Nachfrage nach Wohnraum pro Person stark an. Beide Trends halten an, obwohl sich das Wachstum der Nachfrage nach Wohnraum pro Person deutlich verlangsamt hat. Verbunden mit der höheren Nachfrage nach Wohnraum ist das Wachstum des für Wohnzwecke genutzten Bodens. Anhand einer kurzen Analyse des Bodenmarktes werden die Konsequenzen eines begrenzten Angebots an Bauland dargestellt.
Kapitel 3 führt einfache Modelle des Wohnungsmarktes ein, darunter das DiPasquale-Wheaton-Modell. Zentral für Immobilienmärkte ist die Unterscheidung von Investitions- und von Nutzungsmärkten, die eine simultane Bestimmung von Mieten und Immobilienpreisen erlauben.
Kapitel 4 beschreibt die Entwicklung von Preisen und Mieten in der Schweiz mit Daten, die bis 1900 zurückreichen. Der schweizerische Wohnungsmarkt durchlebte in dieser Zeit verschiedene Zyklen. Die letzten beiden Boomphasen lassen sich anhand des DiPasquale-Wheaton-Modells anschaulich erklären. Während im Boom der 1980er-Jahre das Wachstum von Wirtschaft und Bevölkerung die zentrale Antriebskraft war, sind es beim Boom der 2000er-Jahre die tiefen Zinsen kombiniert mit einem soliden Wachstum der Nachfrage.
Kapitel 5 bis 10 widmen sich einzelnen Bereichen des Wohnungsmarktes, die in der politischen Diskussion eine spezielle Beachtung finden. Kapitel 5 betrachtet den Mietwohnungsmarkt und die Mietzinsregulierung. Die Mieten stiegen in der Schweiz in den letzten fünfzig Jahren zwar deutlich weniger als die Einkommen. Insbesondere in den letzten zehn Jahren stiegen die Mieten aber stärker, als dies aufgrund einer reinen Kostenmiete gerechtfertigt gewesen wäre. Allerdings sieht das schweizerische Mietrecht keine reine Kostenmiete vor, sondern enthält auch Marktelemente. Daraus resultieren Widersprüche, die zu Unsicherheiten und einer grossen Bedeutung der Gerichtspraxis führen.
Kapitel 6 betrachtet das selbstgenutzte Wohneigentum und dessen Behandlung im Rahmen des Systems der Einkommenssteuern. Die Schweiz hat mit der Besteuerung des Eigenmietwerts bei gleichzeitigem Abzug von Unterhaltskosten und Fremdkapitalzinsen ein im internationalen Vergleich wenig übliches System. Entsprechend gross ist der politische Druck zu einer Abschaffung des Eigenmietwerts. Allerdings wird in der Schweiz Wohneigentum trotz Besteuerung des Eigenmietwerts bereits heute steuerlich begünstigt, und ein Systemwechsel würde die Förderung verstärken.
Kapitel 7 befasst sich mit dem gemeinnützigen Sektor, einem Teilbereich des Mietwohnungsmarktes. Hier gelten strengere Formen der Kostenmiete. Dieser Bereich weist in einigen Städten eine grosse Bedeutung auf und leistet dort einen wichtigen Beitrag zur Bereitstellung von günstigem Wohnraum. Allerdings profitieren von diesem Angebot nicht nur Haushalte, die sich sonst keine Wohnung leisten könnten. Und ob der gemeinnützige Sektor für die Bewältigung der zukünftigen Herausforderungen einen entscheidenden Beitrag leisten kann, wie das von verschiedenen Seiten gehofft wird, ist fraglich.
Kapitel 8 analysiert den Zweitwohnungsmarkt, der einen erheblichen Teil aller Wohnungen umfasst. Die Nachfrage nach Zweitwohnungen betrifft vor allem touristische Regionen abseits der wirtschaftlichen Zentren. Aber auch dort kann diese Nachfrage zu Preis- und Mietzinssteigerungen führen, welche die lokale Bevölkerung bei ihrer Suche nach Wohnraum vor Probleme stellen. Es wird deshalb bereits seit Längerem versucht, die Nachfrage nach Zweitwohnungen zu begrenzen: Mit der Lex Koller wird die Nachfrage von ausländischen Käufern eingeschränkt, und die Zweitwohnungsinitiative führte eine Beschränkung der Zahl der Zweitwohnungen ein.
Kapitel 9 gibt eine kurze Darstellung der Raumplanung und ihrer Rolle bei der Bereitstellung von Bauland. Ein Ziel der Raumplanung ist, den Verbrauch von Kulturland zu reduzieren. Allerdings soll nur wenig in die Autonomie von Kantonen und Gemeinden eingegriffen werden, womit die wichtigsten Entscheide nach wie vor auf lokaler Ebene gefällt werden. Entsprechend viel wird auch weiterhin ausserhalb der städtischen Zentren und ihrer Umgebung gebaut.
Kapitel 10 widmet sich dem Energieverbrauch von Gebäuden. Strengere Vorschriften und höhere Standards bei der Wärmedämmung haben zu einem Rückgang dieses Energieverbrauchs geführt. Der verbleibende Verbrauch wird zunehmend durch erneuerbare Quellen gedeckt, womit das in der Klimastrategie des Bundes bis 2050 vorgesehene Ziel einer Netto-Null als durchaus realistisch erscheint.
Kapitel 11 schliesst mit einer Diskussion der grundlegenden Herausforderungen für die Politik. Die Nachfrage nach Wohnraum wird auch in den nächsten dreissig Jahren weiter steigen. Soll für die erwarteten neuen Einwohner der Schweiz ausreichend Wohnraum zu bezahlbaren Preisen vorhanden sein, muss das zusätzliche Angebot gewährleistet sein. Die Anreize für einen ausreichenden privaten Neubau müssen erhalten bleiben, da ein entsprechendes staatliches oder staatlich gefördertes Angebot weder realistisch noch wünschbar ist. Zunehmende Eingriffe in den Mietwohnungsmarkt und bei der Raumplanung gefährden aber dieses notwendige private Mehrangebot.
1 Es wird der generische Maskulin verwendet, gemeint sind immer alle Geschlechter.
2 Siehe Hilber und Schöni (2016) für einen Vergleich zwischen Grossbritannien und der Schweiz.
3 Verschiedene dieser Themen werden in Baumberger und Bodmer (2016) in verkürzter Form dargestellt.
4 Solche Darstellungen finden sich beispielsweise in Lüthi (2006) oder Staub und Rütter (2014).
5 DiPasquale und Wheaton (1992, 1996).
2 Wohnraum und Bodennutzung
Wohnen ist ein Gut des Grundbedarfs, alle Menschen benötigen es. Die Zahl der Einwohner eines Landes stellt damit eine erste fundamentale Bestimmungsgrösse der Nachfrage nach Wohnraum dar. Das Einkommen ist die zweite fundamentale Grösse: Menge und Qualität des nachgefragten Wohnraums steigen mit dem Einkommen, in der Regel sogar überproportional. Preise sind eine dritte fundamentale Bestimmungsgrösse. Daneben spielen die Präferenzen und das vorhandene Angebot eine Rolle. Haushalte, die in einer Stadt wohnen möchten, müssen sich normalerweise mit einer kleineren Wohnfläche zufriedengeben als Haushalte auf dem Land. Dafür sorgen nicht zuletzt die in den Zentren höheren Preise und Mieten.





























