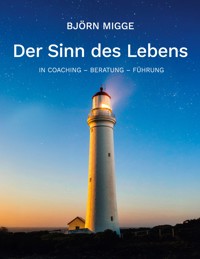
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: BoD - Books on Demand
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Was gibt meinem Leben Sinn? Ob im Coaching, in der Beratung, der Führung oder bei einer persönlichen Standortbestimmung; immer wieder stellen sich zentrale Fragen: Lebe ich im Einklang mit meinen Werten? Folge ich meinem Herzen? Gestalte ich ein Leben, das mich wirklich betrifft? Björn Migge verbindet in diesem Buch Grundgedanken der Logotherapie Viktor Frankls mit Ansätzen der existenziellen Beratung; praxisnah, inspirierend und tiefgründig. Er zeigt, wie Coaches und Führungskräfte die Sinnfrage in ihre Haltung und Arbeit integrieren, um Klient*innen und Teams auf ihrem Weg zu mehr innerer Klarheit und Sinnentfaltung zu begleiten. Auch Themen wie Glaube, Ethik, Würde, Lebensliebe, Todesangst, Intuition, Willensfreiheit und Gerechtigkeit werden einfühlsam beleuchtet. Dabei geht es nicht um fertige Antworten, sondern um eine Einladung zur Reflexion und zur Entwicklung einer tragfähigen inneren Haltung. Mit Diskussionsimpulsen und Leseempfehlungen in jedem Kapitel. Ein Buch, das zum Denken anregt und berührt. Das Hintergrundwissen zur praktischen Seminarreihe SINN-COACH ExperThe® bei Dr.Migge-Seminare. Die vorherige Ausgabe des Buches erschien 2016 im Beltz-Verlag unter dem Titel "Sinnorientiertes Coaching".
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 590
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
ÜBER DEN AUTOR
Dr. Björn Migge ist verheiratet und Vater zweier erwachsener Töchter. Studium der Medizin, sozialen Verhaltenswissenschaft und Philosophie. Ehemals Oberarzt sowie Universitätsdozent am UniSpital Zürich und Mitinhaber einer großen Praxisklinik in Minden/Westfalen. Mit seiner Frau Christine leitet er seit 2004 ein deutschlandweites Weiterbildungsinstitut für Coaching-Ausbildungen, Supervision und Therapie. Er ist Gründer des Qualitätsrings Coaching (QRC) und des Deutschen Fachverbandes Coaching (DFC). Migge ist Autor zahlreicher grundlegender Coaching-Fach- und Lehrbücher im Beltz Verlag.
Homepage & Seminarangebote:www.drmigge.deInstagram: @drmiggeseminare
Wenn Sie Hilfe brauchen:
Dieses Buch kann von allen Interessierten gelesen werden. Wenn Sie jedoch in einer akuten Krisensituation oder tiefen Sinnleere stecken, fragen Sie bitte Ihren Hausarzt, Seelsorger, Psychotherapeuten. Denn dann ist ein hilfreicher Mensch erforderlich und kein Buch!
Bücher, die zum Denken in alle Richtungen einladen – wie dieses –, sind dann vielleicht zusätzlich verwirrend.
Haftungsausschluss: Verlag oder Autor haften nicht für die Inhalte von verlinkten Websites, daher müssen wir uns aus rechtlichen Gründen ausdrücklich von deren Inhalten distanzieren.
Das Werk und seine Teile sind urheberrechtlich geschützt.
Jede Nutzung in anderen als den gesetzlich zugelassenen Fällen bedarf der vorherigen schriftlichen Einwilligung des Autors. Hinweis zu § 52a UrhG: Weder das Werk noch seine Teile dürfen ohne eine solche Einwilligung eingescannt und in ein Netzwerk eingestellt werden. Dies gilt auch für Intranets von Schulen und sonstigen Bildungseinrichtungen.
INHALT
VORWORT.
1. SINN ODER NICHTS
1.1 Zuhören und erzählen
1.2 Glauben als Sinnstiftung
1.2.1 Objektiver oder subjektiver Sinn
1.2.2 Ist Religion dogmatisch?
1.2.3 Humane Religion Fromms
1.3 Toleranz in Glaubensfragen
1.4 Geist oder Materie
1.5 Eine kosmische Perspektive
1.6 Worauf zielt das Sein?
1.7 Das Böse in der Welt
1.8 Personaler Sinn
1.9 Gemeinwohl als Sinn
1.10 Wenn alles beliebig wird
1.11 Lebensfrohe Sinnbotschaft
1.12 Humanismus
1.13 Neuer Humanismus Erich Fromms
1.14 Ethik ohne Religion
1.15 Esoterik
1.16 Spiritualität
2. FREIER WILLE UND WÜRDE
2.1 Idealismus, Dualismus, Naturalismus
2.2 Willentlich anders werden
2.3 Denken und Reden reichen nicht
2.4 Wahrheit und Wirklichkeit
2.5 Sind wir vorherbestimmt?
2.6 Worte machen Wirklichkeit
2.7 Trotzmacht des Geistes
2.8 Würde als Anrecht auf Achtung
3. EXISTENZIELLE BERATUNG
3.1 Was ist existenzielle Beratung?
3.2 Europäische Existenzphilosophen
3.2.1 Søren Kierkegaard
3.2.2 Friedrich Nietzsche
3.2.3 Edmund Husserl
3.2.4 Martin Buber
3.2.5 Karl Jaspers
3.2.6 Paul Tillich
3.2.7 Gabriel Marcel
3.2.8 Martin Heidegger
3.2.9 Jean-Paul Sartre
3.2.10 Simone de Beauvoir
3.2.11 Maurice Merleau-Ponty
3.2.12 Rollo May
3.2.13 Albert Camus
3.2.14 Viktor Emil Frankl
3.3 Offenheit und Haltung
3.4 Unser Sein – unser Wesen
3.5 Zugänge zur Existenz
3.6 Mehrdeutigkeit und Unsicherheit
3.7 Tempel der Existenz
3.7.1 Säule des Halts
3.7.2 Säule der Lebensliebe
3.7.3 Säule der Selbstliebe.
3.7.4 Säule der Selbsttranszendenz
3.7.5 Säule der Begegnung
3.7.6 Säule der Handlung
3.8 Mind – Body – Gefühle
3.9 Ontological Coaching Südamerikas
3.9.1 Wurzeln des Ontological Coachings (OC)
3.9.2 Grundgedanken des Ontological Coachings
3.9.3 Coaching-Anthropologie
3.9.4 Ziele des Ontological Coachings
3.9.5 Domäne der Sprache
3.9.6 Domäne des Körpers
3.9.7 Domäne von Stimmung und Emotion
3.9.8 Die Feinde des Lernens
3.9.9 Coaching bis zur Seele
3.10 Dialog erhellt die Existenz
3.11 Die Beratungsperson
3.12 Resilienz
3.13 Salutogenese
3.14 Das Lebendige
3.15 Liebe des Lebendigen
3.16 Lebensgenuss bis zum Tod
3.17 Stufen des Bewusstseins
3.18 Individuation und Symbol
3.19 Schuld und Verantwortung
4. LOGOTHERAPIE UND EXISTENZANALYSE
4.1 Wer war Viktor Frankl?
4.2 Der holistische Mensch
4.3 Unser Wesen als geistige Person
4.4 Selbsttranszendenz und Intentionalität
4.5 Der Mensch als Sinnsuchender
4.6 Gewissen als Sinnorgan
4.7 Sinnkompass: Das Frankl-Kreuz
4.8 Der Mensch ist Möglichkeit
4.9 Selbstdistanzierung und Träumerei
4.10 Existenzielle Wende
4.11 Hyperreflexion und Dereflexion
4.12 Noch schlimmer mit Humor!
4.13 Frankls Wertelehre
4.13.1 Die umgedrehte Pyramide oder das hierarchische Modell
4.13.2 Das Säulenmodell der Werte- und Weltordnung
4.14 Tragische Trias
4.15 Der Reichtum unseres Lebens
4.16 Sinn in der Arbeitswelt
4.16.1 Das Wasser, in dem wir schwimmen
4.16.2 Führung, die Sinn macht
4.16.3 Führung als ethische Verantwortung
4.16.4 Das Arbeitsleben als Sinnprojekt
4.16.5 Das Gute macht Sinn
4.16.6 Menschenbilder beeinflussen die Führung
4.16.7 Sinnschritte für erfüllende Arbeit
4.16.8 Salutogenese in der Führung
4.16.9 Führung und Werte
4.17 Verbreitung und Ausbildung
4.17.1 Uwe Böschemeyer
4.17.2 Walter Böckmann
4.17.3 Elisabeth Lukas
4.17.4 Wolfram Kurz
4.17.5 Alfried Längle
4.17.6 Ausbildung und Vereine.
LEBEWOHL
Literaturverzeichnis
Audio-Vorlesungen (Auswahl)
Denk- und Sinn-Zeitschriften (Auswahl)
Personen- und Sachregister
VORWORT
„Grundbedingung für das Leben jedes Einzelnen ist und bleibt, dass er selber versuche, sich zu wandeln. Dass er lerne, die Knüppel, welche man ihm vor die Füße wirft, nicht als Hindernisse, sondern als Sprungbretter zu benützen.“
Jean Gebser (1905–1973)
Jeder möchte sinnhaft, glücklich und erfüllt leben. Und niemand möchte ein wertloses und leeres Leben führen. Darin sind wir uns alle einig.
Dieses Buch wendet sich an Menschen, die über den Sinn ihres alltäglichen Lebens oder Seins nachdenken möchten. Vielleicht sind Sie Coach oder Profi in einem helfenden, beratenden oder heilenden Beruf und möchten Ihre Haltung zu existenziellen Themen reflektieren?
Ob Sie als Privatmensch oder Profi auf die Suche gehen: Sie finden hier keine Antworten und nur wenige sogenannte „Tools“. Stattdessen erwarten Sie Denkimpulse, die zur Reflexion von Weltsicht und Menschenbild anregen sollen.
Betrachten Sie bitte das Zitat von Jean Gebser: Auf die Frage, wie wir mit den erschreckenden (Knüppel) oder alltäglichen (Stöckchen) Herausforderungen der Existenz sinnvoll umgehen können, hat Viktor Frankl, der Begründer der Logotherapie und Existenzanalyse, Antworten gesucht. Er hat ein lebensfrohes und sinnhaftes Menschenbild und eine Grundhaltung gegenüber dem Leben entworfen, die uns dabei hilfreich sein können, einen erfüllenden, wertvollen und sinnhaften Weg einzuschlagen.
Frankl ist nicht der einzige Denker, der sich mit dem Sinn des Lebens und der Existenz befasst hat. Diese Frage im ganz Großen und im Alltäglichen hat unzählige Menschen bewegt. In diesem Buch lernen wir neben Frankls Ideen auch die Grundzüge der sogenannten existenziellen Beratung kennen, die sich aus dem Gedankengut der Existenz-Philosophie entwickelt hat.
Dieses Buch ist als Anregung und kurze theoretische und praktische Einführung für Sinnsuchende gedacht, ebenso für die Menschen, die Sinnsuchende begleiten. Bei Profis setzte ich Kenntnisse von Rahmenbedingungen, Verfahren, Methoden und professionelle Dialogfähigkeit voraus, weshalb nicht die Grundlagen hierzu aus anderen einführenden Lehrbüchern wiederholt werden. Wir konzentrieren uns stattdessen auf das Ringen um Sinn: Warum gibt es uns überhaupt, wofür ist unser Leben gut, macht es Sinn – obwohl wir sterben und vergehen, was mache ich bei Herausforderungen des Schicksals, gibt es dann noch ein erfülltes Leben, wie gehe ich mit der Angst vor meinem Tod um?
Das Lesen des Buches alleine kann unterhaltsam oder bildend sein, je nach Geschmack und Vorwissen. Manchmal werden Sie zustimmen, manchmal ablehnend den Kopf schütteln, je nach Vorannahmen oder Glauben. Aber nach dem Lesen werden Sie vermutlich trotzdem ähnlich denken und handeln wie zuvor. Das ist die Macht der Gewohnheit. Es sei denn …
Wenn Sie die im Buch verstreuten Angebote „Jetzt sind Sie gefragt“ aufgreifen und ehrlich über sich nachdenken oder die Fragen mit anderen offen diskutieren, dann werden Sie danach ein bisschen besser verstehen, wer oder wie Sie geworden sind und wohin Sie Ihr mutiges Denken noch führen könnte, auf der Suche nach einem sinnerfüllten Leben.
Björn Migge
1.
SINN ODER NICHTS
DIESE MENSCHEN FRAGEN NACH SINN:
Dem Dachdecker erkrankt die Frau an Krebs. Schnell wird klar, dass sie bald sterben wird. Welchen Sinn macht jetzt noch die Arbeit in dem Betrieb, den beide aufgebaut haben? Wozu nun das Ganze?
Nach dem gemeinsamen Besuch in Brüssel, zur Taufe eines neuen Familienmitgliedes, fährt der Rest der achtköpfigen Familie – die für den Ausflug einen Kleinbus gemietet hat – kurz vor der Ankunft am Heimatort gegen einen Sattelschlepper auf der Gegenspur. Nur ein kleines Mädchen und ein 25-Jähriger überleben. Der junge Mann ist seit einigen Wochen Klient in einen Führungscoaching, da er eine Leitungsfunktion in einem Handelsunternehmen begonnen hatte. Wofür soll das jetzt noch gut sein?
Eine Geschäftsfrau telefoniert während der Fahrt zur Arbeit. Versehentlich rempelt sie mit dem Auto ein Schulmädchen an, das mit dem Fahrrad unterwegs ist. Das Mädchen stürzt unglücklich und verletzt sich das Gehirn so stark, dass es zeitlebens in einem Pflegeheim verbringen wird.
Auf der Intensivstation ringt die Mutter ums Überleben. Wirkliche Hoffnung auf ein Leben zu Hause gibt es nicht mehr. Das Ärzteteam und die klinische Ethikkonferenz beraten einfühlsam. Doch die Kinder stehen weiterhin vor einem Dilemma: Sie können sich nicht einigen, da der frühere Wille der Mutter unklar ist und da die Kinder unterschiedlich über das Leben und den Tod denken.
Mit 54 Jahren wird der erfolgreiche Geschäftsführer eines großen Mittelstandsunternehmens entlassen. Das kam völlig unvorbereitet und seit vielen Jahren blickt er nun erstmals ungewiss in die Zukunft. Er meint, dass vor ihm nur noch eine schwarze Wand stehe, und er wisse nicht, wofür er nun überhaupt noch gut sei.
Der 60-jährige Inhaber einer Möbelfabrik wird bald sterben. Die zerstrittenen Söhne seien von ihrer Einstellung noch nicht so weit, das Unternehmen zu übernehmen. Die Frau sei vor zwei Jahren verstorben. Er sucht Rat in der Klärung der Unternehmensnachfolge und es belastet ihn unerträglich, dass vermutlich sein ganzes Lebenswerk sinnlos war.
Die 26-jährige Betriebswirtin übernimmt eine herausfordernde Führungsposition in einem international tätigen Unternehmen. Sie möchte Karriere machen, möchte aber auch so führen, dass ihre Mitarbeiter sich wohlfühlen und ein glückliches Leben gestalten können. Sie möchte aufmerksam dafür sein, dass in ihrem Verantwortungsbereich sinnvoll und ethisch gehandelt wird. Was ist der richtige Weg, diese Werte zu verwirklichen?
Die 18-jährige Gymnasiastin hängt nur noch ab. Plötzlich, so meinen die engagierten Eltern, habe sie die Motivation verloren, gebe sich mit falschen Freunden ab und nehme Aufputschdrogen. Die Tochter meint, dass eh alles egal sei, und sie wisse nicht, wofür sie sich im Leben noch einsetzen solle und wofür sie überhaupt noch leben solle. Alles sei so egal und leer. Auch Suizid sei eine Option.
Der sehr demente Mann wird wiederholt von der Tochter an das Sterbebett seiner geliebten Frau begleitet. Sein Verstand versteht die Situation nicht in ihrer Tragweite. So scheint es. Aber seine Emotionen und sein Körper drücken eine andere Form des Begreifens aus. Das Ehepaar weint viel zusammen und hält sich in den Armen zum Abschied. Dann wird der Mann wieder zurückbegleitet, während bereits die wenigen Schritte auf dem Stationsflur alles vergessen lassen. Er ist wieder nur im Hier und Jetzt.
Dem Inhaber eines Unternehmens gehen mit 51 Jahren – nach einem Herzinfarkt – ungewohnte Gedanken durch den Kopf: War das bisherige Leben richtig ausgerichtet? Er will kürzertreten, mehr auf sich achten. Waren die bisherigen Ziele und die Art zu leben wirklich passend und wertvoll? Bisher führte er sein Unternehmen autoritär und straff, oft auch ohne Liebe zu den Mitarbeitern. War das der Grund für das verengte Herz?
Das alles sind ganz normale Situationen des Lebens, die ganz normalen Menschen begegnen: Krankheit, Tod, Schuld, plötzliche Veränderung der Rolle, Perspektiv- und Hoffnungslosigkeit, eine neue Nachdenklichkeit nach einem Not-Stopp, neue Gedanken, Rückblick und Vorausblick mit der Frage nach einem Sinn ... Solche Situationen oder Gemütszustände sind mit Fragen verknüpft:
Wohin, wofür, wozu soll ich jetzt leben? Oder: Wofür war das Bisherige gut, wenn es nun genommen ist? Was oder wer trägt mich jetzt und gibt mir Mut zum Leben? Aber auch: Wer bin ich eigentlich? Wer sind die anderen? Gibt es ein gutes Leben ab jetzt?
Viele treffen in solchen belastenden Situationen auf hilfreiche Menschen, die Trost, Wärme und Halt spenden und hierdurch Hoffnung oder Klarsicht ausstrahlen: Hausärzte, Nachbarn, Freunde, Seelsorger, Coaches, Psychotherapeuten, Hospizmitarbeiter, Palliativspezialisten. Viele treffen auch auf gut gemeinte Ratschläge von Menschen, die ihre eigenen Patentrezepte loswerden möchten. Die meisten Betroffenen jedoch machen die Verstörung mit sich selbst aus oder betäuben Verwirrung und Schmerz in Alkohol, Ablenkung durch Fernsehkonsum u. Ä. Und manche, die Hilfe in existenziellen Fragen suchen, erhalten zwar professionelle Hilfe, die aber ihr grundlegendes Sinn-Bedürfnis gar nicht berücksichtigt.
Wenn, liebe Leserin oder lieber Leser, ein solcher Mensch zu Ihnen kommt und offensichtlich nicht „krank“ ist, sondern nur an einer Sinnfrage „krankt“, dann könnten Sie ein Mensch sein, der Trost, Wärme, Halt, Hoffnung, Klarsicht stiften kann und sich als Begleiter anbietet.
Es gibt kaum einen Klienten, der explizit nach dem Sinn des Lebens fragt. Die meisten Klienten umschreiben eher ihre Sinnsuche oder das Erleben von Sinnlosigkeit:
Ich muss mich jetzt ganz neu sortieren, ich weiß nicht mehr, was richtig ist. Das raubt mir jeden Mut, wie konnte das nur passieren? Wie kann ich jetzt normal weiter funktionieren? Was ist denn jetzt meine Aufgabe, für welche Werte kann ich jetzt stehen? Was will ich aus meinem Leben machen? Was gibt mir überhaupt noch Halt?
Wir müssen uns also nicht zu großen metaphysischen, religiösen oder humanistisch-säkularen Vorträgen aufschwingen. Wir müssen auch keine Philosophie des Sinns vor unseren Klienten ausbreiten. Es hilft uns aber, wenn wir zum Thema von Sinn und Existenz einige Grundgedanken kennen und in die eine und andere Richtung hineingespürt haben, damit wir nicht erschrocken zusammenzucken, wenn ein anderer Mensch in seiner Existenz verunsichert ist und sich an uns wendet: Denn kein „Tool“ wird einem Profi beistehen, diesem Menschen zu helfen. Das Werkzeug in der Sinn- und Existenzberatung sind die helfenden Menschen selbst, als annehmendes und fragendes Gegenüber. Die Haltung als Profi ist dabei entscheidend, damit Klienten in verunsichernden Situationen Halt und Klarheit erfahren können.
Es gibt auch Situationen, in denen Klienten zunächst nur Schutz und Trost brauchen. Dann ist die Aufgabe, zunächst fürsorglich für einen Klienten da zu sein und erst im nächsten Schritt die Verantwortung für weitere Schritte zum Klienten zurückzugeben.
An dieser Stelle weise ich Sie schon darauf hin, dass wir uns einer Reihe philosophischer Fragen stellen werden. Wir wenden uns der existenziellen Beratung zu, die sich als praktische Fortentwicklung der Existenzphilosophie versteht. Wir lernen auch die Existenzanalyse und Logotherapie Viktor Frankls kennen. Sie wird auch als Therapieform genutzt, doch sie wurzelt wie alle Formen der Existenzberatung in der phänomenologischen und existenziellen Philosophie.
Von Anfang an war die Logotherapie Frankls als existenzielle Ergänzung zu anderen Therapieformen gedacht, ebenso als Ergänzung zur Beratung, zur Pädagogik, zum allgemeinen Umgang mit Menschen, zur ärztlichen Seelsorge sowie für andere Begegnungen zwischen Menschen, in denen die grundlegenden Fragen zum Sinn des Alltags oder des ganzen Lebensentwurfs auftauchen. Es geht um einen speziellen Blick auf das Sein und das Wesen des Menschen, das eigentlich Humane.
EIN BISSCHEN PRAKTISCHE PHILOSOPHIE:
Die Logotherapie und Existenzanalyse sowie andere Formen der Existenzberatung sind zu einem großen Teil Formen angewandter Philosophie oder philosophischer Praxis in unterschiedlichen Beratungs- und Bildungskontexten.
Wenn Sie Profi sind und einige Ideen des Buches in Ihre Arbeit einfließen lassen möchten, setze ich Ihr Einverständnis voraus, dass ich nicht nochmals erkläre, was überhaupt Coaching ist, was Psychotherapie, Supervision, was Seelsorge, was Hospiz- oder Trauerarbeit, was Palliativarbeit … wo die Unterschiede und Grenzen liegen, wie und wo man diese Formate erlernen kann und dergleichen. Das steht in vielen anderen Büchern. Wir fangen also gleich mitten im Sinn-Thema an.
„WAS IST DER SINN DES LEBENS ODER DEINES LEBENS?“
Einige Menschen aus meinem Umfeld habe ich gefragt:
„Was ist für dich DER Sinn deines Lebens? Und wenn es mal ganz schwierig wird: Was trägt dein Leben dann?“
Die Antworten einiger lebender Menschen finden Sie zu Beginn vieler Kapitel. Ich bedanke mich sehr für die Hilfe. Da die Zitate zu Beginn bestimmter Kapitel stehen, könnte der Eindruck auftauchen, die Zitate sollen die Kapitel einstimmen oder der nachfolgende Text soll das Zitat bestätigen oder widerlegen. Das ist in keinem Fall beabsichtigt! Die Zitate sind zufällig verteilt und würden auch vor jedem anderen Kapitel zu einer solchen nicht beabsichtigten Interpretation einladen.
Wir werden in diesem Buch auch etwas über den freien Willen und die Verantwortung für das eigene Leben, über Selbststeuerung und dergleichen erfahren. Natürlich sind solche Begriffe in Momenten größter Krise und Sinn-Dunkelheit Zumutungen für betroffene Menschen. In solchen Momenten braucht es Trost, Hoffnung, oft nur ein stilles Dabeisein. Der Aufruf zu Verantwortung und Freiheit in der Lebensgestaltung soll also Betroffene nicht zusätzlich kränken! Doch irgendwann gibt es wieder Licht oder Momente der Selbstbestimmung (auch durch Trost und weise Unterstützung). Nur das sind die Augenblicke und Zeiträume, in denen wir die Wahl haben.
Bevor wir beginnen, lassen Sie uns noch einige Eindrücke zu den möglichen Bedeutungen sammeln, die mit dem Begriff des Sinns verbunden sind. Andere Begriffe wie Existenz lernen wir später auch noch näher kennen.
DER WORTSINN DES SINNS: SINN WEIST DIE RICHTUNG UND GIBT BEDEUTUNG
Der Uhrzeigersinn:
In diese Richtung geht die Bewegung des Zeigers.
Ich verstehe das Gesagte
in diesem Sinne:
Diese Bedeutung gebe ich dem Gesagten.
Das
ergibt keinen Sinn:
Ich verstehe den kausalen (Ursache und Wirkung) oder den teleologischen (auf ein Ziel hin ausgerichteten) Zusammenhang nicht.
Was ist der Sinn der Aussage?
Was ist ihr Bedeutungsgehalt?
Das
schießt mir in den Sinn:
Dieser Gedanke taucht gerade auf.
Das ist
in meinem Sinne:
Das habe ich so gewollt (Absicht), das entspricht meiner Absicht.
Sinneswahrnehmung:
Empfangsorgan für Daten der Außen- oder Innenwelt (der Sinn der Daten wird dann jedoch im Gehirn konstruiert).
Der Gemeinsinn:
Die allgemein übliche Auffassung (aber auch: Das Gemeinwohl im Blick haben).
Althochdeutsch
sinnan:
streben, begehren, reisen, sich auf einen Weg begeben.
Indogermanisch
sent-
: gehen, reisen
Lateinisch
sentire:
fühlen, wahrnehmen
Lateinisch
sensus:
Gefühl, Meinung, Sinn
Englisch
meaning:
Sinn, Bedeutung
In diesem Buch werde ich Sie nicht davon überzeugen, dass eine bestimmte Religion die beste ist oder dass Religiosität nur eine Illusion ist. Ich werde weder behaupten, dass nur der Naturalismus die Welt vernünftig erklären kann, noch, dass es einen Weltgeist gibt oder nicht.
Stattdessen werde ich viele Blickwinkel vorstellen, die verschiedenen Menschen als letztendliche Welterklärung dienen oder als Denkgrundlage ihres Lebens. Nach und nach werden wir im Laufe des Buches sehen, dass wir Menschen wohl alles in jede Richtung denkerisch annehmen oder verwerfen können – und das jeweils mit gutem Grund. Was für den einen tröstlich und wahr ist, ist für den anderen nur ein illusionäres Hirngespinst. Das Ziel dieses Buches soll es nicht sein, der einen oder anderen Seite dazu zu verhelfen, dass sie recht bekommt. Es soll eher um die Frage gehen: Was hilft uns oder was hilft anderen, wenn es um die großen Fragen des Lebens (oder des Sterbens und des Leids) geht oder darum, ein glückliches Leben zu leben? Vielen hilft eine gewisse Offenheit. Dieses Buch soll dazu einladen.
Ich möchte Sie noch darauf hinweisen, dass ich um die Begrenzung meines Wissens weiß. Besonders wenn es um die dargestellten Philosophen und ihr Denken geht oder um spezielle Aussagen der Naturwissenschaften und Gesellschaftswissenschaften, sind meine Kenntnisse lückenhaft. Ich versuche, Ihnen darzustellen, was ich als wesentlich verstanden habe, und das meist in einfachen Worten. Mir fehlen aber Tiefe und Weite in der Vernetzung der einzelnen Spezialdisziplinen, weshalb wohl einige Fehlinterpretationen hier und da enthalten sein können. Nehmen Sie bitte die Informationen oder Schlussfolgerungen als Impuls für Ihr Nachdenken und Diskutieren in einer Gruppe – und nicht als meinen Versuch, die Welt umfassend zu erklären.
Am Ende der Kapitel habe ich jeweils Bücher aufgeführt, von denen ich denke, dass sie einzelne Themen mit mehr Weitblick und Hintergrund erfassen oder ganz unterschiedliche Sichtweisen hervorheben (die ich manchmal aber nicht teile). So können Sie bei Interesse Ihre Fragen von verschiedener Seite her vertiefen. Zudem sollen die Kapitel in erster Linie einen Impuls zu einer kritischen Diskussion in Gruppen liefern.
NOCH EINE ANMERKUNG, BEVOR ES LOSGEHT:
In diesem Buch taucht fast immer die männliche Schreibweise auf. Das hat nur etwas mit der Leserlichkeit zu tun. Wussten Sie, dass einer der ersten Männer, der sich für die Rechte der Frauen einsetzte, John Stuart Mill war, in seiner Kampfschrift „Die Hörigkeit der Frau“ (1869)? Ich übersetze das englische Original mit „Die Unterdrückung der Frau“. Auch der nordamerikanische Indianer und Medizinmann Lame Deer war scharfer Kritiker der Unterdrückung der Frauen bei den Weißen. Und Simone de Beauvoir ebenfalls. Alle drei werden uns hier oder da in diesem Buch begegnen.
1.1
ZUHÖREN UND ERZÄHLEN
„Zwei Menschen erleben Ähnliches. Der eine bleibt, was er ist; der andere wächst dadurch am inwendigen Menschen, weil er ihm eine Bedeutung abgewinnt.“
Albert Schweitzer
Im Coaching, der Supervision, der Psychotherapie und in den anderen Beratungsformen und Verfahren, in denen Menschen gefördert, unterstützt und begleitet werden, reden wir viel über Ethik und Menschenbilder; zunehmend auch über die Sinnfrage. Neben all den „Tools“ und speziellen Kompetenzen, die Profis benötigen, ist es sicher wichtig, sich in aller Ruhe zunächst zu überlegen, was man als Profi selbst denkt oder fühlt: Über das Menschsein, über den Sinn des eigenen Lebens, über andere Formen der Lebensgestaltung. Besonders lehrreich hierzu finde ich das Fachgebiet Sozialpsychologie, zu dem Sie in den Lesehinweisen Buchempfehlungen finden. Aber auch die Verhaltenswissenschaft, die Humanbiologie, die evolutionäre Erkenntnislehre, Weisheitstraditionen und Religionen machen Aussagen zum Menschsein. Wollten wir alle Aspekte berücksichtigen, würden wir uns verzetteln.
Das vorliegende Buch nimmt lediglich einige Aspekte der angewandten Philosophie in Kombination mit psychologischem und psychotherapeutischem Wissen so in den Blick, dass dieses Wissen für Coaches und Berater nützlich ist, um ihr Selbst- und Menschenbild zu reflektieren. Es ist also nur ein Blick auf den Menschen, unter vielen möglichen.
Wenn es um philosophische Themen geht, dann kommt es zuallererst darauf an, dass man sein eigenes Denken kennenlernt und in dieser Disziplin mutiger und flexibler wird. Es kommt nicht darauf an, dass man die Meinungen berühmter Philosophen aufsagen kann oder Theorien lernt. Philosophie heißt ja übersetzt so viel wie die Liebe zur Weisheit. Das Wort bedeutet aber nicht Wissen von der Weisheit.
Denken übt man beispielsweise, wenn man sich mit anderen austauscht. Sonst drehen sich die Gedanken immer nur im eigenen Spielfeld im Kreis. Wir brauchen jemanden, der uns zuhört, uns fragt, uns irritiert. Erst dann traut sich unser sprachliches Denken manchmal über die Begrenzung des Spielfeldes.
DIESES BUCH SOLL ZUMGEMEINSAMEN DENKEN ANREGEN:
Coaches, Supervisoren, Trainer, Psychotherapeuten, Berater, Begleiter jeder Art sollten ihr Selbst-, Weltund Menschenbild (Vorannahmen, Werte und Denkbegrenzungen) kennenlernen, bevor oder während sie sich um „Tools“ und Handwerk bemühen. Einen Blick auf unsere „Bilder“ ermöglichen beispielsweise Fragen aus der angewandten Philosophie mit ihrem Bezug zu Psychologie, Ethik u. Ä.
Dieses Kapitel ist für diejenigen gedacht, die die Inhalte des Buches mit anderen diskutieren möchten. Wenn Sie das nicht planen, dann können Sie zum nächsten Kapitel weiterblättern und dieses hier überspringen. Es ist eine kleine Vorschule zum Diskutieren und Zuhören.
Wenn Sie belesen oder gebildet sind, dann werden viele Themen in diesem Buch nicht neu sein, vielleicht aber trotzdem manche Vernetzung oder Interpretation. Wenn Sie sich mit den Themen des Buches noch nicht befasst haben, dann wird vieles neu sein.
Die einzelnen Haupt- und Unterkapitel sind kein Kanon zum Auswendiglernen. Allein das folgende Thema „Glauben und Sinnstiftung“, das gleich folgt, ist so umfassend, dass es Hunderte dicke Bücher füllt. Ich werde einige Denkimpulse dazu aufführen, damit Sie in einer Denk- und Diskussionsgruppe kleine Assoziationspunkte haben, mit denen Sie starten können.
Ich schlage Ihnen vor, dass Sie das Buch mit einem Textmarker und einem Bleistift lesen. Wenn Ihnen ein Satz wichtig, komisch, lehrreich, verwerflich, schön, plump oder auf andere Weise bemerkenswert erscheint, dann markieren Sie ihn bitte. In einer Diskussionsgruppe könnte man so starten, dass alle kommentarlos einige solcher markierten Stellen in die Mitte „werfen“, als würde dort ein ideeller Korb für Themen stehen, die später von Bedeutung sein können. Dieses Teilen von bemerkten Buchstellen zeigt uns, dass wir auf ganz unterschiedliche Sätze reagieren (oder auf die gleichen und diese anders werten).
In einem nächsten Schritt könnten die Teilnehmer, einer nach dem anderen, zu ein oder zwei Sätzen etwas sagen: Nacheinander könnte jedes Mitglied der Diskussionsgruppe drankommen. Zunächst lesen Sie bitte den Satz noch einmal für die anderen laut vor. (Es kann passieren, dass auch andere diesen Satz später nochmals vorlesen.) Bitte erklären Sie den anderen ganz kurz: Wie hat mich dieser Satz berührt? Was hat dieser Satz mit meinem konkreten Leben zu tun: Mit Entscheidungen, die ich täglich treffe? Oder hat der Satz in meiner Biografie eine Bedeutung? Zieht er mich an oder stößt er mich ab? Beruhigt er mich (warum) oder beunruhigt er mich (warum)? …
Vielleicht schaffen Sie es bis zu diesem Moment noch, sich als Zuhörer mit Kommentaren zurückzuhalten, wenn andere von ihren Sätzen erzählen. Nachdem jeder einige Sätze vorgestellt hat und Sie in der Gruppe einen gewissen Überblick an Sätzen und Stimmungen haben, könnte eine Person vermehrt in den Fokus rücken, wenn sie das mag. Sie erhält dann mehr Raum zum Erzählen und die anderen mehr Raum zum Zuhören. Wenn Sie Profi sind, dann wissen Sie, was aktives Zuhören ist: Dabei nutzt man nicht die Gesprächsfetzen des Gegenübers, um eigene Assoziationen zu knüpfen, die man dann als Antwort sendet, sondern konzentriert sich auf den Erzähler und hilft ihm mit eigenen Fragen, seine Erzählung tiefer zu verstehen. Dazu ein Beispiel, wie aktives Zuhören nicht funktioniert:
Vielleicht hat ein Mitglied Ihrer Diskussionsgruppe einen Satz notiert, der kirchenkritisch wahrgenommen wurde, zu dem sie kommentierend sagt: „Mich regen die ständigen Kirchenkritiker auf, immerhin tut die Kirche viel Gutes und die Zeiten des Kreuzzuges sind vorbei.“
In vielen Diskussionsgruppen oder Talkshows kommt dann eine Zustimmung oder Entgegnung als Reaktion. So könnte ein Ja zum Gesprächsimpuls aussehen: „Ja, das regt mich auch auf, besonders, als würde niemand die Armenküchen, Diakonie und so weiter sehen …“ Oder jemand kontert mit einem Nein: „Die Kritik an der Kirche ist allerdings berechtigt. Denn diese Institution ist unverbesserlich. Bedenken Sie die vielen sexuellen Missbräuche, die jahrzehntelang vertuscht wurden …“
Eine andere Reaktionsform ist es, sich den Gedanken eines Erzählers anzueignen, ihn zu annektieren und ihn fortzuführen: „Ja, da bin ich ganz bei Ihnen, gerade letzte Woche habe ich mich selbst total aufgeregt, als ich …“ Schon ist man als Zuhörer wieder bei sich und nicht mehr beim Gesprächspartner.
Andere Gesprächsformen, die man in Talkshows häufig findet, möchte ich kurz auflisten:
Verallgemeinern
:
„Nun, Kritik an bestehenden Verhältnissen gehört zur menschlichen Natur.“
Fokuswechsel:
„Das mag sein, aber die wesentliche Frage hierbei ist doch vielmehr, dass …“
Theoretisieren:
„Nun, sozialpsychologisch liegt hier ein bekanntes Phänomen vor, das durch folgende Begrifflichkeit gekennzeichnet ist …“
Bewerten oder Zusammenfassen:
„Drei Argumente in Ihrer Erklärung sind beachtenswert, wobei Sie aber zum falschen Schluss kommen, dass …“
Im Modell des aktiven Zuhörens geht es darum, dass ein Zuhörer dem Erzähler Raum schenkt, den Raum des Erzählens. Statt eigene Erzählräume aufzumachen, zu bewerten, abzulenken oder Ähnliches, stellt man einfache Klärungsfragen oder Fragen, die sich auf Gefühle des Erzählers, konkrete Begebenheiten zu dessen Erzählung, innere Bewegung und Ähnliches richten. Ziel ist dabei nicht, dass Sie als Erzähler oder Zuhörer andere überzeugen. Ziel ist, dass ein Erzähler sich erzählend besser versteht und dabei durch Fragen der Zuhörer unterstützt wird. Die üblichen Bücher zum Thema „Diskutieren und Überzeugen“ gehen in eine ganz andere Richtung und helfen hierbei nicht. Denn darin wird eher gelehrt, wie wir die Schwächen in der Argumentation der Erzähler ausnutzen, um unsere Stärken in den Vordergrund zu stellen. Dabei geht es oft um Wettkampf oder sogar um sprachliche Gewalt.
Im Modell des aktiven Zuhörens geht es aber um akzeptierende gemeinsame Entwicklung. Das geht jedoch nur, wenn man sicher sein kann, dass andere einem nicht in den Rücken fallen, sobald man sich als Erzähler öffnet.
Wer also eine Gruppe erleben möchte, die sich aktiv zuhört und öffnet, braucht zunächst einige Stunden der Vertrauensbildung. In meiner Heimatregion Minden-Westfalen haben wir einen Gesprächskreis für Philosophie, Toleranz, Spiritualität und Psychologie gegründet. Darin sind (gemischt weiblich und männlich) Pfarrer, Diakone, Atheisten, Yogalehrer, Psychotherapeuten, Coaches, Ärzte verschiedener Fachrichtungen … In den ersten 18 Monaten haben wir nur von uns erzählt, jeweils abwechselnd in den Häusern verschiedener Mitglieder. Nach und nach entstand so viel Vertrauen, dass wir sehr kontroverse Themen auf eine persönliche Weise diskutieren konnten.
Dazu einige persönlichere Beispielfragen des aktiven Zuhörens:
Auf das Gefühl des Erzählers näher eingehen:
„Wenn Sie sagen, die Kirchenkritiker regen Sie auf, was ist das für ein Gefühl? Ist das Wut oder Enttäuschung oder was nehmen Sie dabei wahr?“
Den ersten Impuls wertschätzen:
„Was ist Ihre erste unreflektierte emotionale oder gedankliche Reaktion auf die Textstelle?“ (Das kann später relativiert werden, doch sollte nicht – wie sonst bei Erwachsenen – unter den Tisch gekehrt werden.)
Auf die Umstände konkreter eingehen
:
„An welche Person oder welche Situation denken Sie gerade, wenn Sie das sagen? Ist es in Ordnung, wenn wir diese konkrete Situation hier teilen?“
Zurückspiegelung eigener Betroffenheit:
„Bei mir taucht – wenn ich Ihnen zuhöre – ein Gefühl auf, das ich bei Ungerechtigkeiten spüre. Hat das bei Ihnen etwas damit zu tun oder ist das etwas anderes?“
Hierbei müssen Sie nie „mit der Tür ins Haus fallen“, sondern stellen zunächst behutsame Fragen. In dem Gesprächskreis, in dem ich selbst Mitglied bin, gehen wir bei einzelnen Aussagen auch auf die Biografie ein und berichten von unseren Erfahrungen aus Kindheit, Jugend, Studienzeit mit den jeweiligen Themen. Was wir in den Texten eines Buches bemerkenswert finden, hat viel mit unserer eigenen Geschichte zu tun – und noch viel mehr mit Emotionen. Das wird in reinen Sachdiskussionen oft in den Hintergrund gedrängt.
Wenn Sie in einem Kreis argumentieren, der keine biografischen Zusammenhänge oder Gefühlsoffenbarungen zulässt (Seminar an der Universität, offene oder unverbindliche Gruppe mit ständig wechselnden Teilnehmern), dann müssen Sie rationaler fragen und sich natürlich auch schützen. Statt nach Gefühlen zu fragen, wäre dann passender: „Auf welche Erlebnisse oder Fakten bezieht sich Ihr Urteil konkret?“ Aber auch hier sollte das Ziel nicht sein, dass dann der Erzähler der Unwissenheit überführt wird, sondern, dass er selbst und die anderen besser verstehen, worum es ihm geht.
Es gäbe noch viel mehr zu schreiben über Kommunikation in Gruppen und wie in Gesprächen untereinander mehr (Selbst-)Erkenntnis, mehr Herzlichkeit, mehr Tiefe entstehen. Wenn Sie sich als Gruppe entschließen, dass ein vernünftiges (größtenteils rationales) Diskutieren im Vordergrund stehen sollte, dann schauen Sie sich bitte nach Diskussionsregeln um. Wenn Sie in der Internetsuchmaschine „Diskussionsregeln“ eingeben, finden Sie mehrere Quellen mit Ratschlägen. In den Lesehinweisen sind auch Buchvorschläge zum vernünftigen Argumentieren aufgenommen. Doch ich empfehle Ihnen, dass auch Bauchgefühle und erste emotionale Reaktionen ihren Platz im Gespräch haben sollten.
Nach meiner Erfahrung schärfen rational geführte Diskussionen das Wissen und die argumentative Klarheit, bleiben aber auch ein bisschen theoretisch. Persönlichere Gesprächsformen mit biografischem und emotionalem Bezug hingegen verändern eher die gelebte Haltung und führen eher zu einem Persönlichkeitswandel. Am besten wäre es wohl, man könnte beide methodischen Formen miteinander kombinieren.
SIE SIND GEFRAGT:
Wie wollen wir miteinander reden?
Wo und wie oft trifft sich Ihre Gesprächsgruppe?
Wie viele Personen dürfen teilnehmen, wann und wie darf jemand neu dazukommen?
Geht es uns eigentlich um Erkenntnis, um Selbsterkenntnis, um inneres Wachstum? Wer verbindet welche Hoffnungen und Ziele mit der Gruppe?
Wie bauen Sie Vertrauen in der Gruppe auf? Wie lange wird das dauern?
Möchten Sie auch über Gefühle und Biografie reden oder lieber nur über Fakten und Gedanken?
Wie möchten Sie die Gespräche strukturieren? Vielleicht so: Ein Text oder Thema, Bemerkenswertes teilen, Selbstbezug dazu herstellen, kontroverses diskutieren, Vernetzung zu anderen Wissensgebieten herstellen, Ausblick darauf, wie das Thema noch einmal mit erweitertem Horizont aufgenommen werden könnte? Entwickeln Sie ein Konzept, damit Ihr Gesprächskreis keine Klöngruppe wird.
LESEHINWEISE:
Klaus Jonas, Wolfgang Stroebe, Miles Hewstone (Hrsg.): Sozialpsychologie. Springer, 6. Auflage 2014
Dieter Frey, Hans-Werner Bierhoff (Hrsg.): Sozialpsychologie – Interaktion und Gruppe. Hogrefe, 1. Auflage 2011
Michael Wittschier: Gesprächsschlüssel Philosophie: 30 Moderationsmodule mit Beispielen. Cornelsen, 1. Auflage 2012
Wolfgang Weimer: Logisches Argumentieren. Reclam, 1. Auflage 2005
Thomas Stölzel: Sprache und Wahrnehmung in Therapie, Beratung und Coaching. Vandenhoeck & Ruprecht, 1. Auflage 2015
Björn Migge: Handbuch Coaching und Beratung; aktives Zuhören: S. 95f, 174f, Beltz, 5. Aufl. 2023
Ludger Pfeil: Du lebst, was du denkst: Neun philosophische Denkweisen, mit denen wir uns und andere besser verstehen. rororo, 1. Auflage 2015
Ingrid Miethe: Biografiearbeit: Lehr- und Handbuch für Studium und Praxis. Beltz Juventa, 3. Auflage, 2017
Michael Hampe: Die Lehren der Philosophie: Eine Kritik. Suhrkamp, 3. Auflage 2016
1.2
GLAUBEN ALS SINNSTIFTUNG
„Der Sinn des Lebens? Meinen mir zugedachten Platz im Leben zu finden und ihn mit Humor, Wärme und Dauer auch auszufüllen. In schwierigen Zeiten trägt mich die Erfahrung, dass es in der Welt eine KRAFT gibt, die wir Gott nennen.“
Elke Sieker, ehem. Lehrerin
Wenn es um „Sinn“ geht, dann beginnt für viele die Suche in der Religion, dem Glauben oder großen Ideologien. Mit dem Glauben in verschiedenen Formen geht es nun auch mit dem ersten „echten Sinn-Thema“ los als kurzer Gedankenimpuls für einen Diskurs:
1.2.1
OBJEKTIVER ODER SUBJEKTIVER SINN
Fragen wir jemanden nach dem Sinn des Lebens, dann denken einige Menschen an das, was sie im Alltag trägt und erfüllt. Andere verstehen die Frage in einem viel größeren Zusammenhang, nämlich nach der Stellung und dem Zweck des Menschen im gesamten Dasein. Für die zweite Gruppe der Menschen (oder sogar für beide) gaben die Religionen Tausender Jahre Antworten, die in großen Menschheitsmythen, Urbildern, in Poesie und auch in heiligen Büchern gesammelt sind. Die religiösen Institutionen der Welt mit ihrer jeweiligen Lehrtradition haben diese gedeutet, ausgelegt und ergänzt oder für Herrschaftszwecke verformt. Aus Sicht der jeweiligen Religionsvertreter gibt es einen „objektiven Sinn“ des Daseins, der in der jeweiligen Lehre umschrieben und begründet ist.
Manche heutige Menschen verwerfen diese Dogmen, andere vertrauen auf diese Lehrtraditionen oder zumindest auf einige ihrer Kernbotschaften. Viele deuten sie in ihrem Herzen für sich um und tragen in sich eine Hoffnung, die sich mit den Lehrworten ihrer Religion nur noch an manchen Stellen kreuzt. Das ist dann Religion im tieferen Sinne (lat. religio, Rückbindung) als Bezugnahme auf das, was unser Leben letztlich trägt, auf den Urgrund des Seins. Es ist ein persönliches Vertrauen und sollte nicht mit Religion als Institution oder organisiertem Kult verwechselt werden, die sich um Lehrsätze und Dogmen (goldene Kälber) konstituieren. Menschen, die dem „objektiven Sinn“ religiöser Institutionen nicht vertrauen, seien sie nun spirituell, agnostisch oder atheistisch, müssen sich Sinn in gewisser Weise selbst konstruieren. Dann wird Sinn zu einem individuellen konstruktivistischen Projekt: Man macht sich seinen eigenen Sinn.
ZWEI MÖGLICHKEITEN, SINN ZU FINDEN:
Ich glaube an einen objektiven Sinn, der durch eine höhere Macht gegeben ist und beispielsweise von Religionen beschrieben wird.
Ich konstruiere mir selbst einen subjektiven personalen Sinn, entweder ganz frei oder in Anlehnung an Religionen (oder an mystische und spirituelle Wege) oder an andere sinnstiftende Weltbilder.
In der Existenzanalyse und Logotherapie Viktor Frankls, auf die wir später noch näher eingehen werden, geht man allerdings davon aus, dass Sinn nicht wirklich konstruiert werden kann. Sinn entsteht erst, wenn wir auf die Anfragen des Lebens in wertvoller Weise antworten. Sinn entsteht sozusagen beim Gehen eines Weges, nebenbei. Allerdings muss ich gehen und einen Weg wählen, der meinem inneren Wesen entspricht. Dazu später mehr.
Worauf beziehen sich heutige Menschen also, wenn es einerseits um den Sinn im Alltag oder andererseits den großen Sinn des Ganzen geht?
Wer über den Sinn des Lebens nachdenke, schrieb Sigmund Freud (1856–1939) in einem Brief sinngemäß, sei neurotisch. Vielleicht hatte er ja in einem gewissen Sinne recht. Viele Menschen erleben sich heute in der Industrie- und Konsumgesellschaft, medialer Ablenkungsflut, riesigen Metropolen und beliebigen Werteangeboten marionettenhaft bewegt oder boden- und haltlos, sodass sie sich ausgebrannt, orientierungslos und sinnfrustriert wahrnehmen: Was ist wirklich relevant in dieser Welt? Woody Allen (*1935) prägte für das sinnentleerte Leben dieser Form 1977 das überzeichnete (trotzdem treffende) Bild des Großstadtneurotikers, der den Halt in einem geerdeten, artgerechten Leben verloren hat.
Es gibt sicher Bergbauern, Handwerker und viele „ganz normale Menschen“, die mit ihrem Sein, der Natur, ihrem Wirken im Privaten und der Familie und Gesellschaft auf glückliche Weise verbunden sind, ohne sich die Sinnfrage zu stellen oder latent an ihr zu kränkeln. Denn sie leben sinnhaft, einfach so.
Doch Freuds Kritik ging über die Idee des latent am Sinn kränkelnden Großstadtneurotikers hinaus: Er zielte vornehmlich auf die metaphysischen Sinnkonzepte der Religionen. Er war ein vehementer Gegner religiöser Institution und ihrer Botschaften, die den Menschen Moral und Sinn als gottgegeben vorschreiben. Die Anhaftung an – so meinte er – irrationalen Konzepten und autoritären Dogmen der Religionen sei nichts als die Suche nach Halt oder Trost in einer Illusion oder einem Wahn; also in einer Neurose.
SIE SIND GEFRAGT:
Jetzt kommt die erste Gelegenheit zum Austausch mit anderen als „Sie sind gefragt“. Ich hoffe, dass Sie dieses Buch mit anderen Interessierten gemeinsam durcharbeiten können. Dafür ist es sinnvoll, dass Sie im Text Anmerkungen mit Bleistift oder Textmarker machen: Was regt Sie auf, was finden Sie toll, was wollen Sie sich merken, was möchten Sie kritisch diskutieren, was möchten Sie die anderen fragen? Dann gehen Sie mit anderen in einem toleranten Dialog diese Punkte durch und ebenso die folgenden Anregungen. Dialog bedeutet nicht, dass man andere niederredet, sondern zuerst einmal, dass man wirklich und ehrlich versucht, die anderen zu verstehen in ihrem Denken. Seien Sie nachsichtig. Denn die Fragen um Gott bergen die Kraft in sich, dass Menschen sich entzweien. Der Glaube kann genauso trennend sein wie die Zugehörigkeit zu politischen Lagern, zu unterschiedlichen Ansichten über Kinder- oder Hundeerziehung. So, nun geht es los.
Wie halten es eigentlich Coaches mit dem Glauben und Religionen? Ein kurzes Blitzlicht hierzu: Ein Seminar mit etwa 20 Personen zum Einsatz der Logotherapie und Existenzanalyse im Coaching, einem „Sinn-Seminar“, das mit erfahrenen Coaches durchgeführt wurde. Wir tauschten uns darüber aus, ob wir an Gott glauben, wie dieser Gott in unserer Vorstellung sei oder wie wir es mit der Religion oder Spiritualität halten:
Vier Personen waren als Kinder in der Kirche engagiert und glaubten an Gott. Sie haben diesen Glauben verloren und sehen sich nun eher als Agnostiker. Sie wollen keine klare Stellung gegen oder für den Glauben an Gott einnehmen, da sie dieses Thema für sich selbst nicht bedeutsam empfinden. Eine Person ist säkular erzogen worden und bekennt sich zu einem säkularen Humanismus. Eine Teilnehmerin hat vor 25 Jahren ihr Leben Jesus Christus übergeben. Er sei Zentrum und Herz ihres Glaubens. Zwei Teilnehmende gehen regelmäßig in die Kirche, da dies für sie ein Ort ergreifender Spiritualität sei. Die Atmosphäre, die Musik und anregende Predigten geben ihnen Kraft und Zuversicht. Der Rest der Teilnehmenden ist auf verschiedenste Weise „irgendwie“ spirituell. Sie wollen sich dabei aber nicht festlegen: Sie glauben an oder empfinden eine „höhere Macht“, ein „ordnendes Prinzip im Universum“, eine „Kraft, die über das Naturwissenschaftliche hinausweist“ u. Ä. Sie sehen aber keine Notwendigkeit, diese Vorstellung für sich zu einem Lehrgebäude oder einer Dogmatik auszubauen.
Die Mehrzahl der Teilnehmenden sind – egal ob Agnostiker, Gläubige oder „irgendwie Spirituelle“ – Mitglieder einer christlichen Kirche, weil sie in diese hineingeboren wurden und weil sie diese als eine tragende soziale Institution kennengelernt haben. Dieser Austausch fand im Seminar in großer Wertschätzung und Akzeptanz der „Andersgläubigkeit“ statt.
In anderen Seminaren zu diesem Thema finden sich in der Regel auch ein bis zwei Personen, die sich sehr intensiv mit Yoga oder Buddhismus befassen sowie hin und wieder auch gläubige Moslems. Das Thema „Sinn“ zieht vermutlich vermehrt Coaches an, die auf die eine oder andere Art eine spirituelle Sehnsucht in sich verspüren. Möglicherweise wäre das kurze Blitzlicht anders, wenn ein Seminar zum Thema „kognitives Umstrukturieren“ ausgeschrieben ist.
1.2.2
IST RELIGION DOGMATISCH?
Für Ihre kontroverse Diskussion stelle ich im Folgenden einige Behauptungen auf zum Begriff des Dogmas (von gr.: Meinung, Lehrsatz, Beschluss, feststehende Definition mit Wahrheitsanspruch).
Der Kernbestand jedes religiösen Glaubens hat eine gewisse Ausschließlichkeit, das heißt, diejenigen, die nicht daran glauben, sind in gewisser Weise ausgeschlossen. Sie sind anders, nicht-wissend, verwerflich, unerleuchtet, nicht erwählt … Ähnlich ist es auch bei Vereinen: Wer als Mitglied in einem sehr speziellen Verein nicht gemäß der Vereinsziele denkt und handelt oder sich sogar gegen sie stellt, verliert früher oder später das Zugehörigkeitsrecht und muss in einen anderen Verein eintreten oder vereinslos leben.
Was ist aber der „Vereinszweck“, also das Ziel, von Glaubensgemeinschaften mit Dogma? Zum einen wirken sie meist wohltätig und sie haben diverse sozialpsychologische Binnenfunktionen (Zugehörigkeit, Bereitstellung von Werten u. v. a.). Ein wesentlicher Zweck ist aber auch die Verbreitung des Dogmas, also die Ausbreitung des jeweiligen Glaubens oder seiner Kernaussagen, mit dem Ziel, Nicht-Mitglieder für den eigenen Verein zu begeistern und sie von den Vorteilen einer Mitgliedschaft zu überzeugen (oder feiner ausgedrückt: sie zu erretten). In dieser Hinsicht sind also Glaubensgebilde virulent, von ansteckender Kraft also, und sie haben das Ziel, ihr „Genmaterial“ zu verbreiten wie Viren oder alle Formen des Lebens.
DOGMA BEDEUTET GLAUBEN OHNE DIE ERLAUBNIS ZUM ZWEIFEL:
In den Naturwissenschaften ist der Zweifel ein wichtiges denkerisches Prinzip. Wer Ausnahmen zu bestehenden Annahmen oder gar ihre Widerlegung begründet, schafft Fortschritt. In der Religion ist der Zweifel für den definierten Kernbestand des Glaubens nicht erlaubt. Wer beispielsweise als Christ die Auferstehung oder den Sündentod Jesu bezweifelt (also denkerisch hinterfragt und nach Ausnahmen oder einer Widerlegung forscht oder dieses Dogma ablehnt), ist kein Christ mehr. Wo immer folgender Satz auftaucht, haben wir es mit einem Dogma zu tun: „Wenn du Kernbestandteile unseres Glaubens infrage stellst oder ablehnst, gehörst du nicht zu uns oder musst mit Ausschluss oder gar mit Strafe rechnen.“ So wurden oder werden heute noch Angehörige mancher Religionen verfolgt oder gar getötet, wenn sie sich vom Dogma abwenden oder sich einem anderen zuwenden.
Ein Kennzeichen jedes Dogmas ist sicher auch, dass es nicht gerne als solches erkannt werden möchte (von inbrünstig Glaubenden oder den Mächtigen innerhalb von Glaubensinstitutionen). Oft wird in diesem Zusammenhang nicht von historisch entstandenen Regeln und Ideen gesprochen, sondern von übernatürlichen Offenbarungen oder Wahrheiten, die bereits in einer höheren Sphäre vorexistent waren und sind und lediglich ihren Niederschlag unter den Menschen finden oder fanden. Glauben wird hier zu einem (subjektiv so empfundenen) Wissen über diese Offenbarungen oder einer Glaubens-Gewissheit. Vielleicht mag Ihnen das alles zutreffend erscheinen mit dem Blick auf eine ganz fremde Religion, doch finden Sie es zu frech für den Blick auf die eigene Religion?
Wie bedeutend sind nun Religionen und ihre Dogmen in unserer modernen Gesellschaft überhaupt noch? Der religiös-spirituelle Zustand unserer Gesellschaft ähnelt in etwa in dem oben genannten Sinn-Seminar: In den großen christlichen Kirchen sind – je nach Region – 20 bis 75 Prozent der Mitteleuropäer Mitglied. In Polen, Portugal u. a. Staaten sind es mehr. In Deutschland gehen etwa 5 bis 15 Prozent der Kirchenmitglieder regelmäßig in den Gottesdienst, je nach Region oder Konfession. Die meisten Mitglieder – also 85 bis 95 Prozent – besuchen nur zu Weihnachten, zu Taufen oder Trauerfeiern die Kirche, wenn überhaupt. Zwar bezeichnen sie sich mehrheitlich als Christen und halten christliche Werte für bedeutsam, doch ist weder das Wissen um christliche Dogmatik (was ist die Natur Jesu, was ist Auferstehung, was ist Trinität u. v. a.) noch um die Kirchengeschichte (die blutige und intolerante Entwicklung dieser Dogmatik) relevant für sie. Viele von ihnen sind Menschen, die diese spitzfindigen Themen nicht interessieren, weil sie sich als spirituell wahrnehmen und nach hilfreichen Empfindungen und Erleben suchen, nicht aber nach Lehrsätzen und Meinungen.
Auf der anderen Seite – bei aller Unverbindlichkeit im Glauben und Gottesdienstbesuch – nehmen viele Kirchenmitglieder die Kirchen als sehr bedeutsame Werte-Institutionen wahr. Die Kirchen haben einen großen Einfluss auf Wertedebatten in der Gesellschaft. Unter vielen möglichen Religionsgemeinschaften habe ich exemplarisch die christlichen Kirchen herausgegriffen, weil sie das kulturelle Leben in Deutschland aktuell stärker prägen als andere Religionen.
SIE SIND GEFRAGT:
Glauben in Gemeinschaft? Sind Sie Mitglied einer religiösen Glaubensgemeinschaft? Was führte zu Ihrer Mitgliedschaft? Seit wann sind Sie Mitglied? Wie oft nehmen Sie an Veranstaltungen dieser Gemeinschaft teil? Welche Rituale, Gepflogenheiten, Formen des Feierns, Glaubensinhalte o. a. geben Ihnen Halt, Orientierung und Hoffnung? Wie beantwortet Ihre religiöse Institution die Frage nach dem „Sinn des Lebens“ (welche der Antworten nehmen Sie am deutlichsten wahr)? Wie interpretieren Sie selbst die Frage nach dem Sinn des Lebens im „großen Ganzen“? Welche Seiten der Mitgliedschaft oder inneren Überzeugungen des Glaubens sind für Sie störend oder verwirrend?
Glauben als Individuum? Wenn Sie kein Mitglied einer Glaubensgemeinschaft sind: Zu welchen Menschen fühlen Sie sich in Fragen von Glauben oder Nicht-Glauben zugehörig? Wie stehen Sie mit diesen Menschen in Kontakt? Welche Antworten finden Sie – vor dem Hintergrund dieses Glaubens oder Nicht-Glaubens – auf die Frage nach dem umfassenden Sinn des Daseins oder Ihres Lebens?
Glauben ohne Dogma? Oben habe ich kurz angedeutet, wie „Dogma“ interpretiert werden kann. Wie haben Sie emotional auf diese Aussagen reagiert? Es gibt auch im Alltag, in Familien, Firmen, Dörfern … Vorannahmen, die nicht hinterfragt werden dürfen, ohne in Schwierigkeiten zu gelangen. Auch in der Wissenschaft werden manchmal Ideen als „Dogma“ konstruiert, besonders innerhalb von Wissenschaftshierarchien (Beispiel: Chef einer Abteilung gibt aus Eitelkeitswahn vor, wie andere zu denken haben). In den Religionen werden Dogmen umfassend beschrieben: als Glaubensbekenntnisse, Katechismen – aber auch in sehr dicken systematischen Lehrbüchern. Wer sich nicht an sie hält oder Kernaussagen bezweifelt, verliert Lehrbefugnis, Amtswürden oder Mitgliedschaft (früher geschah noch viel Schlimmeres). Wo treffen Sie persönlich in Ihrem Umfeld auf Denkbegrenzungen? Wo vermeiden Sie selbst durch Ihr eigenes angepasstes Denken, in die Nähe der Grenzen zu kommen? Wie kann ein Glauben an Gott oder eine Spiritualität ohne Dogma aussehen?
Für viele Menschen leitet sich der Sinn ihres Lebens nicht mehr direkt aus dem Glauben ab, der in der Institution Kirche vor Ort gelehrt wird. Im Osten Deutschlands orientieren sich etwa 75 Prozent der Bevölkerung überhaupt nicht an der Kirche. Im Kapitel 1.16 „Spiritualität“ gehen wir hierauf noch einmal unter einem anderen Gesichtspunkt ein.
1.2.3
HUMANE RELIGION FROMMS
Erich Fromm (1900–1980), der vielen durch seine Bücher „Die Kunst des Liebens“ und „Haben oder Sein“ bekannt ist, verlor seinen orthodoxen jüdischen Glauben im Rahmen seiner Psychoanalyse als junger Mann. An die Stelle der personalen Gottesbeziehung setzte er das Ideal des Humanismus. Für ihn wurde der Mensch in diesem Moment Ursprung und eigener Schöpfer seines Sinns. In seinem später formulierten humanistischen Credo baut er jedoch die Idee Gottes wieder ein, als Zielgestalt humaner Entwicklungsmöglichkeit („Ihr werdet sein wie Gott“, 1966). Im höheren Alter wandte er sich mystischer Erfahrung zu, die ihm vom Daisetsu Teitaro Suzuki (1870–1966) nahegebracht wurde (Fromm/Suzuki: „Zen-Buddhismus und Psychoanalyse“, 1972).
Weiter unten werde ich Fromms Gedanken zum neuen Humanismus kurz erklären, sein humanistisches Credo. An dieser Stelle möchte ich die nicht-personalen Religionen erwähnen, von denen Fromm einige für „humane Religionen“ hielt, im Gegensatz zu „autoritären Religionen“. Bei autoritären Religionen, das sind für ihn Religionen mit einer personalen Gottesvorstellung, besteht ein Anspruch auf Gehorsam, Verehrung und Anbetung gegenüber Gott (wie immer diese/r in der jeweiligen Religion genannt wird). Ein wesentliches Element autoritärer Religion ist also die Unterwerfung unter die Macht jenseits der Menschen. Die institutionelle menschliche Vertretung Gottes selbst verlange ebenfalls nach Unterwerfung.
So verlangte Johannes Calvin (1509–1564) beispielsweise, wir müssten in uns alles zerschmettern und eine ungeheuerliche Demut und Niedrigkeit des Herzens erlangen gegenüber Gott. Jede Form von Gott-Mensch-Beziehung, die solche totale Unterwerfung vor einer höheren Macht abverlangt, lehnte Fromm ab. Er konnte sich aber mit einer theistischen (gr. theos: Gott) Form von Religion anfreunden, die versucht, Gott als ein Symbol für die humanen Kräfte zu beschreiben, als eine Religion, die dem Menschen hilft, seine eigenen Kräfte zu entfalten und zu lieben. Beispiele für Botschaften in diese Richtung sah er im frühen Buddhismus, bei Jesaja, Jesus, Sokrates u. a.
Die Vereinnahmung durch religiöse Institutionen kleidete diese Botschaften oft wieder ein als autoritäres Gewand. Als Psychoanalytiker lag es nicht in seinem Interesse, Religion oder die Idee Gottes zu verdammen. Er geht mit dem Wort Gott vorsichtig um: Einmal überlegt er, wie der Mensch sein Bestes auf Gott projiziert und sich dabei selbst verliert, dann formuliert er Ideen, wie der Mensch sein Bestes und seine wahrhaft humanen Qualitäten nur anstreben kann, indem er Gott als einzigen Zugang zu seinem wahren Selbst wählt. An anderer Stelle in seinen unzähligen Aufsätzen und Büchern beschreibt er mystische, nicht personal-göttliche Zugänge zum wahrhaft Humanen.
Fromm war auch ein Bewunderer Meister Eckharts (1260–1328), des tiefgründigen mittelalterlichen Mystikers, dessen Begriffe wie Seelengrund oder seine Bedeutungsunterscheidungen in Gott (etwa: unsere Vorstellung oder Meinung von Gott, unser Bild von ihm) und Gottheit (etwa: Abgrund des Nichts, jenseits menschlicher Vorstellungskraft, in der Mystik erahnbarer Gott) oder das Postulat der Einheit Gottes mit der Menschenseele ihn bewegten. In dieser Vielfalt seiner Such- und Denkbewegungen zum Atheismus, zum personalen Gott, bleibt Fromm wohl zeit seines Lebens der jüdischen Mystik des Chassidismus verbunden. Mit seiner Form des Humanismus ist er für viele eine Zumutung: Gläubige sehen ihn als Atheisten, der das Humane zur neuen Gottheit erhebt, Psychoanalytiker fanden ihn zu lasch in der Ablehnung der Gottesidee, naturalistische Humanisten verstehen nicht, dass er den Gottesbegriff nicht gänzlich über den Haufen geworfen hat und mit Begriffen wie Seele und dergleichen hantiert …
LESEHINWEIS:
Rainer Funk (Hrsg.): Erich Fromm Lesebuch, DVA, 1985 (2015 nur antiquarisch zu beziehen). Eine breite Mischung von Fromms Denken in Aufsätzen zu verschiedenen Themen, u. a. „Autoritäre und humanistische Religion“, ausgewählt von Rainer Funk, der mehrere Fromm-Bücher aus einzelnen Aufsätzen thematisch passend zusammenstellte und herausgab.
SIE SIND GEFRAGT:
Ein Glauben ohne personalen Gott – Beispiel Buddhismus Viele Menschen befassen sich heute mit dem Gedankengut des Buddhismus oder anderen Religionen und Denksystemen (Taoismus, Formen des Hinduismus u. v. a.), die unserer Kultur früher einmal fern waren. Manche sehen im Buddhismus beispielsweise keine Religion, sondern ein kluges Denksystem oder eine Weisheitslehre. Andere interpretieren es für sich als Religion. Welche persönlichen Erfahrungen haben Sie mit solchen „fernen Denksystemen“? Inwiefern konnten oder könnten Sie Ihnen persönlich sinnstiftend sein?
LESEHINWEISE:
Ulrich Schnabel: Die Vermessung des Glaubens: Forscher ergründen, wie der Glaube entsteht und warum er Berge versetzt. Pantheon, 4. Auflage 2010
Jefferson Bethke: Warum ich Religion hasse. Und Jesus liebe. Gerth, 1. Auflage 2015
Clive Staples Lewis: Pardon, ich bin Christ. Meine Argumente für den Glauben. Brunnen, 15. Auflage 1986
Uwe Lehnert: Warum ich kein Christ sein will: Mein Weg vom christlichen Glauben zu einer naturalistisch-humanistischen Weltanschauung. Teia, 7. Auflage 2018
Eugen Drewermann: Wozu Religion? Sinnfindung in Zeiten der Gier nach Macht und Geld. Herder, Nachdruck der 9. Auflage 2017
Karl-Heinz Brodbeck: Buddhismus interkulturell gelesen. Traugott Bautz, 1. Auflage 2005
1.3
TOLERANZ IN GLAUBENSFRAGEN
„Sinn des Lebens? „Begegnung und Verbindung: Die Begegnung und die Zuneigung der Menschen, die mir nahe sind, die Begegnung mit meinem Körper, auf ganz verschiedenen Wegen, der Glaube an etwas ‚Höheres‘, was immer da ist und währt.“
Jutta Bock, Personal- und Business-Coach
Die Frage, ob die Sehnsucht nach Sinn uns durch Gott oder eine nicht-personale Gottheit eingegeben ist, ob sie eine zufällige Notwendigkeit der Evolution darstellt oder ob es sich tatsächlich nur um eine Neurose handelt, stellen wir noch zurück. Schon jetzt verrate ich Ihnen aber, dass ich die richtige Antwort nicht kenne, höchstens meine momentane Meinung. Ich bin kein glühender Anhänger der einen oder anderen Antwort. Ich nehme aber wahr, dass meine Mitmenschen hier eigene Deutungen finden und diese auch gelegentlich in ihrem Leben wechseln. Auch mein Denken hierzu hat sich hin und wieder verändert, durch neue Lernerfahrungen, neue Lebensabschnitte.
Ich persönlich schätze es nicht, wenn Menschen aus ihrer eigenen Glaubens- oder Wissensposition heraus andere oder deren Glauben gering schätzen. So lächeln manche Religionsvertreter über „Ungläubige“ oder beten für sie, damit auch sie zum Glauben kommen mögen. Genauso äußern Vertreter des naturalistischen Humanismus oder der Neurobiologie, dass sie zwar alle Menschen gleich achten, dass sie aber die Dummheit oder die Denkkonzepte dieser (religiösen, metaphysischen) Menschen nicht achten und akzeptieren können. Als gehörte unser Denken und Hoffen nicht auch irgendwie zu uns?
Die Diskussion wird von beiden Seiten manchmal sehr polemisch und doch mit gespielter Freundlichkeit geführt. Es wird ein tolerantes Deckmäntelchen übergezogen und trotzdem missionarisch oder aufklärerisch mit versteckter (unbewusster) Häme oder Selbstüberschätzung in die Richtung der jeweils anderen gedacht und argumentiert. Daher braucht es eine neue Kultur der wirklichen Toleranz, der Achtung und Akzeptanz, auf der Grundlage gemeinsam ausgehandelter Werte und sicher auch einer demütigen Prüfung des eigenen Herzens.
GOTT ODER DAS SEIN DES KOSMOS:
Wenn wir gläubig sind, dann ist uns klar, dass das wahre Wesen Gottes niemals in einem Wort aufgehen kann, welches Menschen sich erdenken und sprechen. Daher ist es wohl egal, ob wir von Gott, Allah, Atman, Weltseele, große Mutter oder anderen Worten reden. Unsere Worte zielen auf etwas, dessen Wesen für uns nicht fassbar sein kann. Ebenso lässt sich das Wesen des Urgrundes allen Seins nicht in den Kleingeistigkeiten von Dogmen, Formeln, Riten oder dergleichen fassen, die Gräben zwischen uns werfen. Statt jedoch zu begreifen, dass wir alle auf unsere je eigene Weise eigentlich über das Wesentliche reden könnten, streiten wir uns in der Wissenschaft, mit unterschiedlichen heiligen Büchern und Dogmen über Details und Kulturerfindungen. Die halten wir für das Wesentliche, womit wir uns ein „Bild“ vom Eigentlichen machen. Das wirft uns alle durcheinander (auf gr. diabol, der Durcheinanderwerfer ist der Diabolos, der Teufel). Das heilige Kalb, das Bild, das wir uns machen, entzweit uns. Jeweils die eigene Seite hat recht, die anderen sind im Unrecht. Das diabolische Prinzip setzt sich leider oft durch.
Natürlich darf man es sich nicht gefallen lassen, dass „der Glaube“ oder „das Wissen“ der jeweils anderen wichtige Werte einschränkt, die wir gemeinsam für erstrebenswert erachten, wie Freiheit, Gleichheit u. Ä. Doch die Tugenden von wahrhaftigem Respekt, von Toleranz und Achtung gegenüber „den anderen“ sind mir wichtig. In der Arbeit mit gemischten Meinungs- oder Glaubensgruppen zum Thema Sinn nehme ich wahr, dass die meisten sehr bemüht sind und trotzdem immer wieder in Fettnäpfchen treten, weil wir durch unsere Biografie, Vorurteile, unbewusste Muster, ein Set von Meinungen und Dispositionen … darauf trainiert sind, zunächst einmal intolerant zu sein gegenüber anderen. Das trifft besonders zu, wenn es um einen „Preis“ geht, der zwischen „meiner“ und der „anderen“ Gruppe verteilt werden soll: Stimmen in Wahlen, Einfluss auf Entscheidungen, materielle Vorteile, Bildung. Wenn es um die Angst geht, dass man zu kurz komme. Toleranz kann in gewissem Umfang erlernt und trainiert werden.
In diesem Buch geht es um viele interessante Fragen. Wenn das Buch verständlich ist und nicht zu sehr von der eigenen Denkposition abweicht, dann ist es also ein „interessantes Buch“, in dem mit verschiedenen intellektuellen Positionen gespielt wird. Es ist ein Zeichen von Toleranz, wenn man einerseits anderen Menschen erlaubt, mit interessanten Ideen zu spielen, und ihnen auch zugesteht, dass sie mit anderen Ideen spielen als man selbst. Doch vermutlich werden wir durch Toleranz und interessante Ideen nicht glücklich, nicht von Sinn erfüllt und schon gar nicht erleuchtet. Dafür müssten wir eigentlich alle interessanten Ideen beiseitelegen und uns nur noch auf das Wesentliche beziehen. Das Wesentliche lebt nicht in Ideen, Dogmen, Meinungen, sondern in der Erfahrung einer sanften inneren Stimme. Diese Stimme findet immer wieder Ausdruck zwischen uns Menschen, wenn wenige verinnerlichte Menschen versuchen, uns von ihr zu erzählen. Das ist nicht jedermanns Geschmack, denn die Botschaft ist eigentlich „informationsarm“ und läuft oft auf wenige Aussagen hinaus, die alle großen Weisheitslehrer wiederholt haben. In neuer Zeit ist eine solche Stimme beispielsweise Eckhart Tolle (*1948). In seinem Buch „Eine neue Erde: Bewusstseinssprung anstelle von Selbstzerstörung“ zeigt er auf, dass die Menschheit mit all ihren Informationen und ihrer Intelligenz immer und immer wieder nur den Wahnsinn von Grausamkeit produziert hat, in einem Rausch von Gier, Machtstreben, Egoismus. Das geschieht immer wieder, wenn Menschen sich mit ihren Ideen, Dogmen, Meinungen identifizieren und dann bereit sind, für diese Ideen alles zu geben oder anderen zu nehmen. Wie könnte eine Welt aussehen, in der nicht mehr Glaube und Ideen das sind, was einen Menschen ausmacht, sondern stattdessen seine Bewusstheit (jenseits von Ego-Selbstbewusstsein)? Wenn man dies als Idee bejaht oder ablehnt, ist wieder nichts verändert. Wenn der Bewusstseinssprung aber erfahren wird, so Tolle, dann hat sich alles geändert.
SIE SIND GEFRAGT:
Wenn Sie an Gott glauben, beschreiben Sie bitte, wie er in Ihrer Vorstellung ist:
Sein Äußeres (obwohl klar ist, dass das so nicht stimmen kann – trotzdem haben viele ein Bild in sich schlummern), ist er gütig, eifersüchtig, streng, kontrollierend, zornig, barmherzig, warm, kalt …?
Welches „Bild“ Gottes hat sich in Ihnen geformt, zu dem Sie in Beziehung stehen?
Wie stehen Sie in Beziehung: unterwürfig, ergeben, in Auflehnung, wie ein liebendes Kind, trotzig, wegblickend, flehend, erwartungsvoll …?
LESEHINWEISE:
Michel Onfray: Wir brauchen keinen Gott. Warum man jetzt Atheist sein muss. Piper, 1. Auflage 2007 (sehr polemischer Text des streitbaren enfant terrible der französischen Philosophie. Kein Beispiel für Toleranz, sondern aggressiver Angriff gegen das Religiöse.)
Karlheinz Deschner: Der gefälschte Glaube: Eine kritische Betrachtung kirchlicher Lehren und ihrer historischen Bezüge. Knesebeck, 5. Auflage 2005
Björn Migge: Handbuch Coaching und Beratung, S. 578 ff. Beltz, 5. Auflage 2023 (Einführungstext zur Religiosität und Spiritualität im Coaching)
Eckhart Tolle: Eine neue Erde: Bewusstseinssprung anstelle von Selbstzerstörung. Ankara, 2. Auflage 2015
1.4
GEIST ODER MATERIE
„Sinn des Lebens? „Rock your riot demon and stay KRASS – konsequent, radikal, aktiv, selbstbestimmt und stark! Das Zauberwort für deinen ganz persönlichen Drachenritt durch ein freies Leben ist ein wirklich cooles Brain-Tattoo-Konzept.“
Rainer Biesinger Der Heavy Metal Coach®, Persönlichkeitstrainer, Redner, Buchautor
In der Philosophie befasst sich die Metaphysik (etwa: Lehre von den erfahrbaren und nicht erkennbaren Dingen des Seienden) oder die Ontologie (die Lehre vom Sein) mit den gedanklichen Ideen und Konzepten des Seinsgrundes. Hier geht es um die Frage, ob es Gott gibt und auch wie Gott ist. Oder um die Frage, ob es eine Welt der Ideen gibt, die sich von der Welt der physischen Erscheinungen und Erfahrungen unterscheidet.
Die Fragen der Metaphysik sind oft spekulativ, gewinnen aber neuerdings wieder Bedeutung, wenn sie mit den Erkenntnissen moderner Naturwissenschaft zusammengebracht und kritisch reflektiert werden. Neben vielen Gedankenkombinationen gibt es auch zwei Extrempositionen: Die einen meinen, dass es eine Welt der Ideen, des puren Geistes oder Gottes gibt, die von der Welt der natürlichen Erscheinungen getrennt ist oder die die Welt der Erscheinungen beeinflusst, lenkt oder trägt.
Und auf der anderen Seite gibt es die Naturalisten, Materialisten, Realisten, Atheisten oder naturalistische Humanisten, die recht übereinstimmend davon ausgehen, dass nur die Materie (inkl. der dunklen Materie) und ihre Kräfte die Basis des relevanten und erkennbaren Seins darstellen und sich hieraus wiederum Phänomene entwickelten wie biologische Wesen innerhalb einer selektierenden Evolution. In diesem Konzept braucht es die Größen Geist oder Gott nicht. Denken, Werte, Gefühle u. v. a. sind nur Ausdrucksformen, Folgeerscheinungen oder Epiphänomene (Randerscheinungen) des bio-physiko-chemischen Funktionierens des materiellen Universums und des Gehirns. Beide Extrempositionen können auch so verkürzt werden:
MIT ODER OHNE GEIST:





























