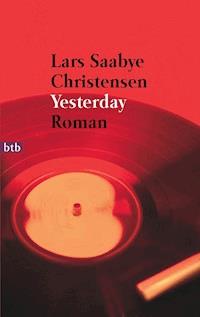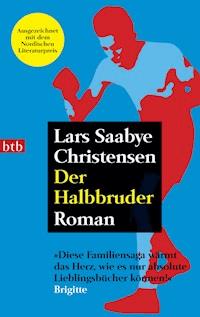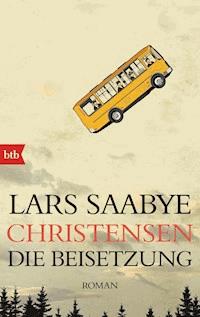3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: btb
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Das Letzte, was ich finden wollte, war mich selbst ...
Man wächst nur an den Wunden. Hatten das nicht alle behauptet, bevor ich meines Weges gezogen war? Dass ich mich selbst finden müsse? Aber das wollte ich nicht. Das Letzte, was ich finden wollte, war mich selbst. Ich wollte einen anderen finden, mit dem der Umgang einfacher war, einer, mit dem ich einer Meinung sein konnte, mit dem ich leben konnte, ohne einzugehen.
Ein Sommer voller Magie in Oslo. Tage voller Selbstzweifel in der amerikanischen Kleinstadt Karmack. Dazwischen liegt ein ganzes Leben, das der norwegische Schriftsteller Funder auf der Suche nach sich selbst und dem ganz gewöhnlichen Glück verbracht hat. Wie er schließlich lernt, sich selbst mit anderen Augen zu sehen und der Phantasie gestatten kann, Einzug in seine wirkliche Welt zu halten, ist eine der zärtlichsten Wendungen in diesem großen, berührenden Roman von Lars Saaybe Christensen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 657
Veröffentlichungsjahr: 2013
Ähnliche
Aus dem Norwegischenvon Christel Hildebrandt
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen. Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Die norwegische Originalausgabe erschien 2012 unter dem Titel»Sluk« bei Cappelen Damm, Oslo.
Copyright © der Originalausgabe 2012 by CAPPELEN DAMM AS
Copyright © der deutschsprachigen Ausgabe 2013 by btb Verlag
in der Verlagsgruppe Random House GmbH, Neumarkter Str. 28, 81673 München.
Lektorat: Frauke Brodd
Satz: Uhl + Massopust, Aalen
ISBN 978-3-641-12138-9V002www.btb-verlag.de
Blue skies
Smiling at me
Nothing but blue skies
Do I see
Bluebirds
Singing a song
Nothing but bluebirds
All day long
Never saw the sun shining so bright
Never saw the things going so right
Noticing the days hurrying by
When you’re in love, my how they fly
Blue days
All of them gone
Nothing but blue skies
From now on
IRVING BERLIN
Der Spiegel sieht nur mein letztes Gesicht,
ich spüre alle meine früheren
TOMAS TRANSTRÖMER
PROLOG
Mein Vater pflegte zu sagen: Man muss ein Haus bauen können, bevor man es zeichnen kann. Er selbst hatte als junger Mann in Kopenhagen vor seinem Architekturstudium eine Maurerlehre absolviert. Dann zog er nach Norwegen, um zu heiraten und norwegische Häuser zu zeichnen. Jetzt standen wir in Majorstua, zusammen mit mindestens tausend anderen Zuschauern, die mit Ohrenschützern und großen Sonnenbrillen ausgestattet waren, als ginge es um eine lärmende Sonnenfinsternis, deren Zeuge wir werden sollten. Aber dem war nicht so. Wir wollten zusehen, wie das Philipsgebäude abgerissen wurde. Zu seiner Zeit war mein Vater an der Planung beteiligt gewesen, 1958, und es handelte sich dabei um das erste Gebäude in Norwegen mit einer sogenannten curtain façade, damit die fünfzehn Etagen leichter wirkten, fast schwerelos. Das Philipsgebäude wurde zum Wahrzeichen von Oslo, aber bald schlug die Stimmung um, wandte sich gegen das Gebäude. Im Laufe der Sechzigerjahre blieb es als hässliches und verhasstes Monument all dessen stehen, was elendig in dieser Welt war, Monopolkapitalismus, Vietnamkrieg, Materialismus, Ausbeutung, EWG, Imperialismus, denn war es etwa kein amerikanischer Imperialismus, wenn man einen Wolkenkratzer mitten in Oslo errichtete und sogar ein schützenswertes Kino abriss, um Platz für ihn zu schaffen? Norwegische Häuser sollten möglichst niedrig sein, zumindest alle gleich hoch. Und das Schlimmste war, dass ich in diesen Sturm der Entrüstung einstimmte. Ich ging aufs Gymnasium und wurde mitgerissen. Ich traute mich nicht zu sagen, dass mein Vater an der Planung beteiligt gewesen war. War ich es nicht, der am lautesten schrie, wenn es um das Philipsgebäude ging? Ich schämte mich für meinen Vater. Ich schäme mich immer noch, dass ich das tat. Jetzt sollte es also abgerissen werden, in einer sogenannten controlled demolition. Spezialisten auf diesem Gebiet waren aus den USA geholt worden, woher auch sonst, denn für diese Methode war in Norwegen bisher noch kein Bedarf gewesen. Das Philipsgebäude war also das erste seiner Art, sowohl bei seiner Entstehung als auch bei seinem Abriss. Am letzten Sonntag im April 2000, um 13.00 Uhr, war es so weit. Mutter wollte übrigens nicht dabei sein. Sie wartete zu Hause auf uns. Massenzusammenkünfte und große Versammlungen mochte sie nicht. Die wirkten bedrückend auf sie. Ein Wort, das sie oft benutzte. Genauso ging es ihr mit dem Gebirge, Hochebenen, Geröllhalden, die wirkten auch bedrückend auf sie. Was mich immer verwunderte. Was ich nie begriff. Wenn sie der Meinung war, dass öde Weiten und Ebenen im Gebirge bedrückend waren, dann müsste sie sich doch unter Menschen wohlfühlen oder umgekehrt, aber nicht beides. Wie wenig ich doch verstand. Mutter war dazwischen. Dort war ihr Platz. Jedenfalls war sie nicht mitgekommen. Nur Vater und ich. Es ging auf ein Uhr zu. Da fiel mir auf, dass Vater jünger als ich jetzt gewesen war, als er das Philipsgebäude gezeichnet hatte. Es war seine Geschichte. Er sagte nur wenig. Jemand sprach in einen Lautsprecher. Die eifrigsten unter den Zuschauern mussten von Wachleuten zurückgehalten werden. Ich hätte meinem Vater gern gesagt, dass ich stolz auf ihn war, stolz darauf, dass er das Gebäude mitgeplant hatte. Ich hätte mich gern dafür entschuldigt, dass ich hinter seinem Rücken schlecht darüber geredet hatte, es verhöhnt und lächerlich gemacht hatte. Aber ich kam nicht dazu, es zu sagen. Ich hörte nur eine heftige Explosion, und im nächsten Moment lag das Philipsgebäude im Staub da, in seinem eigenen Staub. Es ging so schnell, dass viele es gar nicht mitbekamen. Einige murmelten sogar etwas von wegen, man sollte es noch einmal machen, damit die Leute auch ordentlich dabei zusehen konnten. Das war doch nur ein Probelauf, dachte ich, was für ein befreiender Gedanke, das war doch nur ein Probelauf, und jetzt konnte das Philipsgebäude sich wieder aus dem Staub und dem Rauch erheben, Etage für Etage, und ich konnte meinem Vater endlich sagen, wie stolz ich auf ihn war. Während wir dort standen, hatte er keine Miene verzogen. Ich bilde mir ein, dass er vielleicht Folgendes dachte, jedenfalls dachte ich das: Um ein Haus zu zeichnen, muss man es auch abreißen können. Auf dem Heimweg wollte ich ihm den Magnolienbaum direkt unterhalb der Universität zeigen, der in voller Blüte stand, eine weiße, fast durchsichtige Krone, die alle Jahreszeiten im April in sich versammelte, denn in diesem Monat erblühte und verwelkte sie. Deshalb leuchtete sie auch mit einer satten Kraft, trotz der zarten Farben. Vater legte mir die Hand auf die Schulter und sagte: Jetzt gehen wir nach Hause. Damit Mutter sich keine Sorgen um uns macht.
DER SOMMER, IN DEM MEINE MUTTER ZUM MOND FLIEGEN WOLLTE
1
Es war der Sommer, in dem Menschen auf dem Mond landeten, zumindest zwei von ihnen. Der dritte musste brav in der Rakete bleiben oder wie sie das nannten, schon bitter, wenn man bedenkt, wie weit sie gereist waren, und dann darfst du irgendwie das letzte Stück nicht mehr mitgehen, genau den Teil, der wirklich zählt, das ist ungefähr so, als wenn man zu einem ganz vornehmen Fest eingeladen wird, auf dem vorher noch niemand war, und dann musst du auf der Treppe stehen bleiben und warten, bis es vorbei ist. Und nur, damit es klar ist: Ich weiß sehr wohl, dass es nicht gerade neu ist, wenn ein Roman so anfängt. Wenn du sie aufeinanderstapelst, all diese hoffnungslosen Romane, die mit großen Schritten für uns und kleinen Schritten für dich und mich und dem ganzen Gesäusel anfangen, würden sie wahrscheinlich ungefähr bis zu eben diesem Mond reichen, und du könntest trockenen Fußes hin- und zurückgehen. Und ich weiß auch gar nicht, ob das hier überhaupt ein Roman ist oder sein wird. Wir werden sehen. Außerdem ist mit dem Mond eigentlich sowieso Schluss, zumindest in dem Sommer, über den ich mir vorgenommen habe zu schreiben. Deshalb ist es besser, wenn ich an Bord der Nesodden-Fähre anfange, der »Prinsen«, der schönsten Fähre auf dem Oslofjord, mit schwarzem Rumpf, weißer Brücke, eigenem Kiosk, Herren- und Damentoilette und einem Geländer aus Mahagoni. Ich stehe auf dem Deck, ganz vorn, und sehe, wie der Bug das Wasser durchschneidet, und betrachte die Wellen, die an beiden Seiten einen Streifen nach dem anderen bilden, in einer fast unbegreiflich schönen Symmetrie. Die Wellen, die auf Bygdøy zurollen, bringen die Wikingerschiffe dort zum Schaukeln, während die anderen auf die zerfurchten Uferfelsen stoßen, auf denen die Urlauber Holz fürs Mittsommerfeuer sammeln. Es ist also Mittsommer, aber es ist noch lange hin bis zur Nacht. Wir sind auf dem Weg zum Ferienhaus. Wir, das sind Mutter und ich. Sie sitzt im Salon. Sie hat Angst, sich zu erkälten. Das hat sie immer, dabei braucht sie gar keine Angst zu haben, denn es ist so windstill, dass selbst die Segelboote eine Auszeit nehmen, weil sie nichts zum Vorwärtstreiben haben. Vater ist in der Stadt geblieben. Architekten nehmen nicht frei, sagt er immer. Das Land muss erbaut werden, Wohnungen in Hammerfest, ein Kraftwerk in Valdres, das Rathaus in Drammen, Schwimmhallen, Telefonzellen und Schulen. Und wenn die Erbauung des Landes glücken soll, dann muss man zunächst zeichnen, jede Wand, jede Treppe, jede Tür und jede kleinste Besenkammer. Sonst wird es nichts. Vater ist also Architekt. Er plant die Stadt, über die ich den Rest meines Lebens schreiben werde. Doch zunächst muss ich mich um den Mond kümmern. Ich bin fünfzehneinhalb Jahre alt. Ich bin endlich fertig mit der Realschule, zwei qualvolle Jahre, und im Herbst werde ich aufs Gymnasium gehen. Einen Augenblick lang, während ich dem Sommer entgegenfahre, fühle ich mich vollständig frei. Ich bin ergriffen vor Glück und kurz vor den Tränen. Weder früher noch später habe ich jemals etwas Ähnliches gefühlt, und ich habe es auf die verschiedensten Arten und Weisen versucht. Glaubt mir. Ich werde bald sechzig.
Mutter kommt dann doch noch aus dem Salon, genau wie sie es immer tut, und stellt sich neben mich. Wie üblich hat sie zwei Eis gekauft, in Bootsform, irgendwie gehört das an Bord der Prinsen dazu, nicht wahr, was sollte man sonst essen, ein Nusseis, nein, das passt besser an Land. Wir lachen immer darüber, auch wenn man gar nichts mehr dazu sagen muss, es muss mindestens sieben Sommer her sein, dass wir es erwähnt haben, dass man an Bord der Prinsen natürlich nur Bootseis isst, ich glaube, ich war es sogar, der das gesagt hat, aber ich bin mir nicht ganz sicher, vor sieben Sommern war ich ja noch nicht besonders alt. Auf jeden Fall ist das unser kleines Spiel, und jetzt essen wir jeder unser Bootseis, schweigen aber dabei. Mutter trägt ein blaues Kopftuch, das sie fest unter dem Kinn geknotet hat, ungefähr wie einen Südwester, und sie erscheint mir wie immer anders als während des restlichen Jahres. Ich weiß nicht so recht, woran es liegt, vielleicht ist es eine Art Lockerheit, ein Leichtsinn, sie, die sonst jeden zweiten Tag die Fenster putzt und jeden Tag staubsaugt, sie, die immer Haltung bewahrt, koste es, was es wolle. Ich habe gesehen, wie sie in Ohnmacht gefallen ist, als wir Gäste hatten, aber erst, als die letzten endlich gegangen waren. Alles, was nicht gesehen wird, ist auch nicht geschehen. Alles, was nicht gesagt wird, gibt es nicht. Mutters perfekte Welt ist die unsichtbare. Kann auch sie diese Freiheit fühlen, die einen Raum nach dem anderen öffnet, in der alles möglich ist, eine Freiheit, die beinhaltet, dass ich gleichzeitig die Türen hinter mir schließen muss, eine nach der anderen, wenn ich nicht ratlos und verzweifelt stehen bleiben will, ohne je weiterzukommen? Kann sie meine Freiheit erleben? Das Kopftuch ist Mutters Zeichen. Es ist ihre Uniform, mit der sie sich in die Stammrolle der sommerlichen Armee einschreibt. So einfach ist das. Daheim trägt sie nie ein Kopftuch. Auf dem Land, wie wir es nennen, obwohl wir das Rathaus vom Balkon aus sehen können, da nimmt sie sich die Freiheit. Mutters Freiheit ist es, zumindest bilde ich mir das ein, sich Freiheiten zu nehmen. Mutters Freiheit ist stückweise und geteilt. Sie kommt ganz plötzlich. Sie ergreift sie, wenn sich die Gelegenheit bietet. Freiheit ist auch nur eine Gelegenheit von vielen. So denke ich heute. Damals hätte ich nicht so denken können. Aber die Eiswaffel ist wie immer bereits weich und zäh. Das mag ich. Ich mag es, wenn es wie immer ist. Überraschungen sind nicht mein Ding. Darum sollen sich die anderen kümmern. Deshalb ist dieses unglaubliche Glück, diese Freiheit, von der ich nicht weiß, was ich mit ihr machen soll, auch bedrohlich. Ich hoffe, Mutter merkt nicht, dass ich gerade kurz davor war loszuweinen. Sicherheitshalber schaue ich in die andere Richtung, auf den Bunnefjord, der immer im Schatten liegt, ganz gleich, wie viel Sonne es gibt. Mutter gibt mir ein Taschentuch. Nicht, um die Tränen, die noch nicht gekommen sind, wegzuwischen, sondern für das Eis, das wie weißer, zäher Leim zwischen den Fingern herunterläuft und sie zusammenklebt. Ich werfe den letzten Rest der Waffel den Möwen zu, die mit breiten Flügeln und gelbem, gellenden Schrei auf mich herabstürzen. Wir nähern uns dem Anleger von Tangen. Dort steht wie immer Iver Malt und wirft mit der Dose. Er hat keine Angel, deshalb hat er die Leine um eine Blechdose gewickelt, drinnen einen Griff festgeschraubt, und da hast du seine Snurrwade. Ich habe mich oft gefragt, ob der Begriff »die Dose auswerfen« von Iver Malt stammt. Könnte gut sein. Er trägt eine riesige, ziemlich dreckige kurze Hose, ein Unterhemd und eine Schirmmütze von der Essotankstelle oben beim Einkaufszentrum, bei der sein Vater arbeitet, wenn er nüchtern ist, und an den Füßen hat er nichts. Iver Malt geht immer barfuß, zumindest den ganzen Sommer über. Was er den Rest des Jahres macht, davon habe ich keine Ahnung, aber es würde mich nicht wundern, wenn er auch dann keine Schuhe trägt. Er ist nämlich ein fester Einwohner. Er gehört nicht zu den Feriengästen. Er fährt nirgends hin. Er bleibt. Er wohnt in einer der Baracken, die draußen auf Signalen noch von den Deutschen übrig geblieben sind, gleich hinter dem Anleger. Wir sind wahrscheinlich gleich alt. Das ist alles, was ich von ihm weiß. Aber es kursieren viele Gerüchte über die Familie Malt, dass der Vater nie nüchtern ist, dass sie einen bissigen Hund haben, der nicht bellen kann, dass seine Mutter ein Deutschenflittchen ist und noch einen Sohn hat, der also Ivers Halbbruder ist und der ihr gleich nach der Geburt weggenommen und in ein Heim gesteckt wurde, weil er geistig noch weiter zurückgeblieben und langsamer im Kopf ist als die Mutter, die mit Deutschen gevögelt und einen unerwünschten Bastard gekriegt hat. Einige gingen sogar so weit, sie als Hure zu bezeichnen, und nicht nur das, sondern als Landesverräterhure. Ungefähr so lauteten die Gerüchte über die Familie Malt von Signalen, und die meisten glaubten sie.
»Sag Iver Malt Hallo«, sagt Mutter.
»Wieso denn?«
»Weil ihm sonst keiner Hallo sagt, Chris.«
Sagte Mutter das nur, weil es auch nicht viele gab, die mir Hallo sagten? Sollten wir uns sozusagen zusammentun? Ehrlich gesagt, es stimmte, ich hatte nicht viele Freunde, wenn überhaupt einen. Aber das störte mich nicht. Ich meine damit nicht, dass ich mich besonders wohl nur mit mir allein fühlte, dass es amüsant war, so für sich zu sein, aber mir fiel nichts Besseres ein, und deshalb war meine Gesellschaft für mich die angenehmste. Ich kann es auch gleich beim Namen nennen. Ich hatte eine Art Scharte in mir, und ich wollte nicht, dass andere sie entdeckten. Schon damals nannte ich sie so, meine Scharten. Ich wusste nicht, warum ich sie hatte und woher sie kamen. Ich wusste nur, dass sie da waren, und dass ich deshalb anders war. Woraus dieses Anderssein bestand, wusste ich nicht. Ich wusste nur, dass es allein mein Problem war. Ich war irgendwo auf dem Weg zum Leben verunglückt. In diesen Scharten, die ich heute noch habe, denn die lassen sich nicht so einfach reparieren, sie lassen sich nicht ausbeulen wie eine Delle in einem Kotflügel, in ihnen hauste meine Einsamkeit, eine Einsamkeit, gegen die ich nichts hatte und über die ich mich deshalb auch nicht beklagte.
Die Prinsen macht einen Bogen und legt an. Mir gefällt das weiche Dröhnen, das mir innerlich einen Stoß versetzt, wenn das Schiff auf den Fender trifft. Ich bin derjenige, der anlegt. Ich lege an der Zukunft an. Das Deck ist schon seit langem voll mit Frauen, die an Rucksäcken, Koffern, Körben, Luftmatratzen, Sonnenschirmen, Schwimmgürteln, Kinderwagen, Fahrrädern und ihren schreienden Kindern ziehen und zerren. Es sind die Mütter mit Kopftuch, die in Nesodden einmarschieren und tapfer an den Fronten der Ferien kämpfen. Der Mann am Drehkreuz, der Kapitän genannt wird, obwohl er nie das Schiff lenkt, der aber dennoch eine gebügelte Uniform mit goldenen Streifen auf beiden Jackenärmeln trägt, schiebt die Gangway an ihren Platz, eine steile, holprige Treppe, die hinunter in den Sommer führt, denn es ist Hochwasser, und das bedeutet Kielwassersog und Quallen. Doch der Kapitän ist nur zu gern bereit, die Damen auf ihrem Weg zu stützen, ja, wenn es sein muss, nimmt er sich auch zweier zugleich an. Diesen Job hätte ich übrigens gern, ich meine, die Fahrgäste zu zählen, nicht Mütter und Kinder zu geleiten, aber ich hätte sie gezählt, wenn sie das Schiff verlassen, nicht, wenn sie an Bord kommen. Der Erste, der an Land geht, das ist übrigens der Polizeibeamte, der kompakte Gordon Paulsen. Sicher war er in der Stadt, um nach Verbrechen zu suchen, denn auf Nesodden passiert nichts.
Dann tragen wir das Gepäck ins Haus. Ich habe nicht viel dabei, nur hundert leere Seiten, einen kleinen Koffer, der fast nichts wiegt, und ein Fernglas, ich habe es von Vater bekommen. Architekten brauchen kein Fernglas, hat er gesagt. Es ist auch nicht sehr weit, nur um die Kurve, an den Briefkästen vorbei, weiter an den weißen Zäunen entlang, dann dort hinunter, hinein in das, was wir Dumpa nennen, die Mulde, in der sich der Kiesweg teilt. Ein Weg führt nach Hornstranda, der andere geht den steilen Hügel hinauf nach Kleiva, wie unser Haus heißt, ein großes, dunkel gebeiztes Holzgebäude mit zwei Stockwerken, einem Balkon in der Größe des Schlossbalkons, einem leeren Springbrunnen, dem Fahnenmast, Plumpsklo, Brunnen und einem Garten mit Apfelbäumen. Im letzten Moment drehe ich mich um und sehe, dass Iver Malt immer noch mit dem Rücken zu uns steht und seine Leine auswirft. Er hat keine Lust, sich umzudrehen. Er ist zufrieden mit sich selbst. Er angelt. Und wahrscheinlich hat er mich gar nicht bemerkt, warum sollte er auch? Ich grüße ihn ja nie, und er tut es auch nicht, mich grüßen, meine ich. Es war genau, wie Mutter sagte. Niemand grüßt Iver Malt, und ich bin einer von denen. Er wirft wieder seine Leine aus, obwohl die Prinsen gerade ablegt. Der Kapitän ruft ihm wie immer etwas zu, während er die nassen Trosse an Bord wirft und ein Wasserfächer im Licht funkelt, soll ich deine Leine abreißen, du Idiot? Jedes Mal ruft der Kapitän ihm das zu, und Iver kümmert sich wie üblich nicht darum. Was soll’s, denkt er sicher, ich habe genug Leine, noch mehr Dosen und noch viel mehr Blinker. Es ist, als könnte ich die Welt sehen, in die er eingeschlossen ist. Nicht, dass ich sehe, woraus diese Welt besteht, ich bin ja kein Hellseher, nur ziemlich scharfsichtig, aber ich sehe, dass er ganz woanders ist. Ich bin empfindsam für derartige Dinge. Und da kommt mir ein Gedanke, dass wir uns nämlich in gewisser Weise ähneln. Denn auch ich bin ganz woanders in meiner eigenen Welt. Also nicke ich ihm zu, nur Mutter zuliebe oder mir zuliebe, oder um einfach gemein zu sein, ist ja eigentlich egal, Iver dreht mir ja sowieso den Rücken zu, nicht wahr?
2
Ich öffnete den Koffer, der gerade groß genug war für eine Schreibmaschine, hob sie vorsichtig heraus und stellte sie auf den Tisch vor dem Fenster. Dann blieb ich sitzen und betrachtete dieses Wunder, eine Remington Portable, mit der Vater ganz überraschend vor einem halben Jahr angekommen war; ich hatte nicht einmal Geburtstag gehabt, es war nur ein gewöhnlicher Mittwoch gewesen. Die ist übrig, sagte er. Architekten brauchen keine Schreibmaschine. Die schreiben mit der Hand. Ich erinnere mich an Vaters Schrift. Vaters Buchstaben waren Häuser in Reih und Glied, einige hoch, die meisten niedrig. Die Zeilen waren Straßen. Ich versuchte lange, sie nachzumachen. Als mir klar wurde, dass ich es nie schaffen würde, nie besser als Vaters Schrift werden würde, da musste ich mir etwas anderes ausdenken. Und stattdessen ließ ich Menschen in diese Häuser, die Worte waren, einziehen, und ich ging durch die Straßen, die Sätze waren. Ich schlich mich zwischen die Zeilen und fand Zeichen, geheimnisvolle und aufmunternde Zeichen, die mir allein gehörten. Vater schenkte mir also eine Schreibmaschine. Vielleicht hatte er gesehen, dass meine Handschrift hoffnungslos war, nur ein Durcheinander von Durchgestrichenem und Wiederholungen. Ich bekam keine Ordnung in die Worte, ich, der im tiefsten Inneren doch ein ordnungsliebender Mensch ohnegleichen war. Und jetzt saß ich hier, in meinem Zimmer in der anderthalben Etage, vor der Schreibmaschine. Ich hatte natürlich das Farbband gewechselt und die Tasten zu diesem Anlass geputzt. Dann zog ich den ersten Bogen in die Walze, wählte doppelten Zeilenabstand und schrieb den Titel, der mir schon lange klar war. Monduntergang. Mit dem war ich ziemlich zufrieden. Streng genommen brauchte ich nichts weiter zu schreiben. So zufrieden war ich mit dem Titel. Aber so leicht wollte ich es mir doch nicht machen. Ich hatte 26 Tage Zeit, um mit dem Gedicht fertig zu werden, bevor die Menschen es geschafft haben würden, auf dem Mond zu landen. Das müsste reichen. Eigentlich war ich der Meinung, wir sollten den Mond in Ruhe lassen. Ich meine, wenn wir erst einmal den Fuß darauf gesetzt haben, dann konnte es nie wieder wie vorher werden. Deshalb hoffte ich insgeheim, dass etwas schiefgehen würde, nicht, dass die Astronauten umkämen oder so etwas, aber zum Beispiel, dass sich eine Schraube in der Apollo löste, dass es schlechtes Wetter gäbe, dass Nixon eine Magen-Darm-Grippe bekäme oder dass Neil Armstrong sich das Bein bräche, ja, das wäre doch etwas, hätte Neil Armstrong sich das Bein gebrochen, als er hinausging, um die Post zu holen, denn ich zweifelte stark daran, dass jemand auf Krücken zum Mond fahren konnte.
Ich zog die dünnen weißen Gardinen, die fast zu Staub in den Händen wurden, vors Fenster und konnte den Fjord sehen, den Fahnenmast, den Karpfenteich und den Rhododendron. Der Fjord lag glänzend und still da, mit einer Farbe, wie sie nur dieser eine Abend im Jahr, der Sankthansabend, mit sich bringen konnte, blaue Schatten, die wiederum blaue Schatten öffneten, und all dieses Blau verschwand in einem blauen Nadelöhr gleich hinter Kolsåstoppen. Über den Fahnenmast habe ich jetzt keine Lust etwas zu sagen, es muss reichen mit diesem Bettpfosten, abgesehen davon, dass die Farbe abgeblättert und die Kugel an der Spitze rostig war und die Stange deshalb einem Mast eines auf Grund gelaufenen Schiffes ähnelte. Es war übrigens schon ziemlich lange her, dass es Karpfen in dem trockengelegten Karpfenteich gegeben hatte, und ich zweifelte daran, ob es dort überhaupt jemals welche gegeben hatte, denn der Teich war so klein, dass selbst Kaulquappen sich in einer Schlange anstellen und warten mussten, bis sie Kröten wurden, oder waren es Frösche? Außerdem war das Wasser schon vor langer Zeit verrottet und zu Moos an den Rändern geworden. Wobei das ja auch unwichtig war. Aber der Rhododendron war ein richtiges Hotel für Hummeln, und es gab kein freies Zimmer mehr. Sie flogen den ganzen Tag aus den roten, weit geöffneten Türen ein und aus, und wenn die Dunkelheit einsetzte, wurden sie ordentlich hinter den Gästen geschlossen. Hummeln sind ziemlich gut erzogen, wenn man es recht betrachtet. Und wenn ich das Fenster kippte oder nur konzentriert genug lauschte, und ich habe ein ziemlich gutes Gehör, dann konnte ich das Summen bis hier oben hören, wo ich an der Schreibmaschine saß und das große Gedicht über den Mond schreiben wollte. Es gab übrigens einen in meiner Klasse in der Realschule, der stotterte, und jede Norwegischstunde zwang ihn der Lehrer, Rhododendron zu sagen, was er natürlich nicht hinbekam, und man braucht eigentlich gar nicht zu stottern, um Probleme mit diesem Busch zu bekommen, es wurde nur ro, ro, ro, und dann stotterte der Rest der Klasse auch, ich inbegriffen. Sie brauchen gar nichts anderes von mir zu denken, ro, ro, ro rolling home. Jedes Mal wieder gleich witzig. Aber wenn er sang, das hätten Sie hören mögen, dann flossen die Worte ohne jeden Knacks in der Platte, die Konsonanten rutschten nur so heraus, als ölte ihn die Melodie. Der Gesang war seine Werkstatt. Beim Gesang wurde er repariert. Mir ging es ähnlich, aber meine Scharten ließen sich kaschieren, jedenfalls ziemlich lange. Wenn ich schrieb, fiel alles an die richtige Stelle. Die Sprache war meine Werkstatt. In der Sprache wurde ich repariert.
Als ich das erste Feuer entdeckte, irgendwo zwischen Slemmestad und Sandvika, und das Nadelöhr über der Kolsåsspitze sich als ein verirrter Stern herausgestellt hatte, ging ich hinunter zu Mutter, die auf der Terrasse saß, mit einer grünen Decke um die Beine, und Tee trank. Vor ihr lag das kleine gelbe Notizbuch, das sie immer bei sich hatte, und in dem sie Einkaufslisten aufschrieb und Buch führte. Für mich stand auch eine Tasse bereit. Ich schenkte sie fast voll, legte eine Zitronenscheibe oben drauf und schüttete ein halbes Kilo Zucker hinein, das auf den Boden sank und in einer Süße aufstieg, die das Saure überdeckte.
»Was machst du?«, fragte Mutter.
»Schreiben.«
»Über was?«
»Über den Mond.«
»Bist du vorangekommen?«
Ich musste fast lächeln. Mutter redete, als sollte ich am nächsten Montag einen Aufsatz abliefern. Aber eigentlich gefiel mir ihre Art zu fragen, denn es bedeutete, dass sie keine Ahnung davon hatte, was es hieß zu schreiben, ich meine, ernsthaft zu schreiben, nicht Postkarten, Einkaufslisten und langweilige Aufsätze. Sie hatte keine Ahnung, was ich da trieb. So gewann ich irgendwie die Oberhand. Vielleicht war es das erste Mal, dass ich die Oberhand gewann. Es war jetzt meine Sache zu erklären, was sie, oder vielleicht sogar der Rest der Welt, von mir aus auch der, nicht verstand. Ich seufzte schwer und gnädig.
»Leider läuft es nicht so, Mutter.«
»Nein? Wie läuft es dann?«
»Man muss auf die Inspiration warten.«
»Habe ich deshalb nichts gehört?«
»Etwas hören? Glaubst du, man hört es, wenn jemand schreibt?«
Mutter lachte und zündete sich eine Zigarette an.
»Die Schreibmaschine, du Quatschkopf. Die habe ich nicht gehört.«
»Aber ich habe es dir doch erklärt. Oder hast du das nicht verstanden? Ich warte auf die Inspiration, nicht wahr?«
»Ja, natürlich. Du weißt doch, wie dumm ich bin.«
Der Rauch der Zigarette kringelte sich um sie und nahm ihrem Gesicht die Farbe. Ich schaute zu Boden. Ich hasste es, wenn sie so redete. Es wirkte so jämmerlich, und ich wollte nicht, dass Mutter jämmerlich wirkte. Ich bereute, was ich gesagt hatte und wie ich es gesagt hatte.
»So habe ich es nicht gemeint.«
»Ich weiß.«
»Der Titel steht jedenfalls schon fest. Monduntergang.«
»Warum nicht Mondaufgang?«
Es quälte mich sehr, dass sie an diesem Titel so herumklaubte. Er gehörte mir. Sie hatte mit ihm nichts zu tun. Niemand hatte das Recht, an ihm herumzuklauben. Ab jetzt würde ich ganz einfach den Mund halten.
»Ich bin schließlich derjenige, der schreibt, nicht du«, sagte ich.
»Ich finde nur, er klingt so pessimistisch. Ist es nicht schön, dass wir auf den Mond kommen?«
»Wir? Willst du auch da hin?«
Mutter drückte ihre Zigarette vorsichtig im Aschenbecher aus, ein bisschen Glut flog auf, und der Rauch glitt langsam fort, während ihr Gesicht näher rückte. Ob ich jetzt, zur schreibenden Stunde, wie es heißt, meine Mutter so sehe und versuche, in ihren Gesichtszügen zu lesen, oder es damals, am Abend der Mittsommernacht 1969 so war, das weiß ich nicht. Ich sollte es wissen, ich, der als ein Meister im Fach Erinnerung gilt. Aber die Menschen, die uns am nächsten stehen, ziehen sich zurück, wenn die Zeit zwischen sie und uns tritt, und die Erinnerung, dieser zerbrechliche und unbestimmbare Wasserspiegel, ist alles, an das wir uns lehnen und auf das wir vertrauen können. Wir müssen der unzuverlässigen Erinnerung trauen. Wo war Mutters Name? Sie beschriftete meine Kleider mit Namen, aber nicht ihre eigenen. Den Namen, mit dem sie geboren worden war, hatte sie gegen Vaters Namen ausgetauscht. Sie hatte nicht einmal ihren Namen auf der Tür in der Stadt. Deshalb bekam ich den Eindruck, dass sie sich nach etwas sehnte. Es überwältigte mich. Wonach konnte sie sich sehnen? Hatte sie nicht alles? Ich glaube, sie sehnte sich nach etwas, das größer war als sie und das sie erfüllen, ausfüllen konnte. Sie sehnte sich nach ihrem eigenen Leben, das ein anderes Leben war. Wer hatte es ihr genommen? Vater? Oder noch schlimmer: ich?
Ich hatte viele Namen. Wenn jemand mich rief, kam ich nicht.
»Übrigens, da ist er«, sagte Mutter und zeigte nach oben.
»Wer?«
»Der Mond.«
3
Ich wachte vom Regen auf, aber es hätten ebenso gut die Elstern sein können, die auf dem Dach hin und her trippelten, während die Hummeln ihre roten Zimmer öffneten und anfingen zu summen. Es gefiel mir, so dazuliegen, nur zu lauschen und zu träumen. Ich erinnere mich nicht an die Träume. Ich erinnere mich nur daran, dass die Zeit sich auflöste und verduftete, genau wie der dünne blaue Rauch von Mutters Ascot, die Gardinen und meine eigenen Gedankenbahnen. Ich wurde schwerelos. Es war wie schreiben, wie singen. Ich wurde befreit von allem, was mich an die Regelwerke band, an meine eigenen wie an die aller anderen. Aber da ich sowieso die Tropfen nicht zählen konnte – oder waren es die Schritte der Elstern –, was übrigens auch ganz gleich war, denn alles, was man zählt, wird zum Schluss das Gleiche, so blieb mir nichts anderes übrig, als doch aufzustehen, und da konnte ich natürlich nicht umhin, meinen rechten Fuß zu bemerken, der fast im rechten Winkel abstand, ganz nach außen stand er ab, und an schlechten Tagen scherte ich so weit aus, dass ich fast stolperte oder im Kreis ging, was ja ungefähr aufs Gleiche hinausläuft. Ich schaffte es aber schließlich, zur Schreibmaschine zu gehen, in der das Papier in einem Bogen nach vorn gekippt war, als wäre es im Laufe der Nacht eingeschlafen oder zumindest in Gedanken versunken. Das wäre noch was. Wenn der Papierbogen ein Gedicht geträumt hätte. Ich zog den Hebel zur Seite und weckte das Papier mit einem deutlichen Zeilenwechsel. Der Titel war jedenfalls kein Traum. Ich las ihn mir lautlos vor: Monduntergang. Jetzt fehlte nur noch das Gedicht.
Ich zählte die Treppenstufen. Vierzehn Zeilen sollte das Gedicht haben. Wenn ich zwei auf einmal nahm, würde das Gedicht sieben Zeilen lang. Zählte ich jedoch die erste und die letzte Stufe nicht dazu, die eigentlich ja gar keine Stufen waren, sondern eher der Fußboden, dann musste das Gedicht zwölf Zeilen haben, eventuell sechs, wenn ich wie gesagt zwei Stufen auf einmal nahm. Diese Art von Dingen zu bedenken war wichtig. Sonst konnte alles schiefgehen. Mutter war nicht in der Küche. Ich schnappte mir eine Brotscheibe und aß sie auf dem Weg hinaus zum Plumpsklo, ein Name, den Mutter übrigens nicht gern hörte. Sie verlangte, dass es Abtritt hieß, gerne mit Betonung, oder einfach nur Klo, genau wie sie mich bat, in der Stadt vom Hof zu sprechen, nicht vom Hinterhof, wenn ich mit dem Mülleimer hinuntergehen sollte oder die Wäsche von der Wäscheleine holen musste. Ein Hinterhof war etwas, das sie im Ostteil der Stadt hatten. Im Hinterhof gab es Schatten, Ratten, Gestank, Pilze, Pöbel, Mopeds, Schnaps und ständig Schlägereien. Auf einem Hof dagegen schien die Sonne, und es roch frisch nach weißen Betttüchern, Kaffee und Blumen. Mutter war vielen Dingen gegenüber empfindlich, lauter Musik, grellen Farben, Unordnung und Unhöflichkeit, aber ganz besonders gegenüber der Sprache. Falsche Worte waren eine Bedrohung. Die Worte waren wichtiger als, wie soll ich es sagen, nicht als die Wirklichkeit, nicht als die Dinge oder Gegenstände, das wäre zu einfach, aber als das Bild, das wir von uns selbst schufen, der Eindruck, den wir vermittelten. Die Worte waren dem übergeordnet. Sie konnten entweder aufwerten oder abwerten. Deshalb galt es, die richtigen Worte zu finden, nicht Plumpsklo, nicht Hinterhof, nicht »Was«, wenn man etwas nicht gehört hatte oder nicht verstand, was gesagt worden war. Die Sprache war auch eine Maske, die bewahrt werden musste. Aber ganz gleich ob betont oder nicht, es war und blieb trotz allem ein Plumpsklo, egal, was sie sagte, mit einer ovalen Öffnung in dem schmalen Balken, durch die wir unsere Scheiße plumpsen ließen. Aber ich hätte zumindest gern anderes Papier gehabt als diese harte, glatte Rolle, die an einem Haken an der Innenseite der Tür hing und die immer abrutschte, während die grün glänzenden Schmeißfliegen, dick wie Hubschrauber, um mich herum brummten. Es fühlte sich an, als würde man sich mit Weihnachtseinwickelpapier den Hintern abwischen oder mit dem Zwischenlegpapier, das im Schulbrot zwischen den Scheiben klebte und das manchmal, wenn ein paar Tage vergangen waren, einer Käsescheibe zum Verwechseln ähnlich sah, und es half nur wenig, ob es nun Klopapier oder Toilettenpapier oder weiß der Teufel wie hieß. Man hätte genauso gut ein Kartenspiel oder Rhabarberblätter aufhängen können, um sich damit abzuwischen. Vielleicht würde ich gezwungen sein, mein eigenes Papier zu benutzen, falls mein Bauch verrückt spielte. Was für ein Gedicht. Und was wäre, wenn Vater einen Abtritt zeichnete? So schön, dass man ihn unmöglich noch Plumpsklo nennen könnte. Das sollte ich ihm mal vorschlagen.
Mutter rief nach mir.
Ich konnte es nicht ausstehen, wenn nach mir gerufen wurde. Es sollten wirklich gute Gründe existieren, bevor man nach jemandem rief, große Gefahr oder fantastische Neuigkeiten, und wie gesagt, Überraschungen waren nicht mein Ding. Deshalb nahm ich mir die Zeit, die ich brauchte und noch eine ganze Weile dazu, mochte aber dennoch nicht eine Ewigkeit da sitzen und den Schmeißfliegen Gesellschaft leisten. Die mussten ohne mich zurechtkommen. Ich zog die Hose hoch und ging langsam zurück zum Haus. Es hatte aufgehört zu regnen. Alles war still. Die letzten Tropfen hingen in der Luft wie matte Perlen. Wie üblich saß Mutter auf der Terrasse mit der immer gleichen grünen Wolldecke um sich gewickelt. Die Zeitung war gekommen. Sie lag auf dem Tisch vor ihr, zwischen den Teetassen und der Kanne.
»Wo bist du gewesen?«, fragte sie.
»Auf dem Freiluftklosett. Wo sonst.«
Mutter lachte.
»Willst du mich veräppeln? Freiluftklosett!«
»Warum hast du gerufen?«
»Willst du nicht frühstücken?«
»Deshalb musst du doch wohl nicht rufen.«
»Iver Malt war hier.«
Ich hörte, was sie sagte, verstand es aber nicht. Ich war kurz davor, »Was« zu sagen.
»Iver Malt? Der war hier? Was wollte er?«
»Er kam mit der Aftenposten. Er arbeitet im Sommer als Zeitungsbote.«
»Kann er sie nicht einfach in die Briefkiste werfen?«
»Du meinst den Briefkasten?«
»Ja, dann eben den Briefkasten!«
Das gefiel mir noch viel weniger. Im Gegenteil, es quälte mich sogar. Ich wollte meine Ruhe haben. Ich wollte nicht gestört werden. Ich war den Rest des Jahres genug gestört worden und wollte nicht auch noch den ganzen Sommer über gestört werden. Was bildete der Kerl sich eigentlich ein, einer, der einen so lächerlichen Namen wie Iver Malt hatte und den niemand grüßte? Hatte er mein Nicken trotz allem bemerkt, und glaubte er jetzt, wir wären sozusagen Kumpel und beste Freunde? Wollte er jeden Morgen mit der Zeitung kommen, abgesehen von den Sonntagen, und an denen kamen stattdessen alle Tanten, und war das nicht mehr als genug? Sollte der Teufel Iver Malt holen.
»Das habe ich auch gesagt. Dass er sie einfach in den Briefkasten werfen könnte. Und dann könntest du sie ja holen.«
»Gern.«
Ich wollte mir ein Knäckebrot nehmen, aber Mutter hielt mich zurück, bevor ich überhaupt in die Nähe von Wasa gekommen war.
»Hast du dir die Hände gewaschen?«
»Eigentlich nicht.«
»Meine Güte. Dann kannst du gleich Wasser holen.«
Ich ging zum Brunnen, der zwischen den Birken lag, und zog den Deckel zur Seite. Als ich mich über den Rand beugte, konnte ich mit Müh und Not mein Gesicht mitten in der tiefen kühlen Dunkelheit erkennen, aber es entglitt mir immer wieder und kam dann in anderen Formen erneut zum Vorschein, andere Gesichter als meines, als stünde da ein Fremder auf dem Grund und hielte mich zum Narren. Ich ließ den Eimer hinunter, kippte ihn mit einem schnellen Ruck am Seil und zog ihn wieder hoch. Das fremde Gesicht kam mit. Ich wurde es nicht los. Es lag grinsend in dem klaren Wasser. Ich trug den Eimer in die Küche, das geschah der verfluchten Fratze nur recht, sollte Mutter doch mit ihm Kartoffeln kochen.
Als ich zurück auf die Terrasse kam, hatte sie zwei Scheiben Knäckebrot geschmiert, eine mit braunem Ziegenkäse und eine mit Kaviar aus der Tube. Ich hatte keinen Hunger mehr. Sie schaute von der Zeitung auf, zuerst auf meine Hände, dann auf mich.
»Wir müssen den Fahnenmast streichen, bevor die Tanten kommen.«
»Ja.«
»Die Farbe ist im Winter ziemlich abgeblättert.«
»Ja.«
»Du kannst ihn mit Vater streichen.«
»Wann kommen die Tanten?«
Mutter seufzte.
»Viel zu bald.«
Sie legte die Hand auf den Mund, kaum hatten die Worte ihn verlassen.
»Das war nicht nett von mir«, sagte sie.
Dann blätterte sie weiter in der Zeitung, auf deren Titelseite sich ein Foto der drei Astronauten befand. Glaubt jemand tatsächlich, dass ich mich daran erinnere, was da stand? Dass ich mich erinnern könnte, was in einer Zeitung vor mehr als vierzig Jahren gestanden hat? Ich meine, wer kann denn so etwas schon erinnern? Ich. Dort stand, dass Neil Armstrong am 28. Januar 1956 Janet Sharet geheiratet hat, und an ihrem Hochzeitstag, am 28. Januar 1962, verloren sie ihre Tochter Karen. Wollte Neil Armstrong deshalb auf den Mond? Ich bekam diesen Gedanken nicht wieder aus dem Kopf. Alles klebt sich fest. Es gibt zu viel Inhalt auf der Welt. Ganz gleich, ob Müll oder Gold, es klebt sich so verdammt fest. Man nehme nur so eine Zeitung, Daten, Tabellen, Rekorde, Temperaturen, Todesanzeigen, Fahrpläne und Zahlen über Zahlen, Buchstaben über Buchstaben. Früher prahlte ich damit, dass ich schreibe, um nicht zu vergessen. Jetzt behaupte ich das Gegenteil. Ich schreibe nicht mehr, um zu erinnern, sondern um zu vergessen. Sobald etwas aufgeschrieben ist, kann ich es vergessen. Deshalb vergesse ich diesen Sommer jetzt, Wort für Wort. Die Luft war an diesem Morgen noch kühl, am 25. Juni 1969. Daran erinnere ich mich. Jetzt kann ich es also vergessen. Ich vergesse die tote Tochter des Astronauten. Inzwischen hatten die Hummeln im Rhododendron Grand Hotel sauber gemacht. Das Gras glänzte. Eine Ameise krabbelte mir über die Hand. Ein Frachtschiff teilte den Fjord genau in der Mitte, denn ich konnte sehen, dass die Wellen beide Ufer genau gleichzeitig erreichten. Jetzt kann ich all das auch vergessen. Mutter legte die Zeitung hin und blätterte in ihrem kleinen gelben Notizbuch.
»Am liebsten wäre mir, wenn du keinen weiteren Kontakt mit ihm hättest«, sagte sie.
»Mit wem? Vater?«
Ich fand das eigentlich ziemlich lustig und lachte.
»Du weißt, wen ich meine. Er ist nicht gut.«
»Nicht gut? Glaubst du all diesen Gerüchten?«
»Die interessieren mich nicht. Ich weiß nur, dass er nicht gut ist.«
»Aber du warst es doch, du hast mich aufgefordert, diesen Trottel zu grüßen.«
»Das ist ganz was anderes.«
»Wieso?«
»Man grüßt aus Höflichkeit. Und du sollst ihn nicht Trottel nennen. Es ist ja nicht seine Schuld.«
Den Rest des Tages saß ich an der Schreibmaschine, aber ich war zu unruhig und kam mit dem Gedicht über den Mond nicht weiter. Ich saß nur da, die Hände im Schoß, und wartete auf eine Inspiration. Sie zeigte sich nicht. Es dauerte und dauerte. Sie zeigte sich immer noch nicht. Eine Krähe landete auf der abgeblätterten Fahnenstange. Wurde mir die Inspiration in Form eines lächerlichen, kreischenden Vogels geschickt? Und wenn ja, wer hatte sie mir dann geschickt? Ich hatte keine Ahnung. Aber es nützte alles nichts, weder die Krähe noch das Warten. Dennoch fühlte ich mich aus irgendeinem Grund wichtig. Ich saß da, tat nichts und war wichtig. Das gefiel mir. Ich gehörte zu den Auserwählten. Ich musste leiden. Es würde etwas kosten. Es würde etwas kosten, koste es, was es wolle. Mutter sagte das immer. Koste es, was es wolle. Ich litt auf meine Art und Weise. Ich genoss es. Aber nach einer Weile wurde die Stille anstrengend. Ich wurde auf mich selbst aufmerksam. Ich bemerkte das Blut, das unter der Haut floss, und die Haut, die sich um den Körper spannte. Ich bemerkte mein Herz, das schlug, und die Finger, die bei jedem einzelnen Schlag leicht zitterten. Mein Herz war eine Schreibmaschine! Ich bemerkte meine blassen Knie und die Scharten in meinem Kopf, die diese Stille, die nur vom Tastenanschlag des Herzens unterbrochen wurde, in die Schlucht hinausschrie. Ich wollte nicht auf mich selbst aufmerksam werden. Ich wollte in die andere Richtung, weg, so weit wie möglich weg von mir selbst. Eine Krähe ist kein Schwarm. Zwölf Stufen sind eine Treppe. Noch vier dazu sind anderthalb Gedichte. Noch fünfundzwanzig Tage bis zum Mond.
4
Am nächsten Morgen stand Iver Malt wieder an der Pforte, die Aftenposten in der Hand. Mutter war in der Küche und machte Frühstück. Ich saß auf der Terrasse und sah ihn. Er blieb einfach stehen. Ganz sicher hatte er mich auch gesehen, was mir unangenehm war. Am liebsten wäre ich hineingegangen und hätte die Tür fest hinter mir zugezogen, aber das tat ich nicht. Im Gegenteil, ich würde sitzen bleiben, bis er die Zeitung ordentlich hingelegt hatte und ins Blaue verschwunden war. Es sah aus, als würde es ein schöner Tag werden, jedenfalls so weit mein Blickfeld reichte, und dieser aufdringliche barfüßige Trottel sollte ihn nicht verderben. Der Himmel stieg schräg durch die trägen Schäfchenwolken an, die aussahen wie Wolle. Der riesige Baldachin war an Ort und Stelle, er sah aus wie eine halbierte Kuppel, ein halbes Zirkuszelt. Aber Iver Malt rührte sich nicht. Er war ein sturer Kerl. Als Mutter mit hart gekochten Eiern und getoastetem Brot herauskam, stand er immer noch da.
»Geh hin und hol die Zeitung«, sagte Mutter.
»Kannst du das nicht machen?«
»Nein, kann ich nicht. Und sag ihm noch mal, dass er mit der Zeitung nicht ganz herkommen muss. Der arme Junge.«
»Aber hast du nicht gesagt, ich sollte keinen Kontakt mit ihm haben?«
»Die Zeitung holen hat doch mit Kontakt haben nichts zu tun. Und beeil dich bitte.«
Gestern war er nicht gut, und heute war er ein armer Junge. Widerstrebend ging ich den schmalen Weg hinunter, der mit Kies bestreut war und von Ameisen nur so wimmelte, und ich beeilte mich nicht gerade. Ich hatte Zeit, schob die Hände in die Taschen, musterte ein Eichhörnchen, das eine Kiefer hinaufkletterte und die Nadeln wie vertrockneten Regen fallen ließ. Als ich schließlich an der Pforte ankam, streckte ich nur die Hand aus, natürlich in der Absicht, dass Iver Malt mir die Zeitung geben sollte, aber stattdessen nahm er sie, also meine Hand, und da standen wir, jeder auf einer Seite der Pforte, und begrüßten uns wie zwei Loser. Ich wollte Iver Malt nicht anfassen, deshalb riss ich meine Hand zurück und wäre fast hingefallen. Er lachte und warf mir die Zeitung zu.
»Soll ich euch den Fahnenmast streichen?«, fragte er.
»Wieso das?«
»Weil er gestrichen werden muss.«
»Mein Vater wird ihn streichen.«
»Dein Vater ist nicht hier.«
»Aber er kommt.«
Iver zuckte nur mit den Schultern. Sein Gesicht war knöchern, braun und ausdruckslos, abgesehen von den Momenten, wenn er lachte. Als er sein rotes Käppi abnahm und sich in dem platt gedrückten Haar kratzte, leuchtete seine Stirn wie Porzellan. Es war selten, dass er das Käppi abnahm.
»Wollen wir angeln?«, fragte er plötzlich.
Warum ist ein Nein so schwierig, weil es zwei Buchstaben mehr hat als ein Ja?
»Ich habe keine Angel.«
Das war offensichtlich die falsche Antwort. Ich konnte es sogar selbst hören. Ich hätte natürlich Nein sagen sollen, ganz einfach, wir beide wollen nicht angeln, das Allerletzte, was wir beide zusammen machen wollen, ist angeln. Jetzt witterte er dagegen eine Chance.
»Du kannst eine Dose von mir leihen!«
»Ich kann nicht mit einer Dose angeln.«
»Ich zeig es dir. Es ist nicht schwer. Eigentlich ganz einfach, wenn du erst mal den Dreh raus hast!«
»Ich habe keinen Blinker.«
»Ich habe ganz viele. Vattern sammelt die.«
So kam ich also zu einer Art Verabredung mit Iver Malt, bei der ich gegen sechs Uhr zum Anleger kommen sollte, nur weil ich es nicht schaffte, Nein zu sagen. So war ich nun einmal. Ich ließ andere bestimmen und tat, was sie sagten. Ich tat Dinge, die ich nicht wollte, und nickte höflich, während ich innerlich fluchte und es wie verrückt in meinen Scharten juckte. Jetzt war es Iver Malt, der mich dazu brachte, mich dazu brachte, etwas zu tun, was ich nicht wollte. Er lief so schnell er konnte den Hügel hinunter. Konnten wir nicht jeder in unserer Welt bleiben?
»Du brauchst nicht mit der Zeitung bis an die Pforte zu kommen!«, rief ich. »Leg sie einfach in den Briefkasten!«
Iver drehte sich um und winkte mit seiner Mütze.
»Kein Problem! Kein Problem!«
Ich ging zurück zur Terrasse, wütend und unruhig, zwei Schritt vor und einen zur Seite, gab Mutter die verfluchte Zeitung und köpfte ein Ei, dass das Eigelb in fast alle Richtungen spritzte.
»Das hat ja gedauert.«
»Ja.«
Mutter schaute auf.
»Was ist denn?«
»Nichts.«
»Nichts?«
»Was soll denn sein? Musst du mir andauernd Fragen stellen?«
»Entschuldige bitte. Ich habe nur gefragt.«
Den ganzen Tag über graute mir vor dem Abend. Mein Gedicht zu schreiben, konnte ich vergessen. Mein Kopf war im Ungleichgewicht. Stattdessen erweckte eine Libelle meine Aufmerksamkeit, danach war es ein Schmetterling, der mich in Beschlag nahm. Was wäre, wenn ich die Verabredung einfach nicht einhielt? Was wäre, wenn ich mich schlicht und ergreifend gar nicht darum scherte? War das denn nicht möglich? Doch, es war möglich. Einen Moment lang wurde ich von großer Ruhe erfüllt, von einem Gleichgewicht, das der reinen Freude ähnelte. Aber ebenso schnell war ich wieder missmutig. Es würde nicht mehr als eine Herauszögerung bedeuten, und das nächste Mal würde noch schlimmer werden, denn man kann eine Verabredung nicht zweimal sausen lassen. Ich konnte mich ebenso gut am Rettungsseil erhängen oder in den Schuppen gehen, der Wand an Wand mit dem Plumpsklo stand, Entschuldigung Mutter, mit dem Abtritt, und das Fahrrad herausholen, das seit letztem Jahr dort stand. Fahrradfahren in der Stadt war nämlich nichts für mich. Gehen gefiel mir besser, auch wenn es länger dauerte, doch das war ja gerade der Witz dabei. So bekam ich meine Gedanken in den Griff. Bekam sie geordnet. Ich ging im Takt mit ihnen, oder sie wurden gedacht im Takt mit meinen kurzen, fast seitlichen Schritten. Oft kam ich zu spät. Ich blieb stehen, wenn ein Traum es erforderte, was sich nicht machen ließ, wenn ich mit dem Rad fuhr. Außerdem war ich eine Gefahr für mich selbst und meine Umgebung. So konnte ich beispielsweise den Bondebakken hinunterrollen, und plötzlich befand ich mich auf dem Olav Kyrres plass, und bevor ich noch wusste, wie mir geschah, war ich in Skillebekk. Und in der Zwischenzeit, wo war ich da gewesen? Ich konnte mich nicht mehr daran erinnern. Ich wusste es nicht. Ich war fort gewesen, in meiner eigenen Welt. In ihr konnte ich schreiben, singen und träumen, aber nicht Rad fahren. In der Stadt Rad zu fahren, das war mit meiner Natur, mit meinem innersten Wesen nicht zu vereinbaren. Aber hier draußen auf dem Lande, da nutzte ich die Chance.
Der schönste Ausdruck, den ich kannte, das war: in allerschönster Ordnung. Alles ist in allerschönster Ordnung. Kann es noch besser werden? Nein. Aber jetzt war nichts in allerschönster Ordnung.
Das Fahrrad stand in der Ecke hinter einem ganzen Waffenarsenal mit Harken und Rechen und Rosenscheren, mit denen sich meine blutrünstigen Tanten zu bewaffnen pflegten, wenn sie in den Krieg zogen gegen Unkraut, Brennnessel, verrottete Äpfel und Pilze. Ich werde bald darauf zu sprechen kommen, keine Sorge. Ansonsten waren die Urlauber im Grunde genommen eine ziemlich friedliche Truppe, die sich freiwillig zurückzog, wenn auch mit einer gewissen Trauer, sie zogen sich zurück, wenn die Tage im August gezählt waren, und überließen das Gebiet von Nesodden dann wieder den Einheimischen. Übrigens handelte es sich bei dem Fahrrad um eins von Diamant mit drei Gängen, Licht und Zahlenschloss. Ich hatte es von Vater bekommen, als ich mit dieser hoffnungslosen Realschule anfing. Architekten fahren nicht mit dem Rad, hatte er lachend gesagt. Das Licht, das durch die Spalten in der Wand hereinsickerte, ließ die Speichen wie Spinnweben aussehen. Alles sah in diesem Sommer aus wie Spinnweben. Ich zog das Fahrrad heraus, doch als ich versuchte, das Zahlenschloss zu öffnen, funktionierte es nicht. Ich versuchte es noch einmal, mit dem gleichen Ergebnis. Ich kann heute noch den Druck in der Handfläche spüren, wenn die schnellen Bewegungen mit einem Ruck belohnt wurden und Fahrrad wie auch ich freikamen. Aber dieses Mal nicht. Jetzt stand es unerschütterlich verschlossen da. Ich hatte mich unmöglich in dem Zahlencode irren können, denn der war ganz raffiniert: meine Körpergröße. Damit kann man nicht prahlen, aber schlecht war er nicht, dieser Code, zumindest bis jetzt. Schließlich mochte ich nicht mehr. Äußerst unzufrieden warf ich den ganzen Krempel hinter einen Baum, versteckte mich im Apfelbaumgarten und war so wütend, dass ich mindestens eine Viertelstunde dastehen und auf einen grünen Apfel schnaufen musste, anschließend schluckte ich acht unterentwickelte Stachelbeeren, die schlimmer schmeckten als ein Staubfussel mit Stacheldraht. So wütend war ich. Selbst mein Fuß, der rechte, war wütend. Ich hatte keine Ahnung, woher diese Wut kam, denn auch wenn das mit dem Zahlenschloss ärgerlich war, so war es nicht besonders gesund, auf unschuldige Früchte wütend zu werden, die noch nicht einmal reif waren. So viel war selbst mir schon klar.
Mutter pfiff.
Es war vorbei. Und als es endlich vorbei war und ich zur Ruhe kommen konnte, erschöpft und erledigt, schien es mir, als würde ich alles deutlicher sehen und hören, die Welt rückte näher und umschloss mich, und sie wurde zu meiner Welt, die mich wiederum in einer Klarheit in sich einschloss, die ich weder mit jemandem teilen noch jemandem hätte erklären können. Einen Moment lang waren meine Welt und der Rest der Welt eins. Ich gehörte plötzlich dazu. Und ebenso plötzlich war es vorbei. Mutter pfiff weit, weit draußen in der Welt der anderen, die üblichen Signale, zwei kurze, abfallende Töne. Ich mochte es nicht, wenn nach mir gepfiffen wurde, aber dieses Mal ließ ich es gut sein. Ich hatte meinen Wutanfall gehabt und war zufrieden.
Ich ging ums Haus zur Terrasse, die im Schatten badete, unter der Markise, so groß wie ein halbes Zirkuszelt. Wir aßen neue Kartoffeln mit geschmolzener Butter und Sommerkohl. Wir machen es uns heute mal einfach, wie meine Mutter zu sagen pflegte, wobei sie das Essen meinte. Das war ihre Freiheit, die Ansprüche hinunterzuschrauben, uns gegenüber, sich selbst gegenüber, das geschah nicht oft, nur ab und zu. Sie nahm sich frei, ich meine, Freiheiten, sie kaufte sich Zeit, wenn sie es mal einfach machte, dann hatte sie mehr davon übrig. Ich weiß nicht, wozu sie diese Zeit benutzte, die sie dann übrig hatte, träumte sie, bereute sie, war sie glücklich, besorgt, hatte sie ein schlechtes Gewissen, weil sie sich diese Freiheit nahm, es sich mal einfach zu machen, ich weiß es nicht, ich weiß nur, dass ich es als eine jämmerliche Freiheit ansah. Verdienten sie etwa nicht etwas Besseres, etwas Größeres, Prächtigeres, etwas mit mehr Würde als die Freiheit, die eine einfache Mahlzeit beinhaltete, alle diese Mütter, die auf ihre eigenen Möglichkeiten und Chancen verzichtet hatten und sich stattdessen in den Dienst anderer gestellt hatten, diejenigen, die Hausfrauen genannt wurden, weil sie nicht nur die Frauen ihrer Ehemänner waren, sie waren außerdem Frauen der Küche, des Staubsaugers, des Bettzeugs, der Nähnadeln und der Besen, verdienten sie denn nicht etwas anderes? Oh doch, sie verdienten etwas Größeres. Sie verdienten einen anderen Nachruf, diese Frauen, die im Nachhinein herabgewürdigt wurden, verachtet und lächerlich gemacht, die als unnütz und hohl abgeschrieben wurden. Diese Mütter waren das Gegenteil. Sie waren es, die uns die Aufhänger an die Kleidung nähten. Sie waren es, die uns immer wieder fanden. Wir machen es uns heute mal einfach, sagte Mutter. Und während ich das schreibe, denke ich: Sie verdient einen Nachruf.
»Es gefällt mir so«, sagte ich.
»So?«
»Mal einfach.«
5
Als die Uhr auf sechs zuging, lief ich hinunter zum Anleger, um es hinter mich zu bringen. Es dauerte seine Zeit, dorthin zu gehen, denn mein Fuß war schlimmer als je zuvor. Er war widerborstig und bockig. Er wollte mich vom Kurs abbringen, über Zäune, hinunter in Gräben, hoch auf Bäume. Schließlich schaffte ich es doch, am Ziel anzukommen. Iver Malt stand wie üblich da und angelte. Das Ungewöhnliche war, dass wir eine Verabredung hatten. Ich wollte keine Verabredungen haben. Er drehte sich erst um, als ich direkt hinter ihm stand, und eigentlich drehte er sich auch dann nicht um, sondern warf nur einen schnellen Blick über die Schulter, während er langsam die Schnur einholte.
»Will nur sehen, ob mein Vater mit der Fähre kommt«, sagte ich.
»Ja, logo.«
»Ist gut möglich, dass er kommt.«
»Schön für dich. Dann könnt ihr den Fahnenmast streichen.«
»Genau. Der muss gestrichen werden.«
Iver Malt gab mir die Konservendose.
»Bist du Linkshänder?«
Ich hätte antworten können, dass ich Linksfüßer war, auch wenn es so ein Wort nicht gibt. Aber jetzt gab es das, Linksfüßer, ich konnte am besten auf dem linken Fuß gehen.
»Nein«, sagte ich, »du?«
»Warum hältst du sie dann in der Rechten?«
Ich wechselte die Hand, nahm die Schnur in die andere.
»So?«
»Du kannst das Vorfach entweder über dem Kopf schleudern, ungefähr wie ein Lasso, oder neben dir. Kapiert?«
Ich versuchte es zunächst mit dem Lasso. Der Blinker, der gold und rot war, schien mir viel zu schwer zu sein, und ich hätte fast das Gleichgewicht verloren.
»Ich glaube, wir fangen lieber mit der Seite an«, meinte Iver.
Jetzt stellte er sich hinter mich. Er richtete meinen Arm aus und justierte mein Handgelenk, zog sich dann ein Stück zurück. Ich wirbelte wie eine Windmühle, ließ die Schnur los, und das Vorfach flog in den Fjord, ungefähr acht Zentimeter von den Anlegerpflöcken entfernt. Ich holte es ein und warf Iver die Dose zu.
»Du kannst gern angeln. Ich scheiß drauf.«
Iver sah ganz verwundert aus und kam näher.
»Gibst du gleich nach dem ersten Versuch auf?«
»Ich gebe nicht auf. Weil ich noch gar nicht angefangen habe.«
»Beim ersten Mal habe ich es auch nicht geschafft. Das Vorfach ist hinten beim Bus gelandet, der gerade abbiegen wollte.«
»Hast du was gefangen?«
Iver gab mir lachend die Konservendose zurück.
»Versuch es mit etwas weniger Schwung. Drei Runden. Und lass los, gleich nachdem du den Arm gestreckt hast.«
Ich tat, wie er mir gesagt hatte. Es ging etwas besser als beim ersten Mal, nicht, dass es nun der weiteste Wurf mit einer Konservendose in der Geschichte von Nesodden war, aber zumindest landete der Haken so weit draußen im Fjord, dass er eine Makrele hätte treffen können, zumindest einen Merlan. Iver schlug mir auf den Rücken.
»Prima! Klasse! Lass den Haken sinken, während du bis zehn zählst. Dann kannst du langsam die Schnur einholen. Und du musst nicht so furchtbar schnell zählen!«
Mich ergriff ein sonderbares, umgekehrtes Gefühl. Schließlich war ich hergekommen, um Iver Malt gegenüber nett zu sein, und jetzt war er derjenige, der nett zu mir war. Ich glaube, das gefiel mir nicht. Aber ich tat immer noch alles, was er sagte. Zu meiner eigenen Verwunderung musste ich außerdem einräumen, dass an den Bewegungen des Hakens da unten in der Tiefe etwas Besonderes war, winzig kleine Schwingungen, die sich die Leine entlang fortpflanzten, dann weiter in die Hand, den Arm hinauf und in der Ohrmuschel wie ein Lied endeten, nein, nur wie ein Ton, der noch lange anhielt, nachdem der Sommer vorbei war.
»Noch einmal«, sagte Iver.
»Die Fähre kommt.«
»Ist doch egal. Wirf die Leine aus.«
»Außerdem kommen Leute.«
»Ja und? Scheiß auf die Leute.«
Zum dritten Mal tat ich, was Iver sagte. Ich schiss auf die Leute. Es war mir scheißegal, ob diejenigen, die aus dem Bus stiegen, um in die Stadt zu fahren, sahen, dass ich mich lächerlich machte. Ich fing bereits an zu reden und zu denken wie Iver Malt. So einfach ist das mit mir. Ich hatte sogar vergessen, dass mein Vater nicht mit der Fähre kam. Ich entschied mich zu einem größeren Schwung, drei Runden, das heißt, dreieinhalb, und genau im richtigen Moment, kurz nachdem der Arm ganz gestreckt war, ließ ich die Schnur los und wusste im gleichen Augenblick, dass es ein ziemlich guter Wurf war, vielleicht sogar mehr als ziemlich gut. Der Haken flog in einem eleganten Bogen, nicht zu hoch, denn es war ja nicht der Himmel, in dem angebissen werden soll, während die Schnur sich in rasender Fahrt von der Dose abwickelte, bis nicht einmal mehr ein Meter übrig war und ich schon fürchtete, dass das ganze Ding reißen könnte. Aber da war es endlich genug, und ich hörte nicht einmal, wie der Haken aufs Wasser auftraf.
»Oh Scheiße«, sagte Iver, »du bist echt gut!«
Ich zählte nicht bis zehn, sondern bis fünfzehn. Dann holte ich die Leine so langsam ein, wie ich nur konnte. Die Nesodden-Fähre näherte sich, aber es war noch genügend Zeit. Einen Moment lang konnte ich schwören, dass ich in Iver Malts Welt war. Plötzlich gab es einen Ruck. Ich holte die Leine schneller ein.
»Ganz ruhig«, sagte Iver.
Ich war nicht ganz ruhig. Denn jetzt spürte ich etwas Schweres, Störrisches da unten dagegenarbeiten, etwas, das größere Kräfte besaß als ich. Die Leine war stramm gespannt und schnitt mir in die Finger. Ich war nicht mehr derjenige, der zog. Ich wurde gezogen.
»Ich hab ihn!«, rief ich. »Ich hab ihn!«
»Ja, du hast Grund.«
»Grund?«
»Zieh und lass dann locker. Dann löst er sich.«
Die Leute, die in die Stadt wollten, stellten sich um uns herum, denn sie glaubten sicher, dass ich mindestens einen Delphin an der Leine hatte. Es waren nicht viele, aber als sich einige hinter uns gestellt hatten, wurden es immer mehr. Ich wollte, dass Iver die Dose übernahm, aber der stand nur barfuß mit der lächerlichen Baseballkappe da und tat, als hätte er mit der ganzen Angelegenheit gar nichts zu tun. Also zog ich und ließ locker, zog und ließ locker. Langsam aber sicher gab es nach. Was übrigens ein wunderbares Gefühl war. Als würde man eine schwere Last los, ja, mehr als das, es war, als würde alles klar und deutlich werden. Aber immer noch hing da etwas fest. Ich hatte etwas am Haken, das sich mysteriös verhielt. Die Pappnasen rückten immer näher und beugten sich über den Rand des Anlegers. War es ein Tintenfisch? Ich sah unten im Wasser einen Schatten. Der war nicht klein. Ich zog, was das Zeug hielt. Es war ein Kinderwagen. Verdammter Mist, es war das verrostete Gestell eines blöden Kinderwagens, in Algen, Seetang, Muscheln und zähe Quallen eingewickelt. Die prächtigen Pappnasen lachten herzlich und applaudierten. Verdammter Scheißdreck, sagte ich. Die Vorstellung war vorbei. Iver half mir, den Fang herauszuholen und löste den Haken vom Hinterrad.
»Saustark«, sagte er.
»Saustark? Was ist hier saustark? Der Mist hier?«
»Gestern hatte ich ein Fahrrad.«
»Ich dachte, du würdest Fische angeln.«
»Das auch. Aber mein Vater kann alles gebrauchen.«
Iver hockte sich hin und fing an, den Dreck von dem Fang abzupflücken. In dem Moment legte die Fähre an, nicht die Prinsen, sondern die Bunnefjorden, der schlimmste Kahn in diesem Fahrwasser. Nur wenige stiegen aus, die meisten waren ja gestern gekommen. Der Kapitän, der Mann mit dem Zählwerk und der Uniform, stand wieder an der Reling und half denen, die Hilfe brauchten. Er stand an Bord aller Schiffe, die zwischen Utstikker B und Nesodden fuhren. Jemand behauptete sogar, er hätte ihn an Bord der Prinsen gesehen, während er zur gleichen Zeit Passagiere zählte, die in Oksvald an Land gingen. Übrigens war mein Vater nicht mit an Bord. Das hatte ich ganz vergessen, ich hatte meine eigene Lüge vergessen, bis Iver mich daran erinnerte.
»Kommt dein Vater doch nicht?«, fragte er.
»Mein Vater? Der kommt nicht vor Samstag.«