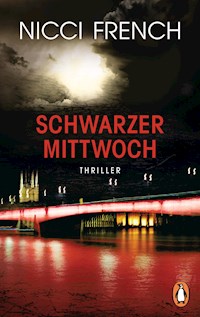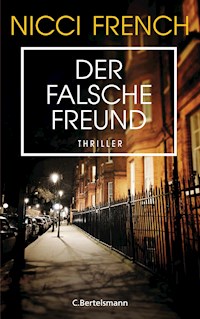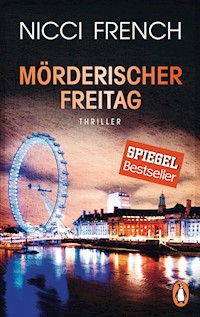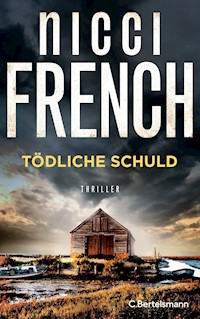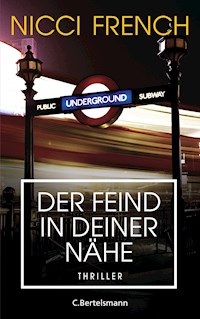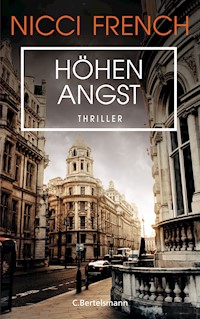6,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Penguin Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Ein perfider Mörder, hilflose Opfer und eine überforderte Polizei: Geniale Spannung made by Nicci French.
Es ist heiß in diesem Sommer in London, ungewöhnlich heiß, und die Stadt heizt sich täglich mehr auf. Der Jahrhundertsommer, am Anfang freudig begrüßt, wird langsam zur Qual. Nur einer genießt die Hitze: Er beobachtet die Körper der Frauen. Heimlich. Er riecht sie, er prägt sie sich ein, er ergötzt sich an ihrer schweißnassen Haut ... Dann terrorisiert und schließlich tötet er sie. Die Polizei setzt alles daran, ihn zu überführen, doch der »Sommermörder« ist immer etwas schneller als sie – bis er an Nadia gerät. Dieses eine Mal hat er seine Macht überschätzt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 586
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
NICCI FRENCH – hinter diesem Namen verbirgt sich das Ehepaar Nicci Gerrard und Sean French. Mit ihrer Krimiserie um die Londoner Psychologin Frieda Klein sorgen sie international für Furore, 2018 erschien mit »Der achte Tag« der letzte Band der achtteiligen Reihe. Nun ist auch ihr Longseller »Der Sommermörder«, von dem sie weltweit über 8 Millionen Exemplare verkauften, bei Penguin lieferbar.
Außerdem von Nicci French lieferbar:Blauer MontagEisiger DienstagSchwarzer MittwochDunkler DonnerstagMörderischer FreitagBöser SamstagBlutroter SonntagDer achte Tag
Besuchen Sie uns auf www.penguin-verlag.deund Facebook.
Nicci French
Der
Sommermörder
Thriller
Aus dem Englischen von Birgit Moosmüller
Die englische Originalausgabe erschien 2000 unter dem Titel Beneath the Skin bei Michael Joseph (Penguin Random House), London.Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
PENGUIN und das Penguin Logo sind Markenzeichenvon Penguin Books Limited und werden hier unter Lizenz benutzt.
Copyright © 2000 by Joint-up Writing, Ltd.
Copyright © der deutschsprachigen Ausgabe 2001 by
C. Bertelsmann, München,
in der Verlagsgruppe Random House GmbH,
Neumarkter Straße 28, 81673 München
Umschlag: www.buerosued.de
Umschlagmotiv: Gettyimages/Ben Lucas-Lee/EyeEm
Satz: Uhl + Massopust, Aalen
ISBN 978-3-641-23663-2V003
www.penguin-verlag.de
FÜR KATIE UND CHRIS
Im Sommer heizen sich ihre Körper auf. Die Hitze sickert durch die Poren ihrer nackten Haut. Heißes Licht dringt in ihre Dunkelheit. Ich stelle mir vor, wie es in ihrem Innern umherwogt und sie erregt. Ich denke an die dunkle, glänzende Flüssigkeit unter ihrer Haut. Sie ziehen ihre Sachen aus, all die dicken, hochgeschlossenen Schichten, die sie im Winter tragen, und lassen die Sonne auf ihre Arme und ihren Hals scheinen, lassen sie zwischen ihren Brüsten nach unten strömen. Mit zurückgelegtem Kopf genießen sie die Wärme auf ihrem Gesicht. Sie schließen die Augen und öffnen den Mund, ihre geschminkten oder nackten Lippen. Die Gehsteige, auf denen sie mit strumpflosen Beinen dahineilen, flimmern vor Hitze. Dünne Röcke flattern im Rhythmus ihrer Schritte. Frauen. Im Sommer beobachte ich sie, rieche sie, präge sie mir ein.
Sie betrachten ihr Spiegelbild in den Schaufenstern, ziehen den Bauch ein, stellen sich aufrechter hin, und ich sehe ihnen dabei zu. Ich beobachte sie dabei, wie sie sich betrachten. Ich sehe sie, wenn sie glauben, unbeobachtet zu sein.
Die Rothaarige im orangefarbenen Sommerkleid. Einer von den Trägern ist verdreht. Sie hat Sommersprossen auf der Nase, einen großen Leberfleck am Schlüsselbein. Sie trägt keinen BH. Beim Gehen schwingt sie die bleichen, mit feinen Härchen bedeckten Arme, und ihre Brustwarzen zeichnen sich unter dem straffen Baumwollstoff ihres Kleides ab. Flache Brüste. Kantige Hüftknochen. Sie trägt Sandalen mit niedrigen Absätzen. Ihre zweite Zehe ist länger als die große. Sie hat schlammgrüne Augen, die an den Grund eines Flusses erinnern. Helle Wimpern, die zu viel blinzeln. Schmale Lippen, eine Spur von Lippenstift in den Mundwinkeln. Sie beugt unter der Hitze die Schultern, hebt einen Arm, um sich die Schweißperlen von der Stirn zu wischen. Unter ihrer Achsel schimmern kupferrote Haarstoppeln, vielleicht ein paar Tage alt. Auch ihre Beine sind stoppelig. Sie würden sich anfühlen wie feuchtes Sandpapier. Ihre Haut wirkt fleckig, und das Haar klebt ihr an der Stirn. Sie hasst die Hitze, lässt sich von ihr unterkriegen.
Ganz anders die mit dem großen Busen, dem wabbeligen Bauch und dem dichten dunklen Haar. Man möchte meinen, bei ihrem Gewicht würde sie stärker unter der Temperatur leiden, aber sie lässt die Sonne in sich hinein, kämpft nicht dagegen an. Ich sehe, wie sie ihren fetten, weichen Körper für die Hitze öffnet. Ihr grünes Shirt ist unter den Armen nass, der Schweiß läuft ihr am Hals hinunter, vorbei an den dicken, geraden Flechten ihres Haars. Ihre dichte Achselbehaarung verrät mir, wie der Rest ihres Körpers aussieht. Sie hat einen dunklen Damenbart und einen Mund wie eine reife Pflaume, rot und feucht. Ihre weißen Zähne beißen in ein Brötchen, das mit braunem, wachsigem Papier umwickelt ist. Ein kleines Stück Tomate klebt an ihrer Oberlippe, und ihr Kinn ist fettverschmiert, aber sie wischt es nicht ab. Ihr Rock verfängt sich zwischen den Pobacken und rutscht ein wenig hoch.
Die Hitze kann Frauen abstoßend machen. Manche von ihnen trocknen total aus, wie Insekten in der Wüste. Sie bekommen vor Trockenheit tiefe Furchen im Gesicht, Lippen wie Pergament, ein Kreuzmuster aus Falten unter den Augen. Die Sonne entzieht ihnen all ihre Feuchtigkeit. Das passiert vor allem den älteren Frauen, die deswegen versuchen, ihre crêpe-artigen Arme unter langen Ärmeln und das Gesicht unter einem Hut zu verbergen. Andere Frauen beginnen einen ranzigen, fauligen Geruch zu verströmen. Wenn sie in meine Nähe kommen, kann ich sie riechen. Unter ihrem Deo, dem Duft ihrer Seife und dem Parfüm, das sie sich auf die Handgelenke und hinters Ohr getupft haben, wittere ich den Geruch von Reife und Verfall.
Manche aber blühen auf wie Blumen im Sonnenlicht, sauber und frisch. Ihre Haut wirkt glatt, ihr Haar glänzt wie Seide, egal, ob es zurückgebunden ist oder locker ihr Gesicht umspielt. Ich sitze auf einer Parkbank und sehe zu, wie sie einzeln oder in Gruppen an mir vorübergehen und dabei ihre heißen Füße in das ausgebleichte Gras pressen. Die Sonne taucht sie in gleißendes Licht. Die Schwarze mit dem gelben Kleid, der schimmernden Haut und dem üppigen, glänzenden Haar. Ich höre sie im Vorbeigehen lachen, das raue Geräusch scheint von einem geheimen Ort tief im Innern ihres starken Körpers zu kommen. Mein besonderes Augenmerk gilt dem, was im Schatten liegt; der Falte in der Achselhöhle, der Hinterseite des Knies, der dunklen Region zwischen den Brüsten. Den verborgenen Stellen der Frauen, von denen sie glauben, dass niemand sie sieht.
Manchmal sehe ich auch, was sie unter ihren Sachen tragen. Die Frau mit dem ärmellosen weißen Shirt und dem BH-Träger, der ihr immer wieder über die Schulter rutscht. Er hat einen Graustich und Flecke vom häufigen Tragen. Sie ist in ein frisches Shirt geschlüpft, hat sich aber nicht die Mühe gemacht, auch einen sauberen BH anzuziehen. Mir fallen diese Dinge auf. Der Unterrock, der unter dem Saum hervorlugt. Der abgeblätterte Nagellack. Der mit Abdeckstift übermalte Pickel. Der Knopf, der nicht zu den Übrigen passt. Der Fleck auf der Hose, der Schmutzrand am Kragen. Der Ring, der mit den Jahren so eng geworden ist, dass er den Finger einschnürt.
Sie gehen an mir vorbei. Ich sehe sie durch ein Fenster, wenn sie sich allein wähnen. Die Frau, die nachmittags in ihrer Küche schläft, in dem Haus an der ruhigen Straße, durch die ich manchmal gehe. Ihre Kopfhaltung wirkt unbequem – gleich wird sie mit einem Ruck hochschrecken, sich fragen, wo sie ist –, und ihr schlaffer Mund steht offen. Über ihre Wange zieht sich eine dünne Linie aus Speichel, wie die Spur einer Schlange.
Das Kleid, das sich beim Einsteigen ins Auto hochschiebt und ein Stück Slip hervorblitzen lässt. Dellige Oberschenkel.
Der Knutschfleck unter dem sorgfältig hindrapierten Schal.
Der Bauchnabel einer Schwangeren, der sich durch den dünnen Stoff ihres Kleides drückt.
Die Milchspuren auf der Bluse einer jungen Mutter; der kleine Speichelfleck an der Stelle, wo der Kopf des Babys an ihrer Schulter ruht.
Das Lächeln, das geschwollenes, schwindendes Zahnfleisch enthüllt, der abgeschlagene Schneidezahn, die Porzellankrone.
Der dunkel nachgewachsene Scheitel in blondiertem Haar.
Die dicken, gelblichen Zehennägel, die ihr Alter verraten.
Das erste Anzeichen von Krampfadern auf einem weißen Bein, wie ein violetter Wurm unter der Haut.
Im Park liegen sie auf der Wiese und lassen die Sonne auf sich herabbrennen. Sie sitzen draußen vor den Pubs, Bierschaum auf den Lippen. Manchmal stehe ich zwischen ihnen in der stickigen Luft der U-Bahn und spüre ihr heißes Fleisch. Manchmal sitze ich so dicht neben ihnen, dass sich unsere Oberschenkel leicht berühren. Manchmal halte ich ihnen die Tür auf und folge ihnen ins kühle Innere einer Bibliothek, einer Galerie, eines Ladens. Dann studiere ich ihren Gang, die Art, wie sie den Kopf wegdrehen oder sich das Haar hinter die Ohren schieben. Die Art, wie sie mit einem Lächeln wegsehen. Manchmal sehen sie nicht weg.
Noch ein paar Wochen lang herrscht Sommer in der Stadt.
ERSTER TEIL Zoë
1. KAPITEL
Ohne die Wassermelone wäre ich nicht berühmt geworden, und ohne die Hitze hätte ich die Wassermelone nicht gehabt. Deswegen fange ich wohl am besten mit der Hitze an.
Bloß festzustellen, dass es heiß war, erweckt vielleicht den falschen Eindruck. Es lässt Sie womöglich ans Mittelmeer denken, an einsame Strände und Longdrinks mit farbenfrohen Papiersonnenschirmen. Nichts dergleichen. Die Hitze war wie ein großer, fetter, stinkender alter Hund, ein räudiger, schmieriger, furzender, verendender alter Hund, der sich Anfang Juni auf London niedergelassen und drei schreckliche Wochen lang keinen Millimeter bewegt hatte. Es war immer schweißtreibender und schwüler geworden, und das anfängliche Blau des Himmels hatte sich im Lauf der Zeit in eine giftige Mischung aus Gelb und Grau verwandelt. Die Holloway Road hatte inzwischen etwas von einem riesigen Auspuffrohr, weil die Abgase der Autos vom Gewicht noch schädlicherer Schadstoffe auf Straßenhöhe festgehalten wurden. Wir Fußgänger husteten einander an wie Beagle, die gerade aus einem Tabaktestlabor befreit worden waren. Anfang Juni hatte ich es noch als wohltuend empfunden, ein Sommerkleid anzuziehen und den leichten Stoff auf meiner Haut zu spüren, aber mittlerweile waren meine Kleider abends immer rußgeschwärzt und fleckig, und ich musste mir jeden Morgen die Haare waschen.
Normalerweise wird mir die Auswahl der Bücher, die ich meiner Klasse vorlese, nach faschistischen, totalitären, von der Regierung vorgeschriebenen Prinzipien aufoktroyiert, aber an diesem Morgen hatte ich ausnahmsweise mal rebelliert und ihnen eine Brer-Rabbit-Geschichte vorgelesen, die ich in einer Pappschachtel voller ramponierter Kinderbücher gefunden hatte, als ich die Wohnung meines Dads ausräumte. Fasziniert hatte ich alte Schulberichte durchgesehen, Briefe gelesen, die lange vor meiner Geburt geschrieben worden waren, und billige Porzellanfigürchen betrachtet, die eine Flut von sentimentalen Erinnerungen auslösten. Die Bücher hatte ich alle behalten, weil ich dachte, dass ich eines Tages vielleicht selbst Kinder haben würde und ihnen dann die Bücher vorlesen könnte, die Mom mir vorgelesen hatte, ehe sie gestorben war und es Dad überlassen hatte, mich jeden Abend ins Bett zu bringen. Seit damals gehörte das Vorlesen für mich zu den Dingen, die ich verloren hatte, und deshalb wurde es in meiner Erinnerung zu etwas sehr Wertvollem, Wunderbarem. Immer wenn ich Kindern etwas vorlese, kommt es mir ein bisschen so vor, als hätte ich mich in eine weiche, verschwommene Version meiner Mutter verwandelt. Als würde ich dem Kind vorlesen, das ich selbst einmal war.
Ich wünschte, ich könnte sagen, jene klassische alte Kindergeschichte hätte meine Schüler so richtig in ihren Bann gezogen. Vielleicht ließ das übliche Geschrei und Gestupse, das Nasenbohren und An-die-Decke-Starren ja tatsächlich ein klein wenig nach, aber als ich sie hinterher zu der Geschichte befragte, kam in erster Linie heraus, dass keines der Kinder wusste, was eine Wassermelone war. Ich griff nach der roten und der grünen Kreide und malte ihnen eine an die Tafel. Eine Wassermelone ist so einfach zu zeichnen, dass sogar ich dazu in der Lage bin. Trotzdem starrten mich die Kinder weiterhin ratlos an.
Ich versprach ihnen, am nächsten Tag eine Melone mitzubringen, wenn sie während der letzten Nachmittagsstunde besonders brav wären, und tatsächlich benahmen sie sich so gesittet, dass es fast schon beunruhigend war. Auf der Heimfahrt stieg ich eine Station später als üblich aus und ging dann zu Fuß die Seven Sisters Road zurück, vorbei an den vielen Gemüseläden und -ständen. Gleich beim Ersten kaufte ich ein Pfund Kirschen, das ich auf der Stelle verspeiste. Der säuerliche Geschmack der sauberen, saftigen Früchte ließ mich an meine Kindheit auf dem Land denken. Mir war, als würde ich plötzlich wieder unter der grünen Markise sitzen und den Sonnenuntergang bewundern. Es war kurz nach fünf, und der Verkehr kam langsam zum Erliegen. Obwohl mir heiße Autoabgase ins Gesicht schlugen, empfand ich fast so etwas wie Fröhlichkeit. Wie üblich musste ich mich durch Unmengen von Menschen kämpfen, aber an diesem Tag schienen viele von ihnen guter Laune zu sein. Die meisten waren farbenfroh gekleidet. Meine Stadtklaustrophobie nahm erheblich ab.
Ich kaufte eine Wassermelone, die die Größe eines Basketballs und das Gewicht einer Bowlingkugel besaß. Der Verkäufer musste vier Plastiktüten ineinanderlegen, und es war praktisch unmöglich, sie auf einigermaßen elegante Art zu tragen. Ganz vorsichtig schwang ich mir die Tüte über die Schulter, katapultierte mich dabei fast auf die Straße, und schleppte die Melone wie einen Kohlensack auf dem Rücken. Bis zu meiner Wohnung waren es nur knapp dreihundert Meter, sodass ich es aller Voraussicht nach schaffen würde.
Während ich die Seven Sisters Road überquerte und in die Holloway Road einbog, starrten mich die Leute neugierig an. Sie dachten wohl, dass ich weiß Gott was im Schilde führte: eine junge blonde Frau in einem knappen Sommerkleid, vornübergebeugt unter der Last einer Einkaufstüte.
In dem Moment passierte es. Lässt sich im Nachhinein noch sagen, was ich dabei empfand? Es war ein Moment, ein Impuls, ein Schlag, und dann war es schon wieder vorbei. Den eigentlichen Hergang der Dinge konnte ich bloß rekonstruieren, indem ich das Ganze immer wieder vor meinem geistigen Auge Revue passieren ließ, verschiedenen Leuten davon erzählte und mir von verschiedenen Leuten davon erzählen ließ. Ein Bus kam auf mich zu. Als er fast auf meiner Höhe war, sprang jemand von der Plattform am Ende des Fahrzeugs. Der Bus fuhr so schnell, wie es in der Holloway Road während der Rushhour überhaupt nur möglich ist. Normale Menschen springen nicht einfach so von einem Bus, nicht einmal die Londoner, sodass ich zunächst der Meinung war, der Mann wäre leichtsinnigerweise gleich hinter dem Bus über die Straße gelaufen, aber die Geschwindigkeit, mit der er auf dem Gehsteig aufkam und die ihn fast das Gleichgewicht verlieren ließ, sagte mir, dass er aus dem Bus gesprungen sein musste.
Dann erst sah ich, dass es sich um zwei Personen handelte, die allem Anschein nach mit Riemen aneinandergebunden waren. Die hintere Person war eine Frau, etwas älter als der Mann, aber nicht wirklich alt. Im Gegensatz zu ihm verlor sie tatsächlich das Gleichgewicht. Es war schrecklich, mit ansehen zu müssen, wie sie auf dem Boden landete und sich überschlug. Ich sah ihre Füße unglaublich hoch in die Luft ragen, ehe sie gegen eine Mülltonne krachte. Ich sah es nicht bloß, ich hörte es auch. Der Mann rappelte sich hoch. Er hatte eine Tasche in der Hand, die Tasche der Frau. Er hielt sie in Brusthöhe mit beiden Händen umklammert. Jemand schrie etwas. Der Mann sprintete los. Auf seinem Gesicht lag ein seltsames, maskenhaftes Lächeln, und sein Blick wirkte glasig. Er rannte direkt auf mich zu. Ich musste einen Satz zur Seite machen, um ihn vorbeizulassen, aber ich ließ ihn nicht vorbei. Stattdessen ließ ich die Wassermelone von meiner Schulter gleiten, lehnte mich zurück und schwang sie dem Mann entgegen. Hätte ich mich dabei nicht zurückgelehnt, wäre die Melone senkrecht nach unten gefallen und hätte mich mit zu Boden gerissen. So aber schwang sie kreisförmig um mich herum. Hätte sie ihre Kreisbewegung fortgesetzt, hätte ich bestimmt schnell die Kontrolle über sie verloren, aber ihr Flug fand ein jähes Ende, als sie den Mann voll in den Magen traf.
Es heißt, dass jede Art von Schläger die optimale Schlagstelle besitzt. Wenn ich als Kind Federball spielte, landete der Ball meist irgendwo am Rand des Schlägers und sprang jämmerlich zur Seite weg. Hin und wieder aber traf er genau die richtige Stelle und flog pfeilschnell zum Gegner zurück, ohne dass ich mich groß anstrengen musste. Auch bei Kricketschlägern gibt es die genau richtige Stelle, ebenso wie bei Tennis- und Baseballschlägern. Und dieser Handtaschendieb erwischte meine Wassermelone an der genau richtigen Stelle, exakt am perfekten Punkt ihrer Rundung. Mit einem erstaunlich dumpfen Geräusch knallte sie in seinen Magen. Dann stieß er zischend die Luft aus und ging zu Boden, als würde in seiner Kleidung plötzlich kein Körper mehr stecken. Es sah aus, als würden seine Sachen versuchen, sich auf dem Asphalt selbstständig zusammenzufalten. Er ging nicht zu Boden wie ein gefällter Baum, sondern wie ein großes Gebäude, das nahe am Fundament durch Sprengstoff zum Einstürzen gebracht wird. Erst steht es noch in voller Größe da, und ein paar Sekunden später sind nur noch Staub und Geröll übrig.
Ich hatte keinerlei Plan für den Fall, dass der Mann aufstehen und auf mich losgehen würde. Meine Wassermelone ließ sich nicht nachladen. Aber der Typ war gar nicht in der Lage aufzustehen. Nachdem er ein paar schwache Versuche unternommen hatte, sich mit den Armen hochzustemmen, war er bereits von einer Menschenmenge umringt, sodass ich ihn nicht mehr sehen konnte. Da fiel mir die Frau wieder ein. Ein paar Leute stellten sich mir in den Weg und wollten mich ansprechen, aber ich schob mich an ihnen vorbei. Ich fühlte mich benommen und seltsam euphorisch. Am liebsten hätte ich gelacht oder wild drauflos gequasselt, aber der Zustand der Frau hatte nichts Lustiges an sich. Sie lag verdreht und in sich zusammengesunken mit dem Gesicht nach unten auf dem Gehsteig. Auf dem Boden war ziemlich viel Blut, das sehr dunkel und dick aussah. Einen Moment lang dachte ich, sie sei tot, aber dann bemerkte ich das seltsame Zucken ihres Beins. Sie trug ein schickes Kostüm mit einem ziemlich kurzen grauen Rock. Plötzlich stellte ich mir vor, wie sie an diesem Morgen gefrühstückt hatte und zur Arbeit gefahren war. Wie sie sich nach der Arbeit auf den Heimweg gemacht und vielleicht schon Pläne für den Abend geschmiedet hatte, und dann passierte plötzlich so was und veränderte ihr ganzes Leben. Warum hatte sie die blöde Tasche nicht einfach losgelassen? Vielleicht hatte sich ihr Arm im Riemen verfangen.
Die Leute standen um sie herum und sahen sich unbehaglich an. Uns allen wäre es am liebsten gewesen, irgendjemand Offizielles – ein Arzt, ein Polizist oder sonst jemand in Uniform – wäre vorgetreten, um die Sache in die Hand zu nehmen, aber da war niemand.
»Ist denn kein Arzt hier?«, fragte eine alte Frau neben mir.
Verdammter Mist. Ich hatte im zweiten Semester meiner Lehrerinnenausbildung einen zweitägigen Erstehilfekurs absolviert. Also trat ich vor und kniete mich neben die Frau. Rund um mich herum ließ die allgemeine Anspannung spürbar nach. Ich wusste höchstens, wie man Kleinkindern Medikamente verabreichte, ansonsten aber konnte ich mich an nichts Brauchbares erinnern, außer an eine der Grundregeln: »Im Zweifelsfall gar nichts tun.« Die Frau war bewusstlos. Gesicht und Mund waren blutverschmiert. Noch etwas fiel mir wieder ein. »Die stabile Seitenlage.« So sanft ich konnte, drehte ich ihr Gesicht zu mir herum. Hinter mir schnappten die Leute nach Luft oder schrien entsetzt auf.
»Hat schon jemand einen Krankenwagen gerufen?«, fragte ich.
»Ja, auf meinem Handy«, antwortete eine Stimme.
Ich holte tief Luft und schob meine Finger in den Mund der Frau. Sie hatte rotes Haar und sehr helle Haut. Sie war jünger, als ich zunächst gedacht hatte, und in normalem Zustand wohl ziemlich schön. Einen Moment lang fragte ich mich, welche Farbe die Augen hinter ihren geschlossenen Lidern hatten. Dann begann ich, das gestockte Blut aus ihrem Mund zu entfernen. Als mein Blick auf meine Hand fiel, entdeckte ich dort einen Zahn oder zumindest ein Stück davon. Aus der Kehle der Frau drang ein Stöhnen, gefolgt von einem Hustenanfall. Wahrscheinlich ein gutes Zeichen. Ganz in unserer Nähe hörte ich eine laute Sirene. Als ich hochschaute, wurde ich bereits von einem Mann in Uniform beiseite geschoben. Das war mir nur recht.
Mit der linken Hand bekam ich in meiner Tasche ein Papiertaschentuch zu fassen und wischte damit sorgfältig das Blut von meinen Fingern. Meine Melone. Sie war mir abhanden gekommen. Entschlossen machte ich kehrt, um nach ihr zu suchen. Der Handtaschendieb hatte sich inzwischen aufgesetzt. Zwei Polizeibeamte, ein Mann und eine Frau, sahen auf ihn hinunter. Mein Blick fiel auf die blaue Plastiktüte.
»Die gehört mir«, sagte ich, während ich danach griff. »Ich habe sie fallen lassen.«
»Die war es«, sagte eine Stimme. »Sie hat ihn aufgehalten.«
»Regelrecht k.o. geschlagen hat sie ihn«, sagte jemand anderer, und eine daneben stehende Frau lachte.
Der Mann starrte zu mir hoch. Ich hatte damit gerechnet, dass er mich hasserfüllt anstarren würde, aber sein Blick wirkte bloß verblüfft.
»Stimmt das?«, fragte die Polizeibeamtin, die mich leicht skeptisch musterte.
»Ja«, antwortete ich vorsichtig. »Aber ich muss jetzt wirklich gehen.«
Ihr männlicher Kollege trat vor. »Vorher brauchen wir noch ein paar Einzelheiten, meine Liebe.«
»Was wollen Sie denn wissen?«
Er zog ein Notizbuch heraus. »Erst mal Ihren Namen und Ihre Adresse.«
Was dann kam, war ziemlich seltsam. Wie sich herausstellte, stand ich stärker unter Schock, als mir bewusst gewesen war. An meinen Namen konnte ich mich immerhin noch erinnern, auch wenn mich selbst das gewisse Mühe kostete, aber meine Adresse wollte mir einfach nicht mehr einfallen, und das, obwohl mir die verdammte Wohnung selbst gehörte und ich schon seit achtzehn Monaten dort wohnte. Ich musste meinen Terminplaner aus der Tasche holen und ihnen die Adresse vorlesen. Dabei zitterte meine Hand so sehr, dass ich die Worte kaum entziffern konnte. Sie müssen mich für verrückt gehalten haben.
2. KAPITEL
Ich war auf der Anwesenheitsliste beim Buchstaben E angelangt: E für Damian Everatt, einem mageren kleinen Jungen mit einer riesigen, auf einer Seite von Klebeband zusammengehaltenen Brille, wachsigen Ohren, einem ängstlichen Mund voller Zahnlücken und aufgeschürften Knien, die daher rührten, dass ihn die anderen Jungs auf dem Spielplatz immer herumschubsten.
»Ja, Miss«, flüsterte er. In dem Moment schob Pauline Douglas den Kopf durch die bereits offene Klassenzimmertür.
»Kann ich Sie kurz sprechen, Zoë?«, fragte sie. Ich stand auf, strich mir nervös das Kleid glatt und ging zu ihr hinüber. Obwohl auf dem Gang angenehmer Durchzug herrschte, lief eine Schweißperle über Paulines sorgfältig gepudertes Gesicht, und ihr grau meliertes Haar, das normalerweise tipptopp saß, klebte ihr feucht an den Schläfen. »Mich hat gerade ein Journalist der Gazette angerufen.«
»Der Gazette?«
»Ein Lokalblatt. Sie wollen mit Ihnen über Ihre Heldentat sprechen.«
»Wie bitte? Ach, das. Es ist –«
»Der Reporter hat irgendwas von einer Melone erwähnt.«
»Ach ja, wissen Sie –«
»Sie wollen auch einen Fotografen mitschicken. Ruhe!« Letzteres galt den Kindern, die hinter uns auf dem Boden herumalberten.
»Tut mir leid, dass die Leute Sie belästigt haben. Wimmeln Sie sie einfach ab.«
»Ganz im Gegenteil«, entgegnete Pauline in bestimmtem Ton. »Ich habe mit ihnen vereinbart, dass sie um halb elf, während der Pause, vorbeikommen sollen.«
»Meinen Sie wirklich?« Ich sah sie zweifelnd an.
»Das Ganze könnte eine gute Werbung für uns sein.« Sie warf einen Blick über meine Schulter. »Ist sie das?«
Ich wandte mich zu der großen grün gestreiften Frucht um, die ganz unschuldig auf dem Regal hinter uns thronte.
»Ja, das ist sie.«
»Sie sind offenbar kräftiger, als Sie aussehen. Also dann, bis später.«
Ich setzte mich wieder an meinen Platz und griff nach der Anwesenheitsliste.
»Wo waren wir stehen geblieben? Ach ja. Kadijah.«
»Ja, Miss.«
Der Journalist war mittleren Alters, ein kleiner, fetter Mann, dem die Haare nicht nur aus den Nasenlöchern, sondern sogar hinten aus dem Hemdkragen quollen. Ich hatte seinen Namen nicht ganz mitbekommen, was insofern ein bisschen peinlich war, weil er mich ständig mit dem Namen ansprach. Bob Irgendwas, glaube ich. Er hatte ein dunkelrotes Gesicht und große Schweißflecken unter den Armen. Während er kleine Stenofetzen in ein abgegriffenes Notizbuch schrieb, rutschte seine plumpe Faust immer wieder am Stift ab. Der Fotograf, der ihn begleitete, sah aus wie siebzehn: Er hatte kurz geschorenes dunkles Haar, einen Ring im Ohr und trug eine so enge Jeans, dass ich jedes Mal, wenn er sich mit seiner Kamera auf den Boden kauerte, Angst bekam, dass sie gleich platzen würde. Während Bob mir seine Fragen stellte, wanderte der Fotograf im Klassenzimmer umher und betrachtete mich durch sein Kameraobjektiv aus unterschiedlichen Blickwinkeln. Bevor die beiden eingetroffen waren, hatte ich noch schnell mein Haar in Ordnung gebracht und ein wenig Make-up aufgelegt. Louise hatte darauf bestanden und mich in die Lehrerinnentoilette geschoben, wohin sie mir mit einer Bürste in der Hand gefolgt war. Nun bereute ich, dass ich mir nicht mehr Mühe gegeben hatte. In meinem alten cremefarbenen Kleid mit dem schiefen Saum fühlte ich mich vor den beiden Männern ziemlich unbehaglich.
»Welche Gedanken gingen Ihnen durch den Kopf, bevor Sie beschlossen, mit der Melone auf ihn loszugehen?«
»Ich habe es einfach getan. Ohne nachzudenken.«
»Dann hatten Sie also keine Angst?«
»Nein. Dazu blieb mir gar keine Zeit.«
Er kritzelte meine Antworten in sein Notizbuch. Irgendwie hatte ich das Gefühl, dass er sich klügere, amüsantere Kommentare von mir erwartet hatte.
»Wo kommen Sie her? Für ein blondes Mädchen wie Sie ist Haratounian ein ungewöhnlicher Name.«
»Aus einem Dorf in der Nähe von Sheffield.«
»Dann sind Sie also neu in London.« Er wartete nicht auf meine Antwort. »Und Sie unterrichten die ganz Kleinen, richtig?«
»Ja, die so genannte Anfängerklasse.«
»Wie alt sind Sie?«
»Dreiundzwanzig.«
»Mmm.« Er betrachtete mich mit dem prüfenden Blick eines Bauern, der auf einer Viehauktion ein nicht sehr viel versprechendes Tier in Augenschein nimmt. »Wie viel wiegen Sie?«
»Was? Knapp fünfzig Kilo, glaube ich.«
»Fünfzig Kilo«, wiederholte er und lachte in sich hinein. »Phantastisch. Und der Typ war ein richtiger Schrank, nicht wahr?« Er saugte an seinem Stift. »Glauben Sie, unsere Gesellschaft wäre menschlicher, wenn sich jeder so engagieren würde wie Sie?«
»Na ja, vielleicht, ich weiß auch nicht…« Ich versuchte krampfhaft, einen zusammenhängenden Satz zu Stande zu bringen. »Ich meine, was, wenn die Melone ihr Ziel verfehlt oder jemand anderen getroffen hätte?«
Zoë Haratounian, die Sprecherin der sprachlosen Jugend. Der Journalist runzelte die Stirn und machte sich nicht mal die Mühe, so zu tun, als würde er sich meine Worte notieren.
»Wie fühlt man sich als Heldin?«
Bis dahin hatte ich das alles irgendwie amüsant gefunden, aber allmählich begann es mich zu nerven. Natürlich gelang es mir nicht, das in einigermaßen sinnvolle Worte zu fassen. »Es ist einfach passiert«, erklärte ich. »Ich möchte mich deswegen nicht auf irgendein Podest heben. Wissen Sie, ob es der Frau, die von dem Kerl überfallen worden ist, schon wieder besser geht?«
»Ja, sie hat nur ein paar gebrochene Rippen, und ein paar neue Zähne wird sie wohl auch brauchen.«
»Ich glaube, wir nehmen sie mit der Melone auf«, meldete sich der jugendliche Fotograf zu Wort.
»Ja, die Story hätten wir«, sagte Bob und nickte.
Er hob die Frucht aus dem Regal und wankte damit zu uns herüber. »Nicht schlecht«, meinte er, als er sie mir auf den Schoß legte. »Kein Wunder, dass Sie ihn bewusstlos geschlagen haben. So, und jetzt sehen Sie mich an. Das Kinn ein bisschen höher. Immer schön lächeln, meine Liebe! Sie haben schließlich gewonnen, nicht wahr? Wunderbar!«
Ich lächelte, bis mir das Gesicht wehtat. Durch die Tür sah ich Louise zu uns hereinspähen und wie wild grinsen. Am liebsten hätte ich losgeprustet.
Als Nächstes wollte er die Melone und mich zusammen mit den Kindern fotografieren. Ich mimte das strenge viktorianische Schulfräulein. Der Fotograf schlug vor, ich solle die Melone aufschneiden. Ihr fasriges Inneres hatte einen dunklen, satten Rosaton, der zum Rand hin blasser wurde, war von glänzenden schwarzen Kernen durchsetzt und verströmte ein frisches Aroma. Ich teilte sie in zweiunddreißig Portionen auf: eine für jedes Kind und eine für mich. Mit je einem Melonenstück in der Hand standen meine Schüler auf dem glühend heißen Asphaltspielplatz um mich herum und lächelten für die Kamera. Und jetzt alle zusammen. Eins, zwei, drei, Cheese!
Das Lokalblatt erschien am Freitag, mit einem riesigen Foto von mir auf der Titelseite. Es zeigte mich umringt von Kindern und Melonenscheiben. »Die Melonenheldin!«, lautete die Schlagzeile. Nicht besonders originell. Daryl hatte einen Finger in der Nase, und Roses Rock steckte in ihrer Unterhose, aber ansonsten war es in Ordnung. Pauline schien zufrieden. Sie hängte den Artikel an das schwarze Brett in der Eingangshalle, wo ihn die Kinder ziemlich schnell zerfetzten, und eröffnete mir dann, eine große Zeitung habe angerufen und wolle ebenfalls einen Artikel über die Geschichte bringen. Sie hatte provisorisch bereits einen weiteren Interview- und Fototermin während der Pause vereinbart, und erteilte mir die Erlaubnis, der Lehrerversammlung fernzubleiben. Natürlich nur, wenn mir das recht sei. Außerdem hatte sie die Schulsekretärin gebeten, eine weitere Melone zu besorgen.
Ich ging davon aus, dass die Sache damit ein Ende haben würde. Es verwirrte mich, welche Eigendynamik eine solche Geschichte entwickeln konnte. Ich erkannte die Frau kaum wieder, die am nächsten Tag mit einer riesigen Wassermelone im Arm auf einer Innenseite der Daily Mail zu sehen war und über deren Foto eine dicke Schlagzeile prangte. Mit ihrem vorsichtigen Lächeln und dem hellen Haar, das sie sich ordentlich hinter die Ohren geschoben hatte, sah sie mir überhaupt nicht ähnlich, und ihre Äußerungen klangen erst recht nicht nach mir. Gab es auf der Welt denn nicht genügend echte Nachrichten? Auf der nächsten Seite stand ganz unten ein sehr kleiner Artikel über ein Busunglück in Kaschmir: Der Bus war von einer Brücke gestürzt und hatte dabei eine große Zahl von Menschen in den Tod gerissen. Vielleicht hätten sie dem Unglück mehr Platz eingeräumt, wenn eine blonde, dreiundzwanzigjährige britische Lehrerin an Bord gewesen wäre.
»Blödsinn!«, meinte Fred, als ich ein paar Stunden später diese Vermutung äußerte. Wir genehmigten uns gerade eine Portion essigdurchweichte Pommes, nachdem wir zuvor in einem Film gewesen waren, in dem mit beachtlichen Bizepsen ausgestattete Männer einander mit Kinnhaken traktiert hatten. »Stell dein Licht nicht unter den Scheffel. Du hast dich wirklich wie eine Heldin verhalten. Du hattest einen Sekundenbruchteil Zeit, dich zu entscheiden, und du hast die richtige Entscheidung getroffen.« Er berührte mit seiner schlanken, schwieligen Hand mein Kinn. Ich hatte den Eindruck, dass er statt meiner die Frau mit dem schmalzigen kleinen Lächeln aus der Zeitung vor sich sah. Er küsste mich. »Manche Leute werden zu Helden, indem sie sich auf eine Granate werfen. Du hast es mit einer Wassermelone geschafft, das ist der einzige Unterschied. Lass uns zu dir gehen, ja? Es ist noch gar nicht spät.«
»Ich hab einen ganzen Stapel Hausaufgaben zu korrigieren.«
»Bloß ein Stündchen.«
Er kippte den Rest unserer Pommes in eine bereits überquellende Tonne, wich einem Haufen Hundescheiße mitten auf dem Gehsteig aus und legte seinen langen Arm um meine Schulter. Obwohl die ganze Stadt nach Abgasen, Kebab und Pommesfett stank, stieg mir Freds typischer Geruch nach Zigaretten und frisch gemähtem Gras in die Nase. Er hatte die Ärmel seines Hemds hochgekrempelt, sodass ich seine zerkratzten, aber schön gebräunten Unterarme sehen konnte. Ein paar Strähnen seines hellen Haars hingen ihm über die Augen. Trotz der schwülen Hitze des Abends fühlte er sich angenehm kühl an. Ich konnte nicht widerstehen.
Fred war mein neuer Freund, oder zumindest meine neue Liaison. Vielleicht waren wir gerade am perfekten Zeitpunkt angelangt. Die schwierige, peinliche erste Phase hatten wir bereits hinter uns: die Phase, in der man sich vorkommt wie ein Komiker, der vor ein anspruchsvolles Publikum tritt und verzweifelt auf dessen Lachen und Applaus hofft. Bloß, dass Lachen in diesem Fall das Letzte war, was man gebrauchen konnte. Andererseits waren wir noch weit von der Phase entfernt, in der man in der Wohnung herumläuft und nicht mal mehr registriert, dass der andere nichts anhat.
Fred hatte den Großteil des Jahres als Gärtner gearbeitet und war dadurch drahtig und sehnig geworden. Man konnte das Spiel der Muskeln unter seiner Haut sehen. An den Unterarmen, am Hals und im Gesicht war er braun gebrannt, aber Brust und Bauch hatten eine blasse, fast milchweiße Farbe.
Wir waren auch noch nicht in die Phase eingetreten, in der jeder einfach seine Sachen auszieht, ordentlich zusammenfaltet und dann routinemäßig über einen Stuhl legt. Als wir in meiner Wohnung ankamen – aus irgendeinem Grund landeten wir immer in meiner Wohnung –, hatten wir es nach wie vor ziemlich eilig, einander in die Finger zu kriegen. Verglichen damit, erschien alles andere nicht mehr so wichtig. Wenn meine Schüler beim Nachmittagsunterricht besonders zappelig waren und mich die Hitze müde und lustlos machte, dachte ich manchmal an Fred und den vor uns liegenden Abend, was meine Stimmung sofort besserte.
Hinterher zündeten wir uns eine Zigarette an. Während wir in dem kleinen Schlafzimmer lagen und Musik hörten, hupten unten auf der Straße die Autos. Jemand schrie: »Du miese Schlampe, das zahl ich dir heim!« Wir lauschten den Schritten auf dem Gehsteig. Irgendwo kreischte eine Frau. Ich hatte mich inzwischen mehr oder weniger an solche Geräusche gewöhnt. Zumindest hielt es mich nachts nicht mehr vom Schlafen ab.
Fred schaltete die Nachttischlampe an und erhellte damit die ganze triste, schäbige Hässlichkeit meiner Wohnung. Wie hatte ich sie bloß kaufen können, und wie sollte ich es jemals schaffen, sie wieder loszuwerden? Ich hatte versucht, sie ein wenig schöner zu gestalten – die billigen orangenfarbenen Vorhänge ausgemustert, die mir der Vorbesitzer zurückgelassen hatte, einen Teppich über die schmuddeligen Dielenbretter gelegt, Tapeten über den beigen Raufaserverputz geklebt, die abgeblätterten Fensterrahmen gestrichen und die Wände mit Spiegeln und Drucken geschmückt –, aber keine noch so geschickte Raumgestaltung konnte kaschieren, wie eng und dunkel alles war. Irgendein Makler hatte den ohnehin schon knapp bemessenen Raum noch weiter zerstückelt, um dieses Loch von einer Wohnung zu schaffen. Das Fenster im so genannten Wohnzimmer war durch die Trennwand zweigeteilt, und auf der anderen Seite hörte ich manchmal einen Nachbarn, den ich nie zu Gesicht bekommen hatte, Obszönitäten schreien, die einer armen Frau galten. Aus lauter Kummer, Einsamkeit und dem Bedürfnis nach einem Ort, den ich mein Zuhause nennen konnte, hatte ich das ganze Geld, das mir mein Vater hinterlassen hatte, für diese Wohnung ausgegeben. Dabei hatte sie sich nie wirklich wie ein Zuhause angefühlt, und nun, da die Immobilienpreise in Schwindel erregende Höhen geschossen waren, brachte ich sie nicht mehr los. Bei diesem Wetter hätte ich jeden Tag die Fenster putzen können, und sie wären abends trotzdem schon wieder schmutzig gewesen.
»Ich mache uns eine Tasse Tee«, meinte Fred.
»Ich habe keine Milch mehr.«
»Hast du Bier im Kühlschrank?«, fragte er hoffnungsvoll.
»Nein.«
»Was hast du denn?«
»Müsli, glaube ich.«
»Was hilft einem Müsli, wenn man keine Milch hat?«
Das war eher eine Feststellung als eine Frage. Die geschäftsmäßige Art, mit der er in seine Hose schlüpfte, kannte ich bereits. Gleich würde er mir ein Küsschen auf die Wange drücken und gehen. Zweck des Besuchs erledigt.
»Als Snack ist es ganz in Ordnung«, antwortete ich vage. »Wie Chips.«
Ich musste an die Frau denken, die der Handtaschendieb überfallen hatte – die Art, wie ihr Körper durch die Luft geflogen war: wie eine zerbrochene Puppe, die jemand aus dem Fenster geschleudert hatte.
»Morgen«, sagte er.
»Ja.«
»Mit den Jungs.«
»Aber klar doch.«
Ich setzte mich im Bett auf und betrachtete den Stapel Hausaufgaben, den ich noch korrigieren musste.
»Schlaf gut. Hier liegen übrigens ein paar Briefe, die du noch nicht aufgemacht hast.«
Das erste war eine Rechnung. Nachdem ich einen Blick darauf geworfen hatte, legte ich sie auf den Tisch zu den anderen Rechnungen. Das andere war ein Brief, verfasst in einer großen, schwungvollen Schrift:
Liebe Miss Haratounian, aus Ihrem Namen schließe ich, dass Sie keine gebürtige Engländerin sind, auch wenn Sie auf den Fotos, die ich gesehen habe, ziemlich englisch aussehen. Selbstverständlich bin ich kein Rassist und zähle zu meinen Freunden viele wie Sie, aber…
Ich legte den Brief auf den Tisch und rieb mir die Schläfen. Verdammt. Ein Verrückter. Das hatte mir gerade noch gefehlt.
3. KAPITEL
Ich wurde von der Türklingel geweckt. Erst dachte ich, dass sich jemand einen Scherz erlaubte oder ein Betrunkener die Haustür mit dem Eingang seiner Unterkunft verwechselt hatte. Ich zog im vorderen Zimmer die Vorhänge ein wenig auseinander und drückte mein Gesicht gegen die Scheibe, aber der Winkel reichte nicht. Ein rascher Blick auf die Uhr sagte mir, dass es erst kurz nach sieben war. Ich konnte mir beim besten Willen nicht vorstellen, wer mich um diese Zeit besuchen sollte. Da ich nichts anhatte, schlüpfte ich schnell in meinen knallgelben Plastikregenmantel, bevor ich nach unten ging.
Ich machte die Tür nur einen Spalt weit auf. Der Vordereingang des Gebäudes geht direkt auf die Holloway Road hinaus, und ich wollte mit meinem Aussehen am frühen Morgen nicht den Verkehr zum Erliegen bringen. Zu meinem Entsetzen war es der Postbote. Wenn der Postbote einem die Post persönlich überreichen möchte, ist das in der Regel kein gutes Zeichen. Meist will er dann, dass man eine Bestätigung über den Erhalt einer schrecklichen, ganz in Rot gedruckten Rechnung unterschreibt, in der sie damit drohen, einem das Telefon abzuschalten.
Wider Erwarten machte er einen recht fröhlichen Eindruck. Draußen schien es noch einigermaßen kühl zu sein, obwohl der Tag bestimmt wieder sehr heiß werden würde. Diesen Postboten kannte ich noch nicht, sodass ich nicht sagen konnte, ob er schon länger so herumlief oder ob sein Outfit neu war. Jedenfalls trug er recht kleidsame blaue Shorts und ein frisches hellblaues Kurzarmhemd. Offenbar handelte es sich dabei um die offizielle Sommerkleidung, aber bei ihm sah es richtig flott aus. Er war nicht mehr ganz jung, hatte aber etwas von einem Baywatch-Postboten. Deswegen machte ich die Tür etwas weiter auf und betrachtete ihn mit einem interessierten Blick, den er mit einer gewissen Neugier erwiderte. Mir wurde bewusst, dass mein Regenmantel ziemlich knapp saß und in der Mitte ein wenig auseinanderklaffte. Ich zog ihn fester um meinen Körper, was die Sache nur noch schlimmer machte. Allmählich kam mir das Ganze vor wie eine Szene aus einer dieser schmierigen britischen Sexkomödien aus den frühen Siebzigern, die manchmal am Freitag Abend laufen, wenn man nach dem Pubbesuch noch den Fernseher einschaltet. Pornos für arme Schweine.
»Wohnung C?«
»Ja.«
»Post für Sie«, sagte er. »Es passt nicht alles durch den Briefschlitz.«
Da hatte er allerdings Recht. Er war mit Unmengen von unterschiedlich großen Umschlägen beladen, die zu mehreren Stapeln gebündelt und von Gummis zusammengehalten wurden. Erlaubte sich da jemand einen Scherz mit mir? Es war gar nicht so leicht, die vielen Bündel mit einem Arm entgegenzunehmen und gleichzeitig mit dem anderen den Regenmantel zuzuhalten.
»Darf man zum Geburtstag gratulieren?«, fragte er augenzwinkernd.
»Nein«, antwortete ich und schob die Tür mit meinem nackten Fuß zu.
Ich trug die Briefe nach oben und kippte sie auf den Wohnzimmertisch. Als Erstes griff ich nach einem fliederfarbenen Umschlag und riss ihn auf, wusste aber eigentlich schon vorher, worum es sich handelte. Dank meinem Urgroßvater oder Ururgroßvater, der vor hundert Jahren mit nichts als einem Joghurtrezept aus Armenien ausgewandert ist, bin ich im Telefonbuch sehr leicht zu finden. Hätte er nicht wie die meisten anderen Einwanderer seinen Namen ändern können? Ich las den Brief.
Liebe Zoë Haratounian,
heute Morgen habe ich in der Zeitung von Ihrer Heldentat gelesen. Gestatten Sie mir bitte, Ihnen als Erstes zu dem Mut zu gratulieren, den Sie bewiesen haben, indem Sie auf diesen Menschen losgegangen sind. Wenn ich Ihre Geduld noch ein wenig länger in Anspruch nehmen darf…
Ich überflog die Seite und blätterte um. Insgesamt waren es fünf Briefbogen, und Janet Eagleton (Mrs.) hatte jeweils beide Seiten des Blattes mit grüner Tinte beschrieben. Ich beschloss, mir diesen Brief für später aufzusparen, und öffnete stattdessen einen Umschlag, der einen normaleren Eindruck machte.
Liebe Zoë,
herzlichen Glückwunsch. Sie haben sich großartig verhalten, und wenn mehr Leute so handeln würden wie Sie, dann wäre London ein Ort, an dem es sich besser leben ließe. Außerdem fand ich Sie auf dem Zeitungsfoto sehr hübsch, und das ist der eigentliche Grund, warum ich Ihnen schreibe. Mein Name ist James Gunter, ich bin fünfundzwanzig, und ich glaube, ich sehe recht passabel aus, aber es ist mir bisher nicht gelungen, das richtige Mädchen kennen zu lernen, Miss »Right«, wenn Sie so wollen…
Ich faltete den Brief zusammen, legte ihn auf den von Mrs. Eagleton und öffnete einen anderen Brief, der eher aussah wie ein Päckchen. In dem Umschlag steckte ein Bündel von Blättern, die halb gefaltet, halb zusammengerollt waren. Ich sah Diagramme, Pfeile, spaltenförmig angeordneten Text. Immerhin begann das Ganze auf der ersten Seite wie ein an mich gerichteter Brief.
Liebe Miss Haratounian!
(Ein interessanter Name. Sind Sie vielleicht eine Nachfahrin Zarathustras? Lassen Sie es mich wissen! [Postfachanschrift siehe unten.] Ich werde weiter unten noch genauer auf dieses Thema [Zarathustra] zu sprechen kommen.)
Sie sind in der Lage, sich gegen die Mächte der Dunkelheit zu wehren, aber wie Sie sicher wissen, gibt es andere Mächte, denen man nicht so leicht widerstehen kann. Wissen Sie, was das englische Wort »kunderbuffer« bedeutet? Wenn ja, können Sie das Folgende überspringen und mit einem Abschnitt beginnen, den ich aus Gründen der Übersichtlichkeit mit einem Sternchen versehen werde. Anbei eines zu Demonstrationszwecken (*). Den als markiert angekündigten Abschnitt werde ich nun mit zwei (2) Sternchen versehen, um unnötige Verwirrung zu vermeiden.
Nachdem ich den Brief auf den von James Gunter gelegt hatte, ging ich ins Bad und wusch mir die Hände, was aber nicht viel half. Ich brauchte eine Dusche. Leider war meine Wohnung in dieser Hinsicht ebenfalls beschissen ausgestattet. Eigentlich mochte ich nämlich Duschen mit Türen aus mattiertem Glas, in denen man aufrecht stehen konnte. Ich war mal mit einem Typen zusammen gewesen, dessen einzig positive Eigenschaft im Nachhinein betrachtet darin bestanden hatte, dass er im Besitz einer Powerdusche mit sechs verschiedenen Düsen war, von der normalen über dem Kopf mal ganz abgesehen. In meiner Wohnung dagegen bedeutete Duschen, dass man sich in die Badewanne kauern und mit uralten, ausgeleierten Wasserhähnen herumärgern musste oder im Eifer des Gefechts den Duschschlauch so sehr verdrehte, dass kein Wasser mehr kam. Trotzdem legte ich mich mehrere Minuten mit einem Waschlappen über dem Gesicht in die Wanne und ließ Wasser einlaufen. Es war, als würde ich unter einer warmen, nassen Decke liegen.
Hinterher schlüpfte ich in meine Arbeitsklamotten, machte mir eine Tasse Kaffee und zündete mir eine Zigarette an. Es ging mir schon ein bisschen besser. Viel besser wäre es mir gegangen, wenn sich der Stapel mit den Briefen inzwischen in Luft aufgelöst hätte, aber er lag noch immer auf dem Tisch. All diese Leute wussten, wo ich wohnte. Na ja, nicht alle. Bei einer weiteren schnellen Durchsicht der Briefe stellte sich heraus, dass sie zum Teil von den Zeitungen, an welche die Absender sie ursprünglich geschickt hatten, an mich weitergeleitet worden waren. Wenigstens beschränkten die Leute sich aufs Schreiben, dachte ich, anstatt mich anzurufen oder gar bei mir vorbeizuschauen.
In dem Moment klingelte das Telefon. Ich zuckte erschrocken zusammen. Zu meiner großen Erleichterung war es kein Fan, sondern Guy, der Immobilienmakler, der angeblich versuchte, meine Wohnung zu verkaufen.
»Ein paar Leute möchten sich die Wohnung ansehen.«
»Schön«, sagte ich. »Sie haben ja den Schlüssel. Was ist mit dem Paar, das am Montag hier war?« Ich hatte mir in ihrem Fall keine wirklichen Hoffnungen gemacht. Der Typ hatte ziemlich grimmig gewirkt, während die Frau sich nett mit mir unterhielt, wenn auch nicht über die Wohnung.
»Sie waren von der Lage nicht so angetan«, antwortete Guy in forsch-fröhlichem Ton. »Außerdem fanden sie die Wohnung ein bisschen zu klein. Und sie meinten, sie müssten zu viel Arbeit reinstecken. Insgesamt waren sie nicht so begeistert.«
»Die Leute heute sollten nicht allzu spät kommen. Ich habe ein paar Freunde auf einen Drink eingeladen.«
»Was gibt es denn zu feiern? Ihren Geburtstag?«
Ich holte tief Luft. »Wollen Sie das wirklich wissen, Guy?«
»Na ja…«
»Ich feiere ein Fest, weil diese Wohnung nun schon geschlagene sechs Monate zum Verkauf steht.«
»Das ist nicht Ihr Ernst, oder?«
»O doch!«
»Es kommt mir gar nicht vor wie sechs Monate.«
Es dauerte eine Weile, bis ich ihn davon überzeugt hatte, dass dem tatsächlich so war. Nachdem wir unser Gespräch beendet hatten, blickte ich mich ziemlich verzweifelt um. Wildfremde Menschen würden vorbeikommen und sich diesen Raum ansehen. Als ich nach London gezogen war, hatte mir meine Tante ein Buch geschenkt, Praktische Tipps für Heim und Haushalt. Es enthielt unter anderem Ratschläge, wie man seine Wohnung in nur fünfzehn Minuten aufräumte. Aber was, wenn man bloß eine Minute zur Verfügung hatte? Ich machte mein Bett, rückte den Teppich vor der Tür gerade, spülte meine Kaffeetasse aus und stellte sie ordentlich mit der Öffnung nach unten auf das Abtropfbrett. Dann zog ich aus einem Schrank eine Pappschachtel heraus, kippte die ganzen Briefe hinein und schob sie unters Bett. Das alles dauerte eineinhalb Minuten, was bedeutete, dass ich mal wieder zu spät in die Schule kommen würde. Zu spät und schweißgebadet. Dabei fing der Tag doch gerade erst an, heiß zu werden.
»So, meine Liebe, was können wir tun, damit du deine Behausung schneller an den Mann bringst?«
Louise stand mit einer Bierflasche am Fenster und gestikulierte mit ihrer Zigarette auf die Holloway Road hinaus.
»Das ist ganz einfach«, antwortete ich. »Als Erstes muss die Straße weg, dann das Pub und das Kebab House. Anschließend wird renoviert. Es ist eine fürchterliche Wohnung, oder? Ich habe sie von Anfang an gehasst, kaum dass sie mir gehört hat, und selbst wenn ich dabei Geld verliere, ich muss hier endlich raus. Ich möchte mir eine gemütliche kleine Wohnung mit einem Garten kaufen, irgendwas in der Art. Angeblich befinden wir uns ja gerade mitten in einem Immobilienboom. Da muss es da draußen doch irgendeinen Irren geben, der dieses Loch hier haben möchte.« Ich zog an meiner Zigarette. »Zugegeben, es waren schon eine Menge Irre da, die sie sich angesehen haben. Jetzt muss ich nur noch die richtige Sorte Irren finden.«
Louise lachte. Sie war ein bisschen früher gekommen, um mir bei den Vorbereitungen zu helfen und dabei mal wieder so richtig zu plaudern. Sie war einfach ein lieber Kerl.
»Aber ich bin nicht so weit gefahren, um mit dir über Immobilien zu reden. Erzähl mir von dem neuen Mann in deinem Leben. Kommt er heute?«
»Sie kommen alle.«
»Was meinst du mit alle? Hast du denn mehr als einen?«
Ich kicherte.
»Nein, aber er zieht mit einer ganzen Gang von Freunden rum. Ich glaube, sie kennen sich schon seit der ersten Klasse, wenn nicht gar seit dem Kindergarten. Sie sind wie ein Six-Pack Bier. Du weißt schon, nicht einzeln erhältlich.«
Louise runzelte die Stirn.
»Wir sprechen hier aber nicht zufällig von einem flotten Fünfer oder irgend so was Seltsamem? Falls doch, möchte ich sämtliche Details wissen.«
»Nein, hin und wieder lassen sie uns allein.«
»Wie habt ihr euch kennen gelernt?«
Ich zündete mir eine neue Zigarette an.
»Ich habe sie alle zusammen kennen gelernt. Vor ein paar Wochen, auf einer Party drüben in Shoreditch. Das Ganze war eine dieser klassischen Katastrophen. Wie sich nämlich herausstellte, war der einzige Typ, den ich kannte, nicht da. Deswegen wanderte ich mit meinem Drink von Raum zu Raum und tat so, als wäre ich unterwegs zu einem unheimlich wichtigen Gespräch. Du weißt, wovon ich rede?«
»In dieser Disziplin bin ich Weltmeisterin«, antwortete Louise.
»Jedenfalls ging ich nach oben in den ersten Stock, wo ich auf eine Gruppe von gut aussehenden jungen Männern stieß, die auf einen Flipperautomaten einhämmerten und sich dabei köstlich amüsierten. Einer von ihnen – nicht Fred – fragte mich, ob ich mitspielen wolle. Also spielte ich mit. Wir hatten eine Menge Spaß und verabredeten uns für den nächsten Abend in der Stadt.«
Louise sah mich nachdenklich an.
»Dann hast du also vor der schwierigen Wahl gestanden, mit welchem von ihnen du dich allein treffen solltest?«
»Ganz so schwierig war es nicht«, antwortete ich. »Einen Tag nach unserem gemeinsamen Abend in der Stadt rief mich Fred zu Hause an und fragte mich, ob ich Lust hätte, mit ihm auszugehen. Als ich mich erkundigte, ob er dazu die Erlaubnis seiner Kumpel hätte, war ihm das ziemlich peinlich.« Ich lehnte mich ein Stück weiter aus dem Fenster. »Da sind sie ja schon.«
Louise spähte ebenfalls hinaus. Sie waren ein Stück entfernt und hatten uns noch nicht bemerkt.
»Sie sehen recht nett aus«, meinte Louise.
»Fred ist der in der Mitte, mit der großen Tasche. Der mit dem hellbraunen, fast blonden Haar.«
»Dann hast du dir ja den hübschesten gekrallt.«
»Der mit dem langen Mantel ist Duncan.«
»Wie kann er bei dieser Hitze einen langen Mantel tragen?«
»Angeblich ähnelt er damit einem Revolverhelden aus einem Italo-Western. Er zieht das Ding nie aus. Die beiden anderen sind Brüder. Die Burnside-Brüder. Der mit der Brille und dem Käppi ist Graham, der mit den langen Haaren Morris. Hi!« Letzteres galt den Jungs unten auf der Straße.
Überrascht sahen sie zu uns hoch.
»Wir würden ja gern raufkommen«, rief Duncan, »aber leider müssen wir zu einer Party!«
»Idiot!«, gab ich zurück. »Hier, fangt!«
Ich ließ meinen Schlüsselbund fallen. Graham riss sich mit einer raschen Bewegung, die bemerkenswert graziös wirkte, die Kappe vom Kopf und fing den Schlüssel damit auf. Nachdem die Jungs die Tür aufgesperrt hatten, verschwanden sie aus unserem Blickfeld.
»Schnell«, sagte Louise. »Uns bleiben lediglich dreißig Sekunden. Welchen von ihnen soll ich heiraten? Welcher ist die beste Partie? Fred kannst du vorerst mal weglassen.«
Ich dachte zwei Sekunden nach.
»Graham arbeitet bei einem Fotografen.«
»Weiter.«
»Duncan und Morris arbeiten zusammen. Sie machen alles Mögliche mit Computern. Ganz genau bin ich noch nicht dahinter gestiegen, aber ich glaube, sie erwarten auch gar nicht, dass ich es kapiere. Duncan ist der Mittelpunkt jeder Party. Morris hingegen ist ziemlich schüchtern, wenn man ihn mal allein erwischt.«
»Das sind die beiden Brüder, richtig?«
»Nein, Morris ist der Bruder von Graham. Duncan hat rotes Haar. Er sieht völlig anders aus.«
»Alles klar. Spontan würde ich sagen, dass die Computertypen viel versprechender klingen. Morris, der schüchterne Bruder, und Duncan, der redselige Rotschopf.«
Als ich den Jungs von der geplanten Party erzählt hatte, hatten sie sich sofort lautstark erkundigt, welche Frauen kommen würden, aber jetzt in meiner Wohnung warteten sie ruhig und höflich, bis ich ihnen Louise vorgestellt hatte. Das mochte ich irgendwie an ihnen.
Fred kam zu mir herüber und gab mir einen langen Kuss. Ich hatte den starken Verdacht, dass es sich dabei in erster Linie um eine Demonstration für alle Anwesenden handelte. Wollte er mir damit wirklich seine Zuneigung zeigen oder bloß sein Territorium abstecken? Nachdem er mich geküsst hatte, zog er etwas heraus, das aussah wie ein bunter Vorhang.
»Ich habe mir gedacht, das kannst du vielleicht brauchen, um es über den feuchten Fleck zu hängen.«
»Danke, Fred.« Skeptisch beäugte ich das knallige Ding. Die Farbkomposition war ein bisschen gewagt. »Ich fürchte, Leute, die eine Wohnung besichtigen, dürfen Vorhänge und Ähnliches wegschieben.«
»Na, dann lass uns die Sache doch mal begutachten. Komm schon, häng es auf.«
»Also gut.«
»Zoë behauptet, ihr seid Computergenies«, sagte Louise gerade zu Duncan.
Morris, der daneben stand, wurde ein bisschen rot, was ich richtig süß fand.
»Sie hat nur deswegen eine so hohe Meinung von uns«, antwortete Duncan, »weil sie sich selbst nicht besonders damit auskennt. Wir haben ihr lediglich beigebracht, ihren eigenen Computer zu benutzen.« Er nahm einen Schluck aus seinem Glas.
»Das war zugegebenermaßen eine beeindruckende Leistung von uns. Es war, als würde man einem Eichhörnchen beibringen, wie man Nüsse sucht.«
»Eichhörnchen sind doch hervorragend im Nüssesuchen«, wandte Morris ein.
»Stimmt«, antwortete Duncan.
»Aber sie können es von selbst, man braucht es ihnen nicht erst beizubringen«, meinte Morris beharrlich.
»Stimmt. Zoë beherrscht ihren Computer jetzt so gut wie ein Eichhörnchen das Nüssesuchen.«
»Aber dann hättest du sagen müssen, dass es war, als würde man einem Eichhörnchen das Jonglieren beibringen.«
Duncan starrte ihn verblüfft an.
»Es ist doch gar nicht möglich, einem Eichhörnchen das Jonglieren beizubringen!«
Ich schenkte Louise nach.
»Das kann stundenlang so weitergehen«, erklärte ich. »Es muss etwas damit zu tun haben, dass sie schon zusammen im Sandkasten gespielt haben.«
Ich ging in die Küche, um ein paar Chips zu holen, und Louise folgte mir. Wir konnten die Jungs im Wohnzimmer sehen.
»Das ist ja ein richtig Hübscher«, sagte sie mit einer Kopfbewegung in Freds Richtung. »Was raucht er da? Er wirkt so relaxed. Irgendwie exotisch.«
»Er hat manchmal was von einem Hippie. Relaxed trifft es aber auch recht gut.«
»Ist das mit euch beiden was Ernstes?«
Ich nahm einen Schluck aus ihrem Glas. »Das kann ich dir noch nicht sagen«, antwortete ich.
Ein paar andere Gäste trafen ein: John, ein netter Lehrer aus unserer Schule, der mich leider ein paar Tage zu spät gefragt hatte, ob ich mit ihm ausgehen wolle, und ein paar Frauen, die ich durch Louise kennen gelernt hatte. Das Ganze entwickelte sich zu einer richtigen kleinen Feier. Nach ein paar Drinks begann ich, für diesen neuen Kreis von Leuten ein warmes, herzliches Gefühl zu empfinden. Das Einzige, was sie verband, war ich. Ein Jahr zuvor hatte ich mich noch einsam und verloren gefühlt und keinen einzigen von ihnen gekannt. Plötzlich war ein klirrendes Geräusch zu hören. Fred klopfte mit einer Gabel gegen eine Flasche.
»Ruhe, ich bitte um Ruhe!«, rief er, obwohl sowieso schon alle still waren. »Ich bin es nicht gewohnt, lange Reden zu schwingen et cetera, et cetera. Deshalb möchte ich nur für einen Moment das Wort ergreifen und zum Ausdruck bringen, wie sehr ich diese Wohnung mag. Ich möchte, dass wir alle das Glas erheben – in der Hoffnung, dass es uns allen vergönnt sein wird, in sechs Monaten wieder hier zusammenzukommen und einen weiteren schönen Abend miteinander zu verbringen.« Rundherum wurden Gläser und Flaschen gehoben. Ein Blitzlicht erhellte mein Gesicht. Einer von Grahams typischen Schnappschüssen. Damit musste man bei ihm ständig rechnen: Während man gemütlich mit ihm plauderte, riss er plötzlich die Kamera hoch und machte ein Foto. Das konnte ziemlich nervtötend sein – als würde er während der ganzen Zeit, die er mit einem sprach oder zuhörte, in Wirklichkeit bloß auf die Gelegenheit zu einer guten Aufnahme warten. »Außerdem«, fuhr Fred fort, »haben Zoë und ich noch einen Grund zum Feiern.« Alle starrten ihn überrascht an, nicht zuletzt ich selbst. »Ja«, meinte er, »es ist nun genau neun Tage her, seit Zoë und ich uns zum ersten Mal… ähm…«, er legte eine Pause ein, »… ähm… begegnet sind.« Hinter mir war das unterdrückte Lachen von Duncan und Graham zu hören, alle anderen aber schwiegen. Einen Moment lang hatte ich das Gefühl, bei einem offiziellen Dinner des Rugby-Clubs gelandet zu sein.
»Fred«, begann ich, aber er brachte mich mit einer Handbewegung zum Schweigen.
»Einen Moment noch«, sagte er. »Es wäre traurig, wenn ein solcher Abend nicht auf besonders feierliche Weise zelebriert würde, aber… was haben wir denn da?« Er sagte das in einem Ton gespielter Überraschung, während er sich hinunterbeugte und hinter meinem Sessel herumkramte. Er zog ein großes, mit braunem Papier umwickeltes Päckchen hervor. »Entweder haben wir es hier mit einer weiteren Gabe von einem von Zoës anonymen Fans zu tun, oder aber es handelt sich um ein Geschenk.«
»Ihr Idioten«, sagte ich, aber in liebevollem Ton. Das Format des Päckchens deutete auf ein Bild hin, aber nachdem ich es aus seiner Umhüllung befreit hatte, sah ich, was es in Wirklichkeit war. »Ihr Mistkerle!«, meinte ich lachend. Sie hatten eine ganze Seite der Sun eingerahmt, auf der oben die Schlagzeile »Ich und meine Melone« prangte und darunter in kleinerer Schrift: »Beherzte Blondine schlägt Handtaschenräuber k.o.«
»Eine Rede!«, rief Louise, die die Hände wie einen Trichter um den Mund gelegt hatte. »Eine Rede!«
»Also«, begann ich, wurde aber von der Haustürklingel unterbrochen. »Augenblick«, sagte ich. »Bin gleich wieder da.«
Der Mann, der vor der Tür stand, trug einen braunen Kordanzug und Gummistiefel.
»Ich würde mir gern die Wohnung ansehen«, erklärte er. »Passt es Ihnen?«
»Ja, ja«, antwortete ich schnell. »Kommen Sie ruhig rauf.«
Die Stimmen meiner Gäste drangen bis ins Treppenhaus.
»Bei Ihnen steigt wohl gerade eine Party«, bemerkte der Mann.
»Ja. Ich habe Geburtstag.«
4. KAPITEL
Mit der Zeit wurden die Briefe weniger. Die anfängliche Flut verwandelte sich in ein Tröpfeln und hörte dann ganz auf. Eine Weile hatte ich das Ganze sogar lustig gefunden. Einmal nahm ich ein paar von den Briefen mit, als ich mich mit Fred und den Jungs traf. Wir saßen vor einer Bar in Soho, tranken eiskaltes Bier, tauschten die Briefe untereinander aus und lasen uns besonders schöne Passagen laut vor. Während Morris und Duncan anschließend mal wieder eines ihrer abstrusen Gespräche führten, unterhielt ich mich mit Graham und Fred ein wenig ernster über die Angelegenheit.
»Man muss sich das mal vorstellen. Diese Leute sitzen in ganz England herum und schreiben achtseitige Briefe an jemanden, den sie überhaupt nicht kennen. Sie schlagen meinen Namen einfach im Telefonbuch nach und kaufen sich eine Briefmarke. Wissen die mit ihrem Leben denn nichts Besseres anzufangen?«
»Nein, offenbar nicht«, antwortete Fred. Er legte mir die Hand aufs Knie. »Du bist eine Göttin. Du und deine Melone. Wir alle hier haben dich schon vorher gern gehabt, aber jetzt bist du eine Männerphantasie. Diese starke, schöne Frau. Wir Kerle wünschen uns doch alle, dass eine Frau wie du mit hohen Absätzen auf unserem Körper herumspaziert.« Dann beugte er sich zu mir und flüsterte mir mit seinem warmen Atem ins Ohr: »Und du gehörst mir allein!«
»Hör auf«, sagte ich. »Ich finde das nicht lustig.«
»Jetzt weißt du, wie es ist, berühmt zu sein«, meinte Graham. »Genieße es, solange du noch kannst.«
»Mein Gott, hat denn kein Mensch Mitleid mit mir? Morris, hast du mir vielleicht was Nettes zu sagen?«
»Ja«, sagte Fred. »Schieß los, Morris. Welchen Rat würdest du einer schönen Frau geben, die sich mit den Schattenseiten des Ruhms herumschlagen muss?«
Mit diesen Worten lehnte er sich zu Morris hinüber und versetzte ihm mehrere sanfte Klapse auf die Wange. Die Jungs schafften es immer wieder, mich zu überraschen. Es war, als würden sie Rituale aus einer fremden, exotischen Welt vollziehen, die ich nicht verstand. Einer von ihnen tat oder sagte etwas zu einem der anderen, und ich wusste nie so genau, ob es ein Scherz war oder eine Beleidigung oder vielleicht eine scherzhaft gemeinte Beleidigung, ob das Opfer lachen oder in Rage geraten würde. Fred beispielsweise schien nie etwas Nettes zu Morris zu sagen, sprach aber manchmal von ihm als seinem besten Freund.
Nun schwiegen plötzlich alle, und ich spürte, wie sich mein Magen verkrampfte. Alle Blicke waren auf Morris gerichtet, der sich blinzelnd mit den Fingern durchs Haar fuhr. Ich hatte immer den Verdacht, dass er das nur tat, um zu demonstrieren, wie beeindruckend lang und dicht es war.
»Wer kann mir zehn Filme nennen, in denen Briefe vorkommen?«, fragte er.
»Morris!«, rief ich wütend.
»Brief einer Unbekannten«, antwortete Graham.
»Ein Brief an drei Frauen«, sagte Duncan.
»Der verhängnisvolle Brief.« Dieser Beitrag kam von Fred.
»Das ist zu einfach«, meinte Morris. »Zehn Filme, in denen Briefe vorkommen, das Wort ›Brief‹ aber nicht im Titel auftaucht.«
»Wie zum Beispiel?«
»Na ja… zum Beispiel Casablanca.«
»Da kommen keine Briefe vor.«
»Doch.«
»Nein.«
Das ernste Gespräch war vorüber.
Von da an sparte ich es mir meist, die Briefe überhaupt zu lesen. Bei manchen erkannte ich bereits die Schrift auf dem Umschlag, sodass ich mir gar nicht erst die Mühe machte, sie zu öffnen. Andere überflog ich flüchtig, bevor ich sie zu den anderen in die Pappschachtel warf. Ich fand sie nicht mal mehr lustig. Ein paar waren traurig, ein paar obszön, die meisten einfach langweilig.
Wenn ich das Bedürfnis hatte, mir den Wahnsinn um mich herum ins Gedächtnis zu rufen, brauchte ich bloß hin und wieder aus meinem Fenster zu schauen, dessen Rahmen langsam vor sich hin rotteten. Dann sah ich junge Männer in verbeulten Autos, die Hand auf der Hupe, das Gesicht rot vor Zorn. Einsame alte Frauen, die auf ihre fahrbaren Einkaufskörbe gelehnt durch die Menge stolperten und dabei leise vor sich hin murmelten. Die nach Pisse und Whisky stinkenden Penner, die in ihren schmutzigen, nicht richtig zugeknöpften Hosen im Eingang des mit Brettern verrammelten Ladens ein paar Türen weiter saßen und den Frauen schräge, lüsterne Blicke zuwarfen.