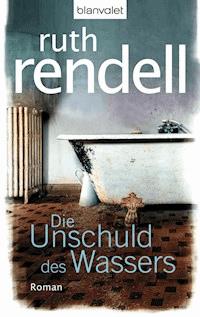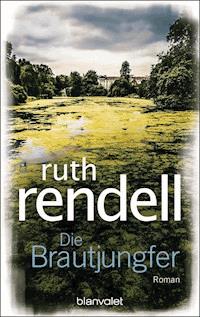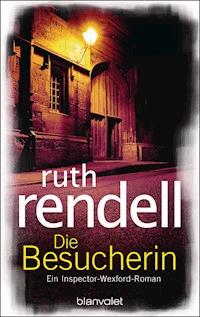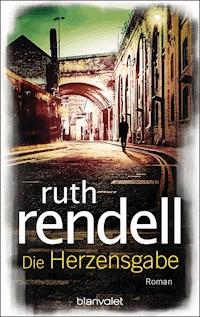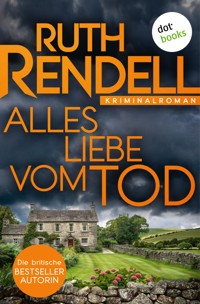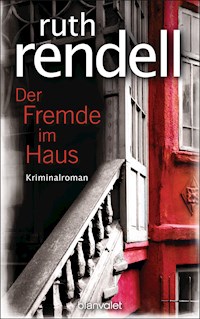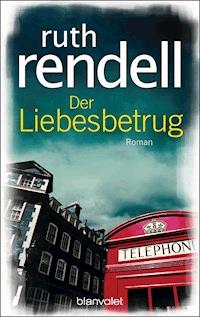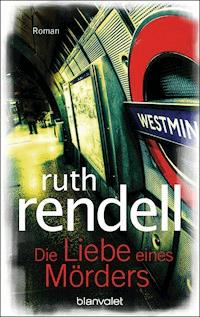2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Blanvalet Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Teddy und Francine sind weltfremde Einzelgänger. Teddy wuchs im Londoner Vorstadtmilieu ohne Wärme und Nähe auf. Seine Eltern interessierten sich nie für ihn, der Einzige, der sich mit ihm beschäftigte, war ein Nachbar. In dessen Werkschuppen entdeckte Teddy seine Liebe zu Holz und wurde zu einem hochbegabten Schreiner. Francine wiederum musste als Siebenjährige den Mord an ihrer Mutter mit ansehen. Seither lebt sie wie unter einer Glasglocke, abgeschnitten von der Welt – bis sie Teddy begegnet und sich in ihn verliebt. Auch Teddy entwickelt schnell Gefühle für die schöne junge Frau, und bald wird klar: Er, der nie etwas Eigenes besessen hat, muss Francine besitzen – selbst wenn er dafür morden muss …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 652
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
Ruth Rendell
Der Sonderling
Buch
Teddy und Francine sind weltfremde Einzelgänger. Teddy wuchs im Londoner Vorstadtmilieu ohne Wärme und Nähe auf. Seine Eltern interessierten sich nie für ihn, der Einzige, der sich mit ihm beschäftigte, war ein Nachbar. In dessen Werkschuppen entdeckte Teddy seine Liebe zu Holz und wurde zu einem hochbegabten Schreiner. Francine wiederum musste als Siebenjährige den Mord an ihrer Mutter mit ansehen. Seither lebt sie wie unter einer Glasglocke, abgeschnitten von der Welt – bis sie Teddy begegnet und sich in ihn verliebt. Auch Teddy entwickelt schnell Gefühle für die schöne junge Frau, und bald wird klar: Er, der nie etwas Eigenes besessen hat, muss Francine besitzen – selbst wenn er dafür morden muss …
Autorin
Ruth Rendell wurde 1930 in South Woodford/London geboren. Zunächst arbeitete sie als Journalistin, bevor sie sich ganz dem Schreiben von Romanen widmete. Dreimal bereits erhielt sie den Edgar-Allan-Poe-Preis und zweimal den Golden Dagger Award. 1997 wurde sie mit dem Grand Master Award der Crime Writer‘s Association of America, dem renommiertesten Krimipreis, ausgezeichnet und darüber hinaus von Königin Elizabeth II. in den Adelsstand erhoben. Ruth Rendell, die auch unter dem Pseudonym Barbara Vine bekannt ist, lebt in London.
Die Reihenfolge der Inspector-Wexford-Romane sowie weitere Romane finden Sie hier.
Ruth Rendell
Der Sonderling
Roman
Aus dem Englischen von Cornelia C. Walter
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen. Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen. Die Originalausgabe erschien 1997 unter dem Titel A Sight for Sore Eyes bei Random House (UK), London.
E-Book-Ausgabe 2015
bei Blanvalet, einem Unternehmen der
Verlagsgruppe Random House GmbH, München
Copyright © der Originalausgabe 1997 by Kingsmarkham Enterprises Ldt.
Copyright © der deutschsprachigen Ausgabe 1999 by Blanvalet Verlag, München, in der Verlagsgruppe Random House GmbH, Neumarkter Str. 28, 81673 München.
Umschlaggestaltung: www.buerosued.de
Umschlagmotiv: Arcangel Images/Stephen Mulcahey
Satz: EDV-Fotosatz Huber/Verlagsservice G. Pfeifer, Germering
ISBN: 978-3-641-15142-3V002
www.blanvalet.de
Wieder für Don
1
_____
Sie sollten sich an den Händen halten und einander ansehen. Einander tief in die Augen schauen.
»Das ist doch kein Porträtsitzen«, meinte sie, »das ist ja Porträtstehen. Warum darf ich mich nicht auf sein Knie setzen?«
Er lachte. Alles, was sie sagte, fand er amüsant oder entzückend, alles an ihr fesselte ihn, von ihren dunkelroten Locken bis hinunter zu den zierlichen weißen Füßen. Den Anweisungen des Malers folgend, sollte er sie verliebt ansehen und sie ihn wie hingerissen. Das war leicht, es kam ganz von selbst.
»Dummes Zeug, Harriet«, sagte Simon Alpheton. »Allein die Vorstellung! Kennt ihr eigentlich Rembrandts Gemälde Die jüdische Braut?«
Sie verneinten. Simon beschrieb es ihnen, während er seine Vorskizze zu zeichnen begann. »Es ist ein sehr zärtliches Bild, es drückt die beschützende Liebe des Mannes zu seiner jungen, demutsvollen Braut aus. Sie sind offensichtlich wohlhabend, sehr reich gekleidet, doch man sieht ihnen an, dass sie empfindsam und nachdenklich sind. Und verliebt.«
»Wie wir. Reich und verliebt. Sehen wir ihnen ähnlich?«
»Nicht im geringsten. Ich glaube auch kaum, dass ihr das wolltet. Das Schönheitsideal hat sich seither geändert.«
»Du könntest es doch ›Die rothaarige Braut‹ nennen.«
»Sie ist aber nicht deine Braut. Ich werde es ›Marc und Harriet in Orcadia Place‹ nennen – wie sonst? Und jetzt hör bitte auf zu reden, Marc, ja?«
Das Haus, vor dem sie standen, wurde von Kennern als Cottage im georgianischen Stil bezeichnet; es war aus der Sorte roter Backsteinziegel gebaut, deren Farbe man gewöhnlich als warm bezeichnet. Um diese Jahreszeit – es war Hochsommer – war das Mauerwerk allerdings fast völlig unter dem dichten Blätterkleid des wilden Weins verschwunden, dessen grüne, glänzende Blätter in der sanften Brise leicht zitterten. Die gesamte Außenfläche des Hauses schien zu beben und zu rascheln; sie wirkte wie eine senkrechte, grüne See, die der Wind zu kleinen Wellen kräuselte.
Simon Alpheton mochte Mauern – Backsteinmauern, Flintsteinmauern, Natursteinmauern und auch Bretterwände. Für das Bild von Come Hither hatte er sämtliche Mitglieder dieser Popgruppe draußen vor dem Aufnahmestudio in der Hanging Sword Alley vor einer Betonmauer platziert, die über und über mit Plakaten beklebt war. Kaum hatte er gesehen, dass es an Marcs Haus eine Mauer voll Laub gab, wollte er sie ebenfalls malen, natürlich mit Marc und Harriet davor: die Mauer als glänzende Kaskade in zahlreichen Grüntönen, Marc im dunkelblauen Anzug mit weißem Hemd und schmaler schwarzer Krawatte, und Harriet ganz in Rot.
Wenn der Herbst kam, würden diese Blätter den gleichen Farbton wie ihr Haar und ihr Kleid annehmen. Dann würden sie allmählich zu Gold und dann Hellgelb verblassen, abfallen und als lästiges Ärgernis die gesamte, von Hecken umgebene gepflasterte Fläche und den Hof hinter dem Haus zentimetertief bedecken. Die Ziegelmauern des Hauses mit dem wahrscheinlich unechten Fachwerk an manchen Stellen kämen wieder zum Vorschein, bis im Frühjahr 1966 hellgrüne Schösslinge sprossen und der Laubkreislauf wieder von neuem begann. Diese Gedanken gingen Simon durch den Kopf, während er Blätter und Haare und gefältelte Seide malte.
»Lass das«, sagte er, als Marc sich zu Harriet hinüberbeugte, um sie zu küssen, ihre Hand dabei weiter festhielt und sie an sich zog. »Kannst du sie nicht mal fünf Minuten in Ruhe lassen?«
»Schwierig, Mann, schwierig.«
»Zärtlichkeit will ich einfangen, nicht Lust. Verstanden?«
»Jetzt ist mir der Fuß eingeschlafen«, sagte Harriet. »Können wir mal Pause machen, Simon?«
»Noch fünf Minuten. Denk nicht an deinen Fuß. Schau Marc an und denk dran, wie verliebt du in ihn bist.«
Sie sah zu ihm hoch, und er sah zu ihr herunter. Er hielt ihre Linke in seiner Rechten, ihre Augen trafen sich zu einem langen Blick, und so malte Simon Alpheton sie und hielt sie im Vorgarten von Orcadia Cottage fest, wenn nicht für die Ewigkeit, so doch für lange, lange Zeit.
»Vielleicht kaufe ich es«, meinte Harriet später mit einem anerkennenden Blick auf das Abbild ihres Gesichts und ihrer Gestalt.
»Womit denn?« Marc küsste sie. Seine Stimme war sanft, seine Worte waren es nicht. »Du hast doch kein Geld.«
Wenn Simon Alpheton später an diesen Tag zurückdachte, meinte er, dies sei der Anfang vom Ende gewesen, als der Wurm in der Knospe sein hässliches Gesicht und seinen zuckenden Körper inmitten der Blumen zeigte.
2
_____
An einem kalten Samstag unternahmen Jimmy Brex und Eileen Tawton eine Busreise nach Broadstairs. Das war im Sommer des Jahres 1966. Es war das erste Mal, dass die beiden so einen Ausflug zusammen machten. Ihre sonstigen Aktivitäten – Eileen nannte es »sich den Hof machen«, und Jimmy hatte gar keinen Ausdruck dafür – bestanden darin, ins White Rose and Lion zu gehen, und gelegentlich schaute Jimmy bei Eileens Mutter zum Abendbrot vorbei. Doch dann bekam das Pub einen neuen Pächter, und für die Stammgäste wurden an den Wochenenden Veranstaltungen organisiert. Eine davon war der Ausflug nach Broadstairs.
Es regnete. Ein scharfer Nordwind brauste die Küstenstreifen von Suffolk, Essex und Kent entlang, bevor er irgendwo auf den Kanalinseln schließlich zum Erliegen kam. Jimmy und Eileen saßen unter einem Unterstand am Wasser und aßen ihre mitgebrachten Sandwiches. Sie kauften Zuckerstangen und schauten in einem vergeblichen Versuch, die französische Küste zu erspähen, durch ein Fernrohr. Am späten Nachmittag beschlossen sie, etwas Richtiges zu essen, und betraten Popplewell’s Restaurant mit Meerblick.
Wie die meisten Restaurants und Cafés damals hatte das Lokal keine Schankkonzession, und Jimmy verzehrte sich nach einem Drink. Er musste mit Tee vorliebnehmen, denn die Kneipen machten erst um halb sechs auf. Als sie ihre Eier mit Pommes frites, Erbsen und Pilzen, ihren Apfelkuchen mit Vanillesauce und ein paar Scheiben Dundee-Kuchen aufgegessen hatten, war immer noch eine halbe Stunde herumzubringen. Während Jimmy noch eine Kanne Tee bestellte, ging Eileen auf die Damentoilette.
Es war ein winziges, fensterloses und – wie damals üblich, verschmuddeltes – Kabuff mit nacktem Betonboden und einer einzigen Kabine. Ein Waschbecken hing – gefährlich locker – an der Wand, aber Seife, Handtuch oder Papiertücher gab es nicht und natürlich auch keinen Händetrockner. Aus einem Wasserhahn tropfte es. Als eine Frau aus der Kabine kam, konnte Eileen hineingehen. Sie hörte, wie draußen das Wasser lief, und dann hörte sie, wie die Tür zuging.
Eileen hatte nicht die Absicht, sich die Hände zu waschen. Sie hatte sie heute Morgen vor der Abfahrt gewaschen, und im Übrigen gab es ja sowieso keine Handtücher. Doch sie warf einen kurzen Blick in den angeschlagenen Spiegel, zupfte ihr Haar ein wenig zurecht, schürzte die Lippen und konnte dabei schwerlich vermeiden, dass ihr Blick auf die kleine Ablage unter dem Spiegel fiel. In deren Mitte lag ein Brillantring.
Die Frau, die gerade vorhin hier gewesen war, musste ihn zum Händewaschen abgelegt und dann vergessen haben. Da konnte man doch wieder mal sehen, wozu übertriebener Wascheifer führte. Eileen war an der Frau nichts weiter aufgefallen, außer dass sie mittleren Alters war und einen Regenmantel trug. Sie betrachtete den Ring. Dann nahm sie ihn in die Hand.
Selbst für jemanden, der sich absolut nicht damit auskennt oder keinen Sinn für guten Schmuck hat, ist ein Brillantring sofort als solcher erkennbar. Bei diesem hier handelte es sich um einen Solitär, bei dem auf jeder Seite ein Saphir eingelassen war. Eileen steckte ihn sich an den rechten Ringfinger. Er passte wie angegossen.
Mit dem Ring am Finger hineinzuspazieren wäre keine gute Idee. Sie steckte ihn in ihre Handtasche. Jimmy saß da und wartete auf sie und rauchte gerade die dreißigste Zigarette an diesem Tag. Er gab ihr auch eine, und dann gingen sie zum Anchor hinüber, wo er für sich ein Bier und für sie ein Glas Cidre bestellte. Nach einer Weile öffnete sie ihre Tasche und zeigte ihm den Brillantring.
Auf die Idee, den Ring ins Restaurant zurückzubringen, ihn dem Geschäftsführer zu geben oder damit zur Polizei zu gehen, kam keiner der beiden. Wer was findet, darf’s behalten. Doch andere Ideen kamen ihnen durchaus in den Sinn. Eigentlich war es ein und dieselbe Idee. Eileen steckte sich den Ring wieder an, diesmal jedoch an den linken Ringfinger, und hielt die Hand hoch, um ihn Jimmy vorzuführen. Wieso sollte sie ihn wieder ablegen? Obwohl sie es nicht laut sagte, übertrug sich ihr Gedanke irgendwie auf ihn.
Er besorgte sich noch ein Bier und dazu eine Tüte Kartoffelchips und sagte, als er wieder an den Tisch trat: »Behalt ihn doch gleich an.«
»Meinst du?« Ihre Stimme klang unsicher. Sie spürte den Ernst der Situation. Es war ein erhabener Augenblick.
»Verloben wir uns eben«, meinte Jimmy.
Eileen nickte, lächelte aber nicht. Ihr Herz klopfte heftig.
»Wenn es dir recht ist.«
»Ich hab’ mir das schon länger überlegt«, sagte Jimmy. »Hab’ auch daran gedacht, dir einen Ring zu kaufen. Ich hab’ nicht damit gerechnet, dass der jetzt hier auftaucht. Ich hol’ mir noch was zu trinken. Willst du noch einen Cidre?«
»Warum nicht?« sagte Eileen. »Also, feiern wir – warum eigentlich nicht? Gib mir noch’ ne Kippe, ja?«
Eigentlich hatte Jimmy bis zu diesem Augenblick überhaupt nicht an Verlobung gedacht. Er hatte keinerlei Absicht zu heiraten. Wieso auch? Seine Mutter versorgte ihn und seinen Bruder. Sie war erst achtundfünfzig und hatte noch viele Jahre vor sich. Doch die Entdeckung des Rings war eine Gelegenheit, die man sich nicht entgehen lassen durfte. Angenommen, er hätte nichts getan und Eileen den Ring einfach behalten lassen. Wenn er dann eines Tages beschlossen hätte, sich doch zu verloben, hätte er ihr einen Ring kaufen müssen, und zwar einen neuen. Außerdem war verlobt nur verlobt und konnte sich jahrelang hinziehen; es hieß ja nicht, dass man gleich morgen heiraten musste.
Eileen war in Jimmy nicht verliebt. Hätte sie darüber nachgedacht, so hätte sie wahrscheinlich gesagt, sie mochte ihn ganz gut leiden. Sie mochte ihn lieber als die anderen Männer, die sie kannte, aber eigentlich kannte sie gar keine anderen. Kein Mann verirrte sich je in das Wollgeschäft, in dem sie Miss Harvey, der Besitzerin, zur Hand ging und einer ältlichen, weiblichen Kundschaft doppelfädige, kuschelweiche Wolle verkaufte. Jimmy hatte sie kennengelernt, als er mit seinem Chef gekommen war, um Miss Harveys Wohnung oben zu streichen und ein neues Waschbecken einzubauen. Das war vor fünf Jahren gewesen.
Obwohl sie Rechtshänderin war, bediente Eileen ihre Kundinnen während der nächsten Wochen mit der linken Hand; oft hielt sie sie sich ans Kinn, um den bisweilen im Licht aufblitzenden Brillanten vorzuführen. Er wurde ausgiebig bewundert. Sie ging mit Jimmy weiterhin ins Pub, und er kam weiterhin zum Abendbrot zu Mrs. Tawton. Dann hatte Eileen ihren fünfunddreißigsten Geburtstag. Sie fuhren noch auf mehrere vom White Rose and Lion organisierte Ausflüge mit, entweder zu zweit oder mit Mrs. Tawton und ihrer Freundin Gladys.
Wenn Eileen manchmal das Thema Heirat ansprach, sagte Jimmy jedes Mal: »Wir haben uns doch gerade erst verlobt«, oder »Das können wir uns in ein paar Jahren immer noch überlegen.« Außerdem würden sie sich niemals eine eigene Wohnung leisten können. Sie hatte nicht vor, zu ihrer Mutter zu ziehen, und zu seiner auch nicht. Ihre Beziehung war nicht sexueller Natur. Obwohl er sie manchmal küsste, hatte Jimmy nie angedeutet, dass er mehr wollte, und Eileen redete sich ein, sie hätte in dem Fall sowieso nicht eingewilligt, und respektierte ihn dafür, dass er es nicht von ihr verlangte. Das konnten sie sich in ein paar Jahren immer noch überlegen.
Dann starb Jimmys Mutter. Sie fiel auf der Straße tot um, in jeder Hand eine vollbepackte Einkaufstasche. Brotlaibe, Halbpfundpäckchen Butter, Kekspackungen, große Cheddarstücke, Orangen, Bananen, Speck, zwei Hähnchen, Konservendosen mit Bohnen und Spaghetti in Tomatensauce kullerten über den Gehweg oder fielen in den Rinnstein. Betty Brex war einem schweren Schlaganfall erlegen.
Ihre beiden Söhne hatten von Geburt an im Haus gewohnt, und keiner kam auf den Gedanken auszuziehen. Als nun niemand mehr da war, um sie zu versorgen, fand Jimmy es an der Zeit zu heiraten. Schließlich war er schon fünf Jahre verlobt. An diese Tatsache erinnerte ihn der Ring, den Eileen tagein, tagaus trug. So viel Glück, einen Ehering auf der Damentoilette zu finden, würde sie wohl nicht haben, doch zum Glück hatte er den, den er seiner toten Mutter vom Finger gezogen hatte. Auf dem Standesamt in Burnt Oak heirateten sie.
Das Brexsche Haus war eine kleine, zweistöckige Doppelhaushälfte mit oben und unten je zwei Zimmern, einem kleinen Bad und einer Küche. Außen war es gipsverputzt und ockergelb gestrichen und lag inmitten ganzer Reihen solcher Häuser in der Nähe der North Circular Road in Neasden. Als Eckhaus hatte es von der Straße her eine Zufahrt zum Garten, und dort stellte Keith Brex immer seinen Wagen ab, der dann den Großteil der verfügbaren Fläche einnahm. Eigentlich war es eine Abfolge von Autos, wobei es sich zum Zeitpunkt der Vermählung seines Bruders um einen rotsilbernen Studebaker mit Heckflossen handelte.
Keith war älter als Jimmy und nicht verheiratet. An Frauen oder jeglicher Spielart von Sex nicht interessiert, Nichtleser und Nichtsportler, war ihm im Grunde alles gleichgültig außer Trinken und Autos. Dabei interessierte er sich nicht so sehr dafür, sie zu fahren, als an ihnen herumzubasteln, sie auseinanderzunehmen und wieder zusammenzusetzen. Sie zu putzen und zu polieren und zu bewundern. Vor dem Studebaker hatte er einen Pontiac gehabt und davor einen Dodge.
Für den täglichen Gebrauch und um zur Arbeit zu fahren hatte er ein Motorrad. Wenn sein Auto perfekt hergerichtet war und nur so glänzte, holte er es heraus und fuhr auf der North Circular Road nach Brent Cross, den Hendon Way hinauf, die Station Road hinunter und den Broadway entlang wieder zurück. Und wenn der Klub der Studebaker-Eigner ein Rennen veranstaltete, nahmen er und sein Auto immer teil. Eine Ausfahrt mit dem Auto bedeutete immer, vorher den Motor auseinander- und wieder zusammenzubauen. Er war wie sein Bruder im Baugewerbe tätig, und so hatte er den Garten hinter dem Haus schon vor langer Zeit zubetoniert, um dort den Wagen und das Motorrad abzustellen. Nur ein winziges, grünes Rechteck mit Gras, Löwenzahn und Disteln hatte er als »Rasen« stehenlassen.
Als ihre Mutter, und früher auch ihr Vater, noch am Leben gewesen waren, hatten sich die Brüder Brex ein Schlafzimmer geteilt. Dort hatte sich Jimmy abends, während Keith an seinem Auto herumwerkelte, unter Zuhilfenahme des Penthouse-Magazins um seine sexuellen Bedürfnisse gekümmert. Jetzt, wo er dort ausgezogen und in Betty Brex’ ehemaliges Zimmer übersiedelt war, hatte eine weitere Veränderung zu erfolgen. Jimmy, der sich nie groß Gedanken machte, nahm an, es ließe sich ganz einfach bewerkstelligen. Im Endeffekt dauerte es dann etwa ein Jahr und war für Jimmy nie so befriedigend wie seine früheren Phantasie-Affären mit den Nacktstars. Was Eileen betraf, so akzeptierte sie ihr Los und hatte nichts dagegen einzuwenden. Es tat ja nicht weh. Es wurde einem nicht kalt oder schlecht davon. Man tat es eben, wenn man verheiratet war. Wie man staubsaugte und einkaufte und kochte und abends die Hintertür abschloss.
Und – natürlich – ein Baby bekam.
Eileen war zweiundvierzig. Aufgrund ihres Alters war sie gar nicht auf die Idee gekommen, sie könnte schwanger sein. Sie war nicht die erste, die es für die Wechseljahre hielt. Außerdem wusste sie nicht sehr viel über Sex und noch weniger über Fortpflanzung und hatte von Mutter und Tanten einige seltsame Vorstellungen aufgeschnappt. Eine davon besagte, dass zur Fortpflanzung häufige, üppige und sich stetig steigernde Ejakulationen nötig waren, dass man also eine Menge von dem Zeug in sich aufnehmen musste, bevor es überhaupt Wirkung zeigte. Darin glich es der Grecian-2000-Kur, die Keith auf sein ergrauendes Haar auftrug und die nur bei wiederholter Anwendung wirkte.
In ihrer Ehe waren die Anwendungen schon anfangs selten gewesen und fielen immer spärlicher aus. Deshalb glaubte sie auch dann noch nicht, sie sei schwanger, als sie zunahm und einen dicken Bauch bekam. Jimmy bemerkte natürlich überhaupt nichts. Mrs. Chance von nebenan war es, die sich erkundigte, wann es denn soweit wäre. Eileens Mutter merkte es sofort – sie hatte sie zwei Monate nicht gesehen – und äußerte die Meinung, mit dem Baby würde wegen des Alters ihrer Tochter dann sicher »etwas nicht stimmen«. Damals redete noch niemand vom Down-Syndrom, und Agnes Tawton sagte, das Kind würde bestimmt mongoloid.
Eileen – wie übrigens die anderen auch – ging nie zum Arzt und hatte auch nicht vor, jetzt damit anzufangen. Sie war der festen Überzeugung, wenn man etwas ignorierte, verschwand es von selbst, und deshalb ignorierte sie ihre auseinandergehende Gestalt und gab sich ihren Essgelüsten hin. Sie entwickelte geradezu eine Leidenschaft für Donuts und Croissants, die damals neu auf dem Markt waren, und paffte etwa vierzig bis fünfzig Zigaretten am Tag.
Es war in den siebziger Jahren, als der Ausdruck »den eigenen Körper spüren« gerade aufkam. Eileen spürte ihren Körper überhaupt nicht, sie betrachtete ihn nie im Spiegel und achtete außer bei echten Schmerzen nicht auf seine Empfindungen. Doch diese Schmerzen waren etwas völlig anderes. Eileen hatte so etwas noch nie erlebt, sie hörten überhaupt nicht mehr auf und verschlimmerten sich zusehends, so dass sie gar nicht anders konnte, als ihren Körper zu spüren. Natürlich besaß die Familie Brex kein Telefon, und es wäre ihnen auch nicht eingefallen, eins anzuschaffen; als Eileen schon tief in den Wehen lag, wurde daher Keith losgeschickt, um den Arzt zu Hilfe zu rufen. Er fuhr im Studebaker hin, es war nämlich zufällig gerade Zeit für die zweiwöchentliche Ausfahrt.
Dass Jimmy gefahren wäre, kam gar nicht in Frage. Er sagte, das Ganze sei doch ein Sturm im Wasserglas. Außerdem hatte er gerade einen neuen Fernseher gekauft, den ersten in Farbe, und wollte sich die Tennismeisterschaften in Wimbledon ansehen. Ein Arzt kam, wutschnaubend, und traute seinen Augen nicht, als er Eileen kettenrauchend mit geplatzter Fruchtblase daliegen sah. Dann kam eine Hebamme. Die gesamte Familie Brex wurde mit scharfen Worten zurechtgewiesen, und die Hebamme schaltete eigenhändig den Fernseher ab.
Das Baby, ein achteinhalb Pfund schwerer Junge, wurde um zehn Uhr abends geboren. Entgegen Mrs. Tawtons Prophezeiungen war mit ihm alles in Ordnung. Jedenfalls das, was sie gemeint hatte. Die Dinge, die bei ihm nicht stimmten, reagierten damals nicht auf Tests und tun es größtenteils auch heute noch nicht. Jedenfalls kommt es darauf an, welcher Schule man angehört: Natur und Veranlagung oder Umgebung und Erziehung. In den siebziger Jahren meinten alle, die nur ein wenig Bescheid wussten, der Charakter eines Menschen und sein Temperament seien einzig und allein das Resultat seiner frühkindlichen Umgebung und Konditionierung. Freud war unbestritten die Nummer Eins.
Es war ein hübsches Baby. Während es in ihr herangereift war, hatte sich seine Mutter von gebutterten Croissants, Donuts mit Schlagsahne, Salami, durchwachsenem Speck, gebratenen Eiern, Schokoladenriegeln, Würstchen und Pommes frites mit sämtlichen Garnierungen ernährt. Sie hatte ungefähr zehntausendachthundert Zigaretten geraucht und literweise Guinness, Cidre, süßlichen Schaumwein und süßen Sherry getrunken. Trotzdem war es ein hübsches Kind mit glatter Pfirsichhaut, seidigem dunkelbraunem Haar, den Gesichtszügen eines Puttchens in einem Gemälde Alter Meister und wohlgestalteten Fingerchen und Zehen.
»Wie wollt ihr ihn denn nennen?« fragte Mrs. Tawton nach einigen Tagen.
»Er muss ja wohl einen Namen kriegen, oder?« sagte Eileen, als wäre die Namensgebung bei einem Kind zwar angebracht, aber absolut nicht zwingend erforderlich.
Weder sie noch Jimmy wussten irgendwelche Namen. Seinen und den von Keith und von Mr. Chance, dem Nachbarn, kannten sie, der hieß Alfred, und die Namen ihrer verstorbenen Väter, aber von denen gefiel ihnen keiner. Keith schlug vor, ihn Roger zu nennen, weil sein Saufkumpan so hieß, doch da Eileen diesen Roger nicht ausstehen konnte, wurde daraus nichts. Dann kam eine Nachbarin vorbei und brachte ein Geschenk für das Baby: einen kleinen weißen Teddybären mit Glöckchen an den Füßen und einem Band, an dem man ihn vom Kinderwagendach herunterhängen konnte.
Sowohl Agnes Tawton als auch Eileen waren ziemlich gerührt über dieses Geschenk, machten: »Aaah!« und nannten es süß.
»Teddy«, sagte Eileen zärtlich.
»Da habt ihr doch euren Namen«, sagte Keith. »Teddy. Oder abgekürzt – Edward!« Dann lachte er über seinen eigenen Witz, weil es sonst keiner tat.
3
_____
Keiner schenkte ihm je besondere Beachtung. Allerdings schenkten sie sich auch gegenseitig keine besondere Beachtung. Jeder schien in einer Art von nichtklinischem Autismus zu leben und sich völlig selbstbezogen ausschließlich um seinen eigenen Kram zu kümmern. Bei Keith waren es die Autos, bei Jimmy das Fernsehen. Und nachdem Eileen das Zeug jahrelang verkauft hatte, entwickelte sie geradezu eine Manie für Wolle und andere Garne, und da sie Stricken unbefriedigend fand, begann sie im großen Stil zu häkeln. Stundenlang häkelte sie vor sich hin und produzierte Flickendecken und Zierdeckchen, Tischdecken und Kleidungsstücke am laufenden Band.
Teddy schlief bei seinen Eltern im Zimmer, bis er vier war. Dann wurde er auf einem Feldbett bei seinem Onkel einquartiert. Als er klein war, wurde er stundenlang im Laufstall allein gelassen, und ein Weinen ignorierte man. Im Ignorieren waren Eileen und Jimmy wahre Meister. Essen war immer reichlich vorhanden, es gab üppige Mahlzeiten in Form von Fertiggerichten und Sachen vom Imbissstand; Teddy wurde also gut gefüttert. Da ununterbrochen der Fernseher lief, gab es immer etwas zu gucken. Nie knuddelte ihn jemand oder spielte und redete mit ihm. Als er fünf war, schickte ihn Eileen allein in die Schule. Die Schule lag keine fünfzig Meter vom Haus entfernt auf der gleichen Straßenseite, es war also nicht ganz so gefährlich und unverantwortlich, wie es sich anhören mag.
In seiner Klasse war er der größte und hübscheste Junge. Einen Teddy stellt man sich eigentlich rundlich und kräftig vor, mit rosigen Bäckchen, einem Lächeln im Gesicht, blauen Augen und braunen Locken. Teddy Brex war groß und schmal, hatte eine samtig schimmernde Haut, ganz dunkles Haar und Augen von einem klaren Haselnussbraun. Seine Stupsnase, der Rosenmund und der süße Gesichtsausdruck weckte in kinderlosen Frauen den Wunsch, ihn an sich zu reißen und heftig an den Busen zu drücken.
Er hätte sie ungehalten abgewehrt.
Mit sieben holte er sein Bett aus dem Zimmer seines Onkels heraus, ohne dass sich in diesem Schlafzimmer je etwas Unziemliches zugetragen hätte. Es hatte keine Begegnung mit Keith gegeben, nicht einmal verbaler Art. Sie hatten selten ein Wort miteinander gewechselt. Falls Teddy Brex in späteren Jahren mit einem Psychiater zu tun gehabt hätte, wäre selbst ein solcher Spezialist nicht in der Lage gewesen, bei ihm posttraumatische Belastungsstörungen zu diagnostizieren.
Teddy hatte lediglich etwas gegen die fehlende Privatsphäre und das schreckliche Geschnarche seines Onkels. Das wässrige Glucksen und Bellen schien das ganze Zimmer zum Wackeln zu bringen, es hörte sich an, als ob Wasser aus zehn Badewannen dröhnend in den Abfluss rauschte, nachdem jemand gleichzeitig alle Stöpsel herausgezogen hatte. Und der Rauch, den Rauch fand er unerträglich. Obwohl er daran gewöhnt war und ihn sozusagen mit der Milchflasche aufgesogen hatte, war es in dem kleinen Schlafzimmer noch schlimmer und die Luft kaum zum Atmen, wenn Keith nachts um halb eins seine letzte und morgens um sechs seine erste schlauchte.
Er schaffte das Feldbett eigenhändig hinaus. Keith war auf der Arbeit und installierte gerade in einem neuen Wohnblock in Brent Cross die sanitären Anlagen. Jimmy war auf der Arbeit und trug in Edgware gerade Ziegelsteine huckepack eine Leiter hoch. Eileen saß im Wohnzimmer und führte gekonnt fünf Tätigkeiten gleichzeitig aus: eine Zigarette rauchen, eine Dose Cola trinken, einen Crunchie-Riegel essen, fernsehen und einen Poncho in den Farbtönen Flammenrot und Limonengrün, Königsblau und Fuchsienpink häkeln. Teddy bugsierte das Bett die Treppe hinunter und machte dabei einen Höllenlärm, weil er noch zu schwach war, um es hochheben zu können. Falls Eileen das Bett die Stufen hinunterpoltern hörte, ließ sie es sich nicht anmerken.
Das Esszimmer wurde nie benutzt, nicht einmal an Weihnachten. Es war sehr klein und mit einem viktorianischen Tisch aus Mahagoniholz, sechs Stühlen und einem Büfett möbliert. Es gab kaum genug Platz, sich hineinzudrücken, geschweige denn sich an den Tisch zu setzen. Alles war mit einer dicken Staubschicht bedeckt, und wenn man an den bodenlangen Samtvorhängen von undefinierbarer Farbe zupfte, zog der Staub wie Rauchschwaden hervor. Doch weil nie jemand diesen Raum betrat, roch es dort etwas weniger nach Rauch als überall sonst im Haus.
Schon damals, schon mit sieben, fand Teddy die Möbel scheußlich. Er betrachtete sie voller Neugier: die drüsenartig geschwollenen Auswölbungen, mit denen die Beine verziert waren, die Messingfüße, die wie Löwentatzen mit Hühneraugen aussahen. Die Sitzflächen der Stühle waren mit schwarzbraun gesprenkeltem Kunstleder bespannt, einer Art Vorläufer von Plastik. Das Büfett mit seinen Holzregalen und den Säulchen mit Blätterknäufen, den kleinen Fächern und geschnitzten Paneelen, den eingelassenen Spiegelstreifen und den grünen Glasscheiben war dermaßen hässlich, dass er glaubte, man würde das große Fürchten bekommen, wenn man zu lange hinschaute oder wenn man im Halbdunkel oder in der Dämmerung aufwachte und die Seitenwände und Türmchen und Höhlungen sah, die sich wie das Hexenschloss im Märchen bedrohlich aus dem Schatten erhoben.
Davor musste man sich hüten. Er malte mit dem Zeigefinger Muster in den Staub auf den Stühlen und schrieb die beiden schmutzigen Ausdrücke, die er kannte, auf die Tischfläche. Dann stapelte er vier von den Stühlen aufeinander, immer Sitz auf Sitz und Beine gegen Lehne, und hievte die beiden restlichen auf das Büfett, um den grausigen Anblick zu verdecken und Platz für sein Bett zu schaffen.
Keith merkte es zwar, sagte aber nichts und kam nur manchmal ins Esszimmer, um eine Zigarette zu rauchen und ein bisschen an Teddy hinzureden, statt mit ihm zu reden – über sein Auto oder dass er vorhatte, ins Wettbüro zu gehen. Wahrscheinlich wussten weder Eileen noch Jimmy, wo ihr Sohn nächtigte. Eileen stellte den Poncho fertig, zog ihn zum Einkaufen an und begann mit ihrem bis dahin ehrgeizigsten Unterfangen, einem bodenlangen Mantel in Scharlachrot und Schwarz, mit Kutscherkragen und Kapuze. Jimmy fiel von der Leiter, verletzte sich den Rücken und gab seine Arbeit auf, um auf Stütze zu gehen. Davon sollte er nie wieder wegkommen und nie wieder arbeiten. Keith tauschte den Studebaker in ein blaugrünes Lincoln-Kabriolett um.
In der Nachbarschaft hieß es, Teddy Brex ginge zu den Nachbarn, weil er zu Hause vernachlässigt wurde. Er suche, hieß es, nach Zuwendung, Umarmungen und Zärtlichkeit, die eine kinderlose Frau wie Margaret Chance ihm geben würde. Auch nach Unterhaltung und dass sich jemand für ihn und das, was er in der Schule machte, interessierte, vielleicht auch nach einem reinlichen Haus und richtigen warmen Mahlzeiten. Die Leute zerrissen sich heftig das Maul über die Familie Brex, diese Autos, den arbeitslosen Jimmy, Eileens extravagante Garderobe und dass sie in der Öffentlichkeit rauchte.
Doch sie irrten sich. Dass er vernachlässigt wurde, mochte stimmen, obwohl er immer genug zu essen bekam und nie geschlagen wurde, doch er hatte gar kein Verlangen nach Zärtlichkeit. Er hatte nie welche bekommen und wusste gar nicht, was das war. Das mochte der Grund dafür sein, oder vielleicht war er auch einfach so auf die Welt gekommen. Er war eigentlich recht selbstgenügsam. Er ging zu den Nachbarn und brachte dort viele Stunden zu, weil das Haus voller schöner Sachen war und weil Alfred Chance in seiner Werkstatt schöne Sachen herstellte. So machte Teddy im Alter von acht Jahren die Bekanntschaft von Schönheit.
Auf dem Gartenstück, auf dem Keith Brex drüben den grünen Lincoln abstellte, hatte Alfred Chance hier seine Werkstatt. Er hatte sie sich vor etwa dreißig Jahren selbst gebaut und bewahrte darin seine Werkbank und sein Handwerkszeug auf, denn Alfred Chance war Schreiner und Tischler und in besonderen Fällen auch einmal Steinmetz. Das erste Beispiel seiner zahlreichen Fertigkeiten, das Teddy sah, war ein Grabstein, in den er die Buchstaben eingemeißelt hatte.
Der Grabstein war aus dunkelgrauem, glitzerndem Granit, die Schrift tief eingemeißelt und schwarz. »Der Tod ist Schlusspunkt und End’ der Sünde«, las Teddy, »Horizont und Isthmus zwischen diesem Leben und dem Besseren«. Natürlich hatte er keine Ahnung, was es bedeutete, doch die handwerkliche Arbeit gefiel ihm sehr. »Muss schwer sein, die Buchstaben so hinzukriegen«, sagte er.
Mr. Chance nickte.
»Find’ ich schön, dass die Buchstaben nicht in Gold sind.«
»Bravo! Neunundneunzig Prozent der Leute hätten lieber Gold. Woher weißt du, dass Schwarz besser passt?«
»Weiß nicht«, erwiderte Teddy.
»Mir scheint, du hast ein angeborenes Stilgefühl.«
In der Werkstatt roch es nach frisch gehobeltem Holz, ein scharfer, organischer Geruch. Ein halbfertiger, aus blondem Eschenholz geschnitzter Engel lehnte an der Wand. Mr. Chance nahm Teddy mit ins Haus und zeigte ihm die Möbel. Es war nicht das erste Haus außerhalb des Brexschen Heims, in dem Teddy gewesen war, denn gelegentlich besuchte er seine Großmutter Tawton und war nachmittags auch schon ein paarmal bei Schulkameraden zu einem Imbiss gewesen. Doch es war das erste Haus, das nicht mit spätviktorianischen Erbstücken, im Obstkistenschick oder à la Parker Knoll eingerichtet war.
Im Brexschen Haus gab es keine Bücher, hier standen dagegen volle Bücherschränke mit Glastüren und gedrechselten Pilastern, vorgelagertem Mittelteil und Ziergiebelchen. Der Schreibtisch im Wohnzimmer war ein Wunderwerk mit winzigen Schubladen, und ein ovaler, dunkler Holztisch, der wie ein Spiegel glänzte, hatte Intarsien in Form von Blüten und Blättern aus hellem, ebenfalls schimmerndem Holz. Ein Schränkchen auf wohlgeformten Füßen hatte bemalte Türen, und auf jede Tür waren Früchte gemalt, die aus einer kunstvoll geschnitzten Schale quollen.
»Eine wahre Augenweide ist das«, sagte Mr. Chance.
Falls es unpassend war, diese ganze Pracht in einer unscheinbaren kleinen Doppelhaushälfte im Norden von London aufzubewahren, war es Teddy jedenfalls nicht bewusst. Er war bewegt und begeistert von dem, was er sah. Doch es war nicht seine Art, Enthusiasmus zu zeigen, und mit der Bemerkung über die Buchstaben hatte er sich schon bis ans Äußerste vorgewagt. Er bedachte jedes Möbelstück mit einem Nicken und fuhr mit dem Finger behutsam über die Früchte auf der Tür des Schränkchens.
Mrs. Chance fragte ihn, ob er gern ein Plätzchen hätte.
»Nein«, sagte Teddy.
Niemand hatte ihm beigebracht, danke zu sagen. Niemand vermisste ihn, während er bei den Nachbarn war, oder schien seine Abwesenheit zu bemerken. Die Chances machten Ausflüge mit ihm. Sie zeigten ihm Madame Tussauds Wachsfigurenkabinett und den Buckingham-Palast, das Naturkundemuseum und das Victoria & Albert Museum. Seine Begeisterung für schöne Dinge und sein Interesse an allem gefiel ihnen, und sein Mangel an Manieren kümmerte sie herzlich wenig. Am Anfang verbot ihm Mr. Chance, die Säge oder das Stemmeisen anzufassen, ließ ihn in der Werkstatt aber zuschauen. Er durfte ihm die Werkzeuge halten, und nach ein paar Wochen erlaubte ihm Mr. Chance, ein Stück Holz glattzuhobeln, das für eine Türfüllung gedacht war. Um Ruhe brauchte man Teddy nicht zu bitten, da er sowieso kaum den Mund aufmachte. Es schien ihm auch nie langweilig zu werden, er jammerte nie und bat um nichts. Manchmal wollte Mr. Chance wissen, ob ihm eine Schnitzerei, die er gerade gemacht hatte, oder ein Entwurf, den er gerade gezeichnet hatte, gefielen, worauf Teddy fast jedes Mal mit »Ja« antwortete.
Doch gelegentlich kam auch ein kaltes, eindeutiges »Nein« wie damals, als er gefragt worden war, ob er gern ein Plätzchen hätte.
Teddy sah sich gern Mr. Chances Zeichnungen an, von denen einige in Rahmen die Wände des Hauses schmückten. Andere wurden in einer Mappe in der Werkstatt aufbewahrt. Es waren akribisch ausgeführte Zeichnungen, klar und sauber mit sicherer Hand angefertigt. Natürlich Schränke, Tische, Bücherregale und Schreibtische, aber gelegentlich – weil Mr. Chance Spaß daran hatte – auch Häuser. Es waren Häuser von der Art, wie er selbst gern eines besessen hätte, wenn er sich etwas Besseres als die Doppelhaushälfte neben den Brexes hätte leisten können. Kunsthandwerker, die schöne Möbel bauen, erlesene Lettern anfertigen und Tische bemalen, verdienen selten viel Geld. Das hatte Teddy im Alter von zehn Jahren inzwischen schon begriffen, und das war auch die Zeit, als Margaret Chance starb.
Damals war es noch nicht selbstverständlich, zur Mammographie zu gehen. Sie konnte den Knoten in ihrer linken Brust spüren, betastete die Stelle dann aber nie mehr und hoffte, wenn sie so tat, als gäbe es ihn nicht, würde er verschwinden. Der Krebs griff auf ihre Wirbelsäule über, und trotz der Strahlentherapie war sie ein halbes Jahr später tot.
Mr. Chance machte ihr einen Grabstein aus rosafarbenem Schottischem Granit, und diesmal war Teddy mit ihm der Meinung, dass es passend und geschmackvoll sei, die Buchstaben mit Silber auszufüllen. Doch die Worte »geliebte Frau« und eine Zeile über ein Wiedersehen bedeuteten ihm nichts. Er hatte Mr. Chance auch nichts Tröstliches zu sagen, ja er sagte überhaupt nichts zu ihm, er hatte Margaret Chance schon fast vergessen. Es sollte einige Zeit dauern, bis Alfred Chance wieder anfing zu arbeiten, und so hatte Teddy die Werkstatt für sich und konnte experimentieren, lernen und etwas Riskantes wagen.
Ein Brex ging nie zum Arzt. Teddy war nie gegen irgendetwas geimpft worden. Als er sich in der Werkstatt schnitt und Mr. Chance ihn mit dem Taxi ins Krankenhaus auf die Unfallstation brachte, gaben sie ihm als erstes eine Tetanusspritze. Teddy hatte noch nie eine Injektion bekommen, blieb aber still und gefügig, als die Nadel eindrang.
Falls es Jimmy und Eileen auffiel, äußerten sie sich nicht dazu. Die einzige, die etwas sagte, war Agnes Tawton. »Was hast du denn mit deiner Hand gemacht?«.
»Ich hab’ mir das oberste Stück vom Finger abgeschnitten«, erwiderte Teddy leichthin, als gestehe er einen kleinen Kratzer ein. »Mit dem Stemmeisen.«
Agnes Tawton war nach dem Einkaufen vorbeigekommen und traf ihren Enkel allein im Haus an. Sie war keine besonders einfühlsame und aufmerksame Frau und auch nicht sonderlich warmherzig. Auch machte sie sich nicht viel aus Kindern, doch irgendetwas an Teddys misslicher Lage beunruhigte sie. Ihr fiel auf, dass er oft allein war, sie hatte ihn auch noch nie mit einem Schokoladenriegel gesehen, einer Tüte Chips oder einer Dose Cola. Er besaß auch keine Spielsachen. Der Laufstall fiel ihr wieder ein, in dem er oft wie ein Stück Vieh eingesperrt gewesen war. Und mit einem für sie absolut untypischen, noch nie dagewesenen, phantastischen Gedankensprung – ihr wurde vor lauter Anstrengung ganz schwach – begriff sie auf einmal, dass eigentlich jede Mutter, deren Kind durch einen Unfall das oberste Fingerglied verloren hatte, es sofort ihrer Mutter erzählt hätte, sich ans Telefon gehängt hätte, womöglich unter Tränen. Hätte Eileen sich als Kind derartig verletzt, dann hätte sie, Agnes, es bestimmt allen erzählt.
Was war also zu tun? Sie durfte kein Theater machen, es Eileen und Jimmy sagen, das konnte sie nicht riskieren. Das wäre ja Einmischung, und sie mischte sich nie ein. Es gab nur eine Lösung. Sie hatte die Erfahrung gemacht, dass es immer die Antwort auf alles war. Geld machte glücklich, und wer etwas anderes behauptete, war ein Lügner. »Wie kommst du denn mit deinem Geld zurecht?«
»Geld?«
»Geben sie dir denn, na, du weißt schon – ein Taschengeld?«
Beide wussten, dass »sie« das nicht taten. Teddy schüttelte den Kopf. Er musterte die Gesichtszüge seiner Großmutter und überlegte, wie es wohl kam, dass sie ein vierfaches Kinn, aber keinen Hals hatte. Als sie sich vorbeugte, um den Verschluss ihrer großen, schwarzen Handtasche zu öffnen, verschmolz das Vierfachkinn wie bei einer Bulldogge mit ihrem Oberkörper.
Aus einer roten Lederbörse förderte sie eine Ein-PfundMünze zutage. »Da nimm«, sagte sie. »Das ist für diese Woche. Nächste Woche kriegst du wieder eine.«
Teddy nahm das Geldstück und nickte.
»Sag danke schön, du kleiner Teufel.«
»Danke«, sagte Teddy.
In Agnes regte sich die Vorstellung, nun sollte sie eigentlich die Arme um Teddy legen und ihn küssen. Doch das hatte sie noch nie getan, und jetzt war es zu spät, um damit anzufangen. Außerdem hatte sie eine Ahnung, er würde sie wegstoßen oder vielleicht sogar nach ihr schlagen. Also sagte sie nur: »Du musst es dir aber bei mir abholen. Ich kann doch nicht immer hierher rennen und nach deiner Pfeife tanzen.«
Keith, ein großer, schwerer Mann, sah dem verstorbenen David Lloyd George ähnlich – er hatte das gleiche eckige Gesicht, die breite Stirn, die gerade Nase, die weit auseinanderstehenden Augen und die wie Schmetterlingsflügel geschwungenen Augenbrauen wie dieser Staatsmann. Er hatte ziemlich langes, gelblichgraues Haar und einen hängenden, struppigen Schnurrbart. Wie Lloyd George hatte Keith in jungen Jahren recht gut ausgesehen, doch die Zeit und das viele Essen und Trinken hatten ihren Tribut gefordert, und mit seinen Fünfundfünfzig befand er sich mittlerweile in einem Zustand fortgeschrittenen Verfalls.
Bei seinem Anblick musste man unwillkürlich an eine halbgeschmolzene Kerze denken. Oder an eine in der Sonne vergessene Wachsfigur. Das Fleisch hing ihm in Kehllappen und Hautfalten vom Gesicht herunter. Es sah aus, als wäre es an seinem Hals hinuntergewabbelt und ihm von Schultern und Brustkorb gesackt, um sich schließlich in übereinanderliegenden Massen auf seinem Bauch zu sammeln. Seine Hosen oder Jeans trug er eng unter der enormen Wölbung seines kugelrunden Bauches gegürtet. Das Schmelzen, oder was auch immer mit ihm passiert war, hatte seine Arme und Beine zu dürren Stecken werden lassen. Sein gefärbtes, schütteres Haar hing ihm lang auf den Rücken hinunter, und neuerdings trug er es mit einem blauen Gummiband zu einem Pferdeschwanz zusammengebunden.
Als Teddy dann auf die Gesamtschule kam, war Eileen schon zu einer allseits bekannten Witzfigur geworden – sie ähnelte eher einer obdachlosen Pennerin als einer Hausfrau und Mutter eines Elfjährigen. Von Kopf bis Fuß in handgearbeitete, in allen Regenbogenfarben erstrahlende Wollsachen gekleidet – im wahrsten Sinne von Kopf bis Fuß, denn neben Kleidern und Umhängen häkelte sie auch Mützen und Schlappschuhe – und mit ihrem langen, grauen Haar, das sich unter der gestreiften Kappe hervor weit über ihre Schultern breitete, schlenderte sie kettenrauchend in die Läden, aus denen sie oft nur mit einem einzigen Artikel in ihrem gehäkelten Beutel heimkehrte. Dann musste sie noch einmal losziehen und setzte sich unterwegs manchmal auf ein fremdes Gartenmäuerchen, rauchte und sang alte Come-HitherHits, bis ihr Husten ihr Einhalt gebot. Das Gehuste nervte sie schließlich dermaßen, dass sie das Singen aufgab und stattdessen den Passanten hinterherschimpfte.
Jimmy ging ins Pub und stellte sich regelmäßig auf dem Arbeitsamt ein, um die Unterstützung zu kassieren – und das war auch schon alles. Er hatte zu viel Luft in der Lunge, wusste mangels medizinischer Behandlung jedoch nichts davon und keuchte und japste den ganzen Tag über und rang nachts nach Luft. Alle drei, Eileen, er und Keith waren fürs Rauchen, weil es angeblich die Nerven beruhigte. Die Wände im Brexschen Haus und vor allem die Decken wiesen einen ähnlich dunklen Ockerton auf wie die Flecken auf Eileens und Jimmys und Keiths Zeigefingern. Niemand kam je auf die Idee, das Haus neu zu streichen, und natürlich schrubbte niemand die Wände.
Auf der Gesamtschule bekam Teddy gute Zensuren. Besonders anstellig zeigte er sich in Kunsterziehung und später in einem Fach mit der Bezeichnung Design-Technologie. Er wollte eigentlich zeichnen lernen, aber weil die Schule keinen Zeichenunterricht anbieten konnte, brachte Mr. Chance es ihm bei. Er lehrte ihn Präzision und Genauigkeit und saubere Ausführung. Immer wieder ließ er ihn Kreise zeichnen und erzählte ihm die Geschichte von Giottos »O«: Als der Bote des Papstes zu Giotto kam, um eine Probe seiner Arbeit abzuholen, holte der Maler kein aufwendiges Gemälde hervor, sondern zog mit kühnem Pinselstrich einen perfekten Kreis auf ein Blatt Papier. Einen perfekten Kreis brachte Teddy zwar nicht zustande, aber sein Versuch war auch nicht schlecht.
Das Zeichnen machte ihm Spaß, und bald war er in Mr. Chances Werkstatt eifrig zugange und stellte zunächst einfache Gegenstände, dann komplizierte Stücke und Schnitzereien her. Teddy machte in acht Fächern die Abschlussprüfung und bestand damit die mittlere Reife. Dann wechselte er an eine spezielle Oberstufe über, um sich auf den Abschluss in Kunst, Graphikdesign und Englisch vorzubereiten.
Zu Hause interessierte man sich nicht im Geringsten dafür, was er in der Schule tat, obwohl sein Vater inzwischen verlauten ließ, es sei nun an der Zeit, aufzuhören und Geld zu verdienen. Jetzt, wo Teddy größer wurde, begannen ihn die drei erwachsenen Brexes allmählich mit anderen Augen zu sehen: als einen, der ihnen vielleicht im Haushalt zur Hand gehen könnte oder ihnen als Botenjunge, als Vermittler gegenüber Vertretern der örtlichen Behörden oder der Stadtwerke, als Geldverdiener, sogar als Koch oder Putzhilfe nützlich sein könnte. Dass sie seine Existenz bis dahin größtenteils ignoriert hatten, war für sie unerheblich. Sie waren sich keinerlei Unterlassungssünden bewusst. Unmerklich, fast unbewusst begannen sie Teddy zu umschmeicheln. Eileen stellte ihm Coladosen in den Kühlschrank, ohne je gemerkt zu haben, dass er sämtliche Sprudelgetränke hasste, und plötzlich boten ihm alle Zigaretten an.
Allerdings war er selten zu Hause. Und wenn er einmal da war, hielt er sich hauptsächlich im Esszimmer auf. Dort erledigte er seine Hausaufgaben und hängte seine Zeichnungen genau wie Mr. Chance an den Wänden auf. Er rahmte sie selbst und benutzte dazu Mr. Chances Rahmenklampe. Als Jimmy eines Abends auf wackligen Beinen hereingewankt kam und seinen Sohn auf dem Feldbett sitzend in die Lektüre von John Ruskins The Two Paths vertieft fand, wollte er wissen, ob er es denn nicht allmählich an der Zeit finde, seinen Hintern zum Arbeitsamt zu bewegen.
»Beweg doch deinen eigenen hin!« entgegnete Teddy, ohne recht aufzublicken.
»So redest du aber nicht mit deinem Vater!«
Teddy fand, dass diese Bemerkung keine Antwort verdiente, doch als Jimmy nach einer Weile immer noch herummotzte und mit der Faust auf das staubige Büfett schlug, sagte er: »Mich wird nie jemand anstellen.«
»Was? Was zum Teufel soll denn das heißen?«
»Das hörst du doch«, sagte Teddy.
Jimmy kam mit erhobenen Fäusten auf ihn zu, war jedoch so fett und schwächlich, dass er nichts ausrichten konnte. Außerdem hatte er von seinem ganzen Geschrei auch noch einen Hustenanfall bekommen. Zusammengekrümmt stand er da, über seinen sitzenden Sohn gebeugt, und keuchte und musste sich schließlich haltsuchend an Teddy klammern. Schweigend machte Teddy die zitternden Hände los, die sich in sein Sweat-Shirt aus dem Oxfam-Laden gekrallt hatten, und bugsierte seinen Vater aus dem Zimmer. Dabei hielt er ihn hinten am Jackenkragen wie ein sich wehrendes Tier, das man im Genick packt.
Doch selbst Jimmy und Eileen wussten über die Arbeitslosigkeit Bescheid. Wenn Teddy mit der Schule fertig war, hätte er keine Arbeit. Er wäre gezwungen, zu Hause zu bleiben und würde sich im Esszimmer breitmachen – eine bedrohliche Präsenz. Und dazu groß und kräftig, denn Teddy maß inzwischen eins zweiundachtzig und war zwar schlank, aber athletisch gebaut und stark. Als daher seine Stipendienformulare kamen, unterschrieben sie fast erleichtert. Nicht, dass Teddy weggehen oder auswärts wohnen würde, er besuchte bloß das College am Ende der Metropolitan Line, eine U-Bahnfahrt entfernt.
Eileen war inzwischen so dick geworden, dass ihr der Verlobungsring nicht mehr passte. Als sie sich den Finger mit Vaseline einfettete, bekam sie ihn herunter. Den Ehering behielt sie jedoch an, und allmählich bettete er sich so tief ins Fleisch ein, dass nur noch ein golden leuchtender Streifen zu sehen war, wie eine zwischen rosafarbene Kissen gefallene Paillette. Sie hatte sich an ihr gewaltigstes Oeuvre gewagt, die Krönung ihres Lebenswerks: eine Tagesdecke aus Spitzenhäkelei für das Doppelbett, das sie mit Jimmy teilte. Das Garn, das sie dazu benutzte, war schneeweiß, doch schon nachdem sie einen Monat gehäkelt hatte, war das Stück durchgehend gelblich verfärbt und sah aus, als wäre es in Tee getaucht worden.
Keith tauschte den Lincoln in einen blassgelben Ford Edsel Corsair aus den späten fünfziger Jahren um. Vielleicht waren die Amerikaner damals mit der senkrechten Gangschaltung nicht recht glücklich gewesen oder mochten vielleicht die Form des Kühlergrills nicht, der nicht wie ein grinsendes Haifischmaul aussah, sondern wie ein zum staunenden Oooh! geöffneter Mund. Was auch der Grund gewesen sein mochte – der Edsel war jedenfalls von Anfang an ein berühmt-berüchtigter Misserfolg, und wahrscheinlich konnte Keith sein Exemplar deshalb für nur fünftausend Pfund bei einem Händler in Süd-London erstehen.
Trotz seines Alters hatte der Wagen vor Keith lediglich einen Besitzer gehabt, war selten gefahren worden und hatte nur zehntausend Meilen auf dem Buckel. Dennoch nahm Keith den Motor auseinander und baute ihn wieder zusammen. Den ganzen heißen Sommer lang arbeitete er draußen, und der Lärm, den er dabei machte, brauchte nicht mit den Sägegeräuschen von nebenan zu wetteifern, weil Mr. Chance im Juli starb.
Er hatte keine Nachkommen. Ein Cousin war sein nächster Verwandter, und als er starb, war dieser Cousin der einzige Trauergast. Teddy kam überhaupt nicht auf die Idee, zur Beerdigung zu gehen. Seine einzige Sorge war, dass er nun nirgends mehr arbeiten konnte, denn das Haus würde bestimmt umgehend verkauft werden. Es beruhigte ihn etwas, als er erfuhr, dass Mr. Chance ihm sein ganzes Werkzeug vermacht hatte, dazu eine Menge Holz, Farben und Zeichenmaterial. Er versuchte, alles ins Esszimmer zu stapeln, und als sich dies als unmöglich erwies, erlebte er den ersten echten Wutanfall seines Lebens. Er war ein kühler Mensch, sein Zorn war jedoch heiß und heftig, ein stummes inneres Kochen, das sein Gesicht anschwellen und feuerrot werden und die Adern an seinen Schläfen hervortreten ließ.
Eigentlich hätte das scheußliche Gerümpel im Esszimmer hinausgeräumt werden sollen, um dort bei Wind und Wetter zu verrotten. Er hätte auch alles fortgeschafft, wenn es durch die schmalen Verandatüren gepasst hätte. Einmal war er kurz davor, die Fenster auszuhängen, den ganzen rückwärtigen Teil des Hauses herauszureißen, die Glasscheiben einzutreten und das Holz zu zersplittern, doch war er nicht nur wütend, sondern auch vorsichtig. Die da drin wären imstande, die Polizei zu rufen. Wie waren die Möbel überhaupt dort hineingekommen?
Keith verriet es ihm. »Die haben meinem Großvater gehört. Mein Vater mochte solche Tische und Stühle. Und das Büfett, das ist doch ein wirklich schönes Stück. Solche Möbel bauen sie heute nicht mehr.«
»Na, hoffentlich«, entgegnete Teddy.
»Du, sei nicht so frech! Was weißt denn du? Zeig mir doch ein Möbel von deinem Chance, dem alten Scheißkerl, das dem hier das Wasser reichen kann. Mein Vater hat das Haus hier gekauft, wusstest du das überhaupt? Er war ein einfacher Arbeiter, aber er hat sich nicht einwickeln lassen und Geld für ’ne Sozialwohnung hingeblättert. Nein, er hat gespart und sich dieses Haus gekauft, und als er die Möbel kriegte und merkte, dass sie nicht reinpassen, hat’s ihm fast das Herz gebrochen. Also ließ er sie auseinandernehmen und drinnen wieder zusammenbauen. Und wer, glaubst du, hat das gemacht?«
»Brauchst du mir nicht zu sagen, ich kann’s mir denken.«
»Chance war gottfroh um das Geld. Förmlich überschlagen hat er sich.«
Das war die allergrößte Enttäuschung. Falls Teddy eine Weile geglaubt hatte, Alfred Chance sei anders, war das nun vorbei. Die Menschen waren doch, wie er schon lange geargwöhnt hatte, allesamt schändlich und verdorben und den Dingen meilenweit unterlegen. Gegenstände enttäuschten einen nie. Sie blieben sich gleich und konnten eine nie versiegende Quelle der Freude und Befriedigung sein. Vielleicht gab es auch ein paar Menschen, auf die das zutraf, doch war er bis zum Alter von achtzehn noch keinem begegnet.
Was das Werkzeug betraf, so blieb ihm am Ende nichts anderes übrig, als es auf dem kleinen Gartenstück unterzubringen, das nicht von Keiths Edsel belegt war. Dort draußen konnte er es nicht benutzen, er musste es mit Plastikplanen bedeckt auf dem »Rasen« aufbewahren. Wenn Keith nicht bei ihnen wohnen würde oder dieses Auto nicht hätte, könnte er sich einen Schuppen bauen wie den von Mr. Chance.
Doch Keith lebte bei ihnen, was auf Eileen jedoch schon sehr bald nicht mehr zutreffen sollte. Mit Eileen nahm es ein schlimmes Ende. Als sie klein war, hatte ihre Mutter ihr das oft prophezeit, diese spezielle Art der Abmeldung dabei aber sicher nicht im Sinn gehabt.
4
_____
Ihre Ungezogenheit rettete Francine das Leben. Sie überlebte, weil sie unartig gewesen war. Das behauptete jedenfalls Julia. Julia war nicht dabei gewesen, niemand außer ihr selbst und ihrer Mutter war dabei gewesen und natürlich der Mann, aber Julia wusste immer alles. Er kam herauf, um dich zu suchen, sagte Julia. Warum wäre er sonst nacheinander in die Schlafzimmer gegangen?
Komisch war nur, dass sich Francine auch lange danach nicht entsinnen konnte, was sie Ungezogenes getan haben sollte. War sie laut gewesen oder ungehorsam oder frech? Ein solches Verhalten wäre für sie aber nicht typisch gewesen; so ein Kind war sie nie gewesen. Und doch musste sie etwas Ungehöriges getan haben, denn ihre Mutter war keine strenge, sondern eine recht umgängliche Frau gewesen. Ein bisschen Krach zu machen hätte nicht dazu geführt, dass eine genervte Stimme zu ihr sagte: »Francine, das war sehr dumm und unachtsam von dir. Du gehst jetzt sofort auf dein Zimmer.«
Vielleicht war sie am Ende doch so ein Kind gewesen. Woher sollte sie das wissen? Was in der folgenden halben Stunde passiert war, hatte ihr Leben verändert, einen anderen Menschen aus ihr gemacht, und sie hatte keine Möglichkeit zu erfahren, ob sie damals eigensinnig und boshaft gewesen war oder genauso wie jetzt. Sie hatte sich ihrer Mutter nicht widersetzt, sondern war brav nach oben auf ihr Zimmer gegangen und hatte die Tür zugemacht. Es war etwa zehn vor sechs, an einem schönen, warmen Junitag gewesen. Damals hatte sie die Uhr noch nicht lesen können. Ihr Vater sagte, die Uhr lesen zu lernen sei für Kinder heutzutage schwerer als früher, weil manche Uhren zwar Zeiger hatten, andere jedoch nur eine Digitalanzeige mit Zahlen. Sie wusste aber, dass es zehn vor sechs war, weil ihre Mutter es gesagt hatte, bevor sie sie auf ihr Zimmer geschickt hatte.
Das Fenster in ihrem Zimmer stand offen, und eine Zeitlang hatte sie sich ans Fensterbrett gelehnt und über den Garten auf die Straße hinausgeschaut. Es waren keine anderen Häuser und Gärten zu sehen, die nächsten lagen fast einen halben Kilometer entfernt. Sie konnte ein Feld, Bäume und eine Hecke erkennen und weit in der Ferne den Kirchturm. Ein Wagen war auf der gegenüberliegenden Straßenseite herangefahren und hatte am Randstein geparkt, doch sie hatte nicht besonders darauf geachtet. Sie interessierte sich nicht für Autos, und später konnte sie sich nicht einmal mehr daran erinnern, welche Farbe es gehabt hatte. Den Fahrer hatte sie nicht bemerkt und auch nicht, ob sonst noch jemand im Wagen saß.
An einen Schmetterling, der in ihrem Zimmer gegen die Scheibe flatterte, erinnerte sie sich, und wie sie ihn zwischen Daumen und Zeigefinger gefangen hatte, ganz vorsichtig, um ihm nicht den Staub von den Flügeln zu wischen. Es war ein Admiral, und sie hatte ihn durch das offene Fenster freigelassen und in den Himmel fliegen sehen und ihm nachgeschaut, bis er nur noch ein kleiner Fleck auf einer blauen Fläche war. Dann war sie vom Fenster weggetreten und hatte sich einsam und gelangweilt auf ihr Bett gelegt und überlegt, wie lange es wohl dauern würde, bis ihre Mutter heraufkam, die Tür aufmachte und sagte: »Na gut, Francine, du kannst wieder herunterkommen.«
Stattdessen klingelte jemand an der Haustür. Sie erwarteten eigentlich niemanden, was es aber viel aufregender machte, denn der Besuch eines Nachbarn oder einer Freundin würde beinahe mit Sicherheit dazu führen, dass sie heruntergeholt wurde. Sie stand vom Bett auf, ging wieder ans Fenster und sah hinunter. Von hier oben konnte man sehen, wenn jemand an die Tür kam, oder jedenfalls auf seinen Kopf hinuntergucken. Einmal hatte sie hinuntergeblickt und einen Kopf mit Totalglatze gesehen, einen weißen, glänzenden Mond. Dieser hier war nicht so, sondern hatte dichtes, braunes Haar, allerdings konnte sie bis auf die braunen, glänzenden Schuhe sonst nichts sehen.
Ihre Mutter machte auf. Es musste ihre Mutter gewesen sein, weil sonst niemand da war und die Tür geschlossen war. Sie hörte sie ganz leise wieder zugehen. Zunächst waren keine Stimmen zu hören, dann hörte sie seine Stimme. Grob, nicht besonders laut, aber wütend, sehr wütend. Es überraschte sie, dass jemand zu ihnen kam und wütend war und ihre Mutter anschrie. Sie hörte die Stimme ihrer Mutter, aber nicht, was sie sagte, doch sie klang ruhig und fest. Der Mann fragte sie etwas. Francine drückte ihr Ohr an die Tür. Als nächstes hörte sie ihre Mutter aufschreien: »Nein!«
Mehr nicht, nur dieses eine »Nein« und dann Schüsse. Erst ein Schuss, dann folgten weitere. Im Fernsehen hatte sie schon Schüsse gehört, wusste also, wie es sich anhörte. Doch ob der Schrei vor dem ersten Schuss kam oder zwischen den Schüssen oder nachdem schon alle Schüsse gefallen waren, wusste sie später nicht mehr. Etwas fiel zu Boden oder wurde umgestürzt, vielleicht ein Möbelstück, ein Stuhl oder wohl eher ein kleiner Tisch, denn es ertönte ein schlitterndes Geräusch und dann ein Krachen und das Geklirr von zerbrochenem Glas. Dann folgten Geräusche, die sie noch nie zuvor gehört hatte, dumpfe Schläge, ein keuchendes, ersticktes Stöhnen, und dann ein Geräusch, das sie kannte, ein Wimmern wie bei dem jungen Hündchen ihrer Freundin, wenn es allein gelassen wurde. Und danach noch ein Schuss.
Francine überlegte, ob sie aus dem Fenster klettern sollte. Sie ging hinüber und sah hinunter, doch es war zu hoch. Außerdem musste sie sich verstecken, und dazu durfte sie nicht in den Vorgarten. Julia sagte immer, sie habe sich versteckt, weil ihr Instinkt ihr gesagt habe, dass der Mann heraufkommen und sie suchen würde, weil er vorhatte, sie auch zu erschießen. Doch sie war sich sicher, dass sie das damals nicht gedacht hatte. Wenn sie erklären müsste, weshalb sie sich versteckt hatte, würde sie sagen, weil Kinder sich instinktiv immer verstecken, wenn Gefahr droht, wie Tiere auch.
An der Tür hatte sie gehorcht und gehört, wie etwas über den Fußboden geschleift wurde. Es klang, wie wenn ein aufgerollter Teppich mühsam über einen Teppichboden gezerrt wird. Einmal, und nur einmal in ihrem kurzen Leben, hatte sie einen erwachsenen Menschen weinen sehen, ihre Mutter. Sie hatte geweint, als ihre eigene Mutter gestorben war. Dieses Geräusch, ein erwachsenes Schluchzen, viel schlimmer als das Weinen bei einem Kind, hörte sie den Mann jetzt ausstoßen. Es war noch viel schrecklicher als die Schüsse und das Schleifen. Sie kletterte in den Schrank.
Im Schrank hingen ihre Kleider auf Bügeln, und ihre Schuhe standen auf dem Boden, daneben ein Pappkarton mit Spielsachen, für die sie zu alt war. Sie schob die Schuhe zu der Spielzeugkiste hinüber und kauerte sich auf den Boden. Erst sah es so aus, als ließe sich die Schranktür von innen nicht schließen, weil es keinen Griff gab, doch sie stellte fest, wenn sie ihre Finger zwischen die Unterkante der Tür und den Teppichboden schob, ging sie zu. Das war der Vorteil, wenn man erst sieben war: Ihre Finger waren sehr klein. Wäre sie älter gewesen, dann wäre es ihr nicht gelungen, und der Mann hätte sie gefunden, als er ins Zimmer kam. Sagte jedenfalls Julia.
Er kam auch herein. Zuerst hörte sie seine Schritte auf der Treppe. Ihre Zimmertür lag gleich neben dem oberen Treppenabsatz, also kam er zuerst in ihr Zimmer. Kam herein, sah sich um, ging wieder. Sie hörte, wie er im Schlafzimmer ihrer Eltern Schubladen aufriss und den Inhalt auf den Boden warf. Und dann die Schubladen auch. Ihr war eiskalt vor Angst, und ihre Zähne klapperten wie letztes Jahr beim Schwimmen im kalten Meer. Ihre Mutter hatte sie in ein großes Strandtuch gewickelt und dann noch in die Jacke ihres Vaters. Jetzt gab es niemanden mehr, der das für sie tat.
Sie hörte ihn nach unten laufen. Er machte die Haustür ganz leise hinter sich zu. Wie jemand, der Schlafende nachts nicht aufwecken will. Ihre Mutter schlief aber nicht. Sie war tot. Doch das wusste sie damals nicht, sie wusste nicht, was der Tod war. Obwohl – als sie schließlich nach unten schlich und sie dort auf dem Boden im Flur liegen sah, wusste sie, dass ihr der Mann wehgetan hatte, dass ihr ganz schrecklich wehgetan worden war.
Sie kniete sich neben ihre Mutter und nahm ihre Hand und drehte sie hin und her. Seltsam, dass sie in dem Moment das Blut noch nicht bemerkte. Es lag vielleicht daran, dass ihre Mutter dunkles Haar hatte und der Teppichboden dunkelrot war. Später erinnerte sie sich wieder an das Blut, denn als sie aufhörte, ihrer Mutter über die Haare zu streichen, waren ihr Handteller und die Finger rot gewesen, wie mit einem feinen Pinsel bemalt. Und jemand von den Leuten, die später kamen – uniformierte Männer, Polizisten, Krankenschwestern –, behauptete, sie habe im Blut gesessen, und ihr Schulröckchen sei ganz rot davon gewesen.
Bald würde ihr Vater nach Hause kommen. Normalerweise kam er um sieben oder um Viertel vor sieben. Sie warf einen Blick auf die Uhr und sah die Zeiger in unverständlichen Winkeln stehen. Nur wenn sie direkt nach oben oder direkt seitwärts zeigten, konnte sie sich in etwa vorstellen, wie spät es war. Sie saß neben ihrer Mutter auf dem Fußboden, betrachtete die Uhr und überlegte, weshalb man nie sah, wie die Zeiger sich bewegten. Aber wenn man ein Weilchen wegsah und dann wieder hinguckte, hatten sie sich bewegt.
Das Zähneklappern hatte aufgehört. Eigentlich hatte alles aufgehört. Die Welt. Das Leben. Aber nicht die Zeit, denn als sie wieder zu der Uhr hinübersah, war einer von den Zeigern nach oben gekrochen und deutete direkt seitwärts, nach links. Rechts und links konnte sie schon unterscheiden.
Der Schlüssel ihres Vaters machte ein kratzendes Geräusch im Schloss, wie Mäusescharren, und dann ging die Tür auf, und er kam herein. Richard Hill blieb starr stehen und stieß einen Laut aus, der sich von allem unterschied, was sie bis dahin gehört hatte. Sie hätte ihn nie beschreiben können, auch nicht, als sie später wieder sprechen konnte. Er war zu schrecklich und zu anders, es war überhaupt kein Menschenlaut, sondern das Brüllen eines einsamen Tieres in der Wildnis.
Sie konnte nicht mit ihm sprechen. Sie konnte ihm nichts sagen. Ihre Stimme war nicht etwa leise oder heiser oder flüsternd wie die ihrer Mutter, als sie einmal Kehlkopfentzündung gehabt hatte. Sie hatte überhaupt keine Stimme, keine Worte. Als sie den Mund öffnete und Lippen und Zunge bewegte, tat sich nichts. Es war, als hätte sie vergessen, wie man spricht, oder es nie gelernt.
Richard Hill hielt sie in seinen Armen und nannte sie sein Baby. Er sagte, er sei jetzt ja da, er sei nach Hause gekommen, er würde sie nie mehr allein lassen. Sogar in diesem Moment brachte er es fertig, ihr zu sagen, es würde alles wieder gut, er würde immer auf sie aufpassen. Doch sie konnte ihm nicht antworten, konnte ihm nur ihr erstarrtes Gesicht zuwenden mit Augen, die, wie er später sagte, doppelt so groß waren wie sonst.
Dann wurden die Psychologinnen zu ihr gelassen. Nicht Julia, damals noch nicht. Später begriff sie, wie behutsam und liebevoll sie alle gewesen waren. Auch die Polizisten. Niemand hatte sie unter Druck gesetzt. Niemand hatte auch nur die leiseste Spur von Ungeduld an den Tag gelegt. Die Psychologinnen hatten ihr Puppen zum Spielen gegeben, und Jahre später begriff sie, dass dies in der Hoffnung geschehen war, sie würde im Spiel die Ereignisse jenes Abends nachstellen. Es gab einen Puppenmann und eine Puppenfrau und ein kleines Puppenmädchen.