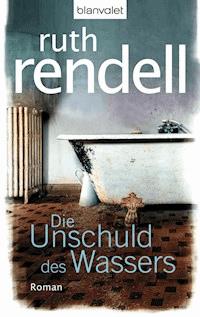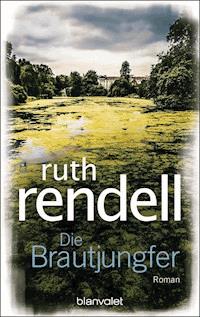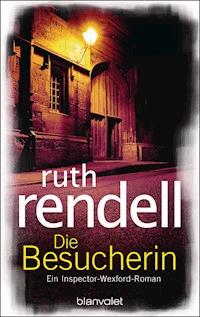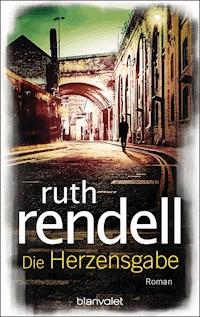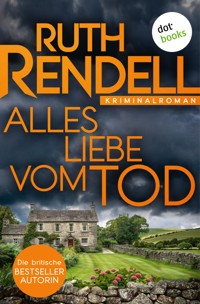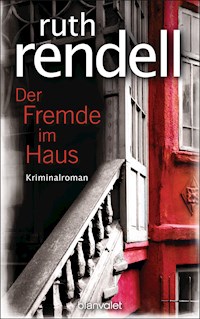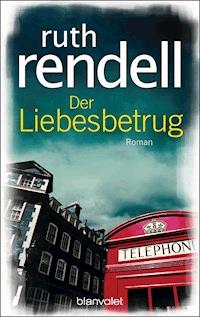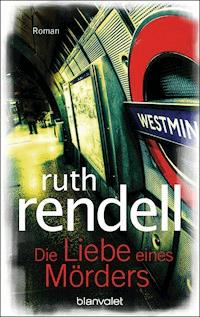
6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Blanvalet Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Die kauzige Gwendolyn Chawcer vermietet eine Wohnung in ihrem Haus in London an einen jungen Mann, der ihr schon bald unheimlich ist. Dabei ahnt sie nicht einmal im Entferntesten, was in ihrem neuen Mieter tatsächlich vorgeht. Denn dieser Michael Cellini ist besessen. Nicht nur vom schönen Topmodel Nerisha, sondern auch von seinem großen Idol, dem berüchtigten Serienmörder John Christie. Und so ist es kein Wunder, dass der leidenschaftliche junge Mann sich von Christies Taten inspirieren lässt, als Nerisha sein zärtliches Werben hartnäckig ignoriert …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 551
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
Buch
Die kauzige Gwendolyn Chawcer vermietet eine Wohnung in ihrem Haus in London an einen jungen Mann, der ihr schon bald unheimlich ist. Dabei ahnt sie nicht einmal im Entferntesten, was in ihrem neuen Mieter tatsächlich vorgeht. Denn dieser Michael Cellini ist besessen. Nicht nur vom schönen Topmodel Nerisha, sondern auch von seinem großen Idol, dem berüchtigten Serienmörder John Christie. Und so ist es kein Wunder, dass der leidenschaftliche junge Mann sich von Christies Taten inspirieren lässt, als Nerisha sein zärtliches Werben hartnäckig ignoriert …
Autorin
Ruth Rendell wurde 1930 in South Woodford/London geboren. Zunächst arbeitete sie als Journalistin, bevor sie sich ganz dem Schreiben von Romanen widmete. Dreimal bereits erhielt sie den Edgar-Allan-Poe-Preis und zweimal den Golden Dagger Award. 1997 wurde sie mit dem Grand Master Awardder Crime Writer’s Association of America, dem renommiertesten Krimipreis, ausgezeichnet und darüber hinaus von Königin Elizabeth II. in den Adelsstand erhoben. Ruth Rendell, die auch unter dem Pseudonym Barbara Vine bekannt ist, lebt in London.
Die Reihenfolge der Inspector-Wexford-Romane sowie weitere Romane finden Siehier.
Ruth Rendell
Die Liebe eines Mörders
Roman
Aus dem Englischen von Eva L. Wahser
Die Originalausgabe erschien 2004 unter dem Titel Thirteen Steps Down bei Hutchinson, London.
E-Book-Ausgabe 2015
bei Blanvalet, einem Unternehmen der
Verlagsgruppe Random House GmbH, München
Copyright © der Originalausgabe 2004 by Kingsmarkham Enterprises Ltd.
Copyright © der deutschsprachigen Ausgabe 2007 by Blanvalet Verlag, München, in der Verlagsgruppe Random House GmbH
Umschlaggestaltung: www.buerosued.de
Umschlagmotiv: Getty Images/Aaron Yeoman
Satz: Uhl + Massopust, Aalen
ISBN: 978-3-641-15141-6www.blanvalet.de
Für P. D. James in größter Wertschätzung
1______
Hier müsste eigentlich die Straße sein, genau da, wo er stand. Davon war Mix überzeugt. Unglaublich. Inzwischen hatte er seinen Schock überwunden. Bittere Enttäuschung stieg in ihm auf. Dann kam die Wut. Es schnürte ihm fast die Kehle zu. Wie konnten sie es wagen? Wie konnten diese Unbekannten etwas zerstören, was eigentlich ein Nationaldenkmal sein sollte? Das Haus hätte längst ein Museum mit einer dieser blauen Tafeln oben an der Wand sein müssen, und den Garten hätte man als Teil einer Besichtigungstour in seinem ursprünglichen Zustand liebevoll bewahren sollen. Ein Kurator wäre auch gleich bei der Hand gewesen: er persönlich.
Alles war sorgfältig neu gestylt und seelenlos. Das war der richtige Begriff dafür – »seelenlos«. Er war ganz stolz auf seinen Einfall. Was für ein hübsches Fleckchen, dachte er angewidert. Genau das Richtige für Yuppies. Besonders wütend machten ihn die Petunien in den Blumenbeeten. Dass man den Rillington Place schon einige Zeit vor seiner Geburt in Ruston Close umbenannt hatte, wusste er natürlich, aber jetzt existierte nicht einmal dieser mehr. Der alte Stadtplan, den er mitgebracht hatte, half auch nicht weiter. Alte Straßen waren noch schwerer zu finden als die Spuren eines Kindergesichtes bei einem Fünfzigjährigen. Ja, ganz genau, fünfzig Jahre. Vor einem halben Jahrhundert hatten sie Reggie geschnappt und gehängt. Wenn sie schon die Straßen umbenennen mussten, dann hätte man wenigstens eine Tafel mit dem Hinweis »Ehemals Rillington Place« oder irgendetwas aufstellen können, was den Besuchern verriet: Hier lebte Reggie. Sicher würden ganze Hundertschaften hierherkommen, einige voller Erwartung und dann dementsprechend tief enttäuscht, während andere keine Ahnung von den historischen Begebenheiten hatten, die mit diesem Ort verbunden waren. Und alle würden sie vor dieser kleinen Enklave mit den roten Backsteinhäusern stehen, deren Blumenkästen üppig mit Geranien und Fleißigen Lieschen bepflanzt waren und deren Grundstücke von Blumenrabatten und Bäumen gesäumt wurden, die man wegen ihrer weiß umrandeten, goldenen Blätter ausgesucht hatte.
Es war ein schöner Hochsommertag mit einem wolkenlos blauen Himmel. Üppig grün leuchteten die kleinen Rasenflächen. Eine rosarote Kletterpflanze legte sich wie ein pastellfarbener Mantel über die geschickt versetzten Gartenmauern. Mix drehte sich um. Vor unterdrückter Wut klopfte sein Herz schneller und lauter. Poch. Poch. Poch. Wenn er gewusst hätte, dass man jede Spur ausgemerzt hatte, hätte er die Wohnung im St. Blaise House nie in Betracht gezogen. In diese Ecke von Notting Hill war er nur gezogen, weil Reggie in diesem Viertel gelebt hatte. Das eigentliche Haus und die Nachbarhäuser waren weg, das hatte er natürlich gewusst. Trotzdem hatte er darauf gesetzt, dass man den Ort selbst leicht wiedererkennen könne: eine Straße, um die Leute mit schwachen Nerven einen weiten Bogen machten, eine Pilgerstätte für intelligente Kenner seines Schlages. Leider hatten sich die zart besaiteten Schwächlinge und die politisch korrekten Bürger durchgesetzt und alles abgerissen. Über seinesgleichen hätten solche Typen nur gelacht und genüsslich triumphiert, weil man einen geschichtsträchtigen Ort durch eine geschmacklose Wohnsiedlung ersetzt hatte.
Den Besuch selbst hatte er sich als besonderes Vergnügen für die Zeit nach seinem Einzug aufgespart. Und was für ein Vergnügen! Wie oft hatte sich in seiner Kindheit ein ganz besonderes Vergnügen als Niete entpuppt? Seiner Erinnerung nach viel zu oft. Und das ging so weiter, sobald man als Erwachsener selbst Verantwortung übernehmen musste. Ein Auszug kam trotzdem nicht in Frage, dafür hatte er an Ed und dessen Kumpel viel zu viel fürs Streichen der Wohnung und die Küchenrenovierung bezahlt. Er drehte den hübschen neuen Häuschen samt ihren Bäumen und Blumenbeeten den Rücken zu, ging langsam die Oxford Gardens hinauf und überquerte den Ladbroke Grove, um sich das Haus anzusehen, in dem Reggies erstes Opfer ein Zimmer bewohnt hatte. Wenigstens hier hatte sich nichts verändert. Dem äußeren Anschein nach hatte das Haus seit dem Tod dieser Frau im Jahre 1943 keine Farbe mehr gesehen. Offensichtlich wusste niemand, um welches Zimmer es sich gehandelt hatte. Keines der Bücher, die er gelesen hatte, machte dazu irgendwelche detaillierten Angaben. Während er in Spekulationen und Mutmaßungen versank, starrte er zu den Fenstern hinauf, bis jemand zu ihm hinunterschaute und er es für besser hielt weiterzugehen.
Je weiter er die St. Blaise Avenue bergabging, umso mehr ging es auch mit dem Viertel bergab: nur noch städtische Sozialwohnungen, Reinigungen, Geschäfte für Motorradersatzteile und an der Ecke die üblichen Tante-Emma-Läden. Die einzige Ausnahme bildete die Reihenhauszeile auf der anderen Straßenseite, die durch ihren eleganten viktorianischen Stil herausstach, und die große Villa. St. Blaise House hatte man als einziges im ganzen Viertel nicht in ein Dutzend Wohnungen aufgeteilt. Schade, dass sie nicht diesen alten Kasten abgerissen und dafür vom Rillington Place die Finger gelassen haben, dachte Mix.
Statt Kirschbäumen standen hier riesige großblättrige Platanen voller Straßenstaub, von deren Stämmen sich die Rinde schälte. Sie waren weitgehend daran schuld, dass es hier so dunkel war. Er blieb stehen, betrachtete das Haus und staunte wie immer über dessen Größe. Ihm war es schleierhaft, warum die Alte das Haus nicht schon vor Jahren an einen Bauträger verkauft hatte. Die grauen Stuckverzierungen des dreistöckigen Gebäudes waren früher einmal weiß gewesen. Eine Treppe führte zu einem großen Portal hinauf, das in den Tiefen eines mit Säulen verzierten Vorbaus halb verschwand. Ganz oben, knapp unterhalb des Giebels, befand sich ein kreisrundes Fenster mit bunten Glasscheiben, das von den anderen rechteckigen Fenstern abstach und schon lange nicht mehr geputzt worden war. Im Laufe der Jahre hatte sich eine dicke Schmutzschicht darauf abgelagert und trübte die Farben.
Mix sperrte auf. Bereits die riesige quadratische Diele, in der es genauso dunkel war wie im übrigen Haus, hatte die Ausmaße einer normalen Wohnung. Dieser Gedanke war ihm schon bei der ersten Besichtigung durch den Kopf gegangen. Ringsum an den Wänden standen mächtige dunkle Sessel mit geschnitzten Lehnen. Darüber hing in einem geschnitzten Holzrahmen ein riesiger Spiegel mit grünlichen Flecken, die an Inseln auf einer Seekarte erinnerten. Eine Treppe führte ins Kellergeschoss hinunter, das er nie betreten hatte und vermutlich seit vielen Jahren auch sonst niemand mehr.
Jedes Mal, wenn er heimkam, hoffte er, dass er sie nicht zu Gesicht bekam, was normalerweise auch zutraf, aber heute hatte er Pech. Mit einem bunten Werbeprospekt für ein tibetanisches Restaurant in der Hand stand sie neben einem geschnitzten Tisch von enormen Ausmaßen, der mindestens eine Tonne wog. Wie üblich trug sie eine lange, ausgeleierte Strickjacke und einen Rock mit einem zipfeligen Saum. »Guten Tag, Mr. Cellini«, rief sie bei seinem Anblick vornehm näselnd. In seinen Ohren klang ihre Stimme ziemlich verächtlich.
Er beschränkte seine Unterhaltungen mit Gwendolen Chawcer aufs Allernötigste und bemühte sich dabei redlich, sie zu schockieren. Leider bisher ohne nennenswerten Erfolg.
»Sie werden nie erraten, wo ich gewesen bin.«
»Da dies ziemlich wahrscheinlich ist«, erwiderte sie, »scheint jeder entsprechende Versuch sinnlos zu sein.«
Sarkastisches altes Biest. »Am Rillington Place«, sagte er, »beziehungsweise dort, wo er früher einmal lag. Ich wollte unbedingt sehen, wo Christie die ganzen Frauen, die er umbrachte, im Garten vergraben hat, aber es ist nichts mehr zu sehen.«
Sie legte den Prospekt wieder auf den Tisch, wo er zweifelsohne die nächsten Monate liegen bleiben würde. Ihr nächster Satz überraschte ihn. »In meiner Jugend bin ich einmal bei ihm im Haus gewesen.«
»Wirklich? Warum?«
Sie würde nicht viel verlauten lassen, das wusste er, und so war es auch. »Ich hatte meine Gründe. Der Besuch dauerte höchstens eine halbe Stunde. Er war ein unangenehmer Mensch.«
Er konnte sich vor Begeisterung nicht bremsen. »Welchen Eindruck hat er auf Sie gemacht? Haben Sie in seiner Gegenwart den Mörder gespürt? War seine Frau dabei?«
Wie immer lachte sie kalt. »Meine Güte, Mr. Cellini, ich habe keine Zeit, lauter Fragen zu beantworten. Ich muss weitermachen.«
Womit denn? Meistens frönte sie ja doch nur ihrer Dauerbeschäftigung: Lesen. Sie musste Tausende Bücher gelesen haben. Nach ihrer unbefriedigenden und gleichzeitig provozierenden Antwort fühlte er sich frustriert. Vielleicht hatte sie jede Menge Informationen über Reggie, aber in ihrer kühlen Art würde sie nie darüber reden.
Er begann, die Treppe hinaufzusteigen, deren Stufen er aus tiefster Seele hasste, obwohl sie weder schmal noch steil oder gewendelt waren. Insgesamt waren es zweiundfünfzig Stufen, aufgeteilt in drei Treppenabsätze. Zweiundzwanzig Stufen im ersten Treppenabschnitt, siebzehn im zweiten und dreizehn ins Dachgeschoss. Und Letzteres war ein Grund, warum Mix die Treppe nicht ausstehen konnte. Denn nichts brachte ihn, abgesehen von unangenehmen Überraschungen und unverschämten alten Weibern, mehr in Rage als die Zahl Dreizehn. Zum Glück hatte St. Blaise House die Nummer vierundfünfzig in der St. Blaise Avenue.
Eines schönen Tages hatte er in Abwesenheit der alten Chawcer die Schlafzimmer gezählt. Es waren neun, sein eigenes nicht eingerechnet. Einige waren mehr oder weniger möbliert, andere leer. Das ganze Haus starrte vor Dreck. Vermutlich hatte hier drinnen seit Jahren niemand mehr sauber gemacht, obwohl er sie auch schon mit einem Federwisch herumwedeln gesehen hatte. Der Staub von Jahrzehnten lag auf dem Holzwerk, das über und über mit Schilden, Schwertern, Helmen, Gesichtern, Blumen, Blättern, Girlanden und Bändern verziert war. Zwischen den einzelnen Sprossen des Treppengeländers hingen dichte Spinnwebennester und verbanden Gesimse und Bilderleisten. Hier hatte sie ihr ganzes langes Leben verbracht, zuerst gemeinsam mit ihren Eltern, dann nur noch mit ihrem Vater und schließlich allein. Sonst wusste er nichts über sie. Keine Ahnung, wie sie darauf gekommen war, drei Schlafzimmer in eine Dachgeschosswohnung umzubauen.
Nach dem ersten Treppenabsatz wurden die Stufen schmaler, und das letzte Stück zum Dachgeschoss war nicht mit einem Teppich belegt, sondern gefliest. Eine Treppe mit glänzend schwarzen Fliesen hatte Mix noch nie zuvor gesehen. Allerdings gab es im Haus von Miss Chawcer vieles, was er noch nie gesehen hatte. Diese Fliesen waren schrecklich laut, egal, welche Schuhe er trug. Entweder polterte es dumpf oder es klackerte. Die Sache mit den Fliesen hatte wahrscheinlich einen Grund: Sie wollte genau wissen, wann ihr Mieter heimkam. Er hatte es sich bereits angewöhnt, die Schuhe auszuziehen und auf Strümpfen weiterzugehen. Er wollte einfach nicht, dass sie über sein Kommen und Gehen Bescheid wusste, auch wenn er nie etwas anstellte.
Das Buntglasfenster – ein Mädchen in die Betrachtung einer Topfpflanze versunken – sprenkelte den obersten Treppenabsatz mit bunten Lichttupfen. Das Isabellafenster hatte es die alte Chawcer genannt, als sie ihn zum ersten Mal hier heraufführte. Mix konnte mit dem Bild von Isabella und dem Basilikumtopf herzlich wenig anfangen. Für ihn war Basilikum ein Kraut aus einem Plastikbeutel, das man bei Tesco kaufte. Das Mädchen sah krank aus. Ihr Gesicht war das einzig weiße Glasteil. Bei jedem Betreten oder Verlassen seiner Wohnung musste Mix sie anschauen, und das gefiel ihm ganz und gar nicht.
Er bezeichnete sein Zuhause als Apartment, während Gwendolen Chawcer von »Räumlichkeiten« sprach. Seiner Ansicht nach lebte sie in der Vergangenheit, aber nicht vor dreißig oder vierzig Jahren wie die meisten alten Leute, sondern ein Jahrhundert früher. Bad und Küche hatte er selbst mit Hilfe von Ed und dessen Kumpel eingebaut und eingerichtet. Eigentlich hätte Miss Chawcer keinen Grund zur Klage und müsste zufrieden sein. Schließlich hatte er den Umbau bezahlt, von dem der Nachmieter profitieren würde, sobald der berühmte Mix ausgezogen war. Leider hatte sie Sinn und Zweck eines Badezimmers nie eingesehen und ihm erklärt, in ihrer Jugend habe im Schlafzimmer ein Nachttopf und ein Ständer mit einer Waschschüssel gestanden, und das Dienstmädchen habe einen Krug heißes Wasser heraufgebracht.
Neben Küche und Bad verfügte Mix über ein Schlafzimmer und ein großes Wohnzimmer, in dem ein Fotoposter von Nerissa Nash alle Blicke auf sich zog. Dieses Bild war entstanden, als eine Modezeitschrift zum ersten Mal neben den Designernamen auch die Namen der Models nannte. Im Gegensatz zu heute galt Nerissa Nash damals noch weithin als die Naomi Campbell der kleinen Leute. Mix stellte sich vor das Poster, was er oft beim Betreten seiner Wohnung tat, und versank in stiller Andacht wie ein gläubiger Mensch vor einem Heiligenbild. Doch statt eines Gebetes murmelte er: »Ich liebe dich, ich bete dich an.«
Er verdiente bei Fiterama ordentlich Geld und hatte es großzügig in diese Wohnung gesteckt. Fernseher, Videorecorder und DVD-Player – alle mit Chromgehäuse – sowie die meisten Küchengeräte hatte er auf Raten gekauft, aber das war Jacke wie Hose, wie Ed gern zu sagen pflegte. Das machten schließlich alle. Den weißen Teppich und die mit grauem Tweed bezogene Couchgarnitur hatte er bar bezahlt. Dabei hatte er aus reinem Impuls die schwarze Marmorstatue eines nackten Mädchens gekauft und es keine Sekunde lang bereut. Das Poster von Nerissa hatte er, passend zum Fernseher, mit einer Chromleiste rahmen lassen. Im Regal aus schwarz lasierter Esche stand seine Sammlung von Büchern über Reggie: »Rillington Place Nummer zehn«, »John Reginald Halliday Christie«, »Der Christie-Mythos«, »Mord am Rillington Place« und »Christie und seine Opfer«, um nur einige zu nennen. Die Verfilmung von »Rillington Place Nummer zehn« mit Richard Attenborough besaß er auf Video und auf DVD. Eines fand er wirklich empörend: Von allen möglichen Hollywoodfilmen kamen laufend Remakes heraus, aber hiervon? Nicht die Bohne. Das Videoband lief oft, noch besser war aber die digitale Version, klarer und leuchtender in den Farben. Richard Attenborough war wunderbar, dagegen gab es nichts zu sagen, auch wenn er Reggie nicht allzu ähnlich sah. Man bräuchte einen größeren Schauspieler mit markanteren Gesichtszügen und glühenden Augen.
Mix neigte zu Tagträumen. Manchmal spekulierte er dar-über, wodurch er berühmt werden würde: durch seine Beziehung zu Nerissa oder durch sein umfassendes Wissen über Reggie? Unter den heutigen Zeitgenossen gab es wahrscheinlich keinen größeren Kenner dieser Materie. Nicht einmal Ludovic Kennedy, der Verfasser des wichtigsten Buches zu diesem Thema, könnte ihm das Wasser reichen. Vielleicht wäre es seine Lebensaufgabe, das Interesse am Rillington Place und an seinem berühmtesten Bewohner neu zu entfachen, auch wenn es ihm nach dem heutigen Nachmittag noch schleierhaft war, wie man das würde bewerkstelligen können. Selbstverständlich würde er dafür eine Lösung finden. Vielleicht würde er selbst ein Buch über Reggie schreiben, garantiert ohne die üblichen schwachsinnigen Kommentare über den bösartigen verdorbenen Charakter dieses Mannes. Sein Buch würde die Aufmerksamkeit auf den Mörder als Künstler lenken.
Es war kurz vor sechs Uhr. Mix gönnte sich seinen Lieblingsdrink, den er selbst erfunden und wegen seiner brutalen Wirkung »Boot Camp« getauft hatte. Sonderbar, dass bisher offensichtlich keiner, dem er ein Glas davon angeboten hatte, seine Vorliebe für einen doppelten Wodka mit einem Glas Sauvignon und einem Löffel voll Cointreau über gestoßenem Eis teilte. Er besaß einen Kühlschrank, der gestoßenes Eis fix und fertig ausspuckte. Er genoss den ersten kleinen Schluck, da läutete sein Handy.
Es war Colette Gilbert-Bamber, die ihm mitteilte, sie wolle unbedingt ihren Heimtrainer repariert haben. Vielleicht läge es nur am Stecker; es könnte aber auch etwas Größeres sein. Ihr Mann sei nicht da, aber sie hätte daheimbleiben müssen, weil sie einen wichtigen Anruf erwartete. Mix wusste, was dahintersteckte. Trotz der Fernliebe zu seinem Star, seiner Königin und Herzensdame, durfte er sich ab und zu ruhig ein bisschen Spaß gönnen. Das würde sich grundlegend ändern, wenn er und Nerissa erst einmal ein richtiges Paar wären.
Mix stellte seinen Boot Camp in den Kühlschrank, mit leisem Bedauern zwar, aber ihm war klar, was Vorrang hatte. Er putzte sich die Zähne, gurgelte mit einem Mundwasser, das fast wie sein Cocktail schmeckte, nur leider den Kick vermissen ließ, und machte sich auf den Weg nach unten. Hier drinnen im Haus würde man nie vermuten, wie strahlend schön es draußen war, wie heiß die Sonne schien. Hier war es immer kalt und seltsam still, tagaus, tagein. Hier hörte man weder etwas von den U-Bahn-Linien Hammersmith und City, die zwischen Latimer Road und Shepherd’s Bush oberirdisch fuhren, noch vom Verkehr auf dem Ladbroke Grove. Nur vom Westway drangen Geräusche herüber, die allerdings nur ein Eingeweihter als Verkehrslärm einordnen würde. Es klang wie am Meer, als würden sich Wellen am Ufer brechen, oder so, als ob man sich eine große Muschel ans Ohr hielte: ein leises unaufhörliches Rauschen.
In letzter Zeit konnte Gwendolen Kleingedrucktes manchmal nur mit Hilfe einer Lupe entziffern. Leider waren die meisten Bücher, die sie lesen wollte, in einer Schriftgröße gedruckt, die man ihres Wissens als Zehn-Punkt bezeichnete. Ihre normale Brille war beispielsweise mit Papas Ausgabe von »Verfall und Untergang des Römischen Reiches« genauso überfordert wie mit ihrer derzeitigen Lektüre, einer uralten Ausgabe von George Eliots »Middlemarch« aus dem neunzehnten Jahrhundert.
Der Salon erstreckte sich, wie ihr darüberliegendes Schlafzimmer, über die ganze Tiefe des Hauses. Nach vorne gingen zwei große Schiebefenster auf die Straße hinaus, während hinten Verandatüren in den Garten führten. Zum Lesen machte es sich Gwendolen auf einem mit braunem Cordsamt gepolsterten Sofa bequem, dessen Rückenlehne ein geschnitzter Mahagonidrache krönte. Der Schwanz des Drachen schlängelte sich über das halbe Sofa bis zu einer der Armlehnen hinunter, während der hoch erhobene Kopf den schwarzen Marmorkamin anfauchte. Die meisten Möbel sahen ziemlich ähnlich aus: geschnitzt, dick gepolstert und mit braunem, mattgrünem oder weinrotem Samt bezogen. Dazwischen standen einige Stücke aus dunkel geädertem Marmor mit vergoldeten Füßen herum. An der einen Wand hing in einem vergoldeten Rahmen, der über und über mit Blättern, Früchten und Schnörkeln verziert war, ein riesiger Spiegel, der im Laufe der Zeit und infolge mangelnder Pflege trüb geworden war.
Im warmen Abendlicht standen die Verandatüren zum Garten hinaus offen, der in Gwendolens Augen immer noch so aussah wie einst: Der kurz gemähte Rasenteppich erinnerte an smaragdgrünen Samt, Blumen leuchteten ringsum in den Rabatten, und die kunstvoll geschnittenen Bäume prangten im üppigen Laub. Nein, so sah sie den Garten nicht wirklich, aber so könnte er mit wenig Aufwand wieder sein. Ein Tag Arbeit – und alles wäre wieder beim Alten. Für das kniehohe Gras, die mit Unkraut überwucherten Blumenbeete und die durch totes Geäst ruinierten Bäume hatte sie keinen Blick. Das gedruckte Wort war für sie realer als eine gemütliche Einrichtung und ein gepflegtes Grundstück.
Aber hin und wieder waren auch ihre Gedanken und Erinnerungen stärker als das Buch. Dann legte sie es weg, starrte nachdenklich die mit Spinnweben überzogene, braun gewordene Decke und die verstaubten Glasprismen am Kronleuchter an und rief sich Vergangenes in ihr Gedächtnis zurück.
Diesen Menschen, diesen Cellini, konnte sie nicht ausstehen, aber das war nicht sonderlich wichtig. Ihre kurze Konversation mit ihm hatte in ihr schlafende Dinge geweckt: Christie und seine Morde, den Rillington Place, Dr. Reeves und Bertha. Die Geschichte musste mindestens zweiundfünfzig Jahre her sein, vielleicht sogar dreiundfünfzig. Damals war der Rillington Place ein schäbiges Elendsviertel gewesen, wo die Eingangstüren der Häuserzeile direkt auf die Straße hinausgingen und am Straßenende der hohe Schlot einer Eisengießerei aufragte. Bis zu ihrem Besuch dort hatte sie nicht einmal gewusst, dass es solche Orte gab. Sie hatte ein behütetes Leben geführt – vorher und nachher. Bertha hatte sicher geheiratet. Das machte diese Sorte Leute doch immer. Hatte vermutlich Kinder wie die Orgelpfeifen, von denen das Älteste sie ins Unglück gestürzt hatte. Inzwischen müssten auch diese längst erwachsen sein.
Warum verhielten sich Frauen so? Das hatte sie nie begriffen. Sie war nie in Versuchung geraten, nicht einmal bei Dr. Reeves, für den sie immer nur keusche und ehrbare Gefühle gehegt hatte, wie umgekehrt auch er. Davon war sie trotz seines späteren Verhaltens überzeugt. Vielleicht hatte sie letztlich doch den besseren Weg gewählt.
Was machte Christie für Cellini dermaßen interessant? Es zeugte von keiner gesunden Geisteshaltung. Gwendolen nahm wieder ihr Buch zur Hand. In einem anderen Roman von George Eliot – »Adam Bede« – kam ein Mädchen vor, das sich wie Bertha verhalten und ein schreckliches Ende genommen hatte. Ganz versunken las sie noch eine halbe Stunde weiter und hatte nur noch Augen für die Buchseite vor ihr. Über ihrem Kopf ließen sich Schritte vernehmen. Sie wurde hellwach.
Im Gegensatz zu ihrer nachlassenden Sehkraft hatte Gwendolen ein ausgezeichnetes Gehör, und das nicht nur für eine Frau ihres Alters, sondern für alle Altersstufen. Ihre Freundin Olive Fordyce war überzeugt, Gwendolen könne eine Fledermaus quietschen hören. Jetzt lauschte sie angespannt. Er ging soeben die Treppe herunter. Zweifellos bildete er sich ein, sie wüsste nicht, dass er die Schuhe auszog, um heimlich, still und leise kommen und gehen zu können. So leicht ließ sie sich nicht hinters Licht führen. Der unterste Treppenabsatz knarrte. Dagegen war er machtlos, schoss es ihr triumphierend durch den Kopf. Sie hörte ihn durch die Eingangshalle tappen, doch dann knallte er die Haustür dermaßen heftig zu, dass das ganze Haus wackelte. Von der Zimmerdecke blätterte ein weißlicher Farbfetzen ab und landete auf ihrem linken Fuß.
Sie trat an eines der Vorderfenster und sah ihn in sein Auto steigen, einen blauen Kleinwagen, den er ihrer Meinung nach völlig absurd auf Hochglanz trimmte. Kaum war er fort, ging sie in die Küche hinaus, öffnete eine betagte, nie benutzte Wäscheschleuder und zog ein ehemaliges Kartoffelnetz voller Schlüssel heraus. Obwohl keiner mit einem Anhänger versehen war, wusste sie ganz genau, wie der gesuchte aussah und welche Farbe er hatte. Sie steckte den Schlüssel in die Tasche ihrer Strickjacke und machte sich auf den Weg nach oben.
Der Aufstieg dauerte lange, doch daran war sie gewöhnt. Trotz ihrer mehr als achtzig Jahre war sie dünn und kräftig und in ihrem ganzen Leben noch keinen Tag krank gewesen. Natürlich konnte sie nicht mehr so schnell Treppen steigen wie vor fünfzig Jahren, aber das konnte man schließlich auch nicht mehr erwarten. Mitten auf dem obersten Treppenabsatz saß Otto und zerlegte genüsslich irgendein kleines Säugetier. Sie kümmerten sich nicht umeinander. Die Abendsonne ließ das Isabellafenster hell aufleuchten. Da draußen kein Wind übers Glas strich, zeichnete sich auf dem Boden ein fast perfektes Farbbild von dem Mädchen und dem Basilikumtopf ab, ein rundes Mosaik aus roten, blauen, purpurfarbenen und grünen Flecken. Bewundernd blieb Gwendolen stehen. So klar und ruhig sah man dieses Abbild wirklich selten.
Trotzdem gönnte sie sich nur eine Minute, dann steckte sie ihren Schlüssel ins Schloss und betrat Cellinis Wohnung.
Überall nur weiß gestrichene Wände. Wie unklug, dachte sie, da sieht man doch jeden Fleck. Und Grau war eine schrecklich kalte und harte Möbelfarbe. Beim Betreten seines Schlafzimmers fragte sie sich, warum er eigentlich mühsam sein Bett machte, wenn er es abends doch wieder aufdecken musste. Alles war deprimierend ordentlich. Höchstwahrscheinlich litt er an dieser Krankheit, über die sie etwas in einer Zeitung gelesen hatte, an Ordnungszwang. Die Küche sah genauso schlimm aus, wie eine Musterküche auf der Schöner-Wohnen-Ausstellung, in die sie Olive in den achtziger Jahren unbedingt hatte zerren müssen. Ein Plätzchen für alles, und alles an seinem Platz. Kein Päckchen auf der Arbeitsfläche, nicht eine Büchse, und nichts im Spülbecken. Wie konnte jemand so leben?
Sie öffnete die Kühlschranktür, hinter der es herzlich wenig Essbares zu sehen gab. Nur im Türregal standen zwei Weinflaschen, und ganz vorne, im mittleren Fach, ein fast volles Glas mit einer Flüssigkeit, die an leicht gefärbtes Wasser erinnerte. Nein, kein Wasser, ganz bestimmt nicht. Hieß das, er trank? Es überraschte sie nicht sehr. Auf dem Rückweg ins Wohnzimmer blieb sie vor dem Bücherregal stehen. Bücher zogen sie stets magisch an, egal welche. Hier stand nicht die von ihr bevorzugte Lektüre herum. Vielleicht sollte niemand so etwas lesen. Bis auf ein Buch mit dem Titel »Sex für Männer im einundzwanzigsten Jahrhundert« hatten alle nur ein Thema: Christie. Über vierzig Jahre hatte sie an diesen Mann kaum einen Gedanken verschwendet, und heute schien sie nicht mehr von ihm loszukommen.
Dahinter verbarg sich wohl noch eine Zwangsneurose von Cellini. Je mehr ich die Menschen kenne, umso lieber sind mir die Bücher. Mit diesem Zitat ihres Vaters auf den Lippen ging Gwendolen hinunter in die Küche, wo sie sich ein Glas Orangensaft und ein Käse-Gurken-Sandwich holte, das sie bereits fertig belegt in dem Laden am Eck gekauft hatte. Damit begab sie sich wieder zum Drachensofa und versank erneut in »Middlemarch«.
2______
Das ganze Viertel zwischen dem Westway im Norden und dem nahe gelegenen Wormwood Scrubs mit seinem Gefängnis war insgesamt ein seltsames Fleckchen Erde, an das sich Mix noch nicht gewöhnt hatte: ein Gewirr aus verschlungenen Gässchen mit Villen, Zweckbauten, hässlichen Reihenhauszeilen aus der viktorianischen Epoche, neugotischen Gebäuden, die mehr an Kirchen erinnerten als an Wohnhäuser, raffiniert gestaffelten Cottages, die aussehen sollten, als stünden sie schon seit zweihundert Jahren hier, an den Ecken Tante-Emma-Läden, TÜV-Prüfstellen, Garagen, Andachtshäuser, echte Kirchen für Katholiken wie für Mormonen sowie Oblaten- und Karmeliterklöster. Die Bevölkerung dieses Stadtteils bestand aus Familien, die schon immer hier gelebt hatten, und solchen, deren Vorfahren aus Freetown, Goa, Vilnius, Beirut und Aleppo stammten.
Auch das Ehepaar Gilbert-Bamber wohnte in West Eleven, allerdings im exklusiven Schickeriabereich. Ihr Haus am Lansdowne Walk war nicht so groß wie das von Miss Chawcer, dafür machte es mit seiner korinthischen Säulenreihe, die sich über die ganze Vorderfront hinzog, und den mit Büschen bepflanzten Ziervasen auf den Balkonen einen imposanteren Eindruck. Die Fahrt dorthin dauerte nicht mehr als fünf Minuten. Weitere fünf brauchte Mix, um sein Auto an einer Parkuhr abzustellen, was nach achtzehn Uhr dreißig nichts kostete. Beim Öffnen der Tür warf ihm Colette einen aufreizenden, wenn auch gänzlich überflüssigen Blick zu. Schließlich kannten beide den eigentlichen Grund ihres Anrufs und seines Besuchs. Er dagegen gab sich betont förmlich, während er mit seinem Werkzeugkoffer lächelnd hereinspazierte und meinte, wenn er sich richtig erinnere, ginge es nach oben.
»Natürlich erinnern Sie sich noch richtig«, kicherte Colette.
Wieder eine Treppe, aber diese hatte breite, flache Stufen, und außerdem ging es nur einen Absatz hinauf. »Wie geht’s denn Miss Nash?«
Dieser Satz würde ihr nicht gefallen, das wusste er, und so war es auch. »Sicher gut. Ich habe sie schon mehrere Wochen nicht gesehen.«
Bei den Gilbert-Bambers hatte er Nerissa Nash zum ersten Mal getroffen, besser gesagt, sie war ihm »erschienen«. Bis dorthin hatte er die schlanke Colette mit der langen blonden Mähne und den vollen Lippen für eine Schönheit gehalten, obwohl sie ihm von ihren Collagenimplantaten erzählt hatte. Zwischen den beiden Frauen gab es einen Unterschied wie zwischen einem Hollywoodstar und der hübschesten Sekretärin im Büro.
Colette ging ins Schlafzimmer voraus. Ihr sogenannter Fitnessraum war lediglich ein begehbarer Kleiderschrank, den man ursprünglich für den Herrn des Hauses direkt neben dem Bad gebaut hatte.
»Wenn er vögeln wollte, hat er bei ihr angeklopft«, hatte Colette erklärt. »Waren damals alles schräge Vögel. Das gleiche Wort, ist das nicht witzig?«
Jetzt bestand das Mobiliar aus Heimtrainer, Stepper, Fitnessbike und Ellipsentrainer. Außerdem standen ein Hantelständer, eine aufgerollte Yogamatte, ein türkiser, aufblasbarer Ball herum und ein jungfräulicher Kühlschrank, der noch nie so etwas wie einen Boot Camp gesehen hatte und nur Mineralwasser mit Kohlensäure enthielt. Auf den ersten Blick erkannte Mix, warum der Heimtrainer nicht anspringen wollte, und Colette vermutlich auch. Schließlich war sie nicht blöd.
Die Maschine verfügte über einen Sicherheitsmechanismus in Form eines Steckschlüssels, der in einen Schlitz am Heimtrainer passte. Am Schlüssel hing eine Schnur mit einem Karabinerhaken, den man während der Übungen an der Kleidung befestigen sollte. Bei einem Sturz würde der Schlüssel herausgezogen und der Motor unterbrochen. Mix hielt den Schlüssel hoch.
»Sie haben ihn nicht reingesteckt.«
»Sagte die Schauspielerin zum Bischof.«
Diese Antwort war für ihn ein uralter Hut. Schon sein Stiefvater hatte diesen Spruch vor gut zwanzig Jahren zitiert. »Erst wenn der Schlüssel steckt, springt er an«, sagte er ungerührt. Er wollte sie spüren lassen, dass sie in seinen Augen nicht witzig klang. Trotzdem, beschweren konnte er sich nicht. Schließlich bekam er für seinen Besuch fünfzig Pfund Notfallzulage.
Er schob den Schlüssel hinein und startete die Maschine, bis sie auf Hochtouren lief. Dann schmierte er ein bisschen Öl unter die Pedale, um die Sache ein wenig hinauszuzögern. Warum sollte alles nach ihrer Nase gehen? Colette schaltete den Apparat eigenhändig ab und führte ihn ins Schlafzimmer zurück. Manchmal fragte er sich, was passieren würde, wenn der ehrenwerte Hugo Gilbert-Bamber unerwartet zurückkäme. Doch dann könnte er immer noch in seine Klamotten springen und sich mit Schraubenzieher und Ölkännchen unter die Geräte verziehen.
Mix wollte unbedingt berühmt werden. Seiner Meinung nach wünschte sich heutzutage jeder Mensch ein Leben wie die Stars. Auf der Straße mit der Bitte um ein Autogramm angehalten werden, nur inkognito verreisen, das eigene Foto in den Zeitungen wiederfinden, dauernd von Journalisten um Interviews angebettelt und in Klatschspalten zitiert werden, Fans haben, die wilde Gerüchte über irgendwelche Bettgeschichten verbreiten. Eine Sonnenbrille aufsetzen, wenn man unerkannt bleiben will, nur Limousinen mit getönten Scheiben benutzen. Einen persönlichen PR-Manager und vielleicht sogar Max Clifford als Agenten haben.
Am besten wäre man wegen einer Tat berühmt, die den Leuten gefällt, oder weil man angebetet wird, so wie Nerissa Nash von ihm. Allerdings wäre es auch nicht übel, ein berühmt-berüchtigter Verbrecher zu sein. Wie fühlte man sich, wenn einen die Polizei mit einem Mantel über dem Kopf aus dem Gerichtsgebäude geleitet, weil einen die Menschenmenge sonst in Stücke reißen würde? Ein Attentat sorgte für ewigen Nachruhm. Man musste nur an den Mörder John Lennons oder Präsident Kennedys denken oder an Princip, der den österreichischen Erzherzog erschossen und den Ersten Weltkrieg ausgelöst hatte. Andererseits wäre man als ständiger Begleiter von Nerissa Nash doch besser dran und lebte vor allem erheblich sicherer. So eine Position würde ihn schnell selbst zum Star machen. Man würde ihn zu Talkshows ins Fernsehen und auf Partys bei den Beckhams und bei Madonna einladen.
Colette war selbst Model gewesen, wenn auch in einer anderen Kategorie. Die Ehe mit einem Börsenmakler hatte ihre Karriere beendet. Trotzdem war sie weiterhin eng mit Nerissa befreundet. Mix hatte sich damals ganz offiziell im Fitnessraum aufgehalten, dem ehemaligen Ankleidezimmer, und am Heimtrainer ein neues Laufband eingezogen. Andere Dinge kamen nicht in Frage, da ein Leihkoch im Haus war, um für Nerissa und Colette einen Lunch zusammenzustellen. Die beiden Frauen kamen ins Schlafzimmer, weil Colette ihrer Freundin unbedingt eine neue Kreation zeigen wollte, die sie für eine astronomische Summe in einer Boutique in Notting Hill gekauft hatte. Flüstern und Kichern drang zu Mix her-über. Irgendwie bildete er sich ein, er habe gehört, wie Nerissa Colette warnte, sie solle beim Ausziehen vorsichtig sein, weil doch gleich nebenan im Fitnessraum »dieser Mann« sei.
Mix kannte Colettes Benehmen und ihre Vorlieben gut genug und wusste, dass es sie nicht einmal stören würde, wenn fünfzig Männer sie mit offenem Mund vom Fitnessraum aus durch die Glastür anstarren würden. Sie würde das genießen. Trotzdem bewunderte er Nerissas Zurückhaltung. So etwas fand man heutzutage nicht mehr allzu oft. Bis zu diesem Tag hatte er lediglich ab und zu ein Foto von ihr in der Boulevardpresse gesehen. Ihre Stimme klang so hübsch und sie lachte so glockenhell, dass er jetzt wild entschlossen war, sie leibhaftig zu sehen. Dazu benutzte er einen Trick, den er immer dann einsetzte, wenn er unbedingt die Dame des Hauses sprechen musste. Er räusperte sich ziemlich laut und rief dann: »Mrs. Gilbert-Bamber, sind Sie da?«
Statt einer Antwort kicherte Colette nur. Also verlor er keine Zeit mehr und spazierte ins Schlafzimmer. Außer einem knallroten BH und einem Stringtanga hatte Colette nichts an, aber schließlich hatte er schon mehr von ihr gesehen. Wie er zu sagen pflegte: Das kümmerte ihn nicht die Bohne. Außerdem hatte er nur noch Augen und Ohren für Colettes Freundin. Dass sie die schönste Frau war, die er je gesehen hatte, wäre noch untertrieben gewesen. Blitzartig wurde ihm bewusst, dass alle gut aussehenden Frauen lange schwarze Haare, goldene Rehaugen und eine Haut wie Cappuccino haben müssten. Obendrein hatte sie eine umwerfende Figur, war groß und hatte eine graziöse Haltung. Er hatte mit einer hochmütigen Miene gerechnet und nicht mit einem warmen, liebenswürdigen Ausdruck. Als sie lächelnd »Hi« sagte, war er restlos verloren.
Von nun an sammelte er in seinen Alben jedes Foto von ihr, das ihm unter die Augen kam. Einmal entdeckte er sogar in einem Touristenladen in Shepherd’s Bush ihr Porträt auf einer Postkarte. Bei jeder Filmpremiere wartete er, manchmal stundenlang, auf dem Gehsteig vor dem Kino, um einen kurzen Blick auf sie zu erhaschen, wenn sie aus dem Wagen stieg. Einmal wurde seine Geduld reichlich belohnt. Er hatte sich einen Platz ganz vorne in der ersten Fanreihe gesichert. Als man ihr beim Aussteigen half, schlang sie eine weiße Pelzstola um ihr durchsichtiges gelbes Hängekleid und schenkte ihm ein strahlendes Lächeln. Hatte sie ihn wiedererkannt?
In einer seiner Fantasien saß er mit ihr in einem Club allein an einem Tisch. Ihre Blicke konnten sich nicht voneinander lösen. Da kam ein Pressefotograf auf sie zu und dahinter gleich noch einer. Nerissa lächelte erst die Fotografen an, dann ihn, und flüsterte: »Küss mich.« Und das tat er. Es war die wunderbarste Umarmung seines Lebens, die das Blitzlichtgewitter und die anfeuernden Rufe der Paparazzi noch reizvoller machten. Am nächsten Tag stand ihr Kuss in allen Zeitungen, und er malte sich erregende Schlagzeilen aus: »Nerissa und ihr neuer Lover« und »Nerissa besiegelt ihre Liebe mit einem Kuss«. Und ihn würde man als »Michael Cellini, den angesehenen Kriminologen« vorstellen.
Unterdessen bekam er sie und ihren goldenen, köstlich gebauten Leib nie leibhaftig zu Gesicht, obwohl er mehrmals vor ihrem Haus am Campden Hill Square gewartet hatte, um sie wenigstens einmal flüchtig am Fenster zu sehen. Colette hatte ihm Nerissas Wohnsitz verraten, wenn auch widerwillig. Er hatte von ihr wissen wollen, ob Nerissa zu Hause irgendwelche Fitnessgeräte hätte.
»Sie geht ins Fitnessstudio.«
»In welches?«, fragte er, wobei er sie zärtlich in den Nacken biss, wie sie es gerne hatte.
»Vermutlich ganz in der Nähe. Wieso willst du das wissen?«
»Reine Neugier«, sagte er.
Eines war ihm klar: Er musste ihr nachgehen, auch wenn das nach Stalking roch, was er in Verbindung mit Nerissa unbedingt vermeiden wollte. Nur ein einziges Mal würde er ihr nachgehen. Sobald er das Fitnessstudio gefunden hätte, würde er dort Mitglied werden. Er war nicht so fit, wie er es in seinem Job sein sollte, und ihr Studio war so gut wie alle anderen. Warum also nicht?
Seit neun Jahren arbeitete er bei Fiterama, davon acht und ein paar Tage in der Birminghamer Filiale. Als er nach London gekommen war und sich nach einer Wohnung umsah, hatte er für einige Zeit ein Zimmer in Tufnell Park gemietet. Gleich um die Ecke lag Hilldrop Crescent, eine Straße, die ihn faszinierte. Obwohl dort der Frauenmörder Dr. Crippen gewohnt hatte, der seine Frau in Einzelteilen unter dem Parkett versteckt hatte, hatte man diese Straße nicht umbenannt. Mix hatte nie etwas über Crippen gelesen. Dieses Verbrechen lag so lange zurück – noch vor dem Ersten Weltkrieg – und war praktisch uralter Schnee von gestern. Dann sah er im Fernsehen eine Sendung über Verbrecher, die man mit Hilfe des Radios gefasst hatte. Crippen war der erste gewesen. So erfuhr er auch dessen damaligen Wohnsitz. Andere würden eine solche Information angewidert oder einfach desinteressiert aufnehmen, aber nicht so Mix. Er war ganz aufgeregt und nahm die betreffende Lokalität selbst in Augenschein. Als er merkte, dass das Haus verschwunden war und an seiner Stelle neue Bauten standen, bekam er einen Vorgeschmack auf jene Enttäuschung, mit der er später wesentlich verbitterter auf die Zerstörung des Rillington Place reagierte.
An allem war dieser Film schuld gewesen, den er im alten Schwarz-Weiß-Fernseher seiner Mutter gesehen hatte. Damals wohnte er noch zu Hause. Obwohl er nie ein großer Leser gewesen war, hatte er ein Buch, das ihm zum Film passend erschien, wie er sich einbildete, in einem Ständer vor einem Trödelladen entdeckt. Beim Anblick der Fotos erlebte er die eigentliche Überraschung: John Reginald Halliday Christie sah weniger wie Attenborough aus, sondern viel eher wie – Mix. Natürlich war Mix viel jünger und trug keine Brille. Um die Ähnlichkeit zu bestätigen, zwang er sich zu einem langen Blick in den Spiegel. Seltsam, diese Äußerlichkeit schien ihm den Massenmörder näherzubringen, denn seither nannte er ihn insgeheim nur noch Reggie und nicht mehr Christie. Warum auch nicht? So schreckliche Untaten hatte er nun auch wieder nicht begangen. Was hatte die Welt schon verloren? Einen Haufen nutzloser Weiber, Nutten und Dirnen.
Reggie – das klang nett, irgendwie warm und freundlich. Als Mix im Laufe seiner Lektüre merkte, dass Reggie bei den Leuten beliebt gewesen war, dass sie zu ihm aufgeschaut und ihn bewundert hatten, war er nicht überrascht. Sie hatten die Macht erkannt, die dieser Mann besaß. Und genau das schätzte Mix an ihm: dass er ein starker Mann war. Er hätte einen guten Vater abgegeben. Er hätte seinen Kids keinen Unfug durchgehen lassen, aber er hätte sie auch nicht verprügelt. Das lag nicht in Reggies Art. Wie jeden Tag dachte Mix flüchtig an Javy. Wenn es nach Mix gegangen wäre, hätten Frauen ihren Kindern keine Stiefväter andrehen dürfen.
Auf der Heimfahrt von Colette fiel ihm wieder die verblüffende Bemerkung der alten Chawcer ein. Sie war tatsächlich bei Reggie zu Hause gewesen. Sie hatte Reggie getroffen. Der junge Mix hatte das Gefühl, als hätte Reggie vor ganz langer Zeit gelebt, sozusagen in grauer Vorzeit, ganz im Gegensatz zur alten Chawcer. Und das begriff er auch irgendwie. Sie musste über achtzig sein. Als Reggie am Rillington Place gewohnt hatte, war sie dementsprechend noch jung gewesen, fast noch ein Mädchen. Was stand gleich noch in allen Büchern? Was wusste jeder, der sich dafür interessierte? Reggie hatte sich als Arzt für Abtreibungen ausgegeben und so seine Opfer in sein Haus gelockt. Also deshalb war sie zu ihm gegangen. Etwas anderes kam nicht in Frage.
Als junger Mensch aus dem 21. Jahrhundert bildete Mix sich ein, alles wäre immer so gewesen wie jetzt und die Jugendzeit der alten Chawcer hätte sich in puncto Sex kaum von seiner eigenen unterschieden: Liebesaffären, flüchtige Abenteuer und möglichst oft Sex. Die alte Chawcer hätte eben nicht aufgepasst und wie die heutige Jugend die Pille vergessen, und schon hätte sie in der Bredouille gesteckt. Von Gesetzen hatte Mix so gut wie überhaupt keine Ahnung. Seine Rechtskenntnisse beschränkten sich darauf, in welchem Umfang Hersteller und Händler von Fitnessgeräten für die Sicherheit ihrer Produkte haftbar waren. Von Gesetzen zur Legalisierung von Abtreibungen hatte er nie etwas gehört. Er vermutete nur, dass man in der Jugend der alten Chawcer wohl nicht einfach hätte ins Krankenhaus gehen und die Sache erledigen lassen können. Logisch, sonst hätte Reggie ja nichts zu tun gehabt.
Eine entscheidende Frage blieb dabei offen: Warum war sie fünfzig Jahre danach immer noch quietschlebendig, obwohl sie sich in seine Hände begeben hatte? Vielleicht würde er nie eine Antwort bekommen, aber er hätte es nur allzu gern herausgefunden.
In seiner Wohnung war kaum ein Laut zu hören. Von seinen Fenstern sah er Teile von Flachdächern und Giebeln und den wilden ungepflegten Garten hinten am Haus. Bis auf einen Garten mit gemähtem Rasen und Rosenbeeten gab es hier unten nur Wildwuchs. In den meisten Nächten sah er nach Einbruch der Dunkelheit, wie zwei leuchtend grüne Augen aus dem dichten Efeu, der ungehindert über Wände und Spalier kletterte, zu ihm heraufstarrten. Die alte Chawcer ging vermutlich früh schlafen. Da es sich um ein frei stehendes Haus handelte, drang von den Nachbarn nie ein Laut herüber. Nur wer nach vorne hinaus schlief, würde vielleicht mitunter von dem schrillen Geplärr und dem dumpfen Wummern geweckt, das aus Autoradios drang und in London jetzt in war, wie man ihm erzählt hatte. Hier hinten, wo er wohnte, wurde man nur selten gestört. Als Kind der heutigen Zeit, das obendrein in einem hellhörigen Sozialbau aufgewachsen war, hätte er nichts dagegengehabt, wenn sich das Leben draußen ab und zu lautstark gemeldet hätte. Hier vergingen die stillen Stunden, als hätten einen Zeit und Welt restlos vergessen. Die einzige Ausnahme bildete der Westway, der wie ein grauer Riesentausendfüßler auf hundert Betonbeinen über das westliche London hinwegstakste. Auf seinem Rücken herrschte ständig Bewegung. Von hier kam dieses Meeresrauschen.
Er öffnete den Kühlschrank. Als zwanghaft ordentlicher Mensch bildete er sich ein, er hätte seinen Boot Camp genau mitten im mittleren Fach abgestellt, etwa fünf Zentimeter hinter der Kühlschranktür. Dass er das Glas auf der linken Seite abgestellt hatte, wo es gegen einen Schokoriegel drückte, sah ihm ganz und gar nicht ähnlich. Nachdenklich nippte er an seinem Getränk. Dafür gab es nur eine Erklärung: Beim Weggehen hatte er es wohl sehr eilig gehabt.
Mit seinem halb leeren Drink stand er vor Nerissas Foto und sagte zu ihm, besser gesagt, zu ihr: »Ich liebe dich, ich verehre dich.« Er hob sein Glas und prostete ihr zu. »Du weißt, dass ich dich anbete.«
3______
Gwendolen Chawcers Großvater väterlicherseits hatte 1860 den Familiensitz in der St. Blaise Avenue gebaut. Damals besaß Notting Hill eine ländliche Struktur mit viel freiem Platz und neuen Gebäuden und galt als gesunde Wohngegend. Bis zu den ersten Plänen für den Westway sollten noch hundert Jahre vergehen, und erst drei Jahre später wurde mit dem ersten Bauabschnitt der Londoner U-Bahn begonnen, mit der Metropolitan Railway von der Baker Street nach Hammersmith. Wo es später eine Straße namens Rillington Place geben sollte, lag offenes Land. Gwendolens Vater, der Herr Professor, wurde im St. Blaise House in den achtzehnhundertneunziger Jahren geboren, sie selbst in den zwanziger Jahren des zwanzigsten Jahrhunderts.
Mit der Gegend ging es immer weiter bergab. Hier konnte man billig leben, und so zogen in den fünfziger Jahren Einwanderer ins schäbige North Kensington, nach Kensel Town, an den Powis Square und in die Golborne Road. Ein Mann aus der Karibik entdeckte die erste Leiche im Fall Christie, als er in seiner neuen Wohnung eine Wand einriss. In den nächsten zwei Jahrzehnten lebten hier Hippies und andere Blumenkinder. Der Ladbroke Grove, den sie liebevoll nur »den Grove« nannten, war ein untrennbarer Bestandteil ihres Lebens. Sie trugen indische Baumwollstoffe und züchteten in ihren möblierten Zimmern und Mietwohnungen Cannabis in Schränken mit eingebauten Strahlern, die ultraviolettes Licht abgaben. Hier keimte die Idee von der Welt als Dorf.
Von alledem hatte Miss Chawcer nicht die geringste Ahnung. Sie, die im St. Blaise House geboren wurde, hatte keine Geschwister und wurde zu Hause von Professor Chawcer unterrichtet, der an der Londoner Universität einen Lehrstuhl für Philosophie hatte. Als sie Anfang dreißig war, starb ihre Mutter. Der Professor war entschieden dagegen gewesen, dass sie irgendeinen Beruf ergriff, und etwas, wogegen der Herr Professor Einwände hatte, kam nicht in Frage. Denn alles geschah stets nach seinem Belieben. Irgendjemand musste sich schließlich um ihn kümmern. Das Dienstmädchen hatte gekündigt und geheiratet, und natürlich übernahm Gwendolen dessen Position.
Sie führte ein merkwürdiges, wenn auch durchaus gesichertes Leben. Vermutlich kann ein Leben ohne Angst, Hoffnung, Leidenschaft, Liebe, Veränderung oder Geldnöte gar nicht anders ablaufen. Das dreistöckige Haus mit dem grandiosen Treppenhaus über vier Stiegen war riesengroß. Quadratische Dielen oder lange Flure führten zu zahllosen Räumen. Als kaum mehr Aussicht auf eine Heirat Gwendolens bestand, ließ ihr Vater drei Zimmer im obersten Stock für sie zu einer abgeschlossenen Wohnung mit Diele, zwei Zimmern und einer Küche umbauen. Trotzdem verspürte sie nur wenig Neigung, hier einzuziehen, was nichts mit dem fehlenden Badezimmer zu tun hatte. Warum sollte sie sich dort oben aufhalten, während drunten im Salon ihr Vater irgendwie immer Appetit auf seine Mahlzeiten oder auf eine Tasse Tee hatte? Seither hatte sie eine Abneigung gegen den obersten Stock und betrat ihn nur, wenn sie etwas verloren und bereits alle dafür in Frage kommenden Plätze abgesucht hatte.
Der Rest des Hauses hatte nie einen Maler gesehen, ganz zu schweigen von irgendwelchen technischen Neuerungen. Nicht einmal elektrische Leitungen hatte man überall verlegt. In den achtziger Jahren musste das ganze Haus neu verkabelt werden; die vorhandenen Leitungen waren lebensgefährlich gewesen. Man hatte die alten Kabel herausgerissen und neue installiert, aber die dadurch entstandenen Löcher in den Wänden lediglich mit Gips zugeschmiert. Sonst wurde nichts renoviert. Gwendolen war nach ihren eigenen Aussagen nicht allzu putzsüchtig. Putzen langweilte sie. Sie war am glücklichsten, wenn sie dasitzen und lesen konnte. Sie hatte Tausende Bücher gelesen und tat nur gezwungenermaßen etwas anderes. Ihre Lebensmittel besorgte sie sich, solange es ging, in den traditionellen Geschäften. Als das Gemüsegeschäft, der Metzger und der Fischhändler verschwanden, ging sie in die neuen Supermärkte, ohne sich einer größeren Veränderung bewusst zu sein. Sie maß dem Essen keine sonderliche Bedeutung bei und hatte ihre Kochgewohnheiten seit ihrer Mädchenzeit mit einer Ausnahme nur wenig verändert: Da niemand für sie kochte, aß sie kaum etwas Warmes.
Nach dem Mittagessen gönnte sie sich täglich ein wenig Ruhe. Sie legte sich hin und schlief beim Lesen ein. Sie hatte ein Radio, aber keinen Fernseher. Das Haus war voller Bücher: Fachliteratur, antiquierte Romane, alte, gebundene Ausgaben von »National Geographic« und »Punch«, längst überholte Enzyklopädien, Lexika von 1906 und Sammelbände wie »Nachtlektüre für den Herrn von Welt« und »Gesammelte Abenteuer-, Geister- und Gespenstergeschichten«. Die meisten hatte sie bereits gelesen, einige sogar mehrmals. Im Verein der Anwohner von St. Blaise und Latimer hatte sie ein paar Damen kennengelernt, die sich als ihre Freundinnen bezeichneten. Für ein Einzelkind, das nie eine Schule besucht hatte, waren solche Beziehungen schwierig. In den Ferien war sie mit dem Professor verreist, sogar ins Ausland. Ihm hatte sie es zu verdanken, dass sie gut Französisch und Italienisch sprach, auch wenn es ihr nur dazu nützte, Montaigne und D’Annunzio im Original zu lesen. Eines hatte sie allerdings nie gehabt: einen Freund. Im Theater und im Kino war sie gewesen, aber nie in einem schicken Restaurant, in einem Club, in einem Tanzcafé oder auf einer Party. Manchmal redete sie sich ein, sie sei wie die Lucy bei Wordsworth: »Sie wohnte, wo der Quell ertönt in unbetretner Flur.« Doch selbst das klang eher erleichtert als unglücklich.
Der Professor erreichte ein hohes Alter und starb schließlich mit vierundneunzig. Die letzten Jahre seines Lebens hatte er nicht mehr laufen können und war inkontinent gewesen, aber sein Gehirn war in Hochform, und seine Wünsche kannten keine Grenzen. Gwendolen kümmerte sich um ihn. Gelegentlich wurde sie dabei von einer Gemeindeschwester und ab und zu auch von einer bezahlten Pflegerin unterstützt. Nie zeigte sie irgendwelche Anzeichen von Erschöpfung. Sie wechselte seine Windeln und zog sein Bett ab. Ihr einziger Gedanke dabei war, die Sache möglichst rasch hinter sich zu bringen, damit sie wieder zu ihren Büchern konnte. In derselben Gemütsverfassung brachte sie ihm seine Mahlzeiten und holte später das Tablett wieder ab. Offensichtlich hatte er sie nur zu einem einzigen Zweck großgezogen: Sie sollte ihm während seiner besten Jahre den Haushalt führen und ihn als alten Mann pflegen, und lesen, damit sie nicht auf dumme Gedanken kam.
Manchmal hatte er sie im Laufe seines Lebens kühl und objektiv gemustert und sich dabei eingestehen müssen, dass sie gut aussah. In seinen Augen gab es für einen Mann nur einen einzigen Grund, sich zu verlieben und zu heiraten, oder wenigstens eine Ehe in Erwägung zu ziehen: wenn die Frau seiner Wahl schön war. Verstand, Klugheit, Charme, Liebenswürdigkeit, eine besondere Begabung oder Herzensgüte – nichts davon hätte seine Wahl beeinflussen können. Und so war es seines Wissens auch bei anderen intelligenten Männern. Er hatte eine Frau einzig und allein wegen ihres Aussehens geheiratet, und als er diese Schönheit bei seiner Tochter wiedererkannte, reagierte er besorgt. So etwas könnte auch ein anderer Mann erkennen und sie ihm wegnehmen. Doch das tat keiner. Wie hätte ein solcher Mann sie kennenlernen können, wenn er außer dem Hausarzt niemanden zu sich einlud und sie ohne Wissen ihres Vaters keinen Schritt aus dem Haus machte?
Aber endlich starb er doch. Sie blieb einigermaßen gut versorgt zurück und erbte auch das Haus. Mittlerweile schrieb man die achtziger Jahre. Die Villa war heruntergekommen und stand ziemlich eingezwängt zwischen neu angelegten Gassen und Durchgängen, kleinen Fabriken, Sozialbauten, Eckläden, schäbigen Reihenhäusern und breiten Durchgangsstraßen. Gwendolen war zu diesem Zeitpunkt eine große, dünne sechsundsechzigjährige Frau, deren Jugendstilprofil allmählich einem Nussknacker ähnelte. Ihre schmale griechische Nase näherte sich immer mehr dem hervorstehenden Kinn an. Die ehemals zarte, helle Haut mit dem rosigen Schimmer auf den Wangenknochen war nur noch ein einziges Faltengespinst, einem Apfel ähnlich, der zu lange in einem warmen Raum gelegen hatte. Ihre blauen Augen waren zu einem durchsichtigen Grau verblasst. Die ursprünglich blonden, üppigen Haare waren nun fast weiß.
Manchmal behaupteten ihre beiden selbst ernannten Freundinnen mit den roten Fingernägeln, den gefärbten Haaren und einer annähernd modischen Kleidung, Miss Chawcer kleide sich durch und durch im viktorianischen Stil. Dadurch bewiesen sie lediglich, in welchem Maße sie ihre eigene Jugendzeit vergessen hatten. Ein Teil von Gwendolens Garderobe hätte wunderbar ins Jahr 1936 gepasst, der andere ins Jahr 1953. Viele ihrer Mäntel und Kleider waren echte Modelle und hätten in den Boutiquen von Notting Hill Gate, wo man so etwas hoch schätzte, ein Vermögen gebracht. Zum Beispiel jene Stücke, die sie 1953 für Dr. Reeves gekauft hatte. Leider war besagter Herr fortgezogen und hatte eine andere geheiratet. Das waren damals gute Stücke gewesen, die sich dank sorgfältiger Pflege auch später nie abtrugen. Gwendolen Chawcer war ein lebender Anachronismus.
Um das Haus hatte sie sich deutlich weniger gekümmert. Allerdings muss man der Gerechtigkeit halber sagen, dass sie sich ein paar Jahre nach dem Tod des Professors entschlossen hatte, alles gründlich renovieren zu lassen und teilweise sogar neu einzurichten. Leider dauerten ihre Entscheidungsprozesse schon immer ziemlich lange. Als sie endlich bereit war, einen Innenarchitekten zu suchen, merkte sie, dass sie sich so etwas nicht mehr leisten konnte. Da keiner für sie je Sozialversicherungsbeiträge gezahlt hatte, bekam sie nur eine sehr kleine Rente, und die Rendite aus der Erbschaft ihres Vaters verringerte sich jährlich.
Eine ihrer Freundinnen, Olive Fordyce, meinte, sie solle ihr Dachgeschoss teilweise vermieten. Nach anfänglichem Entsetzen erwärmte sich Gwendolen allmählich für diesen Vorschlag. Sie selbst hätte allerdings nie die Initiative ergriffen. Mrs. Fordyce entdeckte im »Evening Standard« die Anzeige von Michael Cellini. Sie war es auch, die einen Termin vereinbarte und den jungen Mann zum St. Blaise House schickte.
Gwendolen, die des Italienischen mächtig war, sprach ihn mit Mr. Tschellini an, während er sich als Enkel eines italienischen Kriegsgefangenen immer nur Sellini ausgesprochen hatte. Sie blieb unbeirrt. Im Gegensatz zu ihm wusste sie, was richtig war und was nicht. Ihm wäre bei Mix und Gwen wohler gewesen. Schließlich lebte er in einer Welt, in der sich alle mit Vornamen anredeten. Und genau das hatte er auch vorgeschlagen.
»Davon halte ich wenig, Mr. Cellini«, war ihr einziger Kommentar dazu gewesen.
Wahrscheinlich hätte es sie umgebracht, wenn man sie mit ihrem Vornamen angesprochen hätte, und die Koseform Gwen benutzte nur Olive Fordyce, was Gwendolen ziemlich gegen den Strich ging. Sie bezeichnete ihn nicht als ihren Mieter, ja nicht einmal als »den Mann, der die Wohnung mietet«, sondern lediglich als ihren Logisherrn. Wenn er ihren Namen erwähnte, was selten genug vorkam, nannte er sie »die alte Schrulle, der das Haus gehört«. Trotzdem kamen beide alles in allem gut miteinander aus, was hauptsächlich an der Größe des Hauses lag. Man begegnete sich nur selten. Natürlich standen sie noch ganz am Anfang ihrer Bekanntschaft; schließlich wohnte er erst vierzehn Tage hier.
Bei einer ihrer seltenen Begegnungen hatte er ihr erzählt, er sei Techniker. In Miss Chawcers Augen war ein Techniker ein Mann, der in fernen Ländern Dämme und Brücken baut, aber Mr. Cellini erklärte ihr, er warte Fitnessgeräte. Sie musste ihn fragen, was das sei. Da er sich nicht sonderlich gut ausdrücken konnte, musste er ihr berichten, ähnliche Geräte könne sie in den Sportabteilungen sämtlicher großer Londoner Kaufhäuser besichtigen. Harrods war das einzige Londoner Kaufhaus, das sie je betrat. Bei ihrem nächsten Besuch dort begab sie sich in die Abteilung mit den Trainingsmaschinen und betrat damit eine ihr völlig unverständliche Welt. Ihr war es ein Rätsel, warum jemand auch nur einen Fuß auf einen dieser Apparate setzen sollte, und so hegte sie starke Zweifel an Cellinis Worten. Hatte er sie vielleicht »aufgezogen«, um ein Umgangswort zu gebrauchen, das der Professor nur höchst selten verwendete und auch dann nur mit Anführungszeichen?
Hin und wieder machte Gwendolen mit Staubwedel und Teppichkehrer die Runde durchs Haus, wenn auch nicht allzu häufig. Der 1951 erworbene Staubsauger hatte vor zwanzig Jahren seinen Geist aufgegeben und war nie repariert worden. So stand er nun im Keller zwischen eingerollten alten Teppichen, einer Esstischplatte, zusammengelegten Kartons, einem Grammophon aus den dreißiger Jahren, einer unbesaiteten Violine unbekannter Herkunft und dem Korb eines Fahrrades, auf dem der Professor weiland nach Bloomsbury und zurück geradelt war. Der Teppichkehrer verteilte den Staub genauso regelmäßig, wie er ihn aufnahm. Bis Gwendolen zu ihrem eigenen Schlafzimmer kam, wozu sie das Ding hinter sich die Treppe hinaufschleifen musste, hatte sie das geplante Unternehmen längst satt und wollte nur noch wieder zu ihrer gegenwärtigen Lektüre zurück. Das konnte zum x-ten Mal Balzac sein oder Trollope. Da sie keine Lust hatte, den Teppichkehrer wieder hinunterzuschaffen, ließ sie ihn zusammen mit dem Staubwedel in einer Ecke ihres Schlafzimmers stehen. Und dort blieb er, manchmal wochenlang.
Für den Nachmittag erwartete sie Olive Fordyce und deren Nichte zum Tee. So gegen vier Uhr. Die Nichte hatte sie nie kennengelernt, aber Olive meinte, es wäre grausam, wenn sie Gwendolens Wohnsitz nie sehen dürfe, schließlich sei sie »völlig verrückt« nach alten Häusern. Eine Stunde im St. Blaise House wäre für sie der Himmel auf Erden. Gwendolen hatte nichts Besonderes vor. Sie wollte nur noch einmal »Vater Goriot« lesen. Gleich würde sie beim Inder an der Ecke eine Biskuitrolle und vielleicht eine Packung gefüllte Vanillekekse kaufen.
Früher hätte so etwas nicht genügt, aber diese Zeiten waren lange her. Seit Jahren hatte sie nichts mehr gebacken oder gekocht, höchstens mal ein Rührei. Früher wurden in diesem Hause nur selbst gebackene Kuchen, Pasteten, Haferkekse und Eclairs verspeist. Ganz besonders erinnerte sie sich noch an ein bestimmtes Rezept für eine Biskuitrolle mit zartgelbem, saftigem Teig, gefüllt mit Himbeermarmelade und mit feinem Puderzucker bestäubt. Gekaufte Kuchen kamen für den Professor nicht in Frage. Und die Teestunde war für alle drei die liebste Mahlzeit. Fremde Leute wurden, wenn überhaupt, nur zum Tee gebeten. Als Mrs. Chawcer schwer erkrankt war und unter großen Schmerzen langsam starb, bat man den Arzt bei seinen regelmäßigen Hausbesuchen immer zum Tee. Während ihre Mutter droben im Bett lag und der Professor irgendwo eine Vorlesung hielt, fand sich Gwendolen allein mit Dr. Reeves wieder.
Die Tatsache, dass sie sich in ihn und er sich in sie verliebt hatte, war das wichtigste Ereignis in ihrem Leben. Jedenfalls redete sie sich das ein. Da er nur unwesentlich jünger als sie war, würde auch ihre Mutter ihn nicht aus Altersgründen als inakzeptabel einstufen, dachte Gwendolen. Mrs. Chawcer missbilligte Ehen, in denen der Mann mehr als zwei Jahre jünger war als die Frau. Dank seiner dunklen Locken, den dunklen feurigen Augen und der lebhaften Mimik hatte Dr. Reeves rein äußerlich etwas Jungenhaftes an sich. Trotz seiner schlanken Figur verspeiste er bergeweise Gwendolens Teegebäck mit dicker Buttercreme und hausgemachter Erdbeermarmelade, Königskuchen und Haferkekse, während sie nur vornehm einen trockenen Keks zerbröselte. Männer sehen es nicht gern, wenn ein Mädchen sich vollstopft, sagte Mrs. Chawcer, wenn auch nur noch selten, seit ihre Tochter die dreißig überschritten hatte. Und Dr. Reeves plauderte. Vor dem Tee, während der einzelnen Bissen und danach. Von seinem Beruf und seinen Plänen, von der Umgebung, in der er wohnte, vom Koreakrieg, vom Eisernen Vorhang und den sich stetig verändernden Zeitläufen. Auch Gwendolen unterhielt sich wie nie zuvor über diese Themen und äußerte manchmal die Hoffnung, sie könne noch mehr vom Leben sehen, Freunde finden und auf Reisen die Welt entdecken. Und immer drehte sich das Gespräch um ihre sterbende Mutter. Lange würde es ja nicht mehr dauern. Und was dann?
Bekanntlich haben alle Ärzte eine unleserliche Handschrift. Gwendolen studierte sorgfältig alle Rezepte, die er für Mrs. Chawcer ausstellte, und versuchte, seinen Vornamen zu entziffern. Zuerst glaubte sie, er hieße Jonathan, dann Barnabas. Am ehesten tippte sie auf Swithun. Listig brachte sie das Thema Namen ins Gespräch und wie wichtig oder unwichtig sie für die jeweiligen Namensträger seien. Sie mochte ihren Namen, solange niemand Gwen zu ihr sagte. Niemand? Wer sollte sie schon versehentlich mit einem Kosenamen rufen? Bis auf ihre Eltern nannten alle sie Miss Chawcer. Doch davon erwähnte sie Dr. Reeves gegenüber nichts, sondern lauschte hingebungsvoll seinen Anmerkungen.
Und dann lüftete sich das Geheimnis. »Mit dem Namen Stephen kann man nie falsch liegen. Ist zurzeit in Mode. Eigentlich zum ersten Mal. Vielleicht halten mich ja die Leute eines Tages für dreißig Jahre jünger, als ich bin.«
Gwendolen liebte seine Ausdrucksweise und war begeistert, dass sie seinen Vornamen herausgefunden hatte. Manchmal formulierte sie in der Einsamkeit ihres Schlafzimmers leise interessante Kombinationen: Gwendolen Reeves, Mrs. Stephen Reeves, G. M. Reeves. Als Amerikanerin könnte sie sich Gwendolen Chawcer Reeves nennen. In einigen europäischen Ländern hieße sie Frau Dr. Reeves. Kurzum, er machte ihr den Hof, wie es die Dienstboten nannten. Davon war sie felsenfest überzeugt. Was wäre der nächste Schritt? Eine Einladung zum Ausgehen, hätte vermutlich ihre Mutter gesagt. Miss Chawcer, hätten Sie Lust, mich ins Theater zu begleiten? Gehen Sie gern ins Kino, Miss Chawcer? Darf ich Sie Gwendolen nennen?
Ihre Mutter sagte gar nichts mehr. Sie stand unter Morphium. Stephen Reeves kam regelmäßig und trank jedes Mal mit Gwendolen Tee. Eines schönen Nachmittags nannte er sie bei einem Blick über die Kuchenetagere Gwendolen und bat sie, ihn Stephen zu nennen. Kaum war man beim letzten Bissen Buttercremekuchen angelangt, kam normalerweise der Professor nach Hause, um ein wachsames Auge auf seine Tochter zu werfen. Gwendolen fiel auf, dass Dr. Reeves sie in Gegenwart ihres Vaters wieder mit Miss Chawcer ansprach.
Leise seufzte sie. Das alles war ein halbes Jahrhundert her. Jetzt erwartete man nicht Dr. Reeves zum Tee, sondern Olive und ihre Nichte. Die Einladung für den heutigen Tag war nicht von Gwendolen gekommen, an so etwas hätte sie nicht im Traum gedacht. Die beiden hatten sich selbst eingeladen. Wenn sie damals nicht müde und Olives Gesellschaft überdrüssig gewesen wäre, hätte sie Nein gesagt. Hätte sie es doch nur getan. Mit diesen Überlegungen ging sie in das ehemalige Schlafzimmer ihrer Mutter hinauf, das zugleich deren Sterbezimmer gewesen war, und zog ein blaues Samtkleid mit einem Spitzeneinsatz im Ausschnitt an, einem sogenannten »Betrügerle«. Doch so nannte man dieses modische Detail schon lange nicht mehr. Und dieses Schlafzimmer hatte auch nicht ihre Versuche mit den unterschiedlichen Namenskombinationen vernommen. Sie legte eine Perlenkette um und steckte sich eine Brosche mit einem aufsteigenden Phönix an sowie den Verlobungsring ihrer Mutter an die rechte Hand. Diesen Ring trug sie täglich. Nachts legte sie ihn in das silberne Schmuckkästchen mit den ziselierten Glaseinsätzen, das ebenfalls ihrer Mutter gehört hatte.
Die Nichte erschien nicht, stattdessen brachte Olive ihren Hund mit, einen weißen Zwergpudel mit den Füßen einer Balletttänzerin. Gwendolen war verärgert, aber nicht überrascht. Genau dasselbe war schon einmal passiert. Der Hund hatte wie ein Kind etwas zum Spielen dabei. Allerdings handelte es sich bei diesem Spielzeug um einen täuschend echt aussehenden, weißen Plastikknochen. Olive verspeiste zwei Scheiben Biskuitrolle nebst jeder Menge Kekse und erzählte von der Tochter ihrer Nichte. Wie gut, dass die Nichte nicht gekommen sei, ging es unterdessen Gwendolen durch den Kopf, sonst hätten sie sich im Duett über dieses weibliche Prachtexemplar ausgelassen, über ihr Können, ihren Reichtum, ihre reizende Wohnung und darüber, wie sehr sie an ihren Eltern hing. Für sie war jedenfalls dieser Tag verdorben. Es wäre besser gewesen, wenn sie sich in aller Stille ihrer Erinnerung an Stephen gewidmet und vielleicht sogar Pläne geschmiedet hätte.