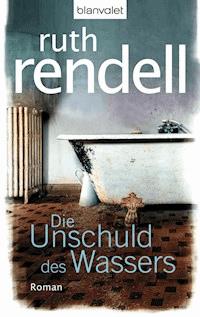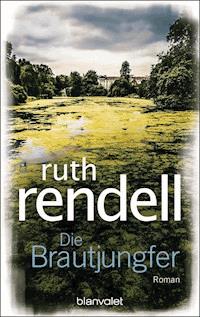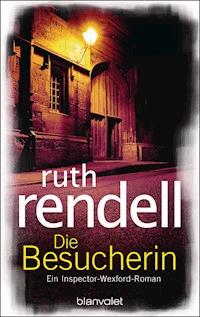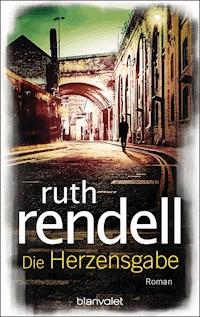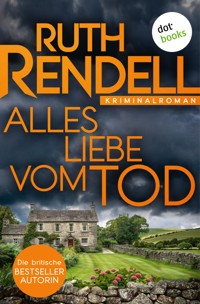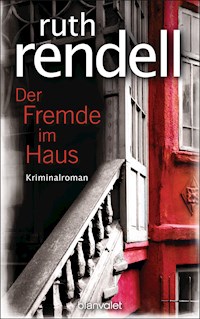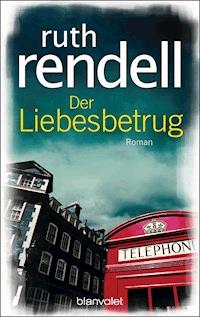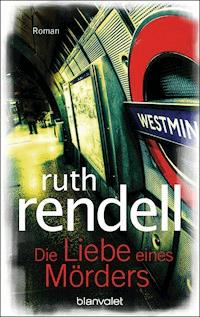12,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Blanvalet Verlag
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
Ein heimliches Versteck aus Kindheitstagen, ein grauenerregender Fund und ein mörderisches Geheimnis, das viel zu lang verborgen war ...
London, gegen Ende des zweiten Weltkriegs: Vier Kinder entdecken in ihrer unmittelbaren Nachbarschaft einen Tunnel, der zu ihrem Geheimversteck wird, bis im Sommer 1944 einer der Väter davon erfährt und ihnen das Spielen dort verbietet.
Sechs Jahrzehnte später: Bauarbeiter finden in einer Blechkiste zwei skelettierte Hände – eine stammt von einem Mann, die andere von einer Frau. Die Entdeckung lässt die Freunde von damals wieder zusammenkommen, um der Polizei unter die Arme zu greifen. Möglicherweise haben sie damals etwas gesehen, was ihnen nicht wichtig erschien. Nach und nach kommt ein lang zurückliegendes Verbrechen ans Licht, in das sie tiefer verwickelt sind, als sie es jemals für möglich gehalten hätten …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 425
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Buch
London, gegen Ende des Zweiten Weltkriegs: Sieben Kinder entdecken in ihrer unmittelbaren Nachbarschaft einen Tunnel, der zu ihrem Geheimversteck wird, bis im Sommer 1944 einer der Väter davon erfährt und ihnen das Spielen dort verbietet.
Sechs Jahrzehnte später: Bauarbeiter finden in einer Blechkiste zwei skelettierte Hände – eine stammt von einem Mann, die andere von einer Frau. Die Entdeckung lässt die Freunde von damals wieder zusammenkommen, um der Polizei unter die Arme zu greifen. Möglicherweise haben sie damals etwas gesehen, was ihnen nicht wichtig erschien. Nach und nach kommt ein lang zurückliegendes Verbrechen ans Licht, in das sie tiefer verwickelt sind, als sie es jemals für möglich gehalten hätten …
Autorin
Ruth Rendell wurde 1930 in London geboren und lebte dort bis zu ihrem Tod 2015. Sie arbeitete als Journalistin, bevor sie sich ganz dem Schreiben von Romanen widmete. 1997 wurde sie mit dem Grand Master Award der Crime Writers’ Association of America, dem renommiertesten Krimipreis, ausgezeichnet und darüber hinaus von Königin Elizabeth II. in den Adelsstand erhoben. Ruth Rendell ist auch unter dem Pseudonym Barbara Vine bekannt.
Besuchen Sie uns auch auf www.facebook.com/blanvalet und www.twitter.com/BlanvaletVerlag.
Ruth Rendell
Die Toten ruhen nicht
Kriminalroman
Deutsch von
Die Originalausgabe erschien 2014 unter dem Titel »The Girl Next Door« bei Hutchinson, London. Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen. Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen. Copyright der Originalausgabe © 2014 by Kingsmarkham Enterprises Ltd Copyright der deutschsprachigen Ausgabe © 2021 by Blanvalet in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, Neumarkter Straße 28, 81673 München Redaktion: Dr. Rainer Schöttle Umschlaggestaltung:www.buerosued.de Umschlagmotiv: © Adrian Muttitt/Trevillion Images KW · Herstellung: sam
Für Michael Redington, in Liebe
1
Er war ein attraktiver Mann. Einen hübschen Jungen hatte seine Mutter ihn immer genannt, denn sie hatte schon angefangen, ihn für sein Aussehen zu loben, als er fünf war. Davor hatte er die üblichen Kinderkomplimente bekommen: »Niedliches Baby.« und »Ist er nicht süß?« Sein Vater war nie da. Mit vierzehn ging er dann von der Schule ab – was damals noch möglich war – und arbeitete in einer Gärtnerei, einem Schlachthof und schließlich in einer Kosmetikfabrik. Die Tochter des Chefs verliebte sich in ihn. Da er damals schon zwanzig war, heirateten sie. Anitas Vater drohte zunächst, ihr das Erbe ihrer Großmutter vorzuenthalten, war jedoch schließlich zu weichherzig dafür. Die Summe war zwar nicht hoch, reichte aber, um ein Haus auf dem Hill in Loughton zu kaufen, etwa zwanzig Kilometer von London entfernt und beinahe ländlich. Woody, wie seine Mutter und seine Frau ihn nannten, weil ihm jemand in der Schule einmal diesen Spitznamen verpasst hatte, war arbeitsscheu und beschloss, für den Rest seines Lebens die Finger von jeglicher Berufstätigkeit zu lassen. Es war ja genug Geld da. Ob es bis an sein Lebensende genügen würde, wusste er nicht. Schließlich war er erst dreiundzwanzig.
Damals führte um die Ehe kein Weg herum. Da biss die Maus keinen Faden ab. Einfach zusammenzuwohnen kam beinahe einer Straftat gleich. Einige Jahre lang waren sie mehr oder weniger glücklich. Seine Mutter starb, und sie erbten auch ihr Haus und einen kleinen Geldbetrag. Als Nächstes starb ihr Vater. In den Dreißigerjahren wurden die Leute noch nicht so alt. Da sie Einzelkind war, trat sie das elterliche Erbe an, und sie erhielt erheblich mehr, als Woody bekommen hatte. Weil er nicht arbeitete, war Woody immer zu Hause. Er empfand es als seine Pflicht, ein Auge auf seine Frau zu haben. Ständig fuhr sie nach London, um Kleider zu kaufen, und ging dauernd zum Friseur. Außerdem verschwand sie übers Wochenende, wie sie sagte, um ihre ehemaligen Mitschülerinnen zu besuchen, die inzwischen verheiratet waren. Woody war nicht eingeladen.
Eine Frau erledigte das Putzen. Woody war der Ansicht, dass seine Gattin das hätte übernehmen können, und sagte das auch. Doch er war machtlos dagegen. Sie bezahlte. Sie kümmerte sich nicht einmal um das Kind und nahm es, soweit er feststellen konnte, kaum zur Kenntnis. Irgendwo hatte er gelesen, das Parlament habe vor sechzig oder siebzig Jahren ein Gesetz erlassen, das es verheirateten Frauen gestattete, selbst über ihr Geld zu verfügen. Davor hatten sie es ihren Ehemännern aushändigen müssen. Er hasste dieses Gesetz. Als die Männer noch alles Geld besessen hatten, musste die Welt ein Paradies gewesen sein.
Als der Krieg ausbrach, war er dreißig. Die schreckliche Möglichkeit, eingezogen zu werden, hing wie ein Damoklesschwert über ihm. Doch er hatte Glück. Dem Arzt erzählte er, er brauche eine Bestätigung, dass er kerngesund sei, damit er sich melden könne, und zwar zur Marine. Wie immer ging es ihm gut, ihm fehlte nichts – sehr bedauerlich. Aber der Arzt stellte ein Geräusch im Herzen fest, offenbar Folge der Lungenentzündung, die er als Kind durchlitten hatte. Woody erinnerte sich an diese Lungenentzündung, und zwar hauptsächlich wegen der Todesangst seiner Mutter. Doch er war zu überglücklich und erleichtert, um sich große Sorgen um sein Herz zu machen. Dem Arzt spielte er Bestürzung vor und meinte bedauernd, er fühle sich ausgezeichnet und würde sicherlich hundert werden.
Im Haus wimmelte es ständig von Freunden seiner Frau. Einer trug Uniform. Er sah zwar nicht so gut aus wie Woody, aber die Uniform wirkte zweifellos äußerst anziehend. Ein anderer junger Mann, der in der Nähe wohnte, war häufig dabei anzutreffen, wie er in Woodys Küche Tee kochte oder ihn in Woodys Wohnzimmer mit Woodys Frau trank. Er machte nicht sehr viel her, fand Woody.
»Du beurteilst alle nach ihrem Äußeren«, sagte seine Frau. »Etwas anderes zählt für dich nicht.«
»Ich habe dich nach deinem beurteilt. Was wäre da sonst noch gewesen?«
Falls seine Frau ihn hätte betrügen wollen, wären ihre Gelegenheiten dafür sehr eingeschränkt gewesen. Allerdings fand die Liebe oder was es auch sein mochte, immer einen Weg. Woher sollte er wissen, wo sie wirklich steckte, wenn sie angeblich ihre Schulfreundinnen besuchte, was er einfach so hinnehmen musste? Seine Frau hatte rotes Haar und blaue Augen. Ihr Freund, der in Uniform, hatte Augen von derselben Farbe und hellbraunes Haar. Eines Nachmittags ging Woody in die Küche, um Geld aus der Keksdose zu holen und Mrs. Mopp zu bezahlen. In Wirklichkeit hieß sie Mrs. Moss, aber Mrs. Mopp war ein so viel lustigerer Name. Die Putzfrau folgte ihm auf den Fersen; sie gierte, wie er fand, viel zu sehr nach ihrem Geld, um ihn aus den Augen zu lassen. Seine Frau saß am Küchentisch und hielt Händchen mit dem Uniformierten. Ihre Hand lag auf der Tischdecke aus amerikanischem Tuch, seine ruhte auf ihrer. Sobald Woody hereinkam, rissen sie die Hände auseinander, allerdings nicht schnell genug. Woody bezahlte Mrs. Mopp und ging hinaus, ohne ein Wort mit den beiden zu wechseln, die reglos auf ihren Schoß starrten.
Für Woody war Wut etwas Kaltes. Kalt war sie und langsam gärend. Doch wenn sie einmal eingesetzt hatte, steigerte sie sich stetig, sodass er an nichts anderes mehr denken konnte. Von Anfang an war ihm klar, dass er nicht weiterleben konnte, solange die zwei am Leben waren. Anstatt zu schlafen, lag er in der Dunkelheit wach und sah ihre Hände vor sich: Anitas schlanke blasse mit den langen, spitzen, pastellrosa lackierten Nägeln. Und die des Mannes, gebräunt, ebenfalls wohlgeformt und mit leicht gespreizten Fingern. Woody dachte an das dritte Mitglied der Familie, um das sich Anita seiner Einschätzung nach nicht scherte. Sie ignorierte das Kind. Einmal hatte er beobachtet, wie sie den Flur entlang zur Haustür rannte und den kleinen Jungen übersah. Sie stieß am helllichten Tag mit ihm zusammen und rempelte ihn um. Sie verletzte ihn zwar nicht, half ihm aber auch nicht, sich aufzurappeln, sondern ließ ihn weinen. Sicher würde er seine Mutter nicht vermissen und sich freuen, sie los zu sein.
Ehe er sein Vorhaben in die Tat umsetzte, nahm er das Geld aus der Keksdose und verstaute es in einer kleineren, die einmal Kakao enthalten hatte. Auf der Keksdose waren verschieden geformte Mürbeteigkekse abgebildet. Sie war ziemlich groß, ein Durchmesser von etwa zwanzig mal fünfzehn Zentimeter und ungefähr sieben Zentimeter tief. Das würde genügen, denn sie hatten kleine Hände. Anita kam und ging mit dem Mann in Khaki und vielleicht auch mit dem anderen in Zivil. Letzterer war Woody egal. Er würde verschwinden, wenn Anita verschwand, und auch nicht aufkreuzen, um sich nach ihr zu erkundigen. Mrs. Mopp kam und putzte das Haus. Sie sprachen kaum miteinander, weil es nichts zu sagen gab. Der Junge ging zur Schule und schaffte den Weg allein. Er wusste, dass er zur Schule gehen musste und dass Widerspruch zwecklos war. Er redete mit Mrs. Mopp und schien sie zu mögen, doch das interessierte Woody nicht. Er dachte viel über Anitas Geld nach. Dieses Nachdenken kostete Zeit und zögerte seinen Plan hinaus. Es musste doch einen Weg geben, sie dazu zu bringen, ihre Tausender, und es waren ziemlich viele Tausender, auf sein Konto zu überweisen. Allerdings neigte sie zum Argwohn.
»Ich werde kein gemeinsames Konto mit dir eröffnen, Woody«, sagte sie. »Warum ist dir das so wichtig? Nein, antworte nicht. Sicher geht es um etwas Zwielichtiges, irgendeine Gaunerei. Die Antwort lautet Nein.«
Schade, doch das würde ihn nicht aufhalten. Nichts konnte ihn bremsen. Seine einzige Möglichkeit war, sich Zugriff auf ihr Scheckbuch zu verschaffen. Er stellte einen Scheck über hundert Pfund auf sich selbst aus; mehr wäre verdächtig gewesen. Wie sich herausstellte, war es ein Kinderspiel, ihn einzulösen, weshalb er ziemlich bedauerte, nicht die doppelte Summe eingetragen zu haben. Nun musste er zuschlagen, bevor sie ihren Kontoauszug erhielt.
Woody dachte nicht an die Anfangszeit ihrer Beziehung. Er dachte nicht an das, was er einst als ihre »Romanze« bezeichnet hatte. Nicht einmal mit der jüngsten Vergangenheit ganz allgemein beschäftigte er sich und meinte zu jedem, der ihm zuhörte: »Es ist vorbei und kommt nicht wieder. Welchen Sinn hat es, darüber nachzugrübeln?« Ganz gleich, wie er es anstellte, es durfte kein Blut fließen. Er teilte Anita mit, er werde seine Tante Midge in Norwich besuchen. Sie sei krank und würde ihm sicher ihr Geld hinterlassen – ein Anlass für einen Besuch, den seine Frau ihm bestimmt glauben würde. Sobald er weg war, würden Anita und der Khakimann gewiss das Bett miteinander teilen, aller Wahrscheinlichkeit nach sein Bett. In den späten Nachtstunden würde er zurückkommen.
Natürlich behielt er recht. Da lagen sie und schliefen tief und fest. Nachdem er die Tür hinter sich abgeschlossen hatte, erdrosselte er zuerst den Mann. Anita war eine zierliche Frau und ihm körperlich nicht gewachsen. Sie jagte er durchs Zimmer, schleuderte sie zu Boden und setzte denselben Ledergürtel auch bei ihr ein. Bald war es ausgestanden. Das einzige Blut stammte von ihm selbst, weil sie ihn beide gekratzt hatten, doch es war nicht sehr viel. Seine Erfahrung aus dem Schlachthof kam ihm jetzt zustatten, als er die rechte und die linke Hand abtrennte. Bevor er die Hände in die Keksdose legte, entfernte er noch Anitas Ehe- und Verlobungsring. Ein zusätzlicher Bonus. Bei seinen Berechnungen, wie viel Geld er würde abzweigen können, hatte er die Ringe ganz vergessen. Natürlich würde er sie verkaufen. Er konnte weit weg nach Devon oder nach Schottland fahren und einen Juwelier suchen, der ihm eine Menge für den Diamantring bezahlen würde. Anita hatte ihn selbst gekauft. Sie hatte einen Diamantring gewollt, und den hatte er sich nicht leisten können.
Es war Oktober, besser als Sommer, da er sich mit der Beseitigung der Leichen nicht so sehr würde beeilen müssen. Nachdem die anstößigen Hände, die Hände, die einander gehalten hatten, nun entfernt waren, konnte er sich kaum noch erklären, warum er das getan hatte. Um sie zu betrachten? Als Erinnerung an seine Rache? Doch das Händchenhalten war Vergangenheit, und er lebte in der Gegenwart. Er wusste, dass er sich die Hände in einem oder zwei Tagen vermutlich nicht mehr würde ansehen wollen. Vielleicht würde er sie ja vergraben. Das Wissen, dass sie versteckt waren und wem sie gehört hatten, würde genügen. Er wickelte die Leichen in Bettlaken und verschnürte sie mit Gartenkordel.
Das Kind hatte alles verschlafen. Der Junge war erst knapp neun, alt genug, um alles zu bemerken, was geschah, auch wenn er das meiste nicht verstand. Woody war klar, dass er ihn würde loswerden müssen. Nicht dass er für ihn dasselbe Schicksal plante wie das, was er Anita und ihrem Liebhaber hatte angedeihen lassen. Michael war sein Sohn. Das wusste nicht nur er, sondern auch alle anderen sahen es, denn der Junge sah ihm glücklicherweise so ähnlich wie ein Ei dem anderen. Obwohl er nie so etwas wie Liebe für ihn empfunden hatte, floss sein Blut in den Adern des Jungen. Michael gehörte ihm, und da seine Mutter nun fort war, war er der Mensch, der ihm auf dieser Welt am nächsten stand. Er konnte dafür sorgen, dass er ihn nie mehr (oder sehr selten) wiedersah. Doch sein Blut zu vergießen kam für ihn überhaupt nicht infrage.
Die Toten in ihren Leichentüchern aus Bettlaken hatte er im Sommerhaus verstaut und mit Brennholz abgedeckt. Da der Deckel der Keksdose fest schloss, konnte man aus ihr nichts riechen. Er stellte die Dose in Anitas Schrank unter die Kleider, die sie von ihren ständigen Shopping-Touren nach Hause gebracht hatte. Aber er musste eine dauerhafte Ruhestätte für die Dose finden. Er schlief in dem Zimmer, in dem er die Morde begangen hatte, und betrachtete manchmal die Dose, unternahm jedoch nie einen Versuch, den Deckel zu öffnen. Inzwischen hatte der Verwesungsprozess eingesetzt, und er fürchtete sich vor dem, was er sehen und riechen würde, wenn er den Deckel hob.
Seit einigen Monaten war ihm bekannt, wo Michael hinging, wenn er mit dem Johnson-Jungen, dem Norris-Jungen, den Batchelors aus Tycehurst Hill, der niedlichen Daphne Jones und der kleinen Rosemary Soundso spielte. Nämlich unter die Erde. Er beobachtete, wie Michael den Hill überquerte, wartete eine halbe Stunde und steuerte dann auf den Eingang der »Tunnels« auf der anderen Straßenseite zu. Die Kinder waren drinnen, doch er konnte sie von seinem Standort aus nicht sehen. »Ich weiß, wo ihr seid!«, rief er. »Kommt jetzt raus. Hier wird nicht mehr gespielt. Am besten geht ihr jetzt nach Hause und kommt nicht mehr zurück. Verstanden?«
Sie hörten ihn und erschienen einer nach dem anderen. Daphne blieb zurück, um die Kerzen auszupusten. Sie tauchte als Letzte auf, stand im nassen Gras auf der Kuppe, schenkte ihm ihr geheimnisvolles Lächeln und wandte sich ab.
Am nächsten Tag suchte ihn ein Polizist auf. Er wollte Mrs. Winwood sprechen. Woody tischte ihm das Märchen auf, das er sich zurechtgelegt hatte. Seine Frau sei krank gewesen und erhole sich jetzt bei ihrer Cousine auf dem Land. Der Polizist verriet ihm nicht, was er von Anita wollte oder ob er einen Verdacht hatte. Er ging einfach wieder.
Den Jungen zu Tante Midge zu schicken kam nicht infrage. Sie war zu alt und zu arm. Aber was war mit seiner Beinahecousine Zoe? Sie konnte keine Kinder bekommen und sehnte sich nach einem, der Himmel mochte wissen, warum. Sie spielte mit dem Gedanken an eine Adoption, hatte sich aber noch nicht für ein Kind entschieden. Michael war sie einige Male begegnet und hatte ihn angehimmelt, wie manche Frauen das eben taten. Eine Adoption war eine einfache Sache. Man besorgte sich die Zustimmung der Eltern und übernahm das Kind. Zoe hatte vor Kurzem geheiratet, ein wenig spät, aber das machte ja nichts. Außerdem hatte sie jede Menge Geld. Sie wollte das Kind unbedingt und interessierte sich nicht weiter dafür, wo Anita steckte oder ob sie verschwunden war. Und so wurde alles arrangiert.
Als der Tag gekommen war, hatte er es so eilig, das Haus für sich zu haben, dass er den Jungen in aller Frühe mit der U-Bahn zum Bahnhof brachte und ihn mehr oder weniger in den Zug nach Lewes schubste. Die geschmierten Brote hatte er auf der Anrichte in der Küche vergessen. Doch der Junge würde mitten am Vormittag keine Brote essen wollen. Woody bedauerte nur eines daran, dass er seinen Sohn zum letzten Mal sah: Es war eigentlich ein Jammer, ein derart hübsches Kind aus den Augen zu verlieren. Er stieg in einen Bus und wieder aus, als dieser in Knightsbridge abbog. Ein Juwelier, in dessen Laden sich Ringe und Perlenketten türmten, kaufte Anitas Verlobungsring und den Ehering für knapp tausend Pfund. Genug, um ein schönes Haus zu erwerben, doch er wollte kein Haus. Er besaß bereits eines und würde es veräußern, sobald der Krieg vorbei war. Der Juwelier stellte keine Fragen.
Woody war frei. Aber war er das wirklich? Nicht solange die Leichen im Sommerhaus unter dem Brennholz lagen. Er betrachtete sie gerade von der Türschwelle des Sommerhauses aus, als Mrs. Mopp durch den Garten kam und meldete, ein Polizist wolle ihn sprechen. Woody zog die Tür zu und schloss ab. Diesmal waren die Polizisten zu zweit. Seine Frau sei schwer krank, beteuerte er. Er werde später nach Yorkshire fahren, um bei ihr zu sein. Obwohl sie ihm das zu glauben schienen, antworteten sie nicht, als er sie, innerlich bebend, fragte, warum sie das interessierte.
Außerdem war er nicht frei, solange er sich im Besitz einer weißen Hand und einer gebräunten Hand in einer Keksdose befand. Diese wurde nun mühelos beseitigt und an einem Ort versteckt, wo nur er sie finden konnte, wenn der Zeitpunkt da war, die Hände anzusehen, um sich zu erinnern. Seit er die Kinderhorde vertrieben hatte, war keines von ihnen zurückgekehrt. Außerdem war es jetzt Winter und zu kühl und nass, um sich in den Tunnels herumzutreiben. Eines kalten, regnerischen Novemberabends tastete er sich, mit einer Taschenlampe und der Keksdose bewaffnet, die Stufen in die Tunnels hinunter und folgte dem Lichtkegel. Obwohl alles mit einer Plane abgedeckt war, war es klatschnass hier. Das stete Tropfen von Wasser war das einzige Geräusch. Er musste vorsichtig sein. Nicht auszudenken, wenn er ausrutschte, stürzte und mit diesen Händen in der Hand um Hilfe rufen musste. Würde man ihn überhaupt jemals finden?
Woody blieb stehen, dachte nach und starrte in ein tiefes Loch hinunter, aus dem das gelbliche, schlammige Wasser abzufließen schien. Er konnte den Grund kaum sehen und wusste nur, dass die Flüssigkeit sich hier einen Weg nach draußen suchte. Er legte die Taschenlampe an den Rand des Loches, kauerte sich hin und schob die Dose in den Abgrund. Im Licht erkannte er, dass sie in der schlammigen Tiefe verschwunden war. Durch ihr Gewicht drängte sie ein Hindernis beiseite und war nicht mehr zu sehen. Beim Aufstehen strauchelte er ein wenig und warf dabei die Taschenlampe ins Loch. Sofort wurde es stockfinster. Er drehte sich um und sagte sich, dass er Ruhe bewahren müsse und nicht in Panik geraten dürfe. Einen Fuß vorsichtig vor den anderen setzend, tastete er sich langsam voran und hielt sich dabei an den muffigen Grasbüscheln fest, die hie und da aus den Lehmwänden wuchsen. Vor ihm leuchtete ein kleines Licht. Es musste der Mond sein, denn die Straßenlaternen brannten nicht. Er kletterte die glitschigen Stufen hinauf und rutschte einige Male ab, bis er endlich – und inzwischen erkannte er die Lichtquelle als prächtigen Vollmond – auf der Wiese stand.
Im Mondlicht stellte er fest, dass er voller Schlamm war, der zu verkrusten begonnen hatte. Gelber Dreck beschmierte seine Hände, Arme und Füße und seine Hose bis fast zu den Oberschenkeln hinauf. Es war niemand unterwegs. Jetzt, zu Kriegszeiten, gingen die Leute abends nur selten auf die Straße. Außerdem herrschte Stille. Kein Licht war zu sehen, keine Musik zu hören, kein Wort wurde gesprochen, kein Kind weinte. Als er sein Gartentor öffnete, warf er einen Blick auf das Haus der Jones nebenan. Unter einem Verdunkelungsvorhang schimmerte ein schmaler Lichtstreifen hervor. Daphnes Zimmer? Die reizende Daphne. Wenn sie nur ein wenig älter gewesen wäre und Geld gehabt hätte, hätte sie seine nächste Frau werden können.
Er betrat das Haus durch die Hintertür und schaute von der Treppe aus hinüber zum Sommerhaus. Was für ein wundervoller Ausweg aus seiner prekären Lage wäre es gewesen, die Leichen, die des Mannes und die der Frau, über die Straße zu schaffen und sie, wie ihre Hände, in das Loch gleiten zu lassen. Allerdings war das unmöglich. Jemand würde ihn sehen. Er hatte weder Auto noch Führerschein. Also musste er diesen Plan aufgeben. Die einzige Methode, die Leichen zu vernichten, bevor die Polizei wiederkam, um das Haus zu durchsuchen, war, sie zu verbrennen.
Erst nachdem das Feuer die Leichen verschlungen und den Garten ruiniert hatte, wurde ihm klar, dass er Anitas Geld gar nicht erben konnte, denn sie war ja bekanntermaßen nicht tot. Für die Polizei, die Anwälte und ihre Angehörigen konnte sie offiziell niemals sterben. Es gab keinen Totenschein, keine Beerdigung, kein Testament, keine Todesanzeige. Er musterte sich im Spiegel. Mein Gesicht ist mein Kapital, das darf ich nie vergessen, dachte er. Aus einer Zeitungsschlagzeile erfuhr er, dass eine Bombe das Polizeirevier in Woodford, nur wenige Kilometer von Loughton entfernt, zerstört hatte. Viele Polizisten waren dabei ums Leben gekommen. Ob die Polizei deshalb nicht zurückgekommen war? Sie hatten ihn vergessen und ließen ihn in Ruhe. Niemand nannte ihn je wieder Woody.
2
Viele Menschen haben diese Fantasievorstellung: eine Art Traum, einen Ort, an den man denkt, damit man einschlafen kann. Der Anfang ist eine Tür in einer Wand. Die Tür öffnet sich, wird selbstbewusst vom Träumenden aufgestoßen, weil er weiß, was sich auf der anderen Seite befindet. Er war nämlich schon dort. Irgendwo hat er bereits etwas Ähnliches gesehen, etwas Reales, allerdings nicht so schön und nicht so grün, mit weniger glitzerndem Wasser und weniger abwechslungsreichen Pflanzen und ohne Magie. Der geheime Garten ist stets gleich: makellos, die Vegetation in voller Blüte, immer scheint die Sonne, ein Vogel singt, eine Libelle fliegt davon. Der Träumende verlässt diesen geheimen Garten nie. Der Garten verlässt den Träumenden, und zurück bleibt ein Gefühl des Verlusts, der Trauer, der verlorenen Hoffnung, vielleicht sogar der ersten, die man jemals hatte.
Ihr Garten war nicht schön. Hier gab es weder blühende Bäume noch Rosen oder duftende Kräuter. Zu Beginn hatten sie ihn »die Tunnels« genannt. Daphne Jones brachte dann das Wort »Qanat« auf, das es gar nicht gab, von den anderen jedoch übernommen wurde. Offenbar bezeichnete es in irgendeiner orientalischen Sprache einen unterirdischen Wasserkanal. Das Wort gefiel ihnen, weil es mit einem Q ohne nachfolgendes u anfing. In der Schule hatten sie gelernt, dass kein Wort mit Q beginnen könne, wenn kein u darauf folgte. Deshalb sagte Daphnes Vorschlag ihnen zu, und so wurden aus den Tunnels Qanats. Natürlich war Daphne dabei. Und Michael Winwood, Alan Norris, Rosemary Wharton, Lewis Newman, Bill Johnson und alle Batchelors, Robert, George, Stanley, Moira, Norman und der Rest. Im Juni vergangenen Jahres, dem letzten Jahr des Zweiten Weltkriegs, hatten sie die Qanats entdeckt, die geheime Gärten waren, zumindest für diejenigen unter ihnen, die über Träume und Fantasie verfügten. Ihren Eltern gegenüber erwähnten sie sie mit keinem Wort. In jener Zeit fragten wenige Eltern, wenn überhaupt, ihre Kinder, wo sie sich abends aufhielten, und ermahnten sie nur, bei Fliegeralarm nach Hause zu kommen.
Die Qanats befanden sich nicht auf Brachland. Vor dem Krieg hatte man auf diesen Wiesen mit Bauarbeiten begonnen, die beim ersten Erklingen der Sirenen eingestellt worden waren. Sie lagen am Rand von Essex, einer Vorstadt von London, an der Grenze zum Epping Forest. Grüne Wiesen wurden noch immer von hohen, dichten Hecken durchzogen, die aus den verschiedensten, nicht beschnittenen und nur selten gestutzten Bäumen bestanden. Dicke, zweihundert Jahre alte Eichen, Wände aus Ulmen, die gediehen, bevor irgendjemand vom Ulmensterben gehört hatte, Schwarzdorn, im Frühjahr cremeweißer Weißdorn und Johannisapfel mit rosigen Blüten. Auf den Feldern, wo kein Heu mehr gemacht wurde, wuchsen gelbes Jakobs-Greiskraut, blauer Ehrenpreis, rote Feuernelken und Bienen-Ragwurz. Distelfalter, Rote Admirale und Pfauenaugen verließen die Wildblumen und stürzten sich auf die Schmetterlingsbäume in den Gärten der Häuser auf dem Hill und in Shelley Grove. Bei Dämmerung erschienen der Rote Dickkopffalter und der Lindenschwärmer. Die Kinder glaubten, dass die Felder für die Ewigkeit bestimmt waren. Sie wussten nichts von Veränderung. Sie spielten im Gras und in den Hecken und liefen nach Hause nach Tycehurst Hill und Brook Road, wenn die Sirenen zu heulen begannen. Es fielen Bomben, allerdings nicht hier – Loughton bekam während des gesamten Krieges nur eine einzige ab. Eines Tages, eine ganze Woche lang war keine Sirene losgegangen, stießen einige der Batchelor-Kinder sowie Alan und Lewis auf eine Art Höhle, ein Loch im Boden, das wie der Eingang zu einem Tunnel aussah.
Es war im Juni 1944 gewesen. Die Sommerferien hatten noch nicht angefangen. Erst in einem Monat würde es so weit sein. Der Unterricht endete um 15.30 Uhr, und alle waren nach Hause gegangen. Die Batchelors, Robert, George, Stanley und Moira – Norman lag mit Windpocken im Bett – liefen zu den Feldern. Stanley nahm Nipper an die Leine. Alan, Lewis und Bill waren bereits da. Sie saßen in der hohlen Eiche in dem großen, runden Bereich, wo jemand offenbar vor hundert Jahren die Baumkrone abgehackt hatte, sodass Dutzende von Ästen ringsherum gewachsen waren. Wenn es im Sommer regnete, konnte man, geschützt von einem Blätterdach, dort sitzen, ohne nass zu werden. An diesem Tag hatte es zwar geregnet, doch inzwischen wieder aufgehört. Alan und Lewis kletterten hinunter und marschierten mit den anderen den Hügel auf der anderen Seite in Richtung des Hill hinauf. Hätten sie die Qanats je entdeckt, wenn Moira nicht beobachtet hätte, wie ein Kaninchen in ein Loch sprang? Keinem der Jungen wäre es aufgefallen, nicht einmal Stanley, der Tiere liebte. Auch nicht Nipper, der den Hund der Jones auf dem Trottoir vor deren Haus gesehen hatte und sich bellend und knurrend gegen die Leine stemmte. Also musste Stanley draußen bleiben, während die anderen in das Loch stiegen. Schließlich musste jemand den Hund festhalten. Der Hund der Jones veranstaltete einen solchen Radau, dass Daphne herauskam, ihn packte und zurück ins Haus schleppte.
In dem Loch gab es schlammige, vom Regen durchweichte Stufen. Wer hatte sie in die lehmige Erde geschnitten? Sie hatten keine Ahnung. Ein Gang führte unter dem Feld, dem Gras, den Wildblumen und den Baumwurzeln hindurch. Es war zwar dunkel, aber nicht so, dass man einander oder das aus einer Plane bestehende Dach nicht hätte sehen können. Allerdings war klar, dass man nachts Kerzen brauchen würde. Die Wände waren aus Erde, jedoch aus ingwerfarbener Erde, der Art von Lehm, über den ihre Väter sich beschwerten, wenn sie den Garten umgraben mussten. Die sieben, denn inzwischen war Daphne Jones auch dabei, erreichten eine große, runde Kammer, wie ein Raum, in dem weitere Gänge mündeten. Es war zwar kein geheimer Garten, hatte aber einiges mit einem gemeinsam. Es war still. Zumindest wäre es ruhig gewesen, wenn sie nicht solchen Lärm veranstaltet hätten. Die Stimmung war ruhig und einladend. Und es war dunkel, solange man kein Licht machte.
»Wir könnten uns hier treffen«, sagte George. »Wir könnten Essen und andere Sachen mitbringen. Gut, wenn es regnet.«
»Es wäre immer gut«, erwiderte Alan.
»Ich schaue mich mal um«, meinte Moira. Alle folgten ihr, erkundeten die Gänge und stellten fest, wie verlassen sie waren. So als sei nie jemand hier gewesen, außer um sie zu graben, die Stufen zu schneiden, über die sie hereingekommen waren, alles mit einer Plane abzudecken und dann einfach zu verschwinden und alles den Kaninchen und Eichhörnchen zu überlassen.
»Qanats«, verkündete Daphne Jones. Und so hießen sie fortan.
Wenn man älter wird, vergisst man Namen: von Leuten, mit denen man die Schulbank gedrückt oder zusammengearbeitet hat. Von Nachbarn, den Gästen bei der eigenen Hochzeit, von seinem Arzt, seinem Steuerberater und seiner Putzfrau. Von diesen Namen entfallen einem vielleicht die Hälfte, vielleicht drei Viertel. Und welche Namen vergisst man nie, weil sie sich einem tief ins Gedächtnis eingegraben haben? Die seiner Geliebten (außer man hat es wild getrieben, sodass es einfach zu viele sind) und die der Kinder, mit denen man die Grundschule besucht hat. Diese Namen behält man, solange die Senilität sie nicht aus dem Gedächtnis löscht. Alan Norris hatte nicht genug Geliebte gehabt, um deren Namen zu vergessen. Seine Frau konnte gar keinen Liebhaber vorweisen. Das war ein Thema, das sie nie erörterten. Sie dachten auch nicht an die Menschen, mit denen sie in der Grundschule gewesen waren. Aber ihre Namen wussten sie noch. Außerdem hatten sie sich ebenfalls in den Tunnels getummelt, denen sie einen seltsamen Namen gegeben hatten. Doch sie hatten erst einen Grund, sich damit zu beschäftigen, als alle Zeitungen darüber berichteten.
»Qanats«, sagte Alan, der vor über fünfzig Jahren zwar nicht das Mädchen von nebenan, aber das aus der Nebenstraße geheiratet hatte.
Rosemary entgegnete, sie habe diesen Namen nie gemocht, obwohl sie erst zehn gewesen sei. »Warum nicht Tunnels? Das waren sie ja schließlich.«
Den Daily Telegraph auf dem Esstisch ausgebreitet, las Alan von einem Fund, den drei polnische Bauarbeiter unter einem Haus namens Warlock auf dem Hill gemacht hatten. Beim Lesen betrachtete er das Foto ihrer Entdeckung, eine Keksdose mit Inhalt.
»Was für ein Name«, meinte Rosemary, die, über seine Schulter gebeugt, mitlas. »Zbigniew. Wie spricht man das wohl richtig aus?«
»Keine Ahnung.«
»Das ist der, der die Dose ausgegraben hat. Sie wollten das Haus unterkellern. Keller sind wirklich das Letzte, was wir in Loughton gebrauchen können, oder? Hände sollen es sein, die sie da gefunden haben. Inzwischen sind es Gott sei Dank nur noch Knochen. Jetzt bauen sie den Keller bestimmt nicht mehr fertig.«
Alan schwieg. Er las den Artikel über die Bauarbeiter mit den seltsamen Namen, die die Blechdose mit ihrem Bagger aus dem Boden geholt hatten. Die Polizei sei gekommen, und die Arbeiten seien eingestellt worden. Das Gefäß hatte einmal Mürbeteigkekse enthalten. Als man es entdeckte, waren die Hände eines Mannes und einer Frau darin.
»Ob die wohl alles abgesperrt haben?«, sagte Rosemary. »Mit Draht rings um den Garten und diesem blau-weißen Flatterband wie im Fernsehen? Wir könnten einen Spaziergang dorthin machen und es uns anschauen.«
»Könnten wir.« In Alans Antwort schwang ein leicht ironischer Unterton mit, der Rosemary nicht entging.
»Nicht wenn du nicht möchtest, Liebling.«
Er faltete die Zeitung zusammen. »Die Qanats – oder besser Tunnels – werden nicht erwähnt. Nur dass die Dose unter Haus Warlock gefunden wurde. Wir wissen nicht einmal, ob man sie in den Qanats entdeckt hat.«
»Mir wäre es lieber, wenn du sie nicht so nennen würdest.«
»Dann eben Tunnels. Wir haben keine Ahnung, welchen Zweck sie erfüllt haben. Tunnels, in ein Feld gegraben und mit einer Plane abgedeckt. George weiß es sicher. Ganz bestimmt. Wenn wir schon einen Spaziergang machen, könnten wir doch George und Maureen besuchen.«
»Wenn du möchtest.«
»Warum wussten wir nie, wozu die Tunnels da waren, Liebling?«
»Wahrscheinlich weil wir nie danach gefragt haben. Unsere Eltern hätten es sicher gewusst, aber wir haben nie mit ihnen darüber geredet oder ihnen davon erzählt.«
»Dann hätten sie uns verboten hinzugehen.«
Als Rosemary in ihr Nähzimmer zurückkehrte, schwelgte Alan in Erinnerungen an die Qanats. An das, was sie dort gemacht und welche Spiele sie gespielt hatten. An das mitgebrachte Essen: zähes Vollkornbrot – wie hatte er sich nach Weißbrot gesehnt – mit einer Marmelade aus Rüben und Rhabarber. Fischpaste. Belegte Brote. Kartoffeln, die sie mit Lehm bestrichen und in einem gefundenen alten Wassertank, den sie zum Feuermachen benutzten, gebacken hatten. Daphne Jones hatte ihnen ihre Zukunft vorhergesagt. Der Name weckte ein altes Erschaudern in ihm. Schauspielerei. Maria Stuart, der Mord von Rizzio. Warum Maria Stuart? Und warum eigentlich die Ermordung der Prinzen im Turm? Lady Jane Grey? Er hatte es vergessen. Trotz dieser wiederentdeckten Erinnerungen waren ihm so viele Gründe entfallen, tief unter der Erde vergraben wie diese Hände. Aber er hatte noch im Gedächtnis, dass Stanley Batchelor seinen Hund dabeigehabt hatte. Einen weißen Hund mit schwarzen Flecken. Alan hatte ihn geliebt. Er und Rosemary hatten den Hund umarmt, ihn gestreichelt und einander bestätigt, dass Stanley ein Glückspilz sei. »Warum darf ich keinen Hund haben?« Irgendwann, als der Krieg vorbei war, hatte er seinen geliebten Labrador bekommen. Und Rosemary ihren Spaniel.
Er nahm die Zeitung und machte sich auf die Suche nach Rosemary. Sie saß an der Nähmaschine. Ihre Finger führten den Saum des Kleides, das sie für Freya nähte. Eine Nähmaschine zu besitzen und zu benutzen war zu Anfang ihrer Ehe ganz normal gewesen. Rosemary hatte im Laufe der Jahre alle ihre Kleider selbst genäht. Als Nähen weniger üblich wurde, hatte sie die Kleider ihrer Kinder genäht. Inzwischen die ihrer Enkel und Urenkel. »Weil sie so viel hübscher sind als etwas aus dem Laden.«
Alan teilte diese Ansicht zwar nicht, schwieg aber. Eine Weile hatte sie versucht, Hemden für ihn zu nähen, doch dem hatte er ein Ende bereitet. Die Hand, die den Stoff festhielt, war mittlerweile runzelig. Die Venen standen hervor, aber die Gelenke wiesen keine Spur von Arthritis auf. Rosemary blickte auf und nahm den Fuß vom Pedal.
»Ich finde, wir sollten George Batchelor besuchen und die Zeitung mitnehmen«, sagte Alan. »Wir haben die Batchelors schon seit Ewigkeiten nicht gesehen.« Ihm kam ein erschreckender Gedanke. »Falls er überhaupt noch lebt.«
Rosemary lachte. »Oh, der lebt noch. Ich habe Maureen letzte Woche in der High Road getroffen. Er ist an der Hüfte operiert worden und wurde gerade aus St. Margaret’s entlassen.«
»Ist die Adresse noch dieselbe?«
»Ja, aber die Telefonnummer hat sich geändert. Maureen hat mir ihre Mobilfunknummer gegeben. Soll ich anrufen, Liebling?«
Michael Winwood war der Einzige unter ihnen, der noch einen lebenden Elternteil hatte. Sie hatten kaum Kontakt zueinander. Es hatte kein Streit stattgefunden. Keiner hatte dem anderen »Ich will dich nie mehr wiedersehen« ins Gesicht geschleudert. Allerdings beabsichtigte Michael nicht, seinem Vater jemals wieder zu begegnen, und er war sicher, dass es diesem genauso erging. Er fragte sich, ob John Winwood von der Männer- und der Frauenhand in der Keksdose gelesen hatte und ob eine solche Entdeckung einem Menschen im Alter seines Vaters überhaupt etwas bedeutete. In einem knappen Jahr würde der alte Mann hundert werden und nicht mehr bei klarem Verstand sein. Vielleicht hätte ihn das betroffen gemacht, wenn sein Vater arm gewesen wäre und unter bescheidenen Bedingungen hätte leben müssen. Aber laut Zoe wohnte er in einer luxuriösen Seniorenresidenz in Suffolk. Er hatte ein Apartment mit eigenem Duschbad, nicht nur ein Zimmer, und auch sonst alles, was ein alter Mensch sich wünschen konnte. Michael war das egal, er hatte kein schlechtes Gewissen.
Was hätte Vivien zu den Händen in der Keksdose gesagt? Oder über seinen Vater? Er würde hinauf in ihr Zimmer gehen, das Zimmer, das einmal ihres gewesen war, und sie fragen. Eher, es ihr erzählen. Sich auf das Bett legen, wo sie früher gelegen hatte, und mit ihr darüber reden. Wenn er die Augen schloss, hatte er das Haus namens Anderby auf dem Hill vor sich. Auf der anderen Straßenseite, wo es damals keine Häuser gegeben hatte, befanden sich die Tunnels und der Eingang, wo sich die Kinder versammelten. Eine Woche nachdem sie auf die Tunnels gestoßen waren, wurden es immer mehr Kinder, zwanzig oder dreißig. Er sah, wie sie einander die Stufen hinunter in den langen Gang folgten wie beim Rattenfänger von Hameln, allerdings ohne dass jemand Flöte spielte, und in der Dunkelheit unter der Plane verschwanden. Und dann gingen in der Tiefe die Lichter an, wenn jemand die Kerzen anzündete.
Gelegentlich dachte er an Anderby, auch wenn er es zu vermeiden versuchte, was ihm nicht immer gelang. Meistens hörte er dann seinen Vater singen. Wenn er das anderen Leuten erzählte, fanden sie es nett, insbesondere weil sein Vater Kirchenlieder gesungen hatte. Religiös war er aber nicht. Michael, seine Mutter und sein Vater gingen nie zur Kirche, sein Vater hingegen hatte als Kind den Gottesdienst besuchen müssen. Er hatte es gehasst, hatte Michael ihn einmal sagen hören, doch er erinnerte sich noch an die Melodien und den Großteil der Texte. »Lead us, heavenly Father, lead us« und »Summer suns are glowing over land and sea«. Das Lied über die Sonne sollte einen glücklich machen. Doch wenn John Winwood es sang, war es das Vorspiel dazu, dass er nach unten kam und Michael anherrschte, er solle verschwinden.
Michael ging nach oben und erzählte Vivien von den Kirchenliedern. Dabei lachte er, als sei es komisch.
Alan und Rosemary spazierten hinüber nach York Hill, nachdem sie sich selbst zum Tee eingeladen hatten.
»Wir trinken keinen Tee«, sagte Maureen Batchelor am Telefon. »George findet, das ist ein Getränk für alte Leute, und wenn ich antworte, dass wir alt sind, meint er, es gebe keinen Grund, sich das ständig vor Augen zu halten. Kommt doch auf einen Sherry vorbei. Für ein Glas Sherry ist es nie zu früh.«
»Und Sherry ist kein Getränk für alte Leute«, spöttelte Alan. »Ich wette, wenn du in den King’s Head gehst« – sie näherten sich gerade besagtem Lokal – »und einen Sherry bestellst, wird die junge Frau hinter dem Tresen nicht wissen, wovon du redest.«
George, der Älteste der noch lebenden Batchelor-Geschwister, wohnte weiterhin in der Stadt, in der er geboren und aufgewachsen war, was in den Vororten von London gar nicht so selten vorkam. Das traf auch auf Alan und Rosemary und beinahe auf Georges Bruder Stanley zu, allerdings nicht auf Georges Bruder Norman. Als sie in Georges und Maureens Wohnzimmer in dem geräumigen Bungalow namens Carisbrooke traten, waren sie deshalb ziemlich überrascht, Norman neben seinem Bruder auf dem Sofa sitzen zu sehen. George hatte das Bein ausgestreckt und stützte es auf etwas, das Maureen als »pouffe« bezeichnete.
»Wie geht es dir, Norman?«, fragte Rosemary. »Lange nicht gesehen.« Diesen Satz, von dem sie annahm, dass die »Chinamänner« ihn benutzten, verabscheute Alan ganz besonders.
»Inzwischen lebe ich in Frankreich und bin nicht mehr oft hier.« Norman setzte zu einem ausführlichen Lobgesang auf die französische Kultur, das Essen, die Getränke, die Verkehrsmittel, die Landschaft, das Gesundheitswesen und sein Haus an. Maureen schien die Ohren auf Durchzug zu stellen. Ihre Miene besagte, dass sie das alles schon öfter gehört hatte. Sie stand auf und kehrte mit einem Servierwagen voller Gläser und verschiedener Sherryflaschen zurück, unter anderem Oloroso, Amontillado und Manzanilla.
Nachdem Alan ein Glas Amontillado entgegengenommen hatte, reichte er George den Daily Telegraph. »Hast du das gelesen?«
George würdigte die Zeitung kaum eines Blickes. »Klar. Wir haben dasselbe Blatt abonniert.« Er nickte wissend. »Ich habe es gebaut.«
»Was, Warlock?«
»Mein Bruder und ich. Die Batchelor-Brothers. Wir haben jede Menge der Häuser auf dem Hill gebaut.«
Wie Alan wusste, hieß das nicht, dass George und Stanley diese Häuser mit eigenen Händen gebaut hatten, sondern ihre Firma, und zwar auf den Feldern, wo sie mit den anderen Kindern zwischen Entwarnung und Fliegeralarm auf den Feldern herumgetollt waren.
»Wann war das, George?«, erkundigte sich Rosemary.
»Irgendwann Anfang der Fünfziger. Zweiundfünfzig? Dreiundfünfzig?«
»Okay. Kannst du mir vielleicht sagen, ob sich unsere Tunnels unter Warlock befunden haben?«
»Oh, nein«, erwiderte George. »Obwohl sie genau das waren: die Fundamente eines Hauses.«
»Die Fundamente eines Hauses«, wiederholte Rosemary. »Darauf wäre ich nie gekommen.«
»Als ich das Land kaufte, waren sie längst weg. Für Warlock haben wir neue Fundamente gegraben. Ein Mr. Roseleaf ließ das Haus bauen. Ein komischer Name, fand ich. Deshalb habe ich ihn mir gemerkt.«
Norman, vor dessen Auge der Sherry keine Gnade gefunden hatte, weil es spanischer, kein französischer war, war eingenickt und erwachte jetzt mit einem Schnauben. »Das war es also«, meinte er. »Die Fundamente eines Hauses. Warlock ist aber auch ein komischer Name.«
»Das bezeichnet einen Mann, der eine Art Hexe ist«, erklärte Maureen. »Irgendwie auch komisch.«
»Mit Hexen hatte es nichts zu tun«, erwiderte George. »Es lag daran, dass er in Maida Vale in einer Straße namens Warlock Road gewohnt hat.«
»Nicht zu fassen«, rief Norman aus. »Du warst damals auch dabei, oder, Alan? Und Rosemary. Und Lewis Newman – erinnert ihr euch an ihn? Und erinnert ihr euch an Stanleys Hund Nipper? Ein lieber Hund. Meine Mum war nur selten sauer auf uns, aber sie war ganz schön wütend, als sie erfuhr, dass Stanley ohne Erlaubnis abends den Hund ausgeführt hat.«
Rosemary lächelte wehmütig. »Nipper war ein Schatz. Wir hätten auch so gern einen Hund gehabt, nicht wahr, Alan?«
»Ihr habt beim Hausbau nicht zufällig diese Hände gefunden, George?«
»Dann hätte ich doch sicher was gesagt, oder?«
Um seinem Ton die Schärfe zu nehmen, wuchtete George sich hoch und füllte die Sherrygläser nach. Einige Gäste bemerkten, dass er Amontillado in Manzanilla-Gläser goss, doch niemand sagte etwas. Rosemary bekam Oloroso anstelle von Amontillado, beschwerte sich aber nicht. Eigentlich war ihr süßer Sherry sowieso lieber, obwohl sie nicht danach gefragt hatte, weil der bekanntermaßen dick machte.
»Dort haben wir uns kennengelernt«, meinte sie. »In den Tunnels.«
»Was, als du zehn warst?«, fragte George.
Rosemary nickte, plötzlich verlegen. Sich kennengelernt, einander aus den Augen verloren, als irgendein Vater sie hinausgeworfen und sie angebrüllt hatte, sie sollten verschwinden und niemals wiederkommen, sich Jahre später wieder begegnet, diesmal auf einer Tanzveranstaltung, miteinander gegangen (obwohl man damals diesen Ausdruck nicht benutzte) und schließlich geheiratet. Sie hatte den Eindruck, dass die anderen sie anstarrten, als habe sie gerade ein uraltes und inzwischen ausgestorbenes Stammesritual geschildert. Außer ihr und Alan waren sie alle davor schon mindestens einmal verheiratet gewesen, waren geschieden und weggezogen oder lebten sogar wie Norman im Ausland.
»Wer hat uns denn eigentlich aus den Tunnels vertrieben?«, erkundigte sie sich fröhlich, um die Peinlichkeit zu überspielen. »Irgendjemandes Vater? Michael Woodman? Woodley?«
»Der Dad von Michael Winwood«, antwortete Norman. »Die Winwoods haben auf dem Hill neben den Jones gewohnt. Und Bill Johnsons Familie wohnte ein Stück weiter den Hill hinauf. Winwood hat rausgekriegt, dass wir alle abends in die Tunnels gegangen sind. Wahrscheinlich hat Michael es ihm erzählt. Er ist einfach über die Straße, hat den Eingang gefunden und hat runtergerufen, wir sollten rauskommen und verschwinden.«
Während er sprach, war sein Bruder Stanley unbemerkt durch die Hintertür ins Haus gekommen. Norman sprang auf, als er die Hand auf seiner Schulter spürte, und die beiden Brüder umarmten sich. Später meinte Rosemary zu ihrem Mann, sie hätte gar nicht gewusst, wo sie hinschauen sollte. Brüder, die sich umarmten. Was wohl als Nächstes dran sei? Obwohl Alan die Geste gefallen hatte, schwieg er. Im Laufe seiner Ehe hatte er sich häufig darin geflüchtet, nichts zu sagen. Diese Batchelors seien schon immer seltsam gewesen, stellte Rosemary auf dem Heimweg fest. Norman, der Jüngste, erzählte zum Beispiel überall herum, er sei auf dem Küchentisch geboren worden.
George, der Konventionellere, schüttelte seinem Bruder die Hand und zeigte mit bedauernder Miene auf seine Hüfte. »Wir haben gerade über die Winwoods geredet. Erinnerst du dich noch an sie?«
»Sie haben neben Daphne Jones auf dem Hill gewohnt. Klar erinnere ich mich noch gut an sie.«
Wieder dieser Name, dachte Alan. Er hatte sie vergessen, und nun war ihr Name bereits dreimal erwähnt worden. In welchem Zeitraum? Den letzten zwei Stunden? Zum Glück war er nicht errötet. Was hatte Stanley mit »gut« gemeint? Alans Stimme klang gepresst, und er fragte sich, ob es jemandem aufgefallen war. Rosemary vielleicht. »Lebt sie noch? Sie war ja älter als wir anderen.«
»War sie nicht. Sie sah nur mit zwölf schon aus wie sechzehn. Sie war nicht älter.« Stanley nickte wissend. »Ich habe den Kontakt mit ihr gehalten.« Offenbar war er stolz darauf. »Sie war dreimal verheiratet. Heute heißt sie Daphne Furness. Wohnt in Hampstead oder St. John’s Wood oder so. Nicht alle klammern sich an ihre Wurzeln.«
Alan spürte, dass er Neid empfand. Was war nur über ihn gekommen? Wie mochte es gewesen sein, in all den Jahren die Bekanntschaft mit Daphne Jones aufrechterhalten und sie womöglich häufig gesehen zu haben? Er schob den Gedanken beiseite. Er war ein alter Mann, ein Urgroßvater. George stemmte sich wieder hoch und stand schwankend da, als habe er eine Mitteilung zu machen. »Gerade ist es mir eingefallen. Ich habe ein Foto, einen Schnappschuss von uns in den Tunnels. Also ich, meine Brüder und Moira am Eingang. Robert ist nicht drauf. Er hat fotografiert. Wo ist denn das Foto, Maureen? Hast du es finden können?«
»Natürlich. Was für eine Frage!«
Alan rechnete mit einem kleinen schwarz-weißen oder sogar sepiafarbenen Bild. Stattdessen brachte Maureen ein Album, das für so eine zierliche Frau zu schwer zu sein schien. Es war braun. Die Seiten bestanden aus dicker Pappe und waren mit vermutlich Hunderten von aufgeklebten Fotos bedeckt. Maureen hatte zwar nicht zu den Kindern in den Tunnels gehört, war jedoch mit dem Inhalt des Albums vertraut, schlug eine Seite mit der Aufschrift »1944« auf und legte das Ganze auf den Couchtisch. George rutschte auf dem Sofa hinüber, stellte vorsichtig den Fuß auf den Boden und hob sein Bein mit beiden Händen an. Stanley hatte sich zwischen ihn und Norman gezwängt.
»Lasst Alan und Rosemary doch mal schauen«, sagte Maureen. »Ihr drei könnt euch die Fotos doch ansehen, sooft ihr wollt.«
Nach einer Weile lag das Album so, dass zwar alle einen Blick darauf werfen konnten, jedoch aus keinem sehr günstigen Winkel. George legte den Finger auf das verschwommene Foto, das fünf Kinder zeigte. Sie drängten sich offenbar am Eingang einer kleinen Höhle. Das Bild war kaum auszumachen und wirkte, als habe Robert Batchelor es durch einen dichten Nebel aufgenommen. »Ich, Stanley und Norman und die arme Moira«, stellte George fest. Er bezeichnete sie als »arm«, weil sie, die Jüngste, ebenso wie Robert, der Älteste, inzwischen verstorben war.
»Wer ist das?«, erkundigte sich Rosemary und wies auf einen Jungen mit einem Lockenschopf.
»Keine Ahnung.« George förderte eine Lupe zutage, wodurch das Gesicht des Jungen noch mehr verschwamm. »Vielleicht Bill Johnson.«
Die übrigen Fotos auf der Seite interessierten Alan und Rosemary nicht sehr. Sie stellten das Innere des Hauses der Batchelors in Tycehurst Hill, Stanley mit einem Kricketschläger und einen Tisch mit einer karierten Decke dar, mysteriös für jeden, der Normans Lebensgeschichte nicht kannte.
»Schaut euch das an«, verkündete Norman. »Das habe ich geknipst. Schön, dass du es behalten hast, George. Ich wurde auf diesem Tisch geboren. Meine Mum ging im Haus herum und wartete auf die Hebamme. Sie hatte natürlich Wehen, aber darüber wurde nie gesprochen, auch wenn es die Wahrheit war. George und Moira haben den Tisch in den Garten getragen, damit Robert ihn fotografieren konnte, weil es in der Küche zu dunkel war. Toll, dass du es noch hast. Kannst du es herausnehmen und mir geben, George?«
»Nein, kann ich nicht. Damit würde ich das Album beschädigen.« George blickte ihn an. »Möchtet ihr mehr sehen? Ich frage nur, weil mein Bein mich umbringt.«
»Reich mal rüber«, erwiderte Maureen. »Dann können Alan und Rosemary besser sehen.«
Sie legte Alan das Album auf die Knie. »Auf der nächsten Seite sind noch mehr, die Robert von den Tunnels gemacht hat«, ergänzte George.
Alan blätterte um, und da war sie. Sie saß zwischen Stanley und Michael Winwood auf einem Stapel Ziegelsteine und trug ein Sommerkleid. Das Haar, dunkelbraun, beinahe schwarz, fiel ihr in Wellen über die Schultern und über den halben Rücken hinab. Als Alan die Seite betrachtete, durchfuhr ihn ein Schauder, so plötzlich, dass Rosemary sich mit besorgter Miene zu ihm umwandte. Diese Haare, die sie manchmal zu Zöpfen geflochten hatte. Die Wellen entstanden, wenn man die Zöpfe wieder löste.
»Das ist sie«, sagte Stanley und reckte den Hals, um besser sehen zu können. »Inzwischen sieht sie ganz anders aus, doch man erkennt immer noch die junge Daphne in ihr.«
Rasch blätterte Alan weiter und stieß auf zehn oder elf Fotos von Stanleys Hund.
»Nipper. Da ist er, mein erster Hund. Seitdem hatte ich schätzungsweise noch zehn, und sie sind alle uralt geworden.« Stanley seufzte. »Alfie ist letztes Jahr mit achtzehn gestorben. Jetzt schaffe ich mir keinen mehr an. Es wäre traurig für ihn, wenn ich zuerst gehen müsste, was in meinem Alter jederzeit der Fall sein kann.«
Nach dieser Bemerkung legte sich eine leicht düstere Stimmung über die Runde. Immerhin waren sie alt, hatten nicht mehr viel Zeit und versuchten, nicht daran zu denken. Alan fragte Stanley, wo er jetzt wohnte. In Theydon Bois, erhielt er zur Antwort, einem abgelegenen, aber nicht allzu weit entfernten Dorf im Wald. Eigentlich hätte er gern mehr über Daphne gewusst, scheute jedoch davor zurück und erkundigte sich stattdessen nach Michael Winwood. Im Nordwesten von London, erfuhr er und erhob sich dann, um zu gehen.
»Sollten wir die Polizei verständigen?«
»Schlafende Hunde sollte man nicht wecken«, entgegnete Stanley. »Schlafende Knochen auch nicht.«
»Wir sollten es besser melden.« George verlagerte sein krankes Bein und verzog das Gesicht. »Wenn ihr möchtet, übernehme ich das. Schließlich habe ich Warlock gebaut und habe diese Fotos. Deshalb ist es meine Aufgabe. Aber das Album nehmen die mir nicht mit.«
»Wir könnten versuchen, ein paar der anderen ausfindig zu machen«, schlug Norman vor. »Das könnte Maureen tun. Du kennst dich doch hier am besten mit der Technik aus, oder?«
»Eher mit dem Telefonbuch«, antwortete seine Schwägerin.
3
Alan und Rosemary stiegen den Traps Hill hinauf. Als sie noch Mitglied im Tennisclub gewesen waren, waren sie diesen Hügel hochgerannt. Inzwischen war Rosemary stolz darauf, dass sie es im Schritttempo schaffte und dabei nur leicht außer Atem geriet. Sie kannten jeden Zentimeter von Loughton. In ihrer Kindheit hatte man es »das Dorf« genannt. »Ich bin kurz unten im Dorf«, hatte es geheißen, wenn man seine Einkäufe erledigte.
Nachdem sie sich bei einer Tanzveranstaltung wiederbegegnet waren und sich an ihre Kindheitsfreundschaft erinnert hatten, waren sie miteinander gegangen, hatten sich verlobt, geheiratet und ein Haus im Harwater Drive gekauft. Als später die Kinder kamen und Alan mehr verdiente, hatten sie ein größeres und besseres in der Church Lane erworben. Die hübschen Felder und Wälder, wo die begehrteste Straße von allen oben auf dem Hill und an der Borders Lane mündete, waren mittlerweile über viele Hektar hinweg mit einer Siedlung namens Debben Estate bebaut worden. Die Wohlhabenden von Alderton Hill waren angesichts dieses Zuzugs aus dem Londoner East End erschaudert. Ebenso erging es den Eltern von Alan und Rosemary und ihren Nachbarn, die in weniger teuren, aber dennoch beliebten und gutbürgerlichen Straßen wohnten. Einige waren weggezogen. Nach außerhalb natürlich, wie nach Essex oder sogar bis nach Epping und Theydon Bois, nur um dort von der neu erbauten Harlow New Town vergrault zu werden. Das Floriansprinzip war damals noch nicht in aller Munde gewesen, doch genau das bestimmte das Denken dieser Menschen.
Alan und Rosemary hatten in der St. Mary’s Church in Loughtons High Road geheiratet. Alans Freund Richard Parr, auch eines der Tunnelkinder, war sein Trauzeuge gewesen. Eine Woche später, Alan und Rosemary verbrachten ihre Flitterwochen auf der Isle of Wight, war Richard nach Kanada ausgewandert. Er und Alan waren noch eine Weile in Kontakt geblieben und hatten sich Luftpostbriefe auf dünnem blauem Papier geschickt. Telefonieren war viel zu kostspielig.
Inzwischen Urgroßeltern – ihr zweites Urenkelkind war vor drei Jahren zur Welt gekommen –, hatten Rosemary und Alan das Haus in der Church Lane, in dem sie fast ein halbes Jahrhundert lang gewohnt hatten, verkauft. Damals hatten sie achttausend Pfund dafür bezahlt, und sie veräußerten es für drei Millionen. Sie waren in eine Wohnung gezogen, in eine Luxuswohnung im ersten Stock in Traps Hill. Denn sie waren für ihr Alter noch gut in Form und erschauderten bei der Vorstellung von betreutem Wohnen.