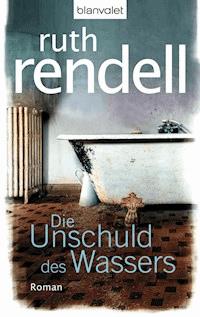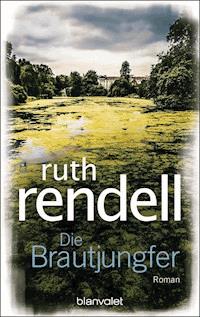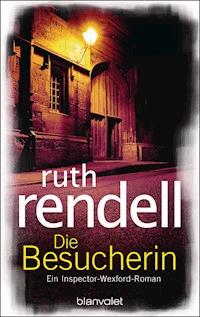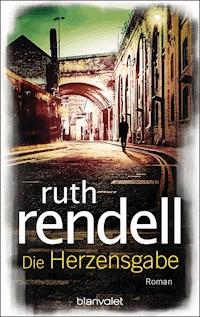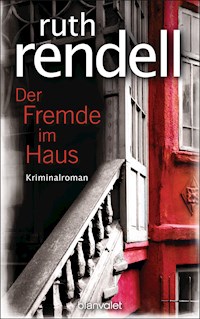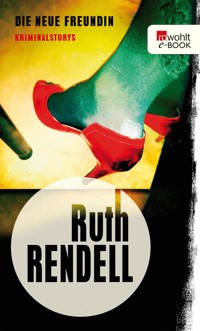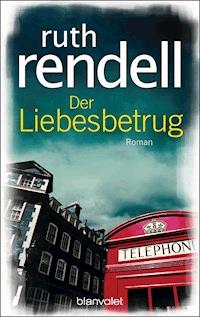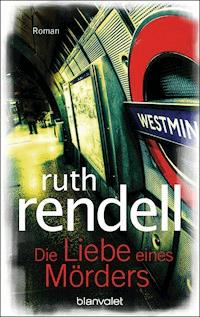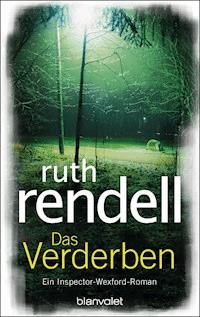4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ROWOHLT E-Book
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Benet Archdale hat sich endlich ihr eigenes Leben aufgebaut. Die durch die geisteskranke Mutter bedingten Kindheitserlebnisse scheint sie verarbeitet und überwunden zu haben. Als erfolgreiche junge Schriftstellerin lebt sie heute in London allein mit ihrem kleinen Sohn James, ihrem größten Glück. Doch der Frieden wird gestört. Benets an Schizophrenie leidende Mutter kommt nach Jahren zu Besuch. Sie scheint völlig geheilt und normal. Umso unvermuteter bricht die Katastrophe über Benet herein …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 442
Veröffentlichungsjahr: 2014
Ähnliche
Ruth Rendell
Die Masken der Mütter
Roman
Aus dem Englischen von Edith Walter
Ihr Verlagsname
Über dieses Buch
Benet Archdale hat sich endlich ihr eigenes Leben aufgebaut. Die durch die geisteskranke Mutter bedingten Kindheitserlebnisse scheint sie verarbeitet und überwunden zu haben. Als erfolgreiche junge Schriftstellerin lebt sie heute in London allein mit ihrem kleinen Sohn James, ihrem größten Glück. Doch der Frieden wird gestört.
Benets an Schizophrenie leidende Mutter kommt nach Jahren zu Besuch. Sie scheint völlig geheilt und normal. Umso unvermuteter bricht die Katastrophe über Benet herein …
Über Ruth Rendell
Ruth Rendell wurde 1930 in London geboren, wo sie auch heute lebt. Seit ihrem ersten Buch «Alles Liebe vom Tod», das 1964 erschien, hat sie alle wesentlichen Preise und Auszeichnungen erhalten: mehrfach den Silver und Gold Dagger der englischen Krimiautoren, mehrfach den Edgar der Mystery Writers of America, den Diamond Dagger für ihr Lebenswerk, den Grand Masters Award, den Literary Award der Sunday Times. Die englische Königin erhob sie 1997 aufgrund ihrer Verdienste um die Literatur in den Adelsstand und verlieh ihr den Titel «Baroness». Ruth Rendell schreibt auch unter dem Pseudonym Barbara Vine.
Weitere Veröffentlichungen:
Der Pakt
Durch das Tor zum Himmlischen Frieden
Die neue Freundin
Dämon hinter Spitzenstores
Die Grausamkeit der Raben
Inhaltsübersicht
Die Hauptpersonen
liebt ihren Sohn James über alles, aber sie hasst ihre Mutter, die anscheinend nur sich selbst liebt.
Margaret ‹Mopsa› Archdalewurde zwar schon einmal von ärztlicher Seite für verrückt erklärt, aber dafür handelt sie ab und zu erstaunlich weitsichtig.
Edward Greenwoodhasst Kinder, aber er ist der Vater von James – diese Tatsache erscheint ihm Grund genug, Benet endlich zu heiraten und damit auch ihren Erfolg.
Dr. Ian Raeburnkann eine Katastrophe nicht verhindern, dafür aber mit großem Einfühlungsvermögen Benet Archdales Vertrauen gewinnen.
Carol Stratfordist eine ausgesprochen attraktive Frau und hat in ihrem Leben bestimmt mit mehr als hundert Männern im Bett gelegen, aber nicht nur diese Gier wird ihr zum Verhängnis.
JasonCarols jüngster Sohn hat nicht nur unter der Vernachlässigung seiner Mutter zu leiden.
Barry MahonAuf diesen Iren trifft das Sprichwort zu: «Liebe macht blind», und zwar in allen Bereichen.
Terry Wandliebt nur das Geld, und er kann den größten Coup seines Lebens landen, wenn seine Nerven mitspielen.
Freda Phippssollte vorsichtiger in der Wahl ihrer Liebhaber sein.
Für mein Patenkind Francesca in Liebe
Erstes Buch
1
Einmal – Benet war damals ungefähr vierzehn, und sie saßen allein in einem Zugabteil – hatte Mopsa sie mit einem Tranchiermesser erstechen wollen. Möglicherweise auch nur bedroht. Benet hatte sich schon gewundert, dass ihre Mutter eine so große Handtasche mitgenommen hatte, eine rote, die nicht zu den Sachen passte, die sie trug. Mopsa hatte geschrien und gelacht und wildes Zeug geredet und dann das Messer in die Tasche zurückgesteckt. Benet hatte große Angst gehabt. Sie hatte den Kopf verloren und die Notbremse gezogen, die Mopsa die «Notleine» nannte. Der Zug hatte angehalten, und sie hatten Schwierigkeiten bekommen. Benets Vater war sehr ärgerlich und auf grimmige Art traurig gewesen.
Benet hatte diesen Zwischenfall mehr oder weniger vergessen. Doch als sie in Heathrow auf Mopsa wartete, kehrte die Erinnerung plötzlich sehr lebhaft zurück. Obwohl sie Mopsa seither oft gesehen, mit ihr unter demselben Dach gewohnt und erlebt hatte, wie sie sich verändern konnte, hielt Benet Ausschau nach einer in flatternde Tücher und Schals gehüllten Gestalt mit kurzen struppigen Haaren, als sie inmitten von Reiseleitern mit Schildern, ängstlichen Indern und Ehefrauen von Geschäftsleuten hinter der Barriere stand. James wollte aus seiner Kinderkarre heraus, er konnte dort unten nichts sehen und fühlte sich nicht wohl. Benet hob ihn hoch, setzte ihn seitlich auf ihre Hüfte und schlang einen Arm um ihn.
Hier zu warten, hätte eigentlich aufregend sein müssen. Als die ersten Leute hinter der Wand auftauchten, hinter der sich die Zollkontrolle verbarg, hatte der Augenblick etwas Dramatisches an sich, fast so, als seien sie in die Freiheit entronnen. Benet fiel ein, dass sie einmal hier auf Edward gewartet hatte, und wie wunderbar es gewesen war, als sie ihn plötzlich sah. All die unbekannten Leute, die Fremden, und dann Edward, so eindeutig und unverkennbar Edward, als sei er in Farbe und alles andere nur schwarz und weiß. Auf Mopsa zu warten war nicht so. Auf Edward zu warten, wenn das überhaupt vorstellbar war, wäre heute auch nicht mehr so. In ihrer Welt gab es außer James niemanden mehr, auf den sie noch so warten konnte, und für eine Trennung von James gab es nicht den geringsten Grund. Nicht auf viele, viele Jahre hinaus. Sie grub in ihrer Handtasche nach einem Tempotaschentuch und putzte ihm die Nase. Armer James. Aber er war ein schöner Junge. Er war immer schön, auch wenn sein Gesicht blass und spitz und seine Nase rot war.
Ein Paar kam heraus. Die beiden schoben je einen karierten Koffer auf Rädern vor sich her. Die Frau hinter ihnen trug einen kleinen Koffer in der einen und eine Reisetasche in der anderen Hand. Schwierig zu sagen, welches Stück Handgepäck war und welches die Zollkontrolle durchlaufen hatte. Koffer und Reisetasche passten zusammen, waren aus einem beigefarbenen Material, dem man nicht ansah, ob es Leder oder Kunststoff war. Die Frau wirkte farblos und verbraucht. Die blassen, rastlos schweifenden Augen blieben auf Benet haften und erkannten sie. Das Erkennen ging von ihr aus – Benet hätte nicht gewusst, wer sie war.
Aber es war Mopsa. Es war ihre wahnsinnige Mutter, die sie küsste, lächelte und mit der Hand abwinkte, als James das Gesicht an Benets Schulter vergrub, anstatt Mopsa zu begrüßen. Sie trug ein schlechtsitzendes graues Kostüm, eine rosafarbene Seidenbluse mit einer goldenen Nadel am Kragen. Das Haar, lieblos abgeschnitten, war zu stumpfem Silbergrau ausgebleicht.
Benet legte das Gepäck auf die Kinderkarre. Sie behielt James auf dem Arm, der schniefte und aus großen runden Augen die unbekannte Großmutter anstarrte. Mopsa hatte sich einen energischen und federnden Gang angewöhnt. Sie hatte eine aufrechte Haltung und trug den Kopf hoch. Früher war sie oft gebückt gegangen, manchmal hatte sie getanzt und sich in ihren Isadora-Duncan-Stimmungen schwebend gewiegt, aber sie war nie ausgeschritten wie eine normale Frau. Oder vielleicht hat sie’s getan, als ich noch sehr klein war, dachte Benet und bemühte sich, sich zu erinnern, wie ihre Mutter vor vierundzwanzig Jahren gewesen war. Es war zu lange her. Sie wusste nur, dass sie sich immer danach gesehnt hatte, eine normale Mutter zu haben wie andere Mädchen, für die das etwas Selbstverständliches war. Jetzt schien auch ihre Mutter normal zu sein, doch Benet war inzwischen achtundzwanzig, und es hatte keinerlei Bedeutung mehr für sie. Sie fragte nach dem Vater.
«Es geht ihm gut, und er lässt dich grüßen.»
«Und es gefällt dir tatsächlich, in Spanien zu leben?»
«Ich möchte nicht behaupten, dass es keine Nachteile hat, aber Dad spürt seit drei Jahren überhaupt nichts mehr von seinem Asthma. Und ich bleibe auch fit.» Mopsa lächelte, als sei ihre Krankheit auch nichts anderes als eine Form von Asthma. Sie redete genau so, wie eine der Nachbarinnen in Edgware geredet hatte. Wie Mrs. Fenton, dachte Benet, wie eine ganz durchschnittliche Hausfrau mittleren Alters. «Ich komme mir wie eine Betrügerin vor, weil ich eigens hergeflogen bin, um mich untersuchen zu lassen», sagte Mopsa. «Ich bin wieder ganz in Ordnung. ‹Mir fehlt nichts mehr›, habe ich gesagt, aber sie meinten, es werde mir nicht schaden, und warum sollte ich nicht ein paar Tage Urlaub machen? Na ja, aber eigentlich bin ich doch ständig im Urlaub, oder? Fahren wir mit der U-Bahn? Es muss schon sieben oder acht Jahre her sein, seit ich das letzte Mal U-Bahn gefahren bin.»
«Ich bin mit dem Wagen hier», sagte Benet.
Als junges Mädchen hatte sie sich immer wieder vorgesagt: Ich darf meine Mutter nicht hassen. Die Selbstbeschwörung hatte nicht immer geholfen, und dann hatte sie sich gesagt: Aber sie ist krank, sie kann nichts dafür, sie ist wahnsinnig … Sie hatte verstanden und vergeben, aber sie hatte nicht mit ihrer Mutter zusammen sein wollen. Als sie auf die Universität gegangen war, hatte sie beschlossen, nie wieder zurückzukehren, und das hatte sie, von ein paar kurzen Ferientagen abgesehen, auch eingehalten. Ihr Vater hatte sich zur Ruhe gesetzt, und dann hatten sich die Eltern ein kleines Haus in der Nähe von Marbella gekauft. Mopsas Gesicht und Handrücken waren von der Sonne Südspaniens gebräunt. Benet setzte James auf ihre andere Hüfte, und er klammerte sich schniefend an sie.
«Er hat eine scheußliche Erkältung», sagte Mopsa. «Ob es richtig war, dass du ihn mitgenommen hast?»
«Ich habe niemanden, der ihn mir abnimmt. Du weißt doch, dass ich gerade umgezogen bin.»
Auf dem Rücksitz des Wagens war ein Kindersitz angebracht, in dem James sonst zufrieden saß. Benet gurtete ihn an und verstaute Mopsas Gepäck im Kofferraum. Sie wäre dankbar gewesen, wenn die Mutter ihr angeboten hätte, sich zu James in den Fond zu setzen, doch sie hatte sich schon auf den Beifahrersitz geschoben, den Sicherheitsgurt angelegt und die Hände in den plumpen schwarzen Lederhandschuhen im Schoß gefaltet. Sie schien auch nicht auf den Gedanken zu kommen, mit James zu sprechen. Er fühlte sich unglücklich, nieste manchmal und quengelte leise vor sich hin. Benet redete mit ihm, während sie fuhr, zeigte ihm Leute, Hunde und Gebäude, alles, was ihn möglicherweise interessieren konnte. Bald jedoch merkte sie, dass Mopsa beleidigt war. Mopsa wollte über ihre Sorgen und Hoffnungen sprechen, über Spanien und ihr Haus und darüber, was sie in London unternehmen wollte. Benet kam ein Gedanke, den sie bisher noch nie verfolgt hatte: Irgendwie setzte man immer voraus, dass ein von einer Geisteskrankheit geheilter Mensch nur noch nett war, selbstlos, rücksichtsvoll, angenehm und vernünftig. Doch das war natürlich nicht der Fall. Wieso denn auch? Unter der Psychose lagen genauso wie beim gesunden Menschen Niedertracht und Anständigkeit verborgen, ganz normale Eigenschaften also. Natürlich war Mopsa nicht gemein oder niederträchtig, durchaus nicht. Aber vielleicht, überlegte Benet, erwies sich ihre Mutter, die so lange geisteskrank gewesen war, nach ihrer Heilung als hochgradige Solipsistin – als ein Mensch, der glaubte, die Welt drehe sich nur um ihn.
Das Haus in Hampstead, im Vale of Peace, war Benet immer noch fremd. Sie war erst vor drei Tagen eingezogen. Sie bog in den schmalen Weg zwischen den hohen Böschungen ein, der in das Dörfchen am Rand der Heide führte. Ihr halbes Leben – genau seit jenem Tag, an dem sie mit Freunden auf dem Jahrmarkt gewesen war, der an Feiertagen in der Nähe der Spaniards Road abgehalten wird – hatte sie davon geträumt, einmal hier zu wohnen. Als der Wunsch schließlich nicht mehr nur Traum bleiben musste, als sie sich ihn erfüllen konnte, hatte er sich in einen handfesten Plan verwandelt. Mopsa schien jedoch noch nie etwas von dieser berühmten Enklave gehört zu haben, die sich unter die hohen Wipfel von Kastanienbäumen, Sykomoren und Montereytannen duckte, wo blaue Gedenktafeln an längst dahingegangene Poeten erinnerten, an einen Maler, an einen oder zwei Impresarios. Dass Shelley auf dem Teich Papierschiffchen segeln ließ und Coleridge, auf dem Dorfanger auf einem Holzklotz sitzend, ein magisches, unvollendet gebliebenes Epos begonnen hatte, waren Überlieferungen aus der Welt der Literatur, die nie bis zu Mopsa durchgedrungen waren. Sie stieg aus dem Wagen und beäugte Benets hohe, schmale viktorianische Villa mit einer Miene, die Enttäuschung verriet. Was hatte sie erwartet? Einen Art-déco-Palast in der Bishop’s Avenue?
«Tja, wahrscheinlich wolltest du nichts allzu Pompöses, einfach nur ein Haus für dich und das Baby allein.»
Also ein Baby ist James eigentlich nicht mehr, dachte Benet, während sie die Haustür aufschloss. Er war ein Jahr und neun Monate, konnte schon ziemlich viele Wörter sprechen und noch mehr verstehen. Er kletterte die Stufen zur Haustür hinauf, wurde munterer, weil er wieder zu Hause war, vermutlich weil er sich an die Schätze erinnerte, die ihn erwarteten – seine Spielsachen, mit denen der Fußboden der großen Küche im Hochparterre übersät war, denn sie diente zugleich als Spielzimmer. Mopsa stieg über ihn hinweg, um zur Tür zu gelangen. Benet fragte sich, wie lange es wohl dauern werde, bis sie auf seine Vaterlosigkeit zu sprechen kam. Oder war sie, trotz ihres unvergleichlich viel besseren Zustands, doch keine konventionelle, spießige Vorstadthausfrau mittleren Alters, die sich an solchen Dingen stieß? War es nicht und würde es nie sein? Benet hatte kaum erwartet, ohne eine Anspielung auf Edward, die Nachteile der Unehelichkeit und die Gefahren davonzukommen, die einem Jungen drohten, der nur von seiner Mutter erzogen wurde. Sie sollte froh sein, dass es Mopsa war, die sie besuchte, und nicht ihr Vater. Er reagierte noch immer mit ungläubiger Betroffenheit auf James’ bloßes Vorhandensein.
Im Haus herrschte noch wüstes Durcheinander. Schachteln und Kisten mit unausgepackten Kleinigkeiten, Küchenutensilien, Porzellan und Glas standen im Flur herum. Außerdem stapelten sich Hunderte und Aberhunderte von Büchern auf dem Fußboden. Bevor sie zum Flugplatz musste, hatte Benet in dem Zimmer, das ihr Arbeitsraum werden sollte, Bücher in die Einbauregale geräumt und die Arbeit unterbrechen müssen. Sie hatte sich vorgenommen, ein gewisses System hineinzubringen, was ihr bisher nie gelungen war. Auf dem Boden ausgebreitet lagen auch alle sechzehn ausländischen Ausgaben ihres Bestsellers. Er war die Quelle des Überflusses, dem sie das Haus zu verdanken hatte: Die vertrackte Ehe. Benet machte die Tür zu, um James daran zu hindern, zwischen den Bergen von Paperbacks zu wüten.
Obwohl James jetzt noch viel weniger als im Auto geneigt schien, irgendwo zu wüten. Er hatte sich nicht, wie Benet es eigentlich erwartete, auf sein neuestes Spielzeug gestürzt, ein Xylophon, dessen über eine Oktave reichende Stäbe in allen Farben des Spektrums glänzten, wozu noch ein goldener kam. Er verzog sich still in sein Korbsesselchen und lutschte am Daumen. Seine Nase lief wieder, und Benet nahm ihn auf, sodass sie den Atem hörte, der seine kleine Brust hob und senkte. Es war kein Pfeifen, nur ein Atemgeräusch, wo eigentlich nichts zu hören sein sollte. In dem großen Raum im Hochsouterrain war es warm und gemütlich und an einem so sonnigen Tag auch hell genug. Benet hatte Küchenelemente aus Massiveiche einbauen und den Boden mit einem florentinerroten Spannteppich auslegen lassen. Außerdem stand hier noch der große Schrank mit James’ Spielsachen.
Mopsa deponierte Koffer und Reisetasche auf dem Bett des Zimmers, das Benet für sie bestimmt hatte, kam munter wieder herunter und verkündete: «So, und jetzt gehen wir alle miteinander essen. Ich lade euch ein.»
«Ich glaube, ich sollte heute lieber nicht mehr mit ihm an die Luft. Es scheint ihm nicht gutzugehen. Wir können hier essen. Ich habe alles für den Lunch vorbereitet.»
Mopsa war ungehalten und zeigte es offen. «Es ist nicht kalt, nicht einmal nach meinen spanischen Maßstäben.» Ihr Lachen klang metallisch und irgendwie geborsten, nicht unähnlich dem tiefsten Ton von James’ Xylophon. «Du musst eine sehr aufopfernde Mutter sein.»
Benet antwortete nicht. Sie war selbst erstaunt, dass sie eine so aufopfernde Mutter geworden war. Es war natürlich auch ihre Absicht gewesen. Als sie sich ganz bewusst dazu entschlossen hatte, als unverheiratete Frau ein Kind zu bekommen, als James geboren wurde, hatte sie sich fest vorgenommen, eine aufopfernde Mutter zu sein, hatte eine ideale Kindheit für ihn geplant, ihm alle nur erdenkliche Liebe und das Beste an materiellen Dingen zu geben. Sie hatte nicht geahnt, dass weder Vorsätze noch Pläne nötig gewesen wären, weil sie ihm vom Augenblick seiner Geburt an völlig verfallen war.
Sie bereitete den Lunch zu – Suppe, Vollkornbrot, Entenpastete und Salat für sie und Mopsa, Rühreier, Toast und Schokoladeeis für James. Am anderen Ende des Raumes, auf dem Fenstersitz mit Ausblick auf den kleinen Steingarten und die Steinmauer dahinter, saß Mopsa und las das Taschenbuch, das sie aus Spanien mitgebracht hatte. Sie hatte nicht versucht, James auf den Schoß zu nehmen. Benet unterdrückte ihre Empörung, verbot sich sogar, sie zu empfinden. James aß nur ein paar Bissen, nicht einmal sein Lieblingsessen konnte seinen Appetit anregen.
«Er muss sich richtig ausschlafen», sagte Mopsa.
Wahrscheinlich hatte sie recht. Obwohl Benet der Meinung war, sie habe es nicht gesagt, weil sie sich um ihn sorgte, sondern eher weil sie ihn loswerden wollte. James’ Zimmer war das einzige im Haus, in dem schon mustergültige Ordnung herrschte und keine unausgepackte Kiste mehr herumstand. Benet gab ihm sein Lieblingsspielzeug, ein knautschiges Tigerjunges mit baumelnden Pfoten, in die Hand und legte ihn liebevoll in sein Kinderbett. James ließ sich am Tag nur höchst unwillig ins Bett bringen, setzte sich normalerweise sofort wieder bolzengerade auf und streckte hartnäckig die Arme in die Höhe. Heute blieb er, seinen Tiger umklammernd, reglos liegen. Sein Gesicht war gerötet, als bekäme er tatsächlich die seit langem erwarteten hinteren Backenzähne. Es kann nichts Schlimmes sein, dachte Benet. Sie hatte ihn gegen jede nur denkbare Krankheit impfen lassen. Gegen Erkältungen war er seit jeher anfällig gewesen, und er hatte sehr empfindliche Bronchien. Es rasselte jetzt in seiner Brust, wenn er einatmete. Sie blieb fünf Minuten bei ihm sitzen, bis er eingeschlafen war.
«Ich hätte nicht geglaubt, dass du zu so mütterlichen Gefühlen fähig bist», sagte Mopsa. Sie war ins Wohnzimmer hinaufgegangen, in dem es noch chaotisch aussah, hatte ein paar Flaschen entdeckt, die Benet noch nicht weggeräumt hatte, und schenkte sich einen Brandy ein. Sie hatte nie viel getrunken, war nie in Gefahr gewesen, Alkoholikerin zu werden, aber sie nahm ab und zu recht gern einen Drink, und manchmal hatte er eine merkwürdige Wirkung auf sie. Benet erinnerte sich noch sehr gut, dass ihr Vater und sie sich vor Jahren immer bemüht hatten, Mopsa von der Sherryflasche fernzuhalten. Mit halbgeöffneten, zitternden Lippen lächelte Mopsa sie auf eine vage, alberne Art an. «Es ist oft so, dass man sie nicht will und sie doch liebt, wenn sie erst mal da sind.»
«Ich wollte James», antwortete Benet und schnitt, um sie abzulenken, das Thema an, auf das die Mutter – wie sie wusste – mit größtem Vergnügen einging. «Erzähl mir von den Tests, die man mit dir machen will.»
«In Spanien haben sie nicht die notwendigen medizinischen Apparate dazu. Ich hab ja schon immer behauptet, dass mir ein Enzym oder so was Ähnliches fehlt, und jetzt sieht es so aus, als kämen sie langsam zu derselben Überzeugung.» Mopsa hatte seit Jahren geleugnet, dass sie überhaupt krank war. Immer waren es die andern, die krank oder boshaft waren oder kein Verständnis für sie hatten. Doch wenn sie der Erkenntnis, dass sie nicht normal war, nicht mehr ausweichen konnte, wenn sie sich in den Perioden geistiger Klarheit an Albträume erinnerte, schrieb sie nicht ihrer Psychose die Schuld zu, sondern einem Defekt in ihrem chemischen Körperhaushalt.
«Nehmt doch einmal den Fall George III.», pflegte sie zu sagen. «Man hat ihn jahrelang für verrückt gehalten. Man unterwarf ihn höllischen Torturen. Jetzt weiß man, dass er Porphyrie hatte und er wieder normal geworden wäre, wenn man ihm gegeben hätte, was seinem Körper fehlte.»
Vielleicht hatte sie recht. Doch welche Körpersubstanz ihr auch gefehlt haben mochte, es sah ganz so aus, als sei der Mangel in letzter Zeit auf natürliche Weise ausgeglichen worden. Während Mopsa völlig klar und sehr intelligent über die Einzelheiten der Tests und der späteren sehr komplizierten Auswertung sprach, hatte Benet den Eindruck, sie sei geistig gesünder, als sie sie seit ihrer Kindheit je erlebt hatte. Sogar der Schleier, der ihre grünblauen Augen getrübt hatte, schien verschwunden. An seine Stelle war ein normaleres, von innen her kommendes Licht getreten.
Mopsa sah sich im Zimmer um. «Wo ist dein Fernseher?»
«Ich habe keinen.»
«Was? Du hast wirklich keinen Fernseher? Ohne Fernsehen wäre ich verloren, obwohl das Programm in Spanien nicht sehr gut ist. Ich habe mich auf das englische Fernsehen gefreut. Warum hast du denn keinen Apparat? Es ist doch unmöglich, dass du ihn dir nicht leisten kannst?»
«Ich schreibe, wenn James schläft, also hauptsächlich am Abend. Ein Fernseher wäre wenig sinnvoll für mich.»
«Er schläft jetzt. Möchtest du vielleicht ein bisschen schreiben? Nimm bloß keine Rücksicht auf mich! Ich bin mucksmäuschenstill und lese mein Buch.»
Benet schüttelte den Kopf. Sie war nicht imstande, einem Außenstehenden die besonderen Voraussetzungen zu erklären, die sie brauchte, um schreiben zu können – eine gewisse Abgeschiedenheit, eine nachdenkliche Atmosphäre, eine gewisse geistig-seelische Einstimmung. Und mit Mopsa konnte sie schon gar nicht darüber sprechen. Außerdem war sie in der höchst ungewöhnlichen Situation einer Frau, die ein paar Erinnerungen und Beobachtungen niedergeschrieben hatte – in ihrem Fall über Edward, sich selbst und ihre gemeinsame Zeit in Indien –, die Notizen und Fragmente später nur zum eigenen Vergnügen zu einem Roman verarbeitete und plötzlich feststellen musste, dass sie einen Bestseller geschaffen hatte. Ein Buch, das sofort an die Spitze jeder Bestsellerliste stürmte. Jetzt musste sie etwas Neues schreiben, das neben Die vertrackte Ehe zumindest bestehen konnte. Sie war die Autorin eines Buches, das möglicherweise ihr einziges bleiben würde, und stand vor der Hürde, ein zweites produzieren zu müssen. Das Schreiben fiel ihr nicht leicht, auch nicht, wenn sie in Stimmung war und James schlief.
Dabei fiel ihr ein, dass er jetzt schon fast zwei Stunden schlief. Sie ging hinauf und sah nach ihm. Er war noch nicht wach. Sein Gesicht war hochrot, und sein Atem ging rasselnd. Sie konnte Edward in seinem Gesicht sehen, besonders im Schwung seiner Lippen und der gut modellierten Stirn. Eines Tages, wenn er erwachsen war, würde er das Aussehen eines «englischen Gentleman» haben, wie Edward. Flachsblondes Haar, ruhige blaue Augen, ein kräftiges Kinn – und vielleicht würde bei James noch etwas dazukommen, etwas, das sein Vater nicht hatte.
Während sie darauf wartete, dass er wach wurde, stand sie am Fenster und beobachtete die untergehende Sonne. Der Himmel färbte sich erst rot, nachdem sie hinter dem Horizont verschwunden war. Jetzt war er aus dunklem Gold, von grauen Streifen durchzogen, und auf dem Wasser des Vale-of-Peace-Teichs funkelten winzige Lichter. Eine Reihe Montereytannen am anderen Ufer hob sich schwarz vom gelb und grau marmorierten Hintergrund ab. Hier ließ es sich leben, hier sollte James aufwachsen, es war der richtige Ort für ihn. Sie hatte gut gewählt.
War es irgendein Teil der Aussicht – die Tannen vielleicht und der Sonnenuntergang – oder waren es ihre Gedanken über die Kindheit und die richtige Umgebung für ein Kind, die in ihrer Erinnerung jenen furchtbaren Nachmittag mit Mopsa heraufbeschwor? Sie hatte seit Jahren nicht mehr daran gedacht. Jetzt erinnerte sie sich sehr deutlich daran, obwohl es neunzehn oder zwanzig Jahre her war. Aber erinnerte sie sich wirklich an das, was tatsächlich geschehen war? Es war der erste Ausbruch von Mopsas Wahnsinn, ihrer paranoiden Schizophrenie, den Benet miterlebte. Sie war acht und ihre Cousine, die bei ihnen war, erst drei oder vier. Mopsa hatte sie ins Esszimmer des Hauses mitgenommen, das sie in Colindale gemietet hatten, verschloss und verriegelte die Tür und rief dann Benets Vater in der Arbeit an, um ihm zu sagen, sie werde die Kinder und sich selbst umbringen. Oder hatte Mopsa nur gedroht, mit den Kindern so lange eingeschlossen zu bleiben, bis sie etwas Bestimmtes erreicht hatte? Die richtige Version lag vermutlich irgendwo zwischen diesen beiden. Wozu hatte eine Esszimmertür eigentlich einen Riegel? Aber Benet erinnerte sich sehr deutlich daran, dass Mopsa Messer aus einer Schublade genommen und die kleine Cousine geschrien hatte wie am Spieß. Dann hatte Mopsa schwere Möbelstücke, eine Anrichte und irgendeinen anderen Schrank, vor die Terrassentür geschoben. Am lebhaftesten erinnerte sich Benet noch an das Krachen der aus den Angeln gerissenen Tür, an das Splittern von Holz und das laute Poltern, mit dem zuerst ihr Onkel, dann ihr Vater ins Zimmer stürmten. Sie waren allein, hatten keine fremde Hilfe mitgebracht. Zweifellos hatten Scham und die Angst vor den Konsequenzen sie daran gehindert. Sie waren alle unverletzt geblieben, und Mopsa war danach ganz ruhig geworden. Niemand hätte vermutet, dass etwas mit ihr nicht stimmte. Bis sie angefangen hatte, zwanghaft zu stehlen. Das war das nächste Symptom gewesen. Unmöglich zu sagen, dass man sich etwas wünschte – etwas innerhalb vernünftiger Grenzen natürlich –, ohne dass Mopsa hinging und es stahl. Benet erinnerte sich, dass ihr Vater eine Platte bewunderte, die er bei irgendjemand gehört hatte, ein populäres, schon fast abgedroschenes Stück, Händels Wassermusik vermutlich. Mopsa gab sich unendliche Mühe, dieselbe Aufnahme zu finden, und als sie sie endlich in einem Laden entdeckte, stahl sie die Platte, die sie ohne weiteres hätte kaufen können, denn Geld hatte sie genug. Sie stahl, um den Menschen, die sie liebte, etwas zu schenken; und das Risiko erhöhte, wie ein Psychiater gesagt hatte, in ihren Augen den Wert des Geschenks. Von da an traten die Symptome ihrer Krankheit immer häufiger und in unterschiedlichster Form auf – sporadische Gewalttätigkeit, Wahnvorstellungen, kleinere «Verrücktheiten» …
James drehte sich um, setzte sich auf, stieß einen zornigen Schrei aus und rieb sich die Augen mit den Fäusten. Aus dem Schreien wurde Husten, und in seiner Brust rasselte es stärker. Benet nahm ihn auf und drückte ihn an sich. Seine Brust war wie ein Resonanzkörper, in dem fast musikalische Töne widerhallten. Die Idee, am Abend ein paar Leute auf einen Drink einzuladen – eine Möglichkeit, den Abend hinzubringen, und eine gute Möglichkeit dazu, da Mopsa sich so vernünftig benahm –, musste sie jetzt wohl fallenlassen. James war schwer erkältet und würde sie ganz für sich beanspruchen.
Im Haus war es sehr warm. Benet hatte vor ihrem Einzug die Zentralheizung überholen lassen und war jetzt froh darüber.
Mopsa, die bei geöffneter Tür ihren Koffer auspackte, sah wie der Inbegriff einer vernünftigen, ziemlich durchschnittlichen Hausfrau aus. Zweifellos war das eine Rolle, die sie spielte, vielleicht schon seit Jahren. Früher hatte sie die verschiedensten Rollen gespielt, und sie alle schienen in dieser einen verschmolzen. Oder war das die echte Mopsa, die endlich die vielschichtige psychotische Persönlichkeit abgeschüttelt hatte?
Jetzt hätte sogar der einfache Name Margaret, auf den sie getauft war, besser zu ihr gepasst als jener andere, der einen Beiklang von Wildheit und Hexenkunst, uralten Überlieferungen, Tauchstuhl, Auge des Wassermolchs und Froschschenkel hatte. Der Name stammte jedoch nicht aus Macbeth, sondern aus Ein Wintermärchen, und Benets Mutter nannte sich so, seit sie mit fünfzehn Jahren bei einer Schulaufführung die Rolle der Mopsa gespielt hatte. Obwohl er Benet als Name ihrer Mutter vertraut war wie anderen Kindern Mary oder Elizabeth, empfand sie ihn plötzlich als etwas Unrealistisches, Unpassendes. Er hätte zugleich mit der wallenden blonden Mähne verschwinden sollen. Mopsas Gesicht, ein mageres, spitzes Gesicht, das seit jeher etwas Hexenhaftes gehabt hatte – obwohl es in Benets Kindheit das einer schönen Hexe gewesen war –, wirkte irgendwie verschwommen, was vielleicht an einem gewissen Alterungsprozess lag. Die Kinnlinie war nicht mehr fest und schwungvoll, die Lippen ein wenig schlaff. Der schlechte Haarschnitt ließ sie eher bemitleidenswert aussehen, doch auch nicht mehr als andere Frauen ihres Alters, deren Leben keinen besonderen Sinn mehr hatte und die weder besonders geliebt noch gebraucht wurden.
Benet war überrascht, als sie in die Küche kam und sah, dass Mopsa sich selbst Tee aufbrühte. Gewöhnlich erwartete sie, dass man sie bediente, gleichgültig, wo sie war. Sobald es James bessergeht, dachte Benet, gehen wir zu dritt aus. James war bald alt genug, um an interessante Orte mitgenommen zu werden, zumindest konnte man jetzt schon damit anfangen. Nachdem Mopsa aus dem Krankenhaus zurück war, würden sie irgendwo nett essen, und wenn das Wetter so schön war wie heute, konnten sie nach Hampton Court fahren. Kleine Kinder wurden schnell einmal krank, aber ebenso schnell wieder gesund, das hatte Benet schon gelernt. Der heutige Abend würde nicht leicht werden, vielleicht war sie in ein oder zwei Tagen so weit, dass sie es für unerlässlich hielt, einen Fernseher zu mieten.
«Wann muss er ins Bett?», fragte Mopsa.
«Gewöhnlich um halb sieben, aber heute wird es ganz offensichtlich später werden.»
«Du verwöhnst ihn.»
Benet antwortete nicht, und Mopsa begann einen langen Monolog über die Schwierigkeiten, zu dem Krankenhaus zu gelangen, in dem die ersten Tests gemacht werden sollten. Der Weg war so weit, und mit der Untergrundbahn fand sie sich bestimmt nicht zurecht, weil sich «alles geändert» hatte, seit sie nicht mehr in London lebte. Sie studierte eine Karte des U-Bahn-Netzes und eine Straßenkarte. Benet sagte, sie bringe sie selbstverständlich mit dem Wagen hin, und wenn James noch zu krank sei, um mitgenommen zu werden, trieb sie schon jemanden auf, der bei ihm blieb.
Als sie noch in der Wohnung in Tufnell Park wohnte, war es nicht schwierig gewesen, einen Babysitter zu bekommen. Im Nebenhaus gab es junge Mädchen in Hülle und Fülle, die alle darauf brannten, ein bisschen Geld zu verdienen. Hier war es anders. Sie kannte niemanden. Sie hatte nicht einmal Freunde mit kleinen Kindern, abgesehen von Chloe, die ständig im Urlaub und verreist war.
Mopsa, der es nicht an einer gewissen Intuition mangelte, schien zu ahnen, um was sich Benets Gedanken drehten. «Könntest du nicht jetzt jemanden finden? Ich möchte mit dir essen gehen.»
«Ich kann ihn heute keiner Fremden überlassen.»
Benet beschloss, Mopsas mürrische Miene zu ignorieren. Es ging jetzt ohnehin nicht mehr darum, ob sie bei James bleiben sollte oder nicht, sondern darum, irgendetwas für ihn zu tun. Seine Stirn war heiß und feucht. Er atmete mühsam, und manchmal hustete er qualvoll. Er war zu seinem Xylophon getrabt und hatte zu spielen versucht, war aber bald wiedergekommen und auf Benets Schoß gekrochen. Da ihm das Atmen so schwerfiel, weinte er immer wieder jämmerlich und erstickt auf.
«Ich muss den Arzt anrufen.»
«Es ist sieben Uhr. Willst du den armen, überarbeiteten Mann jetzt wirklich noch belästigen, weil das Baby erkältet ist?»
«Es ist eine Frau», sagte Benet, aber mehr auch nicht. Sie wusste noch von früher, dass es sinnlos war, auf Mopsa böse zu sein, und noch sinnloser, die Beherrschung zu verlieren. Sie geriet sofort in verzweifelte, rasende Panik. Das war zwar Jahre her, aber alte Gewohnheiten sterben schwer. Benet griff nach dem Telefon, das im selben Moment zu klingeln begann.
«Das wird dein Vater sein.»
Er war es. Mopsa sah sehr selbstzufrieden aus. Über Beweise der Fürsorge und Aufmerksamkeit freute sie sich ganz unverhältnismäßig.
«Hallo, Dad, wie geht’s?» Benet musste die Sprechmuschel höher halten, weil James laut und kläglich schrie. «Tut mir leid, das ist mein armer James. Er ist erkältet.»
Obwohl es keine dramatischen Szenen gegeben hatte und sie nie aus dem Schoß der Familie ausgestoßen worden war, obwohl es auch nie offene Vorwürfe gehagelt hatte, war ihr Vater über ihre Schwangerschaft und James’ Geburt schockiert und empört gewesen. Die Situation war umso schlimmer, weil sie, eine gebildete und jetzt auch wohlhabende Frau, in einer Gesellschaft lebte, in der man die Geburt eines außerehelichen Kindes mit mancherlei Mitteln verhindern konnte. Er hatte James noch nicht ein einziges Mal bei seinem Namen genannt. Wenn James, was kürzlich geschehen war, sich für das Telefon interessierte und mit dem jeweiligen Gesprächspartner seiner Mutter reden wollte, war sein Großvater verlegen, bellte barsch ein paar Mal «Hallo» und «auf Wiedersehen» in den Hörer und schien höchst ungeduldig zu sein, wieder Benet an den Apparat zu bekommen. Als sie ihm jetzt erklärte, dass James erkältet war, sagte er nur: «Ach ja?» Es folgte eine fast peinliche Pause. Dann: «Wie geht es deiner Mutter? Sie ist doch gut angekommen, nicht wahr?»
«Es geht ihr gut. Willst du mit ihr sprechen?»
Die Pause war diesmal kürzer, aber sie war da. Zweifellos hatte John Archdale seine Frau früher einmal geliebt. Seit damals hatte er viel durchgemacht, viel ertragen. Es war nicht ihre Schuld, sie musste einem leidtun, sie war genauso hilflos und krank, als leide sie an multipler Sklerose, aber was er jetzt empfand, war nicht Liebe, sondern Pflichtbewusstsein. Er trug ein Kreuz, das von Jahr zu Jahr schwerer wurde. Im Augenblick genoss er eine kleine, wohlverdiente Atempause, spielte mit seinen ebenfalls in Spanien lebenden Landsleuten und Freunden eine Partie Bridge oder trank ein Glas in der Bar des Miramar-Hotels. Jetzt ihre Stimme zu hören, würde ihm den angenehmen Abend zwar nicht gerade verderben, aber … Benet konnte jedoch nichts tun, um es zu verhindern.
«Nur ein paar Worte», sagte er.
Früher hatte Benet von Zeit zu Zeit erlebt, wie die Mutter ihn mit unglaublich wüsten Schimpfwörtern belegte, von denen «Scheißkerl» und «dreckiger Mörder» ungefähr die mildesten waren. Jetzt nahm Mopsa den Hörer und sprach in der Rolle der vernünftigen Hausfrau mit ihm.
«Hallo, mein Lieber.»
Sie wechselten ein paar Worte, und Benet war entrüstet, weil James’ Name nicht ein einziges Mal erwähnt wurde. Er war jetzt still – das heißt, er hatte zwar aufgehört zu weinen, lehnte sich aber schwer an sie, und sein Atem ging keuchender und rasselnder als zuvor.
«Ja, ein recht angenehmer Flug. Ein Gutes hat die Fliegerei, es dauert nie lange, es ist bald vorbei. O ja, ich wurde abgeholt und ganz vornehm nach Hause gefahren. Ja, morgen früh, um zehn. Am besten, du rufst morgen wieder an, meinst du nicht auch? Also dann auf Wiedersehen.»
Sie legte auf, blieb stehen und musterte Benet forschend, die James unwillkürlich fester in die Arme schloss. Dieser bebende Ausdruck, als werde sie gleich in Tränen ausbrechen, kündigte – wie Benet von früher wusste – immer einen Stimmungswechsel an. Plötzlich begann Mopsa zu sprechen, hoch und schnell, aber mit völlig normaler Stimme.
«Ich war dir keine gute Mutter, Brigitte. Das weiß ich. Ich habe dich vernachlässigt – dich auf jeden Fall zu wenig beachtet. Ich war krank, weißt du, ich war schon lange krank, bevor ihr es gemerkt habt, du und Dad. Es war dieses Hormon, oder was immer mir fehlt – vielmehr damals fehlte –, es machte mich krank. Ich war keine gute Mutter, ich war eine verlorene Seele, weißt du? Kannst du mir verzeihen?»
Gefühlsausbrüche von Mopsa waren Benet immer peinlich. Sie wurde verlegen und scheu, unter anderem auch deshalb, weil die Mutter sie immer wieder, besonders wenn sie unter einer inneren Spannung litt, bei ihrem Taufnamen nannte, den sie hasste und den sie, zur Abwechslung einmal Mopsas Fußstapfen folgend, sofort abgelegt hatte, als sie von zu Hause fortgegangen war. Benet war ziemlich eckig, langbeinig, hatte ein spitzes Gesicht und glattes, dunkles Haar. Wie hätte sie, in einem neuen Freundeskreis, wieder das unvermeidliche spöttische Erstaunen ertragen sollen, weil ausgerechnet sie nach der Bardot benannt worden war?
Sie war verlegen, doch sie musste um der armen, rührenden Mopsa willen ihre Verlegenheit unterdrücken. Und Mopsa stand wartend da, hungrig nach Liebe und nach Trost, und atmete beinahe so schnell und flach wie James.
«Kannst du mir verzeihen, Brigitte?»
«Da gibt es nichts zu verzeihen. Du warst krank. Außerdem warst du keine schlechte Mutter.» James festhaltend und an ihre Schulter drückend, zwang sich Benet, aufzustehen und den anderen Arm um die Mutter zu legen. Mopsa zitterte, bebte wie ein nervöses Tier. Benet hielt James und ihre Mutter mit den Armen umschlungen. Sie küsste Mopsa auf die Wange. Die Haut war heiß und trocken und pulsierte leicht. Aber Mopsas wasserblaue Augen hatten einen klaren, festen Blick. «Ich habe nichts zu verzeihen, glaub mir», sagte Benet. «Und jetzt vergessen wir’s einfach, ja?»
«Ich würde alles für dich tun, einfach alles, um dich glücklich zu machen.»
«Das weiß ich.»
Benet setzte sich wieder ans Telefon, rückte James auf ihrem Schoß zurecht und wählte die Nummer der Ärztin.
2
Er hat Krupp.»
Das Wort war reinste Lautmalerei und klang ungefähr wie das Geräusch, das James beim Atmen machte. Am Ausmaß ihrer Erleichterung – sie hätte Dr. McNeil vor Freude umarmen können – merkte Benet, wie groß ihre Angst gewesen war.
«Ich dachte, das sei eine Krankheit, die nur viktorianische Kinder hatten.»
«Das stimmt. Aber die Kinder bekommen sie auch noch heute. Nur können wir heute mehr für sie tun.» Benets Erleichterung verwandelte sich in eine bleischwere Last, als die Ärztin fortfuhr: «Ich möchte ihn ins Krankenhaus einweisen.»
«Ist das unbedingt nötig?»
«Nur für alle Fälle. Dort ist alles Nötige vorhanden. Ich glaube nicht, dass Sie hier einen Raum mit Dampf füllen können, oder?»
Dr. McNeil war sechzig und wollte in ein oder zwei Wochen in den Ruhestand gehen. Ist sie altmodisch?, fragte sich Benet. Einen Raum mit Dampf füllen? Sie stellte sich ein Bad mit voll aufgedrehter Dusche vor, aus der fast kochendes Wasser in die Wanne prasselte, wobei Fenster und Tür des Badezimmers hermetisch verschlossen waren. Aber in einem der beiden Bäder war keine Dusche, und die im zweiten Bad war hoffnungslos verkalkt und musste erneuert werden.
«Was ist Krupp eigentlich genau?»
«Wenn Sie’s hätten, würden wir es Kehlkopfkatarrh nennen.»
Benet überließ es der Ärztin, die nötigen Telefongespräche zu führen. Sie brachte James in die Küche hinunter, wo Mopsa, sehr hausfraulich praktisch in Schürze und Gummihandschuhen, Tassen und Untertassen spülte. Die Erleichterung war zurückgekehrt. Krupp war nur ein Kehlkopfkatarrh.
«Ich begleite dich», sagte Mopsa.
Benet wäre es lieber gewesen, wenn die Mutter zu Hause geblieben wäre, doch sie wusste nicht, wie sie es ihr sagen sollte. Und vielleicht sollte man Mopsa nicht allein lassen, vor allem nicht abends und in einem fremden Haus. Es war ein unglückliches Zusammentreffen, dass Mopsa ausgerechnet jetzt hier war. Benet konnte sich des Gedankens nicht erwehren, dass die Menschen, die behaupteten, sie würden alles für den anderen tun, nie bereit waren, sich im Hintergrund zu halten, nicht einzumischen und auf kleine Bitten einzugehen.
Doch wenigstens setzte Mopsa sich diesmal auf den Rücksitz und nahm James auf den Schoß. Die Nacht war klar, aber mondlos. Benet fiel plötzlich ein, dass Halloween war. Sie trug den in eine flauschige Decke eingepackten James in die große, gotisch gewölbte Vorhalle des Krankenhauses und wurde mit dem Lift in die zuständige Abteilung geschickt.
Mit Krankenhäusern nicht sehr vertraut – sie selbst hatte nur einmal in einem gelegen, und zwar, als James geboren worden war –, hatte Benet einen großen Krankensaal mit zwei Reihen eng beieinanderstehender Betten erwartet. Doch die Edgar-Stamford-Abteilung bestand aus lauter kleinen Zimmern, die an einem breiten Korridor lagen. Das Gebäude war früher angeblich das Arbeitshaus gewesen, hatte Benet gehört, doch musste dieser Teil von Grund auf saniert worden sein, denn außer den kleinscheibigen Spitzbogenfenstern erinnerte hier nichts mehr an das 19. Jahrhundert. In James’ Zimmer erwartete ihn ein Kinderbett mit einem darüber angebrachten Zelt, in das Dampf gepumpt wurde. Die Schwester nannte es ein Kruppzelt. Zuerst weinte er, dann wurde er still und umklammerte Benets Hand. Der Arzt kam ungefähr nach zehn Minuten. Vor der Tür des Krankenzimmers zog er sein weißes Jackett aus und legte es auf den Schreibtisch der Schwester.
«Sie bekommen Angst vor weißer Kleidung, wenn wir das nicht tun», erklärte er. «Sie gehen dann nicht mal mehr zum Metzger mit Ihnen.» Er lächelte. «Ich heiße Ian Raeburn und gehöre zum Ärztestab des Krankenhauses.»
Außer dem Kinderbett stand noch ein großes Bett im Zimmer. Benet saß darauf. Ihr war aufgefallen, dass es frisch bezogen und die Decke zurückgeschlagen war.
«Kann ich denn bei ihm bleiben?»
«Selbstverständlich, wenn Sie wollen. Dafür sind die Betten da. Nebenan ist ein Bad. Wir sind ziemlich stolz darauf, dass wir die Eltern hierbehalten können. Es ist heute anders als in der bösen alten Zeit.»
«Ich möchte gern bleiben.»
«Und was wird aus mir?», sagte Mopsa leise und verloren.
«Das können Sie entscheiden», sagte Dr. Raeburn. «Sie werden sehen, dass James bald leichter atmen wird.»
Die kleinen Finger umklammerten ihren Finger noch immer ganz fest. «Du kannst mit dem Taxi zurückfahren, Mutter. Ich geh mit dir hinunter und bestell dir ein Taxi. Du kommst schon zurecht.»
Mopsas Gesicht war erschlafft, sah plötzlich wächsern aus, ihre Lippen zitterten. Das Zimmer war nur schwach erleuchtet, eine einzige Glühbirne brannte über dem Waschbecken, und in diesem Dämmerlicht wirkten Mopsas Augen wieder verschleiert. Seit ihrer Ankunft hatten sie zum ersten Mal diesen Ausdruck.
«Ich bin nie allein. Es war schlimm genug, allein im Flugzeug zu sein, ich meine, ohne einen Menschen, den ich kenne. Ich kann in einem wildfremden Haus nicht allein bleiben.»
«Es ist doch nur für eine Nacht.»
«Warum musst du denn bei ihm bleiben? Er schläft, er weiß nicht, ob du hier bist oder nicht. Früher sind die Eltern nie bei den Kindern im Krankenhaus geblieben, das Personal hätte es nicht geduldet.»
«Die Zeiten haben sich geändert.»
«Ja, und zum Schlimmeren. Dein Vater hätte mir nie erlaubt zu kommen, wenn er gewusst hätte, dass du mich allein lassen würdest, Brigitte. Ich werde krank, wenn du mich allein lässt.»
Vorsichtig entzog Benet James ihren Finger. Er rührte sich nicht. Heftige Abneigung gegen Mopsa erfüllte sie, ein Gefühl, das an Hass grenzte. Wenn ihre Mutter so normal wirkte wie jetzt und dabei alle Symptome eines übersteigerten Solipsismus entwickelte – Gleichgültigkeit gegen die Wünsche anderer und unglaubliche Selbstsucht –, hatte man das Gefühl, dass ihr Wahnsinn nur Theater war, das sie spielte, um Aufmerksamkeit zu erregen. Selbstverständlich war es nicht so, die Krankheit war so real wie eine körperliche Lähmung. Und war es, wenn sie Theater spielte, nicht an sich schon ein Zeichen des Wahnsinns, dass sie es so weit trieb – und über eine so lange Zeit hinweg?
Ich darf meine Mutter nicht hassen …
«Es passiert dir nichts. Die unteren Fenster haben Gitter, und in jedem Stockwerk ist ein Telefon. Und es ist ja auch keine verrufene Gegend, oder?»
«Ich gehe nicht ohne dich, Brigitte. Du kannst mich nicht zwingen. Ich kann hier im Sessel schlafen. Oder auf dem Boden.»
«Das ist nicht erlaubt», sagte Benet. «Nur Eltern dürfen hierbleiben. Hör zu, ich bring dich nach Hause, dann fahre ich wieder hierher. Und morgen früh komme ich ganz bald zurück.»
«Morgen früh muss ich ganz bald zu meinen Tests.»
Mopsas Gesicht war eigensinnig verkniffen. Die scharfen Züge hatten wieder etwas Hexenhaftes. Ihre verschleierten Augen waren nicht auf Benet, sondern auf einen Punkt am anderen Ende des Raums geheftet. Benet sah James an. Er schlief, und der Apparat puffte leise und regelmäßig Dampf in das Zelt. Sie nahm ihren Mantel vom Bett. Als sie der Stationsschwester sagte, sie bleibe nicht über Nacht, glaubte sie Überraschung, ja, sogar leichtes Befremden in ihren Augen aufblitzen zu sehen. Mopsa, die einen großen Teil ihres Lebens in Krankenhäusern verbracht hatte, fühlte sich hier nicht wohl. Als sie zum Lift gingen, schaute sie wachsam von einer Seite auf die andere. Vor dem Schild, das zur psychiatrischen Abteilung zeigte, schrak sie förmlich zurück.
Trotz der Kisten, die noch unausgepackt herumstanden, schien das Haus sie willkommen zu heißen. Es war warm und hell und gemütlich. Dennoch verbrachte Benet die Nacht fast schlaflos. Sie sah ständig James vor sich, der in dem dampfenden Treibhaus aufwachte und merkte, dass sie nicht mehr da war – es war die reinste Zwangsvorstellung. Was nützte sie denn ihrer Mutter? Mopsa hatte sofort, nachdem sie heimgekommen waren, eine Schlaftablette genommen, war zehn Minuten später eingeschlafen und schlief seither fest. Als Benet um sechs Uhr morgens in die Küche ging, um sich eine Kanne Tee aufzubrühen, kam sie an Mopsas Zimmer vorbei und hörte sie leise schnarchen.
Benet rief das Krankenhaus an, wurde mit der Stationsschwester der Edgar Stamford-Abteilung verbunden und erfuhr, dass James eine unruhige Nacht gehabt hatte und sein Zustand unverändert war. Die Schwester sagte nicht, ob er geweint oder nach Benet gerufen hatte, und Benet brachte es nicht über sich zu fragen. Er hatte es bestimmt getan, das wusste sie. Er war noch nie von ihr getrennt gewesen. Wenn Mopsa zu ihren Tests nur in dasselbe Krankenhaus müsste! Stattdessen musste Benet sie meilenweit durch die weit auseinandergezogenen nördlichen Vorstädte Londons kutschieren und sich auf der Rückfahrt durch den Verkehr kämpfen, bevor sie James sehen konnte. Zum ersten Mal hatte sie James gegenüber ein schlechtes Gewissen, hatte sie das Gefühl, ihn im Stich gelassen zu haben.
Mopsa erschien um acht Uhr. Sie trug den grauen Kostümrock, einen glockenblumenblauen Angorapullover dazu und als einzigen Schmuck eine einreihige Perlenkette. Heute Morgen war sie weniger vernünftige Haus-, sondern eher elegante Geschäftsfrau. Sogar ihr Haar wirkte nicht mehr so lieblos abgesäbelt. Diskretes Make-up, rosig und malvenfarben, machte sie jünger. Sie fragte nicht nach James, und Benet sagte ihr nicht, dass sie im Krankenhaus angerufen hatte. Mopsa lebte nur noch in Erwartung ihrer Tests. Sah sie gut aus? Sollte sie den blauen Regenmantel, die graue Kostümjacke oder beides anziehen?
James hätte genauso gut nicht existieren können. Benet fühlte einen sehr realen körperlichen Schmerz, weil er so vernachlässigt wurde. Sie konnte nicht essen, glaubte an dem Groll gegen Mopsa und an ihrer Liebe zu James zu ersticken. Am liebsten hätte sie Mopsa gepackt, geschüttelt und ihr ins Gesicht geschrien: Es ist mein Kind, mein Sohn, ist dir das denn nicht klar? Es wäre sinnlos, es wäre grausam und völlig sinnlos gewesen.
Ich darf meine Mutter nicht hassen …
Als sie im Wagen saßen und die Hampstead Lane entlangfuhren, hatte sie sich so weit gefasst, dass sie sachlich und ruhig sprechen konnte.
«Ich lasse dich im Royal Eastern Hospital und fahre zu James. Du musst dir ein Taxi nehmen und dich entweder nach Hause oder zu James’ Krankenhaus fahren lassen. Es ist ganz einfach, und du schaffst es bestimmt. Ich habe dir beide Adressen aufgeschrieben.»
Sie wartete auf den Proteststurm, doch er kam nicht. Mopsa war in euphorischer Stimmung, eifrig darauf bedacht zu gefallen, großmütig bereit, nicht selbstsüchtig zu sein. Selbstverständlich nahm sie ein Taxi, selbstverständlich schaffte sie es. Es tat ihr leid, dass sie am Abend vorher von Benet verlangt hatte, mit ihr nach Hause zu fahren, aber am Abend empfand man alles eben ganz anders, nicht wahr? An einem so hellen Morgen wie heute konnte man kaum noch verstehen, wie schlecht man sich gefühlt hatte, wie unsicher, wie allein und wie sehr man sich gefürchtet hatte.
Benet nahm auf dem Rückweg dieselbe Route, dieselbe Abkürzung durch Seitenstraßen, die sie benutzt hatte, um Mopsa ins Royal Eastern Hospital in Tottenham zu bringen. Der Verkehr staute sich, als sie darauf wartete, aus den Rudyard Gardens in die Lordship Avenue abbiegen zu können – an der Kreuzung behinderte eine Baustelle den Strom der Fahrzeuge. Sie musste sich in die schleichende Schlange einreihen und konnte sich daher ein wenig in dem Viertel umsehen, in dem sie früher einmal gewohnt hatte.
Es hatte sich sehr verändert. Die Bäume in den Rudyard Gardens waren gekappt worden, und die Straße sah jetzt aus wie eine Allee geköpfter Stämme. Die Häuserreihen waren nicht mehr bewohnt, Türen und Fenster mit Wellblech verschlagen. Mopsa hätte kategorisch erklärt, es sei ein Slum. Am entgegengesetzten Ende der Lordship Avenue schien die Sonne aus einem grellblauen Himmel auf die Wohnblocks, Reihenhäuser und den einzelnen Hochhausturm einer Wohnsiedlung, die Winterside Down hieß. Als Benet, Mary und Antonia gemeinsam eine Mansardenwohnung in der Winterside Road bewohnt hatten, hatte es die Siedlung noch nicht gegeben. Nur ihre Straße war da gewesen, die in ein Stück Ödland mündete, das vom Gaswerk bis zum Kanal reichte.
Benets Wagen und die drei Wagen vor ihr krochen langsam auf die Kreuzung zu. Ein schwarzer Dobermann trottete gemächlich über den Zebrastreifen. Als er die andere Seite der Straße erreicht hatte, begann der Verkehr wieder zu fließen. Genau an dieser Stelle, erinnerte sich Benet, hatte sie immer den Bus genommen, der sie in die City und zur Redaktion des Magazins brachte, in der sie gearbeitet hatte. Wäre es nicht James’ wegen gewesen, hätte sie es nicht so eilig gehabt, zu ihm zu kommen, wäre sie in die Winterside Road abgebogen und hätte dort den Wagen geparkt, weil sie, genau in dem Moment, in dem der Verkehrsstrom wieder in Bewegung geriet, jemanden entdeckte, den sie kannte. Groß, schwer gebaut, blond, jetzt wahrscheinlich auf die vierzig zugehend – wie hieß er doch gleich? Tom Sowieso. Tom Woodhouse. Ihm gehörte die Autowerkstatt neben dem Haus, in dem sie gewohnt hatte, und ein- oder zweimal hatte sie sich bei ihm einen Wagen gemietet. Benet kurbelte die Scheibe herunter, rief seinen Namen und winkte, aber ihre Stimme ging im Verkehrslärm unter. Sie beobachtete durch den Rückspiegel, wie er den Zebrastreifen überquerte und in die Fahrerkabine eines Lieferwagens einstieg.
James lag nicht unter dem Kruppzelt, er war nicht einmal in seinem Zimmer, sondern im Spielzimmer und malte mit Kreide auf eine Tafel. Als Benet hereinkam, rannte er nicht auf sie zu und streckte auch nicht die Arme nach ihr aus, sondern lächelte nur strahlend und irgendwie geheimnisvoll, als gehörten sie einer gemeinsamen Verschwörung an.
«Das ist meine Mami», sagte er zu einem kleinen Mädchen.
«Wir möchten, dass er wenigstens eine Nacht ruhig durchschläft, bevor wir ihn nach Hause entlassen», sagte die Oberschwester.
Mopsa kam um zwölf. Sie schien sehr mit sich zufrieden, war beinahe munter. Sie hatten im Royal Eastern Hospital keine Tests durchgeführt, hatten sie nur untersucht, Fragen gestellt und ihr einen neuen Termin gegeben.
«In drei Tagen soll ich wiederkommen. Und ich will versuchen, heute Nacht allein zu Hause zu bleiben.»
«Wenn du das könntest, wäre es eine große Hilfe für mich.» Benet war geradezu lächerlich dankbar. «Das ist sehr tapfer von dir.» Plötzlich war Mopsa zur vernünftigen Frau geworden, die keine Mätzchen kannte und auch nachts allein in einem fremden Haus blieb. «Ich nehme eine Tablette und werde bis morgen früh nichts sehen und hören.»
James war den ganzen Tag auf den Beinen und spielte. Um sechs Uhr schlief er, ziemlich blass, schwer atmend, erschöpft. Wenn er ruhig durchschlief, durfte er morgen nach Hause.
«Ich sollte jetzt dort sein», sagte Mopsa, auf die Uhr sehend. «Dein Vater hat wahrscheinlich angerufen. Er wird sich wundern, dass ich nicht da war.»
«Ich gehe mit dir hinunter und helfe dir, ein Taxi zu finden.»
«Ich dachte, ich könnte vielleicht deinen Wagen nehmen.»
Es war dunkel. Die Straßen hier waren eng und verstopft. Mopsa hatte zwar seit dreißig Jahren einen Führerschein, war aber seit fünfzehn Jahren nicht mehr gefahren.
«Mir wäre lieber, wenn du zuerst bei Tageslicht übtest», sagte Benet.
Mopsa machte Einwände, während sie sich den Mantel anzog, machte weitere Einwände im Lift, gab jedoch überraschenderweise klein bei, als Benet sagte, sie habe den Wagenschlüssel oben im Zimmer gelassen und der Reserveschlüssel sei zu Hause. Der Abend war schwarz und feucht, und in der Luft hing der Geruch von Schießpulver. Kinder hatten als Vorgeschmack auf den Guy-Fawkes-Tag Feuerwerkskörper losgelassen. Mopsa winkte aus dem Taxifenster, sie lehnte sich heraus und winkte, als gehe sie für immer fort.
Ungefähr drei Stunden später wurde Benet wach, weil James weinte. Sie hatte von Edward geträumt, zum ersten Mal seit Monaten. Sie hatte ihm gesagt, sie erwarte ein Kind von ihm, und nein, sie wolle nicht abtreiben, sie wolle das Kind, aber sie werde ihn nicht heiraten, wolle nicht einmal mehr mit ihm zusammen sein … Ganz ähnlich hatte es sich in Wirklichkeit abgespielt. Aufzuwachen war ein Schock, weil sie geglaubt hatte, der Traum sei Wirklichkeit. James saß weinend und schluchzend unter dem Kruppzelt.
Benet nahm ihn auf die Arme, hielt ihn fest, und er hörte auf zu weinen, obwohl sein Atem wieder rasselte. Sie fragte sich, ob diese Nacht jetzt nicht mehr als «ruhige Nacht» galt? Der nächste Arzt oder die nächste Schwester, die ins Zimmer schauten, würden sie wahrscheinlich fragen, und sie konnte sie nicht belügen, würde es um James’ willen nicht wagen. Das Zimmer war nicht ganz dunkel, die schwache Lampe über dem Waschbecken brannte noch. Für ein Krankenhaus war es sehr ruhig, still, abgesehen von einem weit entfernten metallischen Klappern. Benet dachte über Mopsa nach. Ihr war klar, dass es falsch war, sich um diese Stunde den Ängsten zu überlassen, doch sie waren ungerufen gekommen und ließen sich nicht vertreiben. Hatte sie nicht richtig gehandelt, als sie Mopsa allein wegfahren ließ? Angenommen, sie hatte den Schlüssel für die Haustür nicht gefunden? Wie, wenn es einen Kurzschluss gegeben hatte? Benet war überzeugt, ihr Vater hätte es nie zugelassen, dass Mopsa allein blieb. Und angenommen, er hatte erst angerufen, als Mopsa wieder zu Hause war – lag dann auch er schlaflos da? Weit weg, im Süden Spaniens, sorgte sich um seine Frau, war wütend auf seine Tochter und dachte an tausend Dinge, die passieren konnten?
James war an ihrer Schulter eingeschlafen. Sie legte ihn ins Bettchen und unter das Zelt zurück und schob die Hand durch eine Öffnung im Reißverschluss, damit er sie festhalten konnte. Als die Schwester um vier Uhr kam, schlief er noch, und Benet verschwieg, dass er vor zwei Stunden aufgewacht war und geweint hatte. Sie schlief auch wieder ein. Diesmal träumte sie nicht. Als sie das nächste Mal wach wurde, wurde es im Zimmer allmählich hell, das graue Licht des Morgens sickerte durch die Schlitze der Jalousie ins Zimmer. Eine Sirene hatte sie geweckt, und als sie, im Bett kniend, aus dem Fenster sah, fuhr ein Krankenwagen mit rotierendem Blaulicht vorüber.
Kurz vor acht wollte Benet zu Hause im Vale of Peace anrufen. Jetzt war es noch nicht einmal sieben Uhr dreißig. Mopsa war keine Langschläferin, um acht war sie schon immer auf und fertig angezogen. James lag in dem mit Dampf gefüllten Zelt auf dem Rücken und schlief. Der Verdampfapparat arbeitete unermüdlich. Wahrscheinlich wurde James noch vor dem Lunch entlassen. Dann zwei Wochen der Erholung, und nachdem Mopsa wieder abgereist war, sprach nichts dagegen, dass sie mit James in Urlaub fuhr. Warum auch nicht? Sie konnte es sich jetzt leisten. Sie konnte sich jetzt so viele Urlaube leisten, wie sie wollte – oder steuerabzugsfähige Studienreisen, wie ihr Steuerberater das nannte.
«Sie machen nie mehr Urlaub, Miss Archdale …»