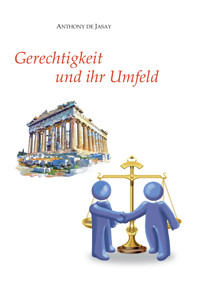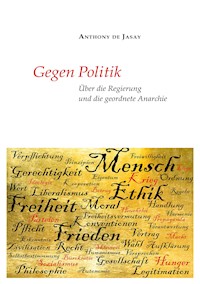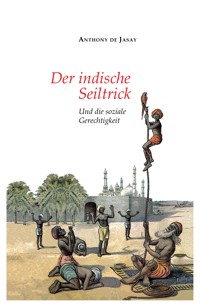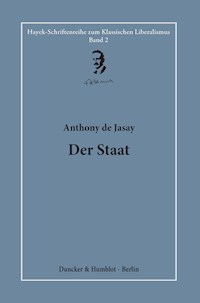
44,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Duncker & Humblot
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Der Staat ist die Erstübersetzung von Anthony de Jasays Buch The State von 1985. Das Buch ist eine Abhandlung zu Grundfragen der modernen politischen Theorie, für die der Autor eine ungewöhnliche Perspektive wählt: die des Staates. Es ist üblich (auch im Klassischen Liberalismus), den Staat als ein Instrument zu sehen, das den Menschen dazu dienen soll, gemeinsame Ziele zu verfolgen. Das weiß auch der Autor. Was aber, so Jasay, wenn wir einmal annehmen, der Staat hätte einen eigenen Willen und eigene Ziele? Zur Beantwortung dieser Frage erkundet Jasay die systematische und historische Entwicklung, die der Staat von seinen Anfängen bis in die Gegenwart hinein genommen hat; vom bescheidenen Minimalstaat, der Leben und Eigentum sichert, bis hin zum vielbeschäftigten Verführer demokratischer Mehrheiten. Nach Liberalismus neu gefaßt (Choice, Contract, Consent) ist Der Staat das zweite Buch Jasays, das auch in deutscher Sprache vorliegt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
ANTHONY DE JASAY
Der Staat
Hayek-Schriftenreihe zum Klassischen Liberalismus
Band 2
Anthony de Jasay
Der Staat
Herausgegeben und übersetzt von
Hardy Bouillon
Duncker & Humblot · Berlin
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
Alle Rechte vorbehalten © 2018 Duncker & Humblot GmbH, Berlin Druck: CPI buchbücher.de gmbh, Birkach Printed in Germany
ISSN 2510-2893 ISBN 978-3-428-15446-3 (Print) ISBN 978-3-428-55446-1 (E-Book) ISBN 978-3-428-85446-2 (Print & E-Book)
Gedruckt auf alterungsbeständigem (säurefreiem) Papier entsprechend ISO 9706 ♾ Internet: http://www.duncker-humblot.de
Vorwort der Herausgeber
Mit der Hayek-Schriftenreihe zum Klassischen Liberalismus sollen einschlägige Schriften, die in der Tradition des Klassischen Liberalismus und in geistiger Nähe zu Friedrich August von Hayek stehen, einer deutschsprachigen Leserschaft nähergebracht werden. Zu diesem Zweck werden Schlüsselwerke bedeutender Autoren übersetzt und in deutscher Erstausgabe herausgegeben. Gleichwohl ist die Schriftenreihe nicht auf Übersetzungen beschränkt, sondern auch offen für Arbeiten gegenwärtiger Autoren, die sich der Schule des Klassischen Liberalismus und dem freiheitlichen Denken Hayeks eng verbunden fühlen. Auf den Autor des zweiten Bandes trifft beides zu.
Der Staat ist eine Abhandlung zu Grundfragen der modernen politischen Theorie, für die der Autor, Anthony de Jasay, eine ungewöhnliche Perspektive wählt: die des Staates. Es ist üblich (auch im Klassischen Liberalismus), den Staat als ein Instrument zu sehen, das den Menschen dazu dienen soll, gemeinsame Ziele zu verfolgen. Das weiß auch der Autor. Was aber, so Jasay, wenn wir einmal annehmen, der Staat hätte einen eigenen Willen und eigene Ziele? Zur Beantwortung dieser Frage erkundet Jasay die systematische und historische Entwicklung, die der Staat von seinen Anfängen bis in die Gegenwart hinein genommen hat; vom bescheidenen Minimalstaat, der Leben und Eigentum sichert, bis hin zum vielbeschäftigten Verführer demokratischer Mehrheiten.
Anthony de Jasay wurde 1925 in Ungarn geboren, wo er seine Kindheit und Jugend verbrachte. Mit 23 Jahren emigrierte er nach Australien, studierte dort Ökonomie und ging Mitte der 50er Jahre als Research Fellow ans britische Nuffield College in Oxford. Von 1962 bis 1979 lebte Jasay als Investmentbanker in Paris. Danach zog er als Privatgelehrter in die Normandie. The State war sein erstes Buch (1985). Es folgten zahlreiche andere Werke, zuletzt eine mehrbändige Ausgabe seiner kleinen Schriften. Von seinen Büchern wurde bislang nur Choice, Contract, Consent ins Deutsche übersetzt (Liberalismus neu gefaßt, 1995).
Nach Der ökonomische Blickwinkel von Israel Kirzner ist Der Staat der zweite Band der Reihe. Weitere Bände anderer Autoren sind bereits in Planung und sollen im Jahresrhythmus erscheinen, darunter Mensch versus Staat von Herbert Spencer. Die Hayek-Schriftenreihe zum Klassischen Liberalismus wird unterstützt von der Friedrich August von Hayek-Stiftung, Berlin.
Prof. Dr. Hardy Bouillon
Prof. Dr. Gerd Habermann
Prof. Dr. Erich Weede
Einleitung des Herausgebers und Übersetzers
1986, kurz nachdem The State erschienen war, lud kein geringerer als James Buchanan den in der Fachwelt praktisch unbekannten Anthony de Jasay nach Virginia zu einem Vortrag ein. Mit dieser Einladung hatte er maßgeblichen Anteil daran, dass Jasay in die Liga liberaler Denker aufstieg, in die er gehörte. Um es in Buchanans Worten zu sagen: „Durch seine Rückkehr in die Welt der Ideen hat Anthony de Jasay einiges bewirkt … und ich bin persönlich stolz auf die kleine Rolle, die ich bei dieser Rückkehr gespielt habe.“1 Was genau Jasay in der Welt der Ideen bewirkt hat, kann man noch nicht abschließend sagen. Und auch worauf diese Wirkung zurückgeführt werden kann, steht noch nicht fest. Aber es dürfte nicht unmaßgeblich mit der originellen Herangehensweise zusammenhängen, mit der Jasay die klassischen Themen der politischen Philosophie erörtert. Er nimmt sich dieser Themen an, indem er dem Staat einen eigenen Willen und eigene Ziele unterstellt. „Eine gelungene Staatstheorie sollte nicht auf die unbegründete Annahme setzen, dass der Staat irgendeinem anderen Interesse dienlich sei als dem eigenen. Sie sollte in der Lage sein, die Rolle des Staates in der politischen Theorie im Sinne jener Interessen des Staates zu erklären, die mit den Interessen Anderer interagieren, konkurrieren, konfligieren und auf dieselben in gebührender Weise ausgerichtet sind,“ so Jasay.
Jasay geht es um den Staat, nicht um dessen Teile und die Individuen, die in ihnen wirken. Letztere ignoriert er nicht, aber er blendet sie aus, stellt sie zurück. Etablierte Distinktionen, wie z. B. die zwischen Staat und Regierung, treten in den Hintergrund. Es geht nicht um Regierung und Opposition, sondern um Staat und Opposition. „Der aktuelle Machtinhaber ist der Staat. Wenn ein anderer Konkurrent das Amt erhält, dann wird er der Staat.“
Eine andere Distinktion, die in den Hintergrund tritt, ist die von Bürger und Untertan. Beide haben Interessen, die nicht die Interessen des Staates sind. Angesichts dessen sind die sonstigen Unterschiede zwischen Bürger und Untertan von untergeordneter Bedeutung. Jasay spricht durchgehend von „subject“. Dieser Terminus wurde – vor allem mit Rücksicht auf die jeweiligen historischen Kontexte – mal mit „Bürger“, mal mit „Untertan“ übersetzt.
Jasays Sprache ist aber nicht nur von Besonderheiten in der Terminologie bestimmt, sondern auch von Eigenarten in der Bildsprache und im Stil. Jasay ist in hohem Maße um die Eintracht von Sinn- und Klangbild der Sprache bemüht. Ein Übersetzer, der die Früchte dieser Mühewaltung in eine andere Sprache hinüberretten will, hat nolens volens einen schweren Stand. Das gilt auch im Hinblick auf die [8] Vorliebe des Autors für komplexe Satzgebilde, die der Komplexität des Gedankens Rechnung tragen soll. Zwei Beispiele mögen diesen Umstand veranschaulichen.
So heißt es z. B. im Hinblick auf Formen der Mischwirtschaft: „Auf dieser Stufe – die oft zustimmend ,Mischwirtschaft‘ genannt wird und einen zivilisierten Kompromiss zwischen komplementären Interessen der Privatinitiative und der gesellschaftlichen Kontrolle suggeriert – ist das Dickicht an Hindernissen, Wallmauern und Bunkern, wohin sich privates Unternehmertum zurückziehen kann, um, nicht ganz frei von Kosten, die Lebensgrundlage jener zu schützen, die, seien sie Eigentümer oder nicht, die Gelegenheit haben, dem Staat die Stirn zu bieten, zwar hier und da gelichtet, aber nicht komplett gerodet.“
Und mit Blick auf die Interessenkonflikte des Staates und die Unfähigkeit des Staates, dieselben zu lösen, schreibt Jasay: „Hin und her geworfen zwischen dem vernünftigen Interesse, weiterhin die ,demokratischen Werte‘ zu schaffen, von denen abhängig zu sein, die Empfänger sich selbst beigebracht haben, (und das Gruppeninteresse, auf dessen Unterstützung der Staat nicht verzichten kann, weiterhin zumindest aufrechtzuerhalten, wenn nicht gar zu vergrößern), und dem gleichermaßen vernünftigen Interesse, eigentlich das Gegenteil zu tun und auf den zunehmenden Poujadismus zu reagieren, und auch auf die wachsende Frustration und Unregierbarkeit bei mehr oder weniger denselben Menschen und Interessen, dreht und windet sich der Staat und erklärt er in zusammenhangsloser Rhetorik seine eigene zusammenhangslose Entwicklung weg.“
Dort, wo die Komplexität des Gedankens auf die Neigung zu feiner und – gelegentlich – übersteigerter Ironie trifft, wird es für den Übersetzer besonders heikel. Dann muss er schon mal auf den Indikativ zurückgreifen, obwohl die Vorlage den Konjunktiv erfordert – oder umgekehrt. Diesen Kunstgriff aber braucht es, will man den ironischen Ton des Autors treffen; z. B. dort, wo es um die Durchleuchtung der charakterlichen Eigenschaften der künftigen Volksvertreter geht. Über sie schreibt Jasay:
„Dank einer solchen Durchleuchtung ist es nun möglich, in freien und demokratischen Wahlen verantwortungsbewusste und nicht-demagogische Volksvertreter zu wählen. Weil sie gleichermaßen um das Wohlergehen ihrer Familien wie das ihres Landes besorgt sind, kann man darauf vertrauen, dass sie (entweder aufgrund eines informellen Konsenses, einer formellen Koalition bzw. ,nationalen Front‘ und abhold kleinkarierter Parteirivalitäten) die verantwortungsvolle, nicht-demagogische Lenkung des Staates stärken und dem Staat die Sicherheit und Kontinuität seiner Amtszeit bescheren, die dieser braucht, um frei von Hast und Unbeständigkeit die Realisierung seiner Ziele zu verfolgen.“
Im Allgemeinen wurde jedoch von wohlmeinenden Änderungen abgesehen und alles vom Autor übernommen. Lediglich die Setzung der Anmerkungen entspricht den Gepflogenheiten des Verlags. Um den verlegerischen Vorgaben zu entsprechen, erwies es sich – wie auch schon beim 1. Band der Hayek-Schriftenreihe zum Klassischen Liberalismus – als notwendig, die vielen umfangreichen bibliographischen Angaben, die ursprünglich in die Anmerkungen eingebunden waren, in ein [9] eigens dafür erstelltes Literaturverzeichnis zu übertragen. Dies wiederum ersparte das wiederholte Zitieren der Werke in den Fußnoten. Die stattdessen eingesetzten Kürzel aus Autor und Jahr beziehen sich auf die Angaben im Literaturapparat. Um Verwechslungen auszuschließen, die hier und da aufgrund mehrerer Publikationen eines Autors im selben Jahr denkbar gewesen wären, wurde gelegentlich der passende Titel der Veröffentlichung ergänzend genannt. Gleiches gilt, wo derlei Verwechslungen aus anderen Gründen möglich gewesen wären oder die Nennung des Titels sonstwie sinnvoll erschien. Sofern im Text Querverweise auf Unterkapitel im Buch auftauchten, wurden die gemeinten Unterkapitel durch Nummern angegeben, um langes Zitieren zu vermeiden, z. B. „Kap. 2.3“ statt „Kap. 2, Lizenz zum Flicken“.
Größere Zitate, etwa die von Marx oder Engels, wurden nicht aus dem Englischen rückübersetzt, sondern nachgeschlagen und aus den Originalquellen, soweit zugängig, übernommen, um etwaige Irritationen beim Leser zu vermeiden. Dort, wo der Autor ausgiebig englischsprachige Klassiker der politischen Theorie zitiert – z. B. Rawls’ Theory of Justice –, wurde der Anschluss an bewährte Standardübersetzungen gesucht, bei Bedarf aber auch Abstand von diesen genommen. Sinnvoll erscheinende Abweichungen von etablierten Übersetzungen können auch Irritationen auslösen. Um dieser Folge vorzubeugen bzw. um dem Leser die Überprüfung unserer Vorschläge zu ermöglichen, wurden die vom Autor gesetzten Seitenreferenzen zum englischsprachigen Original beibehalten.
Anthony de Jasay hat seine Abhandlung über den Staat vor nunmehr 35 Jahren geschrieben. Aber sowohl in ihrer Allgemeingültigkeit als auch in ihrer treffsicheren Vorhersage der Entwicklungen, die der demokratische Staat nimmt, ist sie aktueller denn je. Das gilt z. B. im Hinblick auf die totalitären Tendenzen des Staates, zu denen Jasay schreibt: „Gleichwohl argumentiere ich aber dafür, dass es in einem höheren, ,strategischen‘ Sinn von Rationalität, der vom ,taktischen‘ Sinn der optimalen Anpassung zu unterscheiden ist, für den Staat generell rational ist, mehr statt weniger totalitär zu werden, sofern er damit durchkommt, d. h., sofern er dort noch die Zustimmung der Mehrheit bekommt, wo er sie immer noch braucht. In einer Demokratie ist es auch für den Rivalen der Macht rational, eine totalitärere Alternative vorzuschlagen, wenn diese, obwohl für die Minderheit unattraktiver, der Mehrheit attraktiver zu sein scheint.“
Gleiches gilt aber auch in Bezug auf die wahrnehmbare Angleichung der Wahlprogramme, mit denen die etablierten demokratischen Parteien um die Macht zu ringen pflegen. Im Hinblick auf sie kommt Jasay zu einer recht nüchternen und wenig ermutigenden Erkenntnis: „Trotz aller Künstlichkeit bringen die Beobachtungen zur Arbeitsweise unserer schematisierten Darstellung der Wahldemokratie doch mehr zutage, als das bloße Betrachten des Räderwerks es je könnte. Sie bestärken auf die einfachste nur denkbare Art eine Annahme, die intuitiv einleuchtet: Materielles Interesse alleine reicht nicht aus, um vorherzubestimmen, welchem der Konkurrenten die Macht zuerkannt wird, weil diese, wenn auch unter unterschiedlichen Flaggen, zu guter Letzt im Kern um dieselben Interessen buhlen, [10] und das mit so ziemlich denselben Gewinnaussichten. Vertrauter ist man wohl mit der entsprechenden ,Konvergenz der Programme‘, also der Tendenz (die manche für eine Stärke der Demokratie halten), die Bandbreite, innerhalb derer politische Maßnahmen (und die Erscheinungsbilder der um hohe Ämter buhlenden Kandidaten) wählbar bleiben, einzuengen. Die Rückseite der Medaille ist natürlich die Klage der Nonkonformisten, dass die Wahldemokratie echte und unterscheidbare Alternativen ausschließe. Es ist das Prinzip der öffentlichen Wahl, dass am Ende wenig zu wählen übrig bleibt.“
Mir bleibt am Ende noch zu danken; zum einen der Friedrich August von Hayek- Stiftung für ihre großzügige Unterstützung bei der Übersetzung und Herausgabe dieses Buches; zum anderen Liberty Fund, Inc., für die freundliche Genehmigung, eine deutsche Ausgabe jener Auflage von The State herauszubringen, die Liberty Fund 1998 vorgelegt hat und die sowohl das Vorwort als auch die Anmerkung des Autors enthält, die dieser 12 Jahre nach Erscheinen der Urfassung hinzugefügt hat. Der größte Dank gebührt natürlich dem Urheber dieses Werkes, Anthony de Jasay. Seine Zustimmung hat die vorliegende Übersetzung erst möglich gemacht.
Hardy Bouillon
1 „Anthony de Jasay has made a difference after his re-entry into the world of ideas. And … I am personally proud of the small part I played in the launching.“ (Buchanan (2007), S. 4).
Vorwort
Obwohl dieses Buch sich an die Politische Philosophie, Ökonomie und Geschichte anlehnt, so tut es dies doch in einer Weise, dass es auch für den allgemein interessierten Leser, an den es sich hauptsächlich richtet, zugänglich ist. Sein zentrales Thema – wie Staat und Gesellschaft interagieren, um sich gegenseitig zu enttäuschen und im Elend zurückzulassen – dürfte eine recht breite Öffentlichkeit an Regierenden wie auch Regierten angehen. Die meisten Argumente sind einfach genug gehalten, um bei ihrer Darlegung auf die Präzision und den technischen Apparat verzichten zu können, den schon kaum die Fachleute verkraften, geschweige denn genießen können.
Wenn schon nicht andere Gründe, so werden doch das Ausmaß des Themas und mein etwas unorthodoxer Ansatz dafür sorgen, dass der fachkundige Leser meinen wird, viele Teile der Argumentation bedürften der Ausführung, Verfeinerung oder gar Widerlegung. All das ist im Sinne der Sache, denn selbst dann, wenn ich es wollte, könnte ich doch nicht verbergen, dass mein Anliegen weder war, das letzte Wort zum Thema zu haben, noch die größtmögliche Zustimmung zu erheischen.
Der Leser und ich schulden I.M.D. Little Dank für seinen prüfenden Blick auf große Teile des ursprünglichen Entwurfs. Es ist aber nicht sein Fehler, sollte ich an einigen meiner Fehler festgehalten haben.
Frankreich, 1997
Paluel
Seine Maritime
Anmerkung des Autors
Der Staat handelt von der intrinsischen Natur der politischen Macht, die angesichts wechselnder Verhältnisse gleich bleibt und den Weg vorschreibt, auf dem die Regierungsformen sich entwickeln, anstatt von diesen bestimmt zu werden.
Die Logik, politische Macht auszuüben, ist dieselbe Logik wie jene, die überall dort herrscht, wo man durch das Treffen von Entscheidungen etwas erreichen möchte. Vernünftige Lebewesen haben Ziele, die sie zu erreichen versuchen, und sie verwenden die ihnen verfügbaren Mittel so darauf, wie es ihrer Meinung nach der Erreichung dieser Ziele bestmöglich dient. Der Staat verfügt über eine besondere Art von Mitteln, nämlich die Macht über das Verhalten seiner Bürger, die in ihren jeweiligen Anwendungsformen von den meisten als legitim akzeptiert wird. Welche Ziele er auch immer haben mag – sie mögen moralisch vorbildlich sein oder nicht, den Bürgern zu Gute kommen oder nicht – der Staat kann sie vollständiger umsetzen, wenn er mehr Macht hat statt weniger. Gemäß dem Rational-Choice- Paradigma, dem die diszipliniertere Hälfte der Sozialwissenschaften folgt, maximiert der Konsument „Befriedigung“, das Wirtschaftsunternehmen „Profit“ und der Staat „Macht“.
Dem Staat einen rationalen Verstand und Ziele, die er zu maximieren trachtet, zuzuschreiben, hat seit der Erstausgabe von Der Staat so einiges an Erstaunen, Kritik, ja sogar Unverständnis ausgelöst. Mein Forschungsansatz war recht schwer mit den eher konventionellen Ansätzen in Einklang zu bringen. Folgt man den eher herkömmlichen Sichtweisen, dann hält der Prinz die Macht in treuen Händen, ist die moderne Regierung der Agent der Gewinnerkoalition und dient ein Bündel von Berufspolitikern Sonderinteressen, und zwar im Austausch gegen Geld, Vergnügen und Ruhm. Mein Forschungsansatz hingegen sah keine Rolle für den Gesellschaftsvertrag vor und ließ keinen Platz für das Gemeinwohl. Aber vor allem behandelte er den Staat, ein Geflecht von Institutionen, als wäre dieser eine Person mit einem Verstand.
Wenn man nun so argumentiert, als ob dies der Fall wäre, dann erzeugt das eine „Simulation“, eine Art schematischer Geschichte. Deren Kraft bei der Erklärung und Vorhersage komplexer Entwicklungen durch Offenlegung der Wirkungsweisen einfacher und dauerhafter Ursachen rechtfertigt vielleicht den Bruch mit der herkömmlichen Sichtweise.
Das Buch prophezeit, dass der Diener-Staat durch unaufhaltsames Ausdehnen der kollektiven Sphäre auf Kosten der Privatsphäre stets danach strebt, zu einem totalitären Herrscher-Staat zu werden. Ein paar Jahre nach seiner Ersterscheinung wurden wir jüngst Zeuge eines gründlich misslungenen Versuchs totalitärer Herrschaft. Gemeint ist der Zusammenbruch des sozialistischen Regimes in Russland [14] und seinen Satellitenstaaten. Es ist schwer zu sagen, was dieser Kollaps widerlegt, sollte er überhaupt etwas widerlegen. Muss der Versuch am Ende immer scheitern? Ich sehe keinen überzeugenden Grund, warum dies in der einen oder anderen Weise immer so sein sollte. Genauso wenig muss er immer bis ans Ende gehen, um Korruption und Atrophie gesellschaftlicher Werte in Gang zu setzen.
Mai 1997
Anthony de Jasay
Inhaltsverzeichnis
Einleitung
1. KapitelDer kapitalistische Staat
Gewalt, Gehorsam, Vorliebe
Anspruch und Vertrag
Die Umrisse des Minimalstaates
Wenn es keine Staaten gäbe, sollte man sie dann erfinden?
Den Staat erfinden: der Gesellschaftsvertrag
Den Staat erfinden: das Instrument der Klassenherrschaft
Die Sache durch falsches Bewusstsein zum Abschluss bringen
2. KapitelDer adverse Staat
Repression, Legitimität und Konsens
Parteinahme
Die Lizenz zum Flicken
Die offengelegte Präferenz der Regierungen
Interpersonale Gerechtigkeit
Unbeabsichtigte Effekte beim Herstellen interpersonaler Nutzen und Gerechtigkeit
3. KapitelDemokratische Werte
Liberalismus und Demokratie
Durch Gleichheit zu Nützlichkeit
Wie die Gerechtigkeit Verträge aufhebt
Egalitarismus als Klugheit
Die Liebe zur Symmetrie
Neid
4. KapitelUmverteilung
„Feststehende“ Verfassungen
Konsens erkaufen
Abhängig machende Umverteilung
Steigende Preise
Umrühren
Auf zu einer Theorie des Staates
5. KapitelStaatskapitalismus
Was tun?
Der Staat als Klasse
Auf der Plantage
Literaturverzeichnis
Personen- und Stichwortverzeichnis
Einleitung
Was würden Sie tun, falls Sie der Staat wären?
Es ist eigenartig, dass die Politische Theorie spätestens seit Machiavelli praktisch aufgehört hat, diese Frage zu stellen. Sie hat viel darüber nachgedacht, was der einzelne Staatsbürger, eine Klasse oder die ganze Gesellschaft aus dem Staat herausholen kann, und wie es um die Legitimität seiner Befehle bestellt ist, und um die Rechte, die der Einzelne angesichts dessen behält. Sie befasste sich mit dem Gehorsam, den die hoffnungsvollen Nutzer jenem Staat schulden, dessen Dienste sie in Anspruch nehmen; die Art ihrer Mitwirkung, um den Staat in Gang zu halten, und die Wiedergutmachung, welche die Opfer verlangen können, falls er einmal nicht funktionieren sollte. Sie alle sind Angelegenheiten von vitalem Interesse und werden mit der Zeit und mit der Größe, die der Staat im Vergleich zur bürgerlichen Gesellschaft annimmt, immer wichtiger. Reicht es jedoch aus, sie alleine aus der Sicht des Staatsbürgers zu behandeln, was er braucht, will, kann oder tun sollte? Würde unser Verständnis nicht an Vollständigkeit gewinnen, wenn wir nicht auch sehen könnten, wie sie aus Sicht des Staates ausschauen?
Das vorliegende Buch ist der Versuch, dies zu tun. Trotz aller Risiken, Institutionen mit Personen zu verwechseln, und trotz aller Schwierigkeiten, die entstehen, wenn man vom Prinzen zu dessen Regierung übergeht, entscheidet es sich dazu, den Staat wie eine reale Entität zu behandeln; als ob dieser einen Willen hätte und in der Lage wäre, vernünftige Entscheidungen darüber zu treffen, wie die Mittel zu den Zielen passen. Es versucht also zu erklären, wie der Staat sich gegenüber uns verhält, und zwar in dem Sinne, dass man bei der Betrachtung der sich aneinanderreihenden historischen Situationen wissen will, was er vermutlich getan hätte, falls er in der Lage gewesen wäre, die ihm unterstellten Ziele rational zu verfolgen.
Aus Sicht des jungen Marx steht der Staat im „Gegensatz“ zur bürgerlichen Gesellschaft und „überwindet“ sie. Er sprach von dem „allgemeinen weltlichen Widerspruch zwischen dem politischen Staat und der bürgerlichen Gesellschaft“ und behauptete: „In Zeiten, wo der politische Staat als politischer Staat gewaltsam aus der bürgerlichen Gesellschaft heraus geboren wird, … , kann und muß der Staat bis zur Aufhebung der Religion, bis zur Vernichtung der Religion fortgehen, aber nur so, wie er zur Aufhebung des Privateigentums, zum Maximum, zur Konfiskation, zur progressiven Steuer, wie er zur Aufhebung des Lebens, zur Guillotine fortgeht. 1 An anderen vereinzelten Stellen, vor allem in „Die Heilige Familie“ und „Der achtzehnte Brumaire“, fuhr er damit fort, den Staat als eine autonome Entität [18] darzustellen, die ihren eigenen Weg geht, ohne indes eine Theorie dafür zu bieten, warum dieser in „Überwindung“, „Konfiskation“ und „Widerspruch“ münden muss und der autonome Staat ein Widersacher der Gesellschaft ist.
Als Marx dann dazu überging, sein System zu errichten, stieß er ins selbe Horn wie der Kanon der politischen Theorie, dessen Gemeinsamkeit es ist, den Staat hauptsächlich als ein Instrument zu betrachten. Für den gereiften Marx, und noch viel mehr für Engels, Lenin und die sozialistische Schule, die sie nach wie vor inspirieren, wurde der Staat somit zu einem Werkzeug, das den Interessen der herrschenden Klasse diente und ihr die Vorherrschaft sicherte.
Auch für die Mehrheit der nicht-sozialistischen Theorien ist der Staat ein Instrument und dazu konstruiert, seinen Nutznießern zu dienen. Man betrachtet ihn als allgemein harmlos; entworfen, um die Zwecke anderer zu befördern. Seine Gestalt als Werkzeug, die Arbeiten, die er erledigt, und die Identität der Nutznießer mögen variieren, aber der instrumentelle Charakter des Staates ist allen Hauptströmungen modernen politischen Denkens gemeinsam. Für Hobbes wahrt er den Frieden, für Locke erhält er das Naturrecht auf Freiheit und Eigentum, für Rousseau realisiert er den allgemeinen Willen, und für Bentham und Mill ist er das Mittel, das die gesellschaftlichen Verhältnisse verbessert. Für die Liberalen unserer Zeit überwindet er das Unvermögen der privaten Interessen, spontan zu kooperieren. Er zwingt sie, kollektiv bevorzugte Mengen an öffentlichen Gütern, wie öffentliche Ordnung, Verteidigung, saubere Luft, geteerte Straßen und allgemeine Bildung, zu produzieren. Wenn man öffentliche Güter sehr weit fasst, dann ermöglicht sein Zwang der Gesellschaft auch, Verteilungsgerechtigkeit oder, schlicht, allgemeine Gleichheit zu erzielen.
Gewiss gibt es auch weniger blauäugige Varianten dieser instrumentellen Sichtweise. Für die Schule der „nicht-marktlichen Entscheidungen“ bzw. „Public Choice“-Schule führen die Interaktionen privater Entscheidungen mithilfe des Staates zur Überproduktion öffentlicher Güter, aber auch zu anderweitigen Fehlversuchen, gewünschte Ergebnisse zu erzielen.2 Die „Public Choice“-Schule befasst sich mit der Unhandlichkeit des Staates als Werkzeug, d. h. mit dessen Möglichkeiten, einer Gesellschaft zu schaden, die ihn zur Hand nehmen will. Nichtsdestotrotz ist der Staat ein Werkzeug, obgleich ein schadhaftes.
Was aber ist schadhaft, fehlerhaft entworfen und ein Geburtsfehler? Und was innere Beschaffenheit? Degeneriert Platons Republik auf dem Weg von der Demokratie zur Despotie? Oder entspricht sie dabei ihren eigenen Zwecken?
*
Der erste Schritt zu einem angemessenen Verstehen des Staates ist, über ein Leben ohne ihn nachzudenken. Wenn wir uns ein Beispiel an Rousseau nehmen, [19] dann tendieren wir unnötigerweise dazu, den Naturzustand mit den Wilden und vielleicht nicht allzu hellen Jägern zu Beginn der Menschheitsgeschichte gleichzusetzen. Es ist zu einem anerzogenen Reflex geworden, ihn als eine frühe, primitive Stufe der Zivilisation anzusehen und davon auszugehen, dass es für eine fortschrittliche Zivilisation notwendig ist, einen Staat zu bilden und ihn einzufordern. Das mag so sein, wenn man das Ganze als empirische Frage auffasst. Logisch betrachtet, kann man dies keineswegs aus dem schließen, was den Naturzustand als einziges notwendigerweise auszeichnet; nämlich, dass in ihm die Teilnehmer ihre Souveränität nicht abtreten. Niemand hat ein Gewaltmonopol erhalten; alle behalten ihre Waffen. Dieser Zustand muss nicht im Widerspruch zu irgendeiner Zivilisationsstufe stehen, weder zu einer früheren, noch zu einer späteren.
Die Nationalstaaten befinden sich in einem Naturzustand und zeigen keinerlei Neigung, die Souveränität in einem Superstaat zu bündeln. Im Gegensatz zu dem, was Hobbes angeblich implizit annahm, schaffen es die meisten von ihnen, Kriege auf lange Zeit zu vermeiden. Sie kooperieren sogar im bewaffneten Frieden, und zwar sehr auffallend und tapfer im internationalen Warentausch, Investment und Kreditgeschäft, trotz aller Risiken der Souveränität. Die Theorie des Gesellschaftsvertrages würde für all diese Bereiche vorhersagen, dass es auf internationaler Ebene Diebstahl, Betrug, Konfiskation und ein Verhalten auf Kosten der Nachbarn gäbe und der Vertrag nur ein wertloses Stück Papier wäre. In Wirklichkeit bricht die internationale Zusammenarbeit nicht zusammen, und das, obwohl es keinen Superstaat gibt, der Verträge über die nationale Gerichtsbarkeit hinweg durchsetzt. Wenn überhaupt, dann bewegen sich die Dinge in entgegengesetzter Richtung. Die internationalen Beziehungen nähren eher die Zweifel an der gängigen Meinung, dass die Menschen im Naturzustand kurzsichtige Einfaltspinsel in Tierhäuten waren, die sich gegenseitig mit dem Knüppel auf den Kopf schlugen. Stattdessen gibt es vielmehr Grund zur Annahme, dass mit dem Fortschreiten der Zivilisation der Naturzustand immer tragfähiger wird. Die Angst vor der hochentwickelten Aufrüstung könnte sich für die kriegerische Enthaltsamkeit als sehr potent erweisen und die Menschen weit besser vor einem „ekelhaften, tierischen und kurzen Leben“ bewahren, als es die Superstaaten der Geschichte, wie Rom, das Karolingische Reich oder das Britische Weltreich, konnten; allerdings dürfte es zu früh sein, dies jetzt schon zu sagen.
Wie Menschen und Gruppen sich im Naturzustand entwickeln, ist weitaus schwerer zu beurteilen als die Entwicklung, die sie als Teil einer Nation nehmen. Der zivilisierte Mensch lebt schon zu lange als Untertan des Staates. Mithin haben wir keine Gelegenheit festzustellen, wie gut er mit anderen im Naturzustand kooperieren würde. Empirisch betrachtet, können wir noch nicht einmal so tun, als ob wir beurteilen könnten, welchen Unterschied es macht, wenn man einen Staat hat. Würden die Menschen die Verträge in Ehren halten, wenn kein Erzwingungsbevollmächtigter da wäre, der das Gewaltmonopol in letzter Instanz hätte? Für gewöhnlich sagt man, dass gesellschaftliche Kooperation auf freiwilliger Basis nicht aufrechterhalten werden kann, weil jeder nur will, dass alle anderen zu ih[20]rem Wort stehen und es ihm freisteht, seines zu brechen. In der Fachsprache der Entscheidungstheorie kann ein richtig konstruiertes „Gefangenendilemma“ keine nicht-erzwungene kooperative Lösung haben. Neuere Forschungen aus Mathematik, Psychologie und Sozialwissenschaften lehren uns, dass dem nicht so sein muss, wenn die Menschen solchen Dilemmata wiederholt ausgesetzt sind. Die Resultate lehren sie, wozu die erwarteten Ergebnisse sie verleiten, nämlich spontan zu kooperieren. Jedes Argument, wonach der Staat sie zwingen muss, zu kooperieren, weil sie es ohne Zwang nicht täten, ist ein non sequitur.
Andererseits gilt: Je länger sie zur Kooperation gezwungen wurden, desto unwahrscheinlicher ist es, dass sie die Fähigkeit, spontan zu kooperieren, künftig aufrechterhalten (falls sie dieselbe je hatten). „Wer kann, der macht es.“ Aber das Gegenteil „Wer es macht, der kann es“ ist nicht weniger wahr, weil Übung den Meister macht. Menschen, die man dazu bringt, sich auf den Staat zu verlassen, lernen weder die Kunst der Eigenständigkeit, noch eignen sie sich die Gepflogenheiten staatsbürgerlichen Handelns an. Eine der vielgerühmten Einsichten Tocquevilles (obgleich er von diesen tiefere hatte) war in der Tat die in Bezug auf die englische und amerikanische „Regierung“, die sowohl Raum und Notwendigkeit für Initiativen von unten lasse als auch durch wohlmeinendes Unterlassen die Menschen dazu verleite, ihre Angelegenheiten selbst zu regeln, während die französische „Verwaltung“ keines von beiden getan habe. Die abhängig machenden Effekte des Staates, die Abhängigkeit der menschlichen Werte und Vorlieben von den herrschenden politischen Verhältnissen, die diese hervorbringen sollen, ist das grundlegende Leitmotiv, das in all meinen Argumenten immer wieder auftaucht.
Das andere wiederholt auftretende Grundelement des Staates ist die Unberechenbarkeit von Ursache und Wirkung in gesellschaftlichen Beziehungen. Vielleicht führt staatliches Handeln zu dem beabsichtigten Resultat, vielleicht auch nicht, weil das nächste Ereignis, das eintritt, kein schlüssiges Indiz für das endgültige Ereignis bietet. Fast immer hat es jedoch auch andere Effekte, womöglich sogar bedeutende und länger währende. Diese unintendierten Effekte dürften zudem gewiss ungewollt, unvorhergesehen und, naturgemäß, unvorhersagbar sein. Aus diesem Grund kriegt man eine Gänsehaut angesichts der schönfärberischen Auffassung, dass Politik eine pluralistische Vektorgeometrie sei und die bürgerliche Gesellschaft sich selbst regiere und den Staat kontrolliere, der nur eine Maschine sei, um die „gesellschaftlichen Entscheidungen“ aufzugreifen und auszuführen.
*
Die These dieses Buches ist auf fünf Kapitel verteilt und umspannt den Verlauf, den der Staat logisch (wenn auch nicht in Echtzeit) nimmt, wenn er sich zwischen den beiden Grenzextremen bewegt; nämlich von dem Punkt, wo seine Ziele nicht mit den Zielen der Staatsbürger konkurrieren, bis hin zu dem Punkt, wo er den größten Teil ihres Eigentums und ihrer Freiheit besitzt.
Kapitel 1 „Der kapitalistische Staat“ behandelt zunächst die Rolle, die Gewalt, Gehorsam und Vorlieben bei der Geburt des Staates einnehmen. Danach beginnt[21]es, die charakteristische Kontur eines Staates, der, falls er existierte, nicht mit der bürgerlichen Gesellschaft konfligierte, abzuleiten. Ich nenne diesen Staat „kapitalistisch“, um die charakteristische Art und Weise hervorzuheben, in der er Eigentum und Vertrag behandelt. In ihm herrscht die Vorstellung, dass das Recht auf Eigentum gut begründet ist, wenn der Finder das Gefundene behalten darf. Der Staat greift nicht in die Verträge ein, die andere zu ihrem Vorteil schließen. (Das schließt auch aus, dass er andere dazu zwänge, einen umfassenden, allseitigen Gesellschaftsvertrag zur Überwindung ihrer Trittbrettfahrerversuchungen abzuschließen). Er gibt auch nicht dem Mitgefühl und Mitleid nach, das er für die eher glücklosen Staatsbürger hegt, und zwingt nicht die weniger Glücklosen, den Glücklosen zu helfen. Außerdem ist er ein Minimalstaat, also ein Staat mit weniger Politik („Die Umrisse des Minimalstaates“).
Es scheint ungewöhnlich, wenn nicht gar in sich widersprüchlich zu sein, dass der Staat nicht nur einen Willen hat, sondern auch das Verlangen, sich zu minimieren. Damit dies vernünftig ist, müssen die Ziele jenseits der Politik liegen und können nicht durch Regieren erzielt werden. Der Zweck des Regierens liegt dann allein darin, nicht-minimale Rivalen raus zu halten (Revolutionsvorbeugung). Natürlich hat es einen solchen Staat in der Geschichte nie gegeben, obwohl ihm ein oder zwei Staaten im 18. und 19. Jahrhundert zumindest ansatzweise nahekamen.
Der „politische Hedonist“, der den Staat vorzieht, weil dieser für ihn die Balance zwischen helfen und hindern findet, muss logischerweise einen umfassenderen Staat als den Minimalstaat anstreben und würde diesen wohl erfinden, falls es ihn nicht bereits gäbe.3 Aus Sicht der individuellen Staatsbürger begründet der politische Hedonismus den Wunsch nach einem umfassenderen und optionsärmeren Kooperationsprogramm als dem Flickenteppich aus Verträgen, die aus freiwilligen Verhandlungen hervorgehen („Den Staat erfinden: der Gesellschaftsvertrag“). Und aus Sicht der hypothetischen Herrscherklasse sollte man aus politischem Hedonismus nach einer Maschine verlangen, die Dominanz sicherstellt („Den Staat erfinden: das Instrument der Klassenherrschaft“). Beide Versionen des politischen Hedonismus setzen eine gewisse Leichtgläubigkeit hinsichtlich der Risiken voraus, die entstehen, wenn man die Waffen niederlegt, um den Staat damit auszustatten. Sie setzen den Glauben an den instrumentalen Charakter des Staates voraus, als sei er dazu gemacht, den Zielen anderer zu dienen, ohne selbst welche zu haben. In jeder nicht-einstimmigen Gesellschaft, in der es eine Vielfalt an Interessen gibt, kann der Staat jedoch keine anderen Interessen verfolgen als seine eigenen, so verträglich diese auch sein mögen. Seine Art, Konflikte zu lösen und die Ziele anderer zu gewichten, sind für die Befriedigung seiner eigenen Ziele konstitutiv („Die Sache durch ein falsches Bewusstsein zum Abschluss bringen“). Ist der politische Hedonismus zweckmäßig, besonnen und vernünftig? Stellt der Staat, der uns umgibt, uns besser oder schlechter? Sind die Güter, die der Staat in [22] Verfolgung seiner eigenen Interessen zu produzieren beschließt, auch jene, die wir gewählt hätten? All diese Fragen werden im Hinblick auf Reform, Fortschritt und Nützlichkeit in Kapitel 2 aufgegriffen, und in Kapitel 3 im Rahmen bestimmter Themen erörtert, z. B. Jeder eine Stimme, Egalitarismus (sowohl als Mittel wie auch als Ziel) und Verteilungsgerechtigkeit.
*
Gewalt und Vorlieben mögen zwar historisch bzw. logisch den Ursprung des Staates bilden, aber politischen Gehorsam ruft der Staat weiterhin hervor, indem er auf die alte Trias von Repression, Rechtmäßigkeit und Konsens (das Thema des ersten Abschnitts von Kapitel 2) zurückgreift. Der Rechtmäßigkeit beugt man sich auch ohne Hoffnung auf Belohnung und Furcht vor Strafe. Der Staat kann mehr Legitimität nicht nach Belieben erzeugen, bzw. nur auf lange Sicht. Um selbst erhört zu werden, verbleiben ihm nur die verschiedenen Kombinationen aus Repression und Konsens. (Gleichwohl wird er sich natürlich glücklich schätzen, wenn er sich der Rechtmäßigkeit erfreuen kann.) Der Konsens eines Bruchteils der Gesellschaft, z. B. der Lagerwachen in einem Lagerstaat, kann reichen, um den Rest zu unterdrücken. In solchen Fällen fließen die Belohnungen der willigen Minorität naturgemäß reichlich zu, während die Unterdrückung sich über die große Mehrheit fein verteilt. Eine Umkehr dieses Musters geht mit einem größeren Vertrauen auf Konsens einher.
Aus Gründen, die anfangs Anerkennung finden, rückblickend jedoch vielleicht als schwach oder töricht bereut werden, hält es der repressive Staat auf Dauer für angebracht, einige von denen, die er bislang zu unterdrücken pflegte, dazu zu bringen, sich auf Konsens zu verlegen („Parteinahme“). Dieser Prozess ist eine Kombination aus Schritten hin zu einer umfassenderen politischen Demokratie und Schritten zu guten Taten, wobei dem Staat eine gegenläufige, umstrittene Rolle zufällt, weil er nun große Teile der Gesellschaft um deren Unterstützung bittet, indem er ihnen anbietet, beträchtliche Belohnungen einzustreichen, die man anderen kleineren, aber zahlungskräftigen Teilen der Gesellschaft abnimmt. Ein Nebenprodukt dieses Prozesses, Gewinner und Verlierer zu schaffen, ist, dass der Staatsapparat größer und schlauer wird.
M.E. ist es nahezu unbestreitbar, dass der normative Inhalt jeder herrschenden Ideologie mit dem Interesse des Staates zusammenfällt, statt, wie in der marxistischen Theorie behauptet, mit denen der herrschenden Klasse. Mit anderen Worten, die herrschende Ideologie ist jene, die, allgemein gesprochen, dem Staat sagt, was er hören will; wichtiger noch, die ihm sagt, was seine Untertanen mitbekommen sollen. Statt den „Überbau“ der Ideologie auf das Fundament der Interessen zu platzieren (wohin man ihn normalerweise platziert), stützen sich diese beiden gegenseitig. Es braucht eigentlich keine herrschende Klasse in der Gesellschaft. Dennoch gedeihen und entwickeln sich der Staat und die herrschende Ideologie gemeinsam. Diese Auffassung führen wir weiter aus, um darlegen zu können, warum wir dem Utilitarismus („Die Lizenz zum Flicken“ und „Die offengelegte Präferenz der Regierungen“), der eine überaus mächtige, wenn auch inzwischen meist unbewusst [23] wirkende Einflussgröße im politischen Denken unserer und früherer Tage ist, so viel Aufmerksamkeit schenken. Die utilitaristischen Verbesserungsmaßnahmen, welche die Veränderungen der Verhältnisse nach den zu erwartenden Konsequenzen beurteilen und interpersonale Nutzenvergleiche durchführen, damit der Staat bei der Einschätzung einer politischen Maßnahme den Schaden, den er einigen zumutet, von dem größeren Gut abziehen kann, das er anderen zufügt, um unter dem Strich ein größeres Glück zu erhalten, verleihen den Handlungen des Staates ein moralisches Gewicht. Die Doktrin, die derartige Maßnahmen empfiehlt, stellt die perfekte Ideologie für den aktivistischen Staat dar. Sie bildet die moralische Grundlage für politische Maßnahmen, die der Staat ergreift, wenn es in seinem Ermessen liegt, wen er zu begünstigen gedenkt. Aber auch dann, wenn die Frage, wer zu begünstigen sei, nicht mehr seine Ermessenssache ist, sondern ihm im Zuge von Wahlkämpfen vorgegeben wird, dienen ihm interpersonale Nutzenvergleiche nicht nur, um an der Macht zu bleiben, sondern auch als Grundlage für seine Beteuerungen, dass das, was er tue, gut, gerecht oder beides sei.
In der sozialen Gerechtigkeit als dem erklärten Ziel und der moralischen Rechtfertigung einer Politik der Verführung liegt offenbar ein Bruch mit dem Utilitarismus. Ein durchgehender Grundzug bei beiden als Kriterien der Politikrechtfertigung ergibt sich indes aus der Abhängigkeit, in der beide zu interpersonalen Nutzenvergleichen stehen. Während in dem einen Fall Nutzen verglichen werden, vergleicht man in dem anderen Fall Verdienste. Jeder der beiden Vergleiche kann für eine Befugnis, freie Verträge zu überstimmen, herhalten. Bei beiden fällt die Rolle des „mitfühlenden Beobachters“ oder des „offenen Auges“, in welcher der sachkundige und verbindliche Vergleich durchgeführt wird, natürlich dem Staat zu. In diese Rolle zu schlüpfen, ist für ihn eine genau so große Errungenschaft wie die sich daraus ergebende Möglichkeit, unter seinen Bürgern eine Klasse, Rasse, Alterskohorte, Region, Berufsgruppe oder sonstige Interessengemeinschaft zu begünstigen. Wenn nun der Staat mittels Reform und Umverteilung das Fundament der Schützenhilfe zu gießen beginnt, dann genießt er zwar die Freude am Ermessen, auszuwählen, wen man auf wessen Kosten vorzieht, aber diese Freude ist nur von kurzer Dauer. In Kapitel 4 werden die Gründe dafür erörtert, warum die Ermessensfreiheit im Zuge des politischen Wettbewerbs und der wachsenden Abhängigkeit der Gesellschaft von einem gegebenen Verteilungsmuster dazu neigt, vor die Hunde zu gehen.
*
Der vollentwickelte Umverteilungsstaat, in dessen Namen „der Nichtbesitzende zum Gesetzgeber des Besitzenden“4 wird und der auf Dauer den Charakter und die Struktur der Gesellschaft auf weitgehend unbeabsichtigte Weisen verändert, hat auch ein doktrinäres Gegenstück, seine ideologische Entsprechung. Die Entwicklung des einen kann ohne die Entwicklung des anderen kaum gedacht werden. Kapitel 3 „Demokratische Werte“ behandelt die linksliberale Ideologie, die genau [24] dann vorherrscht, wenn der Staat, der zunehmend vom Konsens abhängt und dem Wettbewerb um denselben ausgesetzt ist, die Menschen überwältigt und gleichzeitig ihren Idealen dient.
Indem der Staat den Aufstieg der Demokratie als Vehikel für den Übergang von der Repressionsherrschaft zur Konsensherrschaft gutheißt, fördert und vorbereitet, verpflichtet er sich zu bestimmten Verfahrensweisen (z. B. Jeder eine Stimme, Mehrheitsregel), damit man ihn mit der dauerhaften Macht belohne. Die Verfahrensweisen sind so, dass der Staat auf seiner Suche nach Unterstützung um ein einfaches Zählen der Köpfe nicht umhinkommt. Seine Politik muss, salopp gesagt, einfach mehr Gewinner als Verlierer abwerfen, anstatt z. B. die zu begünstigen, die es am meisten verdient haben, oder jene, die er am meisten mag, oder die mehr Einfluss haben, oder sonst ein subtileres Ziel verkörpern. „Mehr Gewinner als Verlierer“ lässt sich lukrativer erreichen, wenn man statt einer Anzahl an Armen die gleiche Anzahl an Reichen in die Rolle der Verlierer drängt. Diese Regel ist allerdings rein zweckdienlich. Sie mag vielleicht nicht den Beifall jener erheischen, die das Spiel von außen beobachten und sich von ihrer Anwendung keinen Gewinn versprechen. Einige von diesen (zu denen natürlich auch viele Utilitaristen zählen) würden wohl lieber die Regel „Lieber mehr Gewinn schaffen als mehr Gewinner“ vorziehen und das Köpfe zählen sein lassen. Wieder andere dürften Zusätze mögen, wie „unter Berücksichtigung der Naturrechte“ oder vielleicht „solange die Freiheit nicht verletzt wird“, wobei jede dieser Klauseln genug Einschränkungen vorsieht, mit denen die meisten demokratischen Politikmaßnahmen zum Stillstand kämen.
So gesehen, ist es sehr hilfreich, wenn die linksliberale Ideologie einen Fall oder, um sicher zu gehen, eine Reihe von gleichgelagerten Fällen angibt, die zeigen, dass demokratische Politik demokratische Werte schafft, was wiederum heißt, dass die politische Zweckmäßigkeit als zuverlässiger Wegweiser zu einem guten Leben und zu den allgemein geschätzten letzten Zielen ausreicht.
Ich werde mich mit vier solchen Fällen befassen. In einem davon, der zwei große Fürsprecher hatte (in Edgeworth einen eindeutigen und in Pigou einen eher fragwürdigen), geht es darum, die Auffassung zu stärken, dass Einkommensangleichung Nutzen maximiere. Vorausgesetzt, dass es überhaupt einen Sinn ergibt, die Nutzen verschiedener Personen zu addieren und die Summe zu maximieren, lautet mein Gegenargument („Durch Gleichheit zu Nützlichkeit“), es sei vernünftiger anzunehmen, dass irgendeine festgelegte und altehrwürdige Einkommensverteilung, sei sie nun gleich oder ungleich, den Nutzen tatsächlich maximieren werde. (Falls es einen Grund für Angleichung gibt, dann ist er wahrscheinlich auf die neuen Reichen und die neuen Armen beschränkt.)
Ein aktuellerer und kaum weniger einflussreicher Fall, nämlich der, den John Rawls konstruiert hat, spricht für einen modifizierten, gemäßigten Egalitarismus, der den Gerechtigkeitsprinzipien entspreche. Ich bringe aus verschiedenen Gründen Einwände gegen die Prinzipien vor, die Rawls aus dem durchdachten Interesse der Menschen ableitet, welche, in Unwissenheit über sich selbst und mithin über ihre Unterschiedlichkeit, die Verteilung aushandeln. Ich bestreite die angebliche [25] Abhängigkeit der gesellschaftlichen Kooperation; nicht wegen der Bedingungen, die bereitwillige Teilnehmer in beiderseitigem Einvernehmen schaffen, indem sie ihre Kooperation tatsächlich entfalten, sondern wegen der Neuausrichtung dieser Bedingungen, um Prinzipien zu entsprechen, die separat verhandelt werden, und zwar in einem „Urzustand“ („original position“) der Ignoranz, der zu diesem Zweck erdacht wird. Ich stelle auch in Frage, warum die Gerechtigkeitsprinzipien von der Demokratie abgeleitet werden, anstatt umgekehrt vorzugehen („Wie die Gerechtigkeit Verträge aufhebt“). Im Abschnitt „Egalitarismus als Klugheit“ hinterfrage ich die angebliche Klugheit eines bestimmten Egalitarismus und jenen Anteil, den Risiko und Wahrscheinlichkeit haben, wenn man eigeninteressierte Menschen dazu bringt, sich für diesen Egalitarismus zu entscheiden. Außerdem wende ich mich gegen Rawls’ Leerformel, der Umverteilungsprozess sei schmerzund kostenlos und der Staat ein Automat, der „gesellschaftliche Entscheidungen“ ausspucke, wenn wir ihn mit unseren Wünschen fütterten.
Anstatt, und wie ich meine, erfolglos, daran festzuhalten, dass bestimmte ökonomische und politische Ungleichheiten letzte, unumstrittene Werte wie Nützlichkeit oder Gerechtigkeit produzierten, nimmt die linksliberale Ideologie manchmal keck Zuflucht zu einer Abkürzung und erhebt die Gleichheit selbst in den Rang eines letzten Wertes, die um ihrer selbst willen geschätzt wird, weil es dem Menschen angeboren sei, sie zu mögen.
Mein Hauptgegenargument („Die Liebe zur Symmetrie“), für das wir in Marxens „Kritik des Gothaer Programms“ und in einem unschätzbaren Ausbruch von Engels wohl eher unerwartet Schützenhilfe finden, lautet, dass wir dann, wenn wir glauben, für die Gleichheit zu stimmen, in Wirklichkeit eine Gleichheit enttäuschen, indem wir einer anderen zum Durchbruch verhelfen. Vielleicht wohnt die Liebe zur Gleichheit generell der menschlichen Natur inne, vielleicht auch nicht. Aber die Liebe zu einer bestimmten Gleichheit, die man einer anderen vorzieht (weil man nicht beide gleichzeitig haben kann) ist nur eine Geschmackssache wie andere Vorlieben auch und kann nicht für ein allgemeines moralisches Argument herhalten.
Ähnlich gelagerte Gründe können gegen die Behauptung ins Feld geführt werden, die demokratische Politik sei deshalb gut, weil sie durch Angleichung der Schicksale die Leiden mindere, welche die Menschen empfänden, wenn sie sähen, dass dem Nachbarn mehr Glück beschert sei („Neid“). Nur wenige der zahllosen Ungleichheiten, die den Menschen zu schaffen machen, eignen sich zum Angleichen, schon gar nicht, wenn der Angriff auf den Unterschied so unverblümt daherkommt wie in Maos Kulturrevolution. Es ist nutzlos, jeden das Gleiche essen, anziehen und arbeiten zu lassen, wenn einer immer noch glücklicher verliebt ist als der andere. Die Quelle des Neides ist der neidische Charakter und nicht eine Hand voll handhabbarer Ungleichheiten aus einer unendlichen Fülle von Ungleichheiten. Der Neid wird nicht verschwinden, sobald alle Schlösser niedergebrannt sind, das Verdienst das Privileg ersetzt hat und alle Kinder in dieselbe Schule geschickt werden.
*
[26] Anreize und Widerstände, aber auch die Zwangslage, an der Macht zu bleiben, und zwar angesichts des Wettbewerbs um Konsens und der Eigenart der Gesellschaft, deren Konsens es hervorzulocken gilt, sollten den Staat eigentlich dazu führen, sich ein entsprechendes Repertoire an politischen Maßnahmen zuzulegen, mit dem er einigen Personen Eigentum und Freiheit wegnehmen kann, um sie anderen Personen zu geben. Müsste aber dieser Baukasten, wie auch immer er aussehen mag, nicht zwangsläufig hypothetisch bleiben, und damit Eigentum und Freiheit unangetastet, falls die Verfassung dem Staat untersagte, Eigentum und Freiheit anzutasten, oder zumindest gesetzliche Schranken für das vorgäbe, was angetastet werden darf? Um Klarheit bezüglich der Verfassungsschranken demokratischer Politik zu schaffen, beginnt Kapitel 4 „Umverteilung“ mit einigen Anmerkungen zu unveränderlichen Verfassungen. Es liegt zwar demnach nahe, dass die mutmaßlichen Schranken einer Verfassung dem Staat als vertrauensbildende Maßnahme durchaus von Nutzen sind, aber es ist unwahrscheinlich, dass eine Verfassung unverändert bleibt, wenn sie nicht mit dem vorherrschenden Gleichgewicht der Interessen in der Gesellschaft zusammenfällt. Der zu erwartende Gewinn, den eine Änderung brächte, bildet für eine Koalition von ausreichender Größe einen Anreiz, die Änderung durchgehen zu lassen (auch wenn auf diese Weise keine hinreichende Bedingung für die Ingangsetzung einer Verfassungsänderung geschaffen wird).
Im Abschnitt „Konsens erkaufen“ schauen wir auf die Mechanismen, mit deren Hilfe man im Rahmen der demokratischen Regeln die Unterstützung der Mehrheit erhält. Dazu betrachten wir zunächst einen sehr stark vereinfachten und abstrakten Fall. Wenn die Menschen sich nur darin unterscheiden, wieviel Geld sie haben und sie das Umverteilungsprogramm wählen, bei dem sie am meisten gewinnen (oder das wenigste verlieren), dann werden die rivalisierenden Programme von Amtsinhaber und Opposition sehr ähnlich sein (wobei eines für die Reichen marginal weniger schlecht sein wird als das andere). Bedingt durch den Machtwettbewerb, muss alles, was dem voraussichtlichen Verlierer weggenommen werden kann, dem mutmaßlichen Gewinner angeboten werden. Somit bleibt für den Staat kein „Ermessenseinkommen“ übrig, über das er verfügen könnte. Folglich ist seine Macht über die Ressourcen seiner Bürger mit der eigenen Reproduktion, mit dem bloßen Machterhalt, völlig aufgebraucht.
Eine weniger abstrakte Spielart („Abhängig machende Umverteilung“), bei der die Menschen, und damit auch ihre Interessen, sich in unendlich vielen Hinsichten unterscheiden und die Gesellschaft, in der die Unterstützung vornehmlich erzielt werden muss, nicht atomistisch ist, sondern intermediäre Gruppenstrukturen zwischen Mensch und Staat zulässt, führt zu Ergebnissen, die zwar unklarer, aber für den Staat kaum erfreulicher sind. Umverteilungsgewinne neigen dazu, sowohl auf der individuellen Ebene wie auch auf der Gruppenebene auf das Verhalten abzufärben. Ihre Reduzierung kann Entzugserscheinungen auslösen. Während im Naturzustand die Integrierung von Menschen in geschlossene Interessengruppen durch (potentielles wie tatsächliches) „Trittbrettfahren“ in Schach gehalten wird, werden mit dem Auftreten des Staates als Quell von Umverteilungsgewinnen [27] Gruppenbildungen zur Erzielung solcher Gewinne nicht nur zulässig, sondern auch angeregt. Dies gilt in dem Maße, in dem staatsausgerichtete Interessengruppen unter ihren Mitgliedern das Trittbrettfahren, das marktausgerichtete Gruppen zerstören würde, tolerieren kann.
Jede Interessengruppe hat wiederum einen Anreiz, gegenüber dem Rest der Gesellschaft als Trittbrettfahrer aufzutreten, wobei der Staat das Mittel ist, das sicherstellt, dass dieses Treiben auf keinen ernsthaften Widerstand stößt. Es gibt keinen Grund zur Annahme, dass das korporatistische Ideal der Bildung sehr großer Gruppen (alle Arbeiter, alle Doktoren, alle Einzelhändler), die mit dem Staat und untereinander verhandeln, dieses Ergebnis entscheidend beeinflussen würde. Insofern wird das Umverteilungsmuster auf Dauer zu einem irrwitzigen Flickenteppich mit Schlupflöchern und asymmetrischen Vorteilen unter Berücksichtigung verschiedener Größen wie Branchen, Berufsgruppen oder Regionen bzw. ohne deutlich erkennbares Muster oder Motiv; jedenfalls nicht nach dem klassischen Schema von reich-nach-arm oder reich-nach-median. Über alledem entzieht die Entwicklung des Musters sich zunehmend der staatlichen Oberaufsicht.
Abschnitt „Steigende Preise“ geht davon aus, dass die von der süchtig machenden Umverteilung beflügelte Gruppenstruktur der Gesellschaft jede Gruppe in die Lage versetzt, jede Einbuße am Umverteilungskuchen zu verhindern und wettzumachen. Ein Symptom der daraus resultierenden Hängepartie ist die endemische Inflation. Ein damit verbundenes Symptom ist die Klage des Staates, die Gesellschaft sei unregierbar, kenne kein „Aus!“ und verweigere jedes Opfer, das in harten Zeiten oder bei unerwarteten Erschütterungen als Ausgleich erforderlich wäre.
Das gesellschaftliche und politische Umfeld, das zum großen Teil aus den Handlungen des Staates resultiert, ruft schließlich ein zunehmendes Auseinanderklaffen zwischen brutto und netto der Umverteilung hervor („Umrühren“). Anstatt Peter auszurauben, um Paul zu bezahlen, werden sowohl Peter als auch Paul in vielfältiger Hinsicht bezahlt und ausgeraubt (viel Bruttoumverteilung für eine geringe und ungewisse Nettobilanz). Das erzeugt Turbulenzen und ist dazu verdammt, Enttäuschung und Frustration hervorzurufen.
Zum jetzigen Zeitpunkt hat der Staat seine Metamorphose vom reformerischen Verführer des mittleren 19. Jahrhunderts zum umverteilenden Lastesel des späten 20. Jahrhunderts abgeschlossen und wandelt infolge seiner Suche nach Konsens („Auf zu einer Theorie des Staates“) als Gefangener der unbeabsichtigten kumulativen Effekte in einer Tretmühle. Wenn seine Ziele so sein sollten, dass er sie erreichen kann, indem er die Ressourcen seiner Bürger zu seinen eigenen Zwecken verwendet, dann wäre es vernünftig von ihm, seine Verfügungsgewalt über diese Ressourcen zu maximieren. In der undankbaren Rolle des Lastesels verbraucht er indes all seine Macht für den Machterhalt und bleibt ihm keine Verfügungsgewalt übrig. Für ihn ist genau das zu tun, ebenso vernünftig, wie es für den Arbeiter vernünftig ist, für ein Lohnminimum zu arbeiten, oder für die im perfekten Wettbewerb stehende Firma rational ist, an der Rentabilitätsgrenze zu arbeiten. Eine höhere Form von Rationalität würde den Staat allerdings dazu führen, sich von den [28] Beschränkungen des Konsenses und des Wahlkampfs zu emanzipieren, in etwa so wie bei Marx das Proletariat der Ausbeutung durch Revolution entflieht oder bei Schumpeter der Unternehmer dem Wettbewerb durch Innovation entkommt. Mit meiner These behaupte ich nicht, dass alle demokratischen Staaten früher oder später so enden müssten, sondern dass eine angeborene totalitäre Ausrichtung als Zeichen ihrer Rationalität gedeutet werden sollte.
*
Auf dem Weg von der Demokratie zum Totalitarismus muss die Handlungsautonomie nicht in einem einzigen ununterbrochenen und vorgeplanten Schritt zurückgewonnen werden. Es ist zumindest anfangs eher eine Art Schlafwandeln als ein bewusstes Voranschreiten zu einem klar umrissenen Ziel. Kapitel 5, „Staatskapitalismus“, handelt von kumulativen politischen Maßnahmen, die den Staat mit großer Wahrscheinlichkeit Schritt für Schritt der „Selbstverwirklichung“ näher bringen. Sie bewirken eine Veränderung im gesellschaftlichen System, und zwar derart, dass das Potential für Verfügungsgewalt maximiert wird und der Staat in die Lage versetzt wird, dieses Potential voll auszuschöpfen.
Ganz oben auf der Tagesordnung zur Ausweitung der Verfügungsgewalt („Was tun?“) muss das Problem stehen, wie man die Zivilgesellschaft um ihre Autonomie und ihre Fähigkeit bringt, den Konsens zu verweigern. Die Politik, die der Staat, der eine gemischte Wirtschaftsform betreibt, einzugehen neigt, wird die Grundlage dieser Autonomie zu einem großen Teil aushöhlen, nämlich den selbstständigen Umgang der Menschen mit ihrem Lebensunterhalt. Was das Kommunistische Manifest „die Erkämpfung der Demokratie“ nennt, um „der Bourgeoisie nach und nach alles Kapital zu entreißen, alle Produktionsinstrumente in den Händen des Staats … zu zentralisieren“, ist die Vollendung dieses Prozesses. Der sozialistische Staat setzt damit der historischen und logischen Missgeburt, welche die ökonomische Macht unter der Zivilgesellschaft ausgestreut und zugleich die politische Macht zentralisiert hat, ein Ende. Durch die Zentralisierung und Vereinigung der beiden Mächte schafft er jedoch ein Gesellschaftssystem, das mit den klassischen demokratischen Regeln, die den Staat auf Dauer mit Macht belohnen, unvereinbar ist und unter ihnen nicht richtig funktionieren kann. Die Sozialdemokratie muss zur Volksdemokratie oder zur nächstbesten Lösung werden, weil der Staat nun mächtig genug ist, diese Entwicklung durchzusetzen und einen systematischen Zusammenbruch abzuwehren.
Im Kontext von privatem und staatlichem Kapitalismus („Der Staat als Klasse“) werden die „systemischen Konstanten“ mit den Variablen des Faktors Mensch verglichen, um den Platz für die Verwaltungsbürokratie festlegen. Der Grundsatz, demzufolge die Trennung von Eigentum und Kontrolle für den Eigentümer tatsächlich Kontrollverlust impliziert, verliert hier seine Bedeutung. Stattdessen muss man davon ausgehen, dass die Bürokratie eine heikle Aufgabe übernimmt und ihre Verfügungsgewalt begrenzt ist. Ob die Bürokraten, die den Staat vertreten, freundlich oder gemein gesinnt sind, welche „sozio-ökonomische Herkunft“ sie haben und welche Schule ihre Väter besuchten, bilden hier die Variablen, und die Macht-[29]und Abhängigkeitskonfigurationen, die jeweils den privaten und den staatlichen Kapitalismus kennzeichnen, stellen die Konstanten dar. In Phrasen wie „Sozialismus mit menschlichem Antlitz“ wird es zu einer reinen Sache der persönlichen Hoffnungen und Ängste, wie man das Kräfteverhältnis zwischen den Konstanten des Sozialismus und den Variablen des menschlichen Antlitzes einschätzt.
Anders als in lockeren Gesellschaftssystemen, führt im Staatskapitalismus eine Sache zur anderen und entsteht kurz, nachdem eine Unstimmigkeit eliminiert worden ist, eine neue, die nach Eliminierung schreit. Der letzte und futuristische Abschnitt dieses Buches („Auf der Plantage“) handelt von der Logik des Staates, der das ganze Kapital besitzt und folglich auch seine Arbeiter besitzen muss. Arbeitsund Gütermärkte, Konsumentensouveränität und Bürger im Angestelltenverhältnis, die mit ihren Füßen abstimmen, sind hier Fremdkörper und wirken einigen der Ziele des Staatskapitalismus entgegen. Ein Gesellschaftssystem, das sie ernsthaft in Betracht zieht, übernimmt so einige Merkmale der alten paternalistischen Südstaaten Nordamerikas.
Die Menschen sind in vielerlei Hinsicht zu beweglichen Sklaven geworden. Ihre Arbeit gehört ihnen nicht mehr, sie schulden sie jemandem. Es gibt „keine Arbeitslosigkeit“. Öffentliche Güter stehen vergleichsweise reichlich zur Verfügung und meritorische Güter wie gesundes Essen oder Tonträger von Bach sind billig, während die Löhne kaum mehr als ein Taschengeld sind, gemessen am Standard, der sonst auf der Welt herrscht. Wohnungen, öffentliche Transportmöglichkeiten, Gesundheitsleistungen, Kultur und Sport werden den Menschen rationiert und in natura zugeteilt und kommen ihnen nicht über Gutscheine (geschweige denn Geld) und mit der entsprechenden Pflicht, selbst auszuwählen, zu. Ihre Geschmäcker und Gemüter stellen sich darauf ein (auch wenn nicht alle süchtig werden und manche womöglich allergisch reagieren). Bevor er überhaupt merkt, dass er in eine neue Zwickmühle geraten ist, wird der Staat seine Verfügungsgewalt schon längst bis zum Anschlag ausgeweitet haben.
*
Der Themenkatalog eines vernünftigen Staates führt im Umkehrschluss zu einem inversen Themenkatalog für vernünftige Bürger, zumindest in dem Sinne, dass er ihnen sagt, was zu tun ist, um die Dinge zu befördern oder abzuwenden. Wenn die Bürger – was wahrscheinlich schwieriger sein dürfte, als es klingt – alle unvereinbaren Präferenzen ausmisten können, die sie haben, wenn sie mehr Freiheit und mehr Sicherheit, mehr Staat und gleichzeitig weniger Staat haben wollen, dann werden sie wissen, wie weit sie dem Staat bei der Umsetzung seiner Agenda bei- oder entgegenstehen wollen. Von diesem Wissen wird ihr Fortbestand abhängen.
1Marx, Die Judenfrage, S. 355, 363, 357.
2 Wie einer der Gründer dieser Schule einmal sagte, handelt die Wohlfahrtsökonomie vom Versagen des Marktes und die Public Choice Theorie vom Versagen der Staates (Buchanan (1975), Kap. 10). Man beachte aber den davon abweichenden Kurs bestimmter Public Choice-Theoretiker, auf den wir in Kapitel 4 (Anm. 187) Bezug nehmen.
3 Der Begriff „politischer Hedonist“ wurde von dem großen Leo Strauss geprägt, um dem willigen Untertan Leviathans einen Namen zu geben.
4Marx, Die Judenfrage, S. 354.
1. Kapitel
Der kapitalistische Staat
Gewalt, Gehorsam, Vorliebe
Vorlieben für politische Arrangements hängen von dem ab, was die Menschen als ihr Wohl ansehen, und von den Arrangements, die dazu angeblich vorzuziehen sind.
In der Regel beginnen Staaten damit, dass jemand verliert.
„Der Ursprung des Staates ist die Eroberung“ und „Der Ursprung des Staates ist der Gesellschaftsvertrag“ sind nicht zwei Erklärungen, die miteinander wetteifern. Die eine handelt vom Ursprung des Staates in Echtzeit, und die andere betrifft die logische Ableitung. Beide können gleichzeitig gültig sein. Soweit es uns vergönnt ist, derlei Dinge überhaupt in Erfahrung zu bringen, zeigt uns die historische Forschung, dass die meisten Staaten ihren Stammbaum auf die Unterwerfung eines Volkes durch ein anderes zurückführen können; nur selten auf die Vorherrschaft eines siegreichen Anführers und seiner Bande über das eigene Volk, und fast immer auf Migration. Andererseits kann man mit Hilfe weithin geteilter Axiome „zeigen“ (allerdings in einem anderen Sinne des Wortes), dass vernünftige Menschen auf der Suche nach ihrem Wohl es für vorteilhaft halten, sich einem Monarchen oder Staat zu unterwerfen. Da diese beiden Ansätze zur Erklärung des Staates auf unterschiedliche Kategorien zurückgreifen, bringt es nichts, sie miteinander zu vergleichen oder einen Ansatz dem anderen vorzuziehen. Genau so wenig sinnvoll ist es, aus dem Umstand, dass Staaten entstanden und zu Glanz gekommen sind, zu schlussfolgern, dass es für die Menschen, die nach ihrem Wohl gestrebt haben, vernünftig gewesen sein muss, sich ihnen zu unterwerfen, weil sie ansonsten vor ihrer Unterwerfung mehr hätten kämpfen müssen.
In diesem Lichte wollen wir nun den honorigen Versuch betrachten, den man aus den analytischen Darstellungsmethoden, wie z. B. der zum Gesellschaftsvertrag, kennt und der darauf abzielt, den (historisch) gewaltsamen Ursprung des Staates mit dem rationalen Willen des Untergebenen unter einen Hut zu bringen.5 Bei diesem Versuch kommt jede im Naturzustand lebende Person zu einer Einschätzung all ihrer künftigen Einkommen, die sie im Naturzustand vermutlich erzielen wird, sowie zu einer weiteren Einschätzung all ihrer künftigen Einkommen, die sie in einer mit einem Staat ausgestatteten Zivilgesellschaft bekommen würde. Man nimmt dabei an, dass die zweite Schätzung größer ausfällt als die erste. Die beiden Schätzungen werden diskontiert, um einen Wert zu erhalten. Es braucht einige [31] Zeit, bis alle jenen Gesellschaftsvertrag abgeschlossen haben, der den Übergang vom Naturzustand in die Zivilgesellschaft bereitstellt. Die großen Gewinne, die aus der Schaffung des Staates hervorgehen, liegen deshalb in weiter Ferne, und der Wert dessen, wie sehr diese Gewinne die im Naturzustand erzielbaren Einkommen überragen, ist gegenwärtig klein. Er könnte durchaus sein, dass der Anreiz für die Aufgabe, jedem das Einverständnis zum Gesellschaftsvertrag abzuringen, nicht ausreichen würde. Auf der anderen Seite kann ein Staat mit Hilfe von Gewalt rasch erschaffen werden. Die höheren Einkünfte, die der Existenz des Staates geschuldet sind, kommen somit schneller zustande. Sie schrumpfen nicht so sehr, wenn man sie in gegenwärtige Werte umsetzt. Vergleicht man den gegenwärtigen Wert der Einkünfte, die in einem Staate erzielt werden, der beim friedlichen Aushandeln eines Gesellschaftsvertrages langsam an Gestalt gewinnt, mit dem der Einkommen, die in einem durch einen kurzen Gewaltstreich entstehenden Staat generiert werden, so muss der Vergleich zugunsten der Gewalt ausfallen. Insofern kann man von einer rationalen, einkommensmaximierenden Person erwarten, dass sie entweder die Gewalt, die ihr durch den Staatsgründer widerfährt, gutheißt oder sich selbst der Gewalt bedient, um den Staat zu organisieren. Der Leser mag daraus entweder schließen (auch wenn der Autor dies keineswegs gewollt haben kann), dass dies der Grund dafür ist, dass die meisten Staaten nicht durch friedliche Verhandlungen entstanden sind, sondern durch Gewalt, oder dass diese Theorie der rationalen Motivation mit dem historischen Ursprung des Staates, wie immer der auch im Einzelfall ausgefallen sein mag, zumindest kompatibel ist.
Diese Art der Theorie verleitet, wie auch schon die Vertragstheorien vor ihr, zu dem voreiligen Schluss, dass die Menschen die staatsschaffende Gewalt im nachhinein deshalb gutgeheißen hätten, weil die Staaten auf dem Wege der Gewalt zustande kamen und blühten und weil es für die Menschen durchaus sinnvoll sein kann, mit Gleichmut die Gewalt zu ertragen, die zur Gründung jenes Staates führt, den sie ersehnen, aber nicht selbst erwirken können. Egal, ob der Staat friedlich oder gewaltsam entspringt, man unterstellt ihm, dass er den Menschen bei der Verfolgung ihres Wohls behilflich sei.
Erstaunlicherweise ist diese Unterstellung nie in einer allgemeineren Form dargestellt worden, z. B. in einer, die Vorzeichen (+/–) zuließe. Falls man dies nachholen wollte, dann müsste es heißen, „der Staat unterstützt/hindert“, wobei die tatsächliche Bilanz der Aussage vom empirischen Inhalt der Begriffe „Unterstützung“ und „Behinderung“ abhinge. Man erhielte mehr Informationen, wenn man die Unterstellung in eine Aussageform brächte, wie z. B.: „Der Staat unterstützt/ hindert einige Personen, unterstützt/hindert einige andere und lässt die übrigen unberührt.“ Die Betroffenen werden auf unterschiedliche Weise und in unterschiedlichem Maße unterstützt/behindert. Nur in Glücksfällen ist die Menge der behinderten Personen leer (d. h., jeder wird unterstützt oder in Ruhe gelassen), ansonsten ist die algebraische Summe ein Vergleich zwischen den unterstützten und behinderten Personen. Dass man schon so auf interpersonale Vergleiche stößt, ist ein Zeichen dafür, dass unsere Reflexionen zumindest in die richtige Richtung weisen, nämlich auf die zentralen Fragen der politischen Theorie.