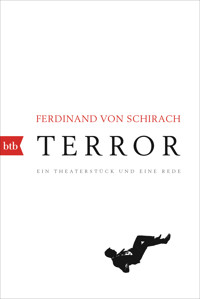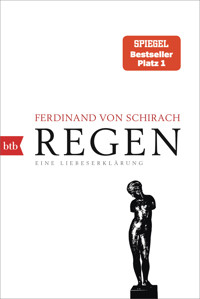19,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Luchterhand Literaturverlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Nach »Kaffee und Zigaretten« und »Nachmittage« - neue Erzählungen von Bestsellerautor Ferdinand von Schirach.
Ferdinand von Schirach schreibt über die Verletzlichkeit des Menschen, über seine Triumphe und sein Scheitern. Seine Geschichten erzählen von der Gesellschaft, vom Tod und von Verbrechen, von Musik, Film, Malerei und Philosophie. Sie spielen in Berlin, Kapstadt, Rom, Wien und an der Côte d´Azur. Sie berichten von privaten Begegnungen, von historischen Ereignissen und von Persönlichkeiten wie dem Tennisspieler Gottfried von Cramm, dem Architekten Adolf Loos oder dem Wiener Schriftsteller, Schauspieler und Kulturphilosophen Egon Friedell. Und immer wieder erzählt sein neues Buch »Der stille Freund« von Zufällen, die ein Leben unaufhaltsam verändern, von der Unbegreiflichkeit und Großartigkeit des Menschen, von der Unsicherheit des Daseins und der Sehnsucht nach Schutz, Sicherheit und Freiheit.
Das neue Buch bildet zugleich die Grundlage für Ferdinand von Schirachs großes Bühnenprogramm »Der stille Freund«, mit dem er ab Herbst 2026 durch Deutschland, Österreich und die Schweiz auf Tournee geht.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 164
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Zum Buch
Ferdinand von Schirach schreibt über die Verletzlichkeit des Menschen, über seine Triumphe und sein Scheitern. Seine Geschichten erzählen von der Gesellschaft, vom Tod und von Verbrechen, von Musik, Film, Malerei und Philosophie. Sie spielen in Berlin, Kapstadt, Rom, Wien und an der Côte d’Azur. Sie berichten von privaten Begegnungen, von historischen Ereignissen und von Persönlichkeiten wie dem Tennisspieler Gottfried von Cramm, dem Architekten Adolf Loos oder dem Wiener Schriftsteller, Schauspieler und Kulturphilosophen Egon Friedell. Und immer wieder erzählt sein neues Buch Der stille Freund von Zufällen, die ein Leben unaufhaltsam verändern, von der Zerbrechlichkeit und Großartigkeit des Menschen, von der Unsicherheit des Daseins und der Sehnsucht nach Schutz, Sicherheit und Freiheit.
Zum Autor
Der SPIEGEL nannte Ferdinand von Schirach einen »großartigen Erzähler«, die New York Times einen »außergewöhnlichen Stilisten«, der Independent verglich ihn mit Kafka und Kleist, der Daily Telegraph schrieb, er sei »eine der markantesten Stimmen der europäischen Literatur«. Seine Erzählungsbände und Romane wurden vielfach verfilmt und zu millionenfach verkauften internationalen Bestsellern. Sie erschienen in mehr als vierzig Ländern. Die Theaterstücke Terror und Gott zählen zu den erfolgreichsten Dramen unserer Zeit, und mit seinem Theatermonolog Regen trat Ferdinand von Schirach nahezu 18 Monate lang vor ausverkauften Sälen auf. Seine Essaybände wie Die Würde des Menschen ist antastbar sowie die Gespräche mit Alexander Kluge Die Herzlichkeit der Vernunft und Trotzdem standen monatelang auf den Bestsellerlisten. Zuletzt erschienen von ihm u. a. die Erzählsammlung Nachmittage, der Theatermonolog Regen und das Theaterstück Sie sagt. Er sagt. Ferdinand von Schirach wurde vielfach mit Literatur- und Filmpreisen ausgezeichnet. Er lebt in Berlin.
Ferdinand von Schirach
DER STILLE FREUND
Luchterhand
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.Der Verlag behält sich die Verwertung der urheberrechtlich geschützten Inhalte dieses Werkes für Zwecke des Text- und Data-Minings nach § 44b UrhG ausdrücklich vor. Jegliche unbefugte Nutzung ist hiermit ausgeschlossen.
Luchterhand Literaturverlag
in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH,
Neumarkter Str. 28, 81673 München
Copyright © 2025 Ferdinand von Schirach
(Vorstehende Angaben sind zugleich
Pflichtinformationen nach GPSR)
Umschlaggestaltung: buxdesign | München
Umschlagmotiv: © Norman Parkinson / Iconic Images
Satz: Uhl + Massopust, Aalen
ISBN 978-3-641-33613-4V002
www.luchterhand-literaturverlag.de
facebook.com/luchterhandverlag
»Ich gestehe, ich glaube nicht an die Zeit.«
Vladimir Nabokov inErinnerung, sprich
Der stille Freund
Vor acht Jahren wollte Massimo von seiner Farm in Namibia mit der Propellermaschine in die Hauptstadt fliegen. Es war eine alte Cessna 172. Wir sind oft mit dieser Maschine geflogen, das sind gutmütige kleine Flugzeuge, solide und robust, sie brauchen nur kurze Landebahnen, und mit ein bisschen Pflege tun sie Jahrzehnte ihren Dienst. Massimo flog damit alle zwei Wochen nach Windhuk, um Einkäufe zu erledigen und Freunde zu besuchen. Das war angenehmer, als sechs Stunden in dem furchtbar unbequemen Toyota zu sitzen.
Als das Flugzeug abhob, stieg ein Schwarm Webervögel auf. Dagegen ist auch der beste Pilot machtlos. »Vogelschlag« stand später in dem offiziellen Unfallbericht. Er liegt mit den Fotos auf meinem Schreibtisch, während ich diesen Text schreibe.
Seine Frau saß mit ihrer Schwester auf der Veranda des Farmhauses, nur ein paar Meter von der Startbahn entfernt. Sie hörten die Explosion und rannten zu dem Rauch hinter dem Hügel. Verstreute Trümmerteile, Metall, das sich in den Boden gebohrt hatte, ein herausgerissener Sitz. Neben der Piste der Rumpf des schmalen Flugzeuges, verbogen und zusammengestaucht, ein Flügel war abgerissen. Massimos Frau konnte den Geruch nach verbranntem Fleisch nie wieder vergessen.
Massimo und ich waren zusammen in einem Jesuiteninternat gewesen. Seine Frau ging in eine Klosterschule, mit deren Schülerinnen wir unseren ersten Tanzkurs hatten. Er war damals ein dürrer Junge mit bleichem Gesicht, riesiger Nase und lautem Lachen. Auch als Erwachsener sah er immer ein wenig aus, als sei er gerade aus dem Bett gekommen. Die Kragen und Manschetten seiner Hemden waren durchgescheuert, er trug heruntergetretene Schuhe, und alle seine Jacken hatten Löcher, selbst sein Smoking. Jede Form von Ordnung hielt er für verrückt, und Geld sei ausschließlich dafür da, es sofort wieder auszugeben. Seinen Wagen besaß er seit mehr als dreißig Jahren und hatte ihn noch nie gewaschen.
Massimo stammte aus einer streng katholischen Familie. Seine Mutter trug auf Festen den Sternkreuzorden. Als sein Vater einmal für ein staatliches Amt vereidigt werden sollte, sagte sie: »Du liebe Güte, man schwört nicht auf die Verfassung. Man dient nur dem Herrn.«
Als Kind las Massimo die Bibel, weil er mehr über diesen Gott wissen wollte, von dem seine Mutter ständig sprach. Der Gott des Alten Testaments sei ein kleiner Feuergott, eifersüchtig und bösartig, sagte Massimo später. Der brutale Gott eines unterdrückten Volks, einer, der Brüder gegeneinander kämpfen lasse. Dieser Gott habe Feinde und lasse sie von seinen Anhängern verstümmeln und töten. So ein Gott könne keine Welten erschaffen, dachte Massimo, das Universum ist zu erhaben für ihn. Er sagte, viele der Geschichten in der Bibel gehörten zum Besten, was er in seinem Leben gelesen habe. Nur glaubten die Christen, es seien keine Erzählungen, keine wundervollen Menschheitsmärchen. Sie würden die Wahrheit verkünden, behaupteten sie.
Jesus Christus sei ihm näher als der Gott des Alten Testaments, sagte Massimo. Ein verlassener und verletzlicher Mensch, einer der das Brot teile, tröste und heile. Massimo las die Bücher der Kirchenväter, einige Originalausgaben standen in der Bibliothek seiner Familie in Florenz. Er war beeindruckt von der Phantasie dieser gläubigen Männer, von ihrer Sicherheit und Intelligenz. Und er war angewidert von ihrer Intoleranz und Grausamkeit. Das, was sie »Beweise« nennen, kam ihm albern vor. Das seien nur Sprachspiele und Zirkelschlüsse, sie könnten die Welt nicht erklären, sagte er.
Jedes Volk kennt solche Mythen über die Entstehung der Welt. In China glaubten einige, das All sei ursprünglich ein Ei gewesen, in dem ein einziges Urwesen lebte. Bei den Maori waren Himmel und Erde ein sich liebendes, eng umschlungenes Paar. Bei den Germanen gab es eine gähnende Schlucht, die große Leere zu Beginn des Weltgeschehens. Auch das sind phantastische Geschichten, voller Wunder und Fabelwesen. Aber jeder Mythos verlangt, dass man an ihn glaubt, sonst kann sich sein Zauber nie ganz entfalten. Und glauben konnte Massimo nicht.
Er suchte Antworten in der Antike. Der Schriftsteller Gustave Flaubert schrieb 1861: »Die Schwermut der Antike erscheint mir tiefer als die moderner Menschen, die alle mehr oder weniger glauben, jenseits der dunklen Leere liege die Unsterblichkeit. Für den antiken Menschen aber war die dunkle Leere die Unendlichkeit selbst. Seine Träume tauchen auf und versinken vor dem Hintergrund aus unveränderlichem Ebenholz. Keine Schreie, keine Bewegungen – nichts als ein starrer, nachdenklicher Blick. Als es die Götter schon nicht mehr gab und Christus noch nicht gekommen war, gab es diesen einzigartigen Augenblick in der Geschichte, von Cicero bis Mark Aurel, da war der Mensch allein. Diese Größe finde ich nirgendwo sonst.« Massimo fragte, warum diese Klarheit wieder verloren ging. Wie konnte das begabteste Volk, die Athener, nach den 50 strahlendsten Jahren der Menschheit, wieder Krieg gegen seine Nachbarn führen? Und warum waren nach der Aufklärung die größten Verbrechen der Menschheit möglich?
Ich erinnere mich auch, wie er eines Morgens im Internat in mein Zimmer kam, im Schlafanzug auf den Tisch stieg und laut die drei Fragen Kants stellte: »Was kann ich wissen? Was soll ich tun? Was darf ich hoffen?« Dann sprang er herunter und sagte: »Das wird das nächste Jahr.« Bei einem Jahr blieb es nicht. Er las Platon, Aristoteles, Descartes und Spinoza. Nächtelang erklärte er mir, dass er ein Traum innerhalb eines Traums sein könnte. Oder ein Gehirn, das sich diese Welt nur ausdenke, eine Simulation. Dann ging es weiter mit Hegel, Fichte, Schelling, Schopenhauer, Nietzsche, Heidegger und der Frankfurter Schule. Und nie wurden Kants Fragen beantwortet.
Viel später beschäftigte sich Massimo mit den Naturwissenschaften. Wir lagen auf dem Dach der Farm in Namibia unter einem riesigen Sternenhimmel, und er versuchte seiner Frau und mir vergeblich Superstrings in höher dimensionalen Bahnen zu erklären. Er sprach von Paralleluniversen, von Big Bangs, die aus Big Crunches entstünden, von schwarzen Löchern in fünfdimensionalen Räumen und von Blasen, die selbst so groß wie Universen seien. Es werde immer wieder neue Theorien geben, die versuchen, den Anfang zu verstehen und das Ende vorauszusehen. Diese Theorien würden von den hervorragendsten Gehirnen unseres Planeten entworfen, sagte Massimo. Aber sie seien nicht überprüfbar, man könne sie glauben oder auch nicht. Es seien also ebenfalls Mythen, nur weitaus klügere.
An einem frühen Morgen im August, nachdem Massimo wieder die ganze Nacht gelesen hatte, trat er auf die Terrasse seines Hauses in Florenz. Es war schon warm, die Dächer der Stadt leuchteten, die Kuppel von Santa Maria del Fiore, Giottos Campanile und der Turm des Palazzo Vecchio. Und dann, ganz plötzlich, wurde ihm klar, dass nur das Lebendige wahr ist, nur das Staunen, nur die Schönheit unserer Welt, dieser eine Moment. Er ging in ein Café, bestellte ein Cornetto, biss hinein und konnte nicht mehr aufhören zu lachen. Massimo nannte diesen Moment später seinen »stillen Freund«, zu dem er immer wieder zurückkehren konnte. Das verstand ich sehr gut.
Er sagte, es sei Wahnsinn, dass alle Menschen immer wieder die gleichen Erfahrungen machen müssten. Und die gleichen Fehler. Man solle doch einfach einmal alle Regeln aufschreiben, mit denen ein Leben gelinge. Nach Massimos Tod fragte mich seine Tochter, ob ich dieses Buch für sie schreiben könne.
Ich vermisse meinen klugen Freund noch immer. Aber ich fürchte, er irrte sich. Natürlich, man muss freundlich sein, großzügig, tapfer und sanft. Es ist albern, sich selbst allzu ernst zu nehmen. Und niemals, wirklich niemals, darf man sich als Opfer sehen. Aber das ist schon alles. Es ist doch ganz gleichgültig, ob wir in der besten oder der schlechtesten aller Welten leben. Alle Fragen nach einem Sinn sind Kinderfragen. Niemand weiß, warum das eine Leben glückt und das andere nicht. Es gibt keine Regeln, es gab sie noch nie.
Ich jedenfalls kann Massimos Buch nicht schreiben. Aber ich erinnere mich an den Geruch des Sommers in Südfrankreich, als ich 15 Jahre alt war und an den roten Sand des Tennisplatzes in unserem Park und an die sehr langen, weißen Seidenhandschuhe meiner Tante.
Ich bin Schriftsteller, ich erzähle nur Geschichten.
Spiegelstrafe
Auf dem einzigen Foto, das ich von Cynthia besitze, ist sie fünf Jahre alt, ich bin zwei Jahre jünger. Wir stehen am alten Brunnen im Rosengarten vor unserem Haus in München. Sie ist größer als ich und hat eine Hand auf meine Schulter gelegt. Wir schauen beide angestrengt in die Kamera, die vermutlich mein Vater hielt. Ich erinnere mich nicht an die Situation, an nichts, was davor oder danach geschah. Nur dieses Schwarz-Weiß-Foto gibt es noch.
18 Jahre später traf ich sie auf einem Empfang in Bonn wieder. Sie studierte damals in England und besuchte über das Wochenende eine Freundin in der Stadt. Ich hatte dort gerade mein zweites Semester begonnen.
Um Cynthias vollständigen Namen mit allen Vornamen und Titeln zu schreiben, brauchte man eine halbe Seite. Sie stammte aus einer schlesischen Familie, die nach dem Krieg alles verloren hatte. Als sie vier Jahre alt war, sind ihre Eltern in Südamerika bei einem Autounfall umgekommen.
Cynthia war bei ihren Großeltern aufgewachsen. Das alte Fürstenpaar lebte damals in München. Sie beklagten sich nie, aber sie kamen nicht gut zurecht. Sie wohnten in drei kleinen Zimmern, die bis zur Decke mit Antiquitäten und Erinnerungen vollgestopft waren. Die Regeln, die sie gelernt hatten, galten nicht mehr, und die neuen Regeln hatten sie nie ganz verstanden. In Schlesien hatten sie zu den reichsten Familien gehört, jetzt besaßen sie nichts mehr. Sie wurden von Verwandten und Freunden unterstützt und wandten sich immer weiter zurück, der Vergangenheit zu.
Als ich Cynthia an diesem Tag in Bonn wiedersah, trug sie ein blau-schwarzes Kleid, eine vierfache Perlenkette umschloss eng ihren Hals. Sie hatte die Arme vor der Brust verschränkt und hielt eine Zigarette zwischen den Fingern. Es war verblüffend: Sie sah genau aus wie das Bild, das der Fotograf Horst P. Horst 1946 von Babe Paley in New York für die Vogue gemacht hatte. Neben Cynthia stand einer der Männer, deren Gesichter immer zu nahe kommen, wenn sie reden. Ich ging zu ihr, sie umarmte mich und schien erleichtert. Wir verabredeten uns für den Abend, sie wollte meine Wohnung sehen.
Ich holte sie in Bad Godesberg bei ihrer Freundin ab, und wir fuhren mit der Straßenbahn zum Bonner Hauptbahnhof. Wir gingen auf der Poppelsdorfer Allee an den immer schmutzigen Tulpen vorbei und weiter unter den hohen Kastanien bis zu meiner Wohnung. Es war ein später Frühlingstag gewesen. Die Stadt hatte den Rasen mähen lassen, es roch nach frischem Gras und nach Erde. Wir setzten uns auf den Balkon meiner Wohnung, und dann begann es endlich zu regnen. Die beiden Eisenstühle, die ich auf dem Flohmarkt gekauft hatte, waren zu unbequem, deshalb zogen wir die Matratze, die mein Bett war, aus dem Zimmer auf den Balkon. Ich machte Kaffee, und sie öffnete eine Flasche Pimm’s No. 1, die sie mitgebracht hatte.
Cynthia hatte ein Stipendium der Studienstiftung, leitete den Debattierclub ihres Colleges, spielte Theater in der Oxford University Dramatic Society und hatte bereits einen Aufsatz in einer angesehenen philosophischen Fachzeitschrift veröffentlicht. Wir sprachen darüber, was wir tun würden und wer wir sein wollten. Natürlich traf später fast nichts davon ein, aber in dieser Nacht war alles wahr, was wir glaubten, und nichts fehlte uns.
Irgendwann zog sie ihre Schuhe aus und stützte ihr Kinn auf die angezogenen Knie. Ich verstand jetzt, warum Truman Capote gesagt hatte, Babe Paley sei einer seiner »Schwäne« gewesen. Ich fragte, ob sie wisse, dass sie heute beim Empfang wie die Paley ausgesehen habe. Sie lachte und nickte. In ihrem Internat in England hätten sie oft die Fotos von Cecil Beaton, Horst P. Horst und den anderen Fotografen aus den 50er und 60er Jahren nachgestellt. Sie hätte immer Babe Paley auf diesen Bildern gespielt und ihre beste Freundin Wallis Simpson – die Frau, wegen der König Edward VIII. abgedankt und auf die englische Krone verzichtet hatte.
»Das Kleid und die Perlenkette gehörten meiner Mutter«, sagte sie.
Truman Capotes Schilderungen von seinen Schwänen in New York kannte sie natürlich. Aber an seinem Buch Erhörte Gebete sei nur der Titel großartig, sagte sie.
»Capote wollte der Marcel Proust Amerikas werden«, sagte Cynthia. »Er hatte mit seinen Büchern Frühstück bei Tiffany und Kaltblütig ja unfassbaren Erfolg gehabt und damit auch einen ganz neuen Stil erfunden. Es war der Höhepunkt seines Lebens. Jetzt wollte er die New Yorker Gesellschaft so beschreiben, wie Proust das mit der Pariser Gesellschaft zu Beginn des 20. Jahrhunderts getan hat. Aber das war natürlich nicht möglich.«
»Warum?«, fragte ich.
»Capote verstand nicht, dass Marcel Proust über die upper class geschrieben hatte, er selbst aber über die high society. Das sind zwei völlig verschiedene Dinge.«
»Interessant«, sagte ich.
»Die upper class«, sagte Cynthia, »hat es immer gegeben und wird es immer geben. Aber die high society wurde erst durch die Boulevardpresse möglich, durch Radio und Fernsehen. Jeder in Amerika konnte jetzt etwas über diese Gesellschaftsschicht erfahren. Am Anfang in McClure’s Magazine und im Ladies’ Home Journal und später in allen Zeitschriften und Zeitungen, selbst in den seriösen. Es war ja kein Zufall, dass Capote seinen Black and White Ball 1966 im Plaza zu Ehren der Herausgeberin der Washington Post gab. Die high society, das waren die Neuen, das neue Geld, die nouveaux riches. Die amerikanische upper class ist selbst in diesem noch jungen Land viel älter. Ihre Vorfahren haben die Unabhängigkeitserklärung unterschrieben, die Eisenbahnlinien gebaut und die Universitäten gegründet. Diese Leute haben nach und nach besondere Umgangsformen entwickelt, komplizierte Codes und Verfeinerungen, so wie der französische Adel bei Proust. Mit den Aufsteigern aus New York wollten sie nichts zu tun haben. Die Häuser und Familien der upper class waren den Neureichen nicht zugänglich, zu den alten Clubs bekamen sie trotz ihres Geldes keinen Zutritt. Die high society war also eigentlich eine Gegenbewegung zur upper class. Vor allem spielte das Leben der Neureichen in der Öffentlichkeit, nicht im Privaten. Jeder konnte und sollte ihrem Leben zuschauen. Es ging darum, berühmt zu sein.«
»Und in der upper class hat niemand so etwas gewollt? Klingt ein bisschen wie heute«, sagte ich.
»Genau wie heute sogar. Mein Großvater sagt, man dürfe nur drei Mal in der Zeitung stehen: bei Geburt, Hochzeit und Tod. Das Leben selbst könne man getrost dem Personal überlassen.«
»Auch Jules Verne schreibt so etwas. Der Held in seinem Roman In 80 Tagen um die Welt ist der Gentleman Phileas Fogg. Der gehöre zu der Sorte von Engländern, welche die Länder, durch die sie reisen, nur von ihren Dienern anschauen lassen«, sagte ich.
»Es ist sinnlos, sich anzustrengen, wenn man dadurch an seiner Stellung in der Gesellschaft nichts ändern kann. Eine Demokratie lebt von Aufstieg, Fall und Konkurrenz. Meine Großeltern nicht. Sie standen nie in einem Wettbewerb. Wozu Aufstieg und Ehrgeiz überhaupt gut sein sollen, blieb ihnen unklar. Sie konnten nichts werden und nichts verlieren. Auch ohne Vermögen und Land blieben sie genau das, als was sie geboren wurden«, sagte Cynthia. »Marcel Proust hat solche Menschen beschrieben. Sie waren genauso, wie meine Großeltern und beinahe alle alten Verwandten, die ich habe. Sie haben sich in ihrer Welt eingeschlossen und den Schlüssel weggeworfen. Aus ihr gibt es keinen Ausgang – und für andere eben auch keinen Eingang.«
»Die meisten Menschen glauben, das sei Arroganz«, sagte ich.
»Ich weiß. Aber das stimmt nicht. Für meine Großmutter gibt es nur richtiges und falsches Verhalten, alles andere ist entweder ›unerzogen‹ oder ›verrückt‹. Wenn ein Gast ›Guten Appetit‹ vor dem Essen wünscht oder das ›Klo‹ ›Toilette‹ nennt, findet sie das merkwürdig, aber sie verachtet denjenigen nicht. Einer, der ›lecker‹ sagt oder einen Ärmelknopf an seiner Jacke offen lässt, um zu zeigen, dass sie maßgemacht ist, gehört einfach nicht zu ihrer Welt. Das ist dann eben ein Mensch, der ›seine Möbel selbst kaufen muss‹, würde mein Großvater sagen. Das ist keine Arroganz. Das ist Distanz ohne Hochmut. Sie können gar nicht anders denken. Und meine Großeltern haben eine Sicherheit, die es heute gar nicht mehr gibt.«
»Parkettsicherheit«, sagte ich.
»Ja, aber es geht noch weiter. Meine Großmutter hält selbst einen Tisch für richtig oder falsch. Niemand brauche ein Bidet, sagt sie, ein Badezimmer müsse nur groß genug sein, damit man einen Stuhl reinstellen kann, um dem Kind in der Badewanne etwas vorzulesen. Wenn sich alles verändert, soll man das auf keinen Fall auch noch selbst tun – so dachten diese Menschen. Und so denken sie noch heute. Trotzdem würde sich natürlich niemand aus der upper class selbst dazu zählen. In England würden sogar die Familien, die ihre Namen seit der französischen Invasion tragen, das ablehnen. Vermutlich würden selbst die Mitglieder des Königshauses erklären, sie seien allenfalls upper middle class. Die Vergangenheit meiner Familie ist jedenfalls die Ausrede für alles.«
»Es geht um Zeit, oder?«, sagte ich.
»Das stimmt«, sagte sie. »Zeit ist bei Marcel Proust nur Erinnerung – eine Vorstellung ohne irgendeine Verbindung zur Realität. Seine Zeit ist die verlorene Zeit, die Vergangenheit, die Sehnsucht nach längst verschwundenen Tagen. Ich kenne das gut, weil es auch bei meinen Großeltern so ist, wenn sie von Schlesien erzählen, von den Jagden und Festen dort, von Weizenfeldern, Streuselkuchen und Heidelbeeren. Meine Großmutter sagt, als junge Frau hätte sie nur Ballkleider und Reitzeug gebraucht. Ihre Welt waren Breslau, Hirschberg und Ratibor – Orte, die sie nach dem Krieg nie wieder besucht hat. Diese Städte sind trotzdem für sie heute noch lebendig. So lebendig wie für uns Paris oder Berlin. Bei Truman Capote ist Zeit etwas ganz anderes, nämlich Tempo und Zukunft. Was bei Proust langsam verweht und zur bloßen conversation agréable