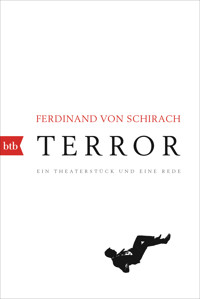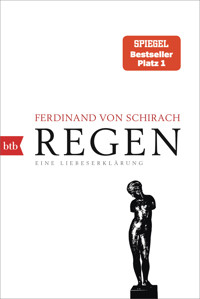10,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: btb Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Ein angesehener, freundlicher Herr, Doktor der Medizin, erschlägt nach vierzig Ehejahren seine Frau mit einer Axt. Er zerlegt sie, bevor er schließlich die Polizei informiert. Sein Geständnis ist ebenso außergewöhnlich wie seine Strafe ... Ein Mann raubt eine Bank aus, und so unglaublich das klingt: Er hat gute Gründe. Gegen jede Wahrscheinlichkeit wird er von der Justiz an Leib und Seele gerettet ... Eine junge Frau tötet ihren Bruder. Aus Liebe.
Ferdinand von Schirach erzählt unglaubliche Geschichten, die dennoch wahr sind. Präzise, schnörkellos, lakonisch wie ein Raymond Carver und gerade deswegen mit unfassbarer Wucht.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 222
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
FERDINAND VON SCHIRACH
VERBRECHEN
Stories
Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Genehmigte Taschenbuchausgabe Mai 2020btb Verlag in der Verlagsgruppe Random House GmbH,Neumarkter Str. 28, 81673 MünchenCopyright © 2020 Ferdinand von SchirachUmschlaggestaltung: buxdesign | Münchenunter Verwendung eines Motivs von © auf der Grundlagedes Designs von R·M·E Roland EschlbeckUmschlagmotiv: Getty Images / Paul Taylor / RiserAutorenfoto: Michael Mann | © Ferdinand von SchirachKlü · Herstellung: sc
ISBN 978-3-641-26778-0V001
www.btb-verlag.dewww.facebook.com/btbverlag
Inhalt
Vorwort
Fähner
Tanatas Teeschale
Das Cello
Der Igel
Glück
Summertime
Notwehr
Grün
Der Dorn
Liebe
Der Äthiopier
Die Wirklichkeit, von der wir sprechen können, ist nie die Wirklichkeit an sich.
(Werner K. Heisenberg)
Vorwort
Jim Jarmusch hat einmal gesagt, er würde lieber einen Film über einen Mann machen, der mit seinem Hund spazieren geht, als über den Kaiser von China. Mir geht es genauso. Ich schreibe über Strafverfahren, ich habe in mehr als siebenhundert verteidigt. Aber eigentlich schreibe ich über den Menschen, über sein Scheitern, seine Schuld und seine Großartigkeit.
Ich hatte einen Onkel, der Vorsitzender Richter an einem Schwurgericht war. Diese Gerichte sind für Tötungsdelikte, für Mord und Totschlag, zuständig. Er erzählte uns Fälle, die wir als Kinder verstanden haben. Sie begannen immer damit, dass er sagte: »Die meisten Dinge sind kompliziert, und mit der Schuld ist es so eine Sache.«
Er hatte recht. Wir laufen den Dingen hinterher, sie sind schneller als wir, und am Ende können wir sie nicht erreichen. Ich erzähle von Mördern, Drogendealern, Bankräubern und Prostituierten. Sie haben ihre Geschichte, und sie unterscheiden sich nicht sehr von uns. Wir tanzen unser Leben lang auf einer dünnen Schicht aus Eis, darunter ist es kalt, und man stirbt schnell. Manche trägt das Eis nicht, und sie brechen ein. Das ist der Moment, der mich interessiert. Wenn wir Glück haben, passiert es nicht, und wir tanzen weiter. Wenn wir Glück haben.
Mein Onkel, der Richter, war im Krieg bei der Marine, sein linker Arm und seine rechte Hand wurden von einer Granate abgerissen. Er hat trotzdem lange nicht aufgegeben. Man sagt, er sei ein guter Richter gewesen, menschlich, ein aufrechter, gerechter Mann. Er ging gerne auf die Jagd, er hatte ein kleines Revier. Eines Morgens ging er in den Wald, er nahm den Doppellauf seiner Schrotflinte in den Mund und drückte mit dem Stumpf seines rechten Armes ab. Er trug einen schwarzen Rollkragenpulli, sein Jackett hatte er über einen Zweig gehängt. Sein Kopf zerplatzte. Viel später habe ich die Bilder gesehen. Er hinterließ einen kurzen Brief an seinen besten Freund, er schrieb, dass er einfach genug habe. Der Brief begann mit den Worten: »Die meisten Dinge sind kompliziert, und mit der Schuld ist es so eine Sache.« Er fehlt mir immer noch. Jeden Tag.
Von solchen Menschen und ihren Geschichten handelt das Buch.
Fähner
Friedhelm Fähner war sein Leben lang praktischer Arzt in Rottweil gewesen, 2800 Krankenscheine pro Jahr, Praxis an der Hauptstraße, Vorsitzender des Kulturkreises Ägypten, Mitglied im Lions Club, keine Straftaten, nicht einmal Ordnungswidrigkeiten. Neben seinem Haus besaß er zwei Mietshäuser, einen drei Jahre alten Mercedes E-Klasse mit Lederausstattung und Klimaautomatik, etwa 750000 Euro in Aktien und Obligationen und eine Kapitallebensversicherung. Fähner hatte keine Kinder. Seine einzige noch lebende Verwandte war seine sechs Jahre jüngere Schwester, die mit ihrem Mann und zwei Kindern in Stuttgart lebte. Über Fähners Leben hätte es eigentlich nichts zu erzählen gegeben.
Bis auf die Sache mit Ingrid.
Mit 24 Jahren hatte Fähner Ingrid auf dem sechzigsten Geburtstag seines Vaters kennengelernt. Auch sein Vater war Arzt in Rottweil gewesen.
Rottweil ist eine durch und durch bürgerliche Stadt. Jedem Fremden wird ungefragt erklärt, die Stadt sei von den Staufern gegründet und die älteste in Baden-Württemberg. Tatsächlich trifft man hier auf mittelalterliche Erker und hübsche Stechschilder aus dem 16. Jahrhundert. Die Fähners waren schon immer hier. Sie gehörten zu den sogenannten ersten Familien der Stadt, waren anerkannte Ärzte, Richter und Apotheker.
Friedhelm Fähner ähnelte dem jungen John F. Kennedy. Er hatte ein freundliches Gesicht, man hielt ihn für einen sorglosen Menschen, die Dinge glückten ihm. Nur wenn man genauer hinsah, fiel etwas Trauriges, etwas Altes und Dunkles in seinen Zügen auf, wie man es nicht selten in dieser Gegend zwischen Schwarzwald und schwäbischer Alb sieht.
Ingrids Eltern, Apotheker in Rottweil, brachten ihre Tochter zu der Feier mit. Sie war drei Jahre älter als Fähner, eine handfeste Provinzschönheit mit schweren Brüsten. Wasserblaue Augen, schwarze Haare, blasse Haut – sie war sich ihrer Wirkung bewusst. Die seltsam hohe, metallische Stimme, die keinerlei Modulation zuließ, irritierte Fähner. Nur wenn sie leise sprach, hatten ihre Sätze eine Melodie.
Sie hatte die Realschule nicht abgeschlossen und arbeitete als Kellnerin. »Vorübergehend«, sagte sie zu Fähner. Ihm war das gleichgültig. Sie war ihm auf einem anderen Gebiet, das ihn mehr interessierte, weit voraus. Fähner hatte bis dahin nur zwei kurze sexuelle Kontakte mit Frauen gehabt; sie hatten ihn eher verunsichert. Er verliebte sich sofort in Ingrid.
Zwei Tage nach der Feier verführte sie ihn nach einem Picknick. Sie lagen in einer Wetterhütte, und Ingrid machte ihre Sache gut. Fähner war so durcheinander, dass er sie schon eine Woche später bat, ihn zu heiraten. Ohne zu zögern, nahm sie an: Fähner war eine sogenannte gute Partie, er studierte Medizin in München, er war attraktiv und liebevoll, und er stand kurz vor dem ersten Examen. Vor allem aber zog seine Ernsthaftigkeit sie an. Sie konnte das nicht formulieren, aber sie sagte ihrer Freundin, Fähner werde sie nie sitzen lassen. Vier Monate später wohnte sie bei ihm.
Die Hochzeitsreise ging nach Kairo, es war sein Wunsch. Wenn man ihn später nach Ägypten fragte, sagte er, es sei »schwerelos«, auch wenn er wusste, dass ihn niemand verstand. Er war dort der junge Parsifal, der reine Tor, und er war glücklich. Es war das letzte Mal in seinem Leben.
Am Abend vor der Rückreise lagen sie im Hotelzimmer. Die Fenster waren geöffnet, es war immer noch zu heiß, die Luft staute sich in dem kleinen Zimmer. Es war ein billiges Hotel, es roch nach faulem Obst, und von unten hörten sie den Straßenlärm.
Trotz der Hitze hatten sie miteinander geschlafen. Fähner lag auf dem Rücken und verfolgte die Drehungen des Deckenventilators, Ingrid rauchte eine Zigarette. Sie drehte sich zur Seite, stützte ihren Kopf auf eine Hand und sah ihn an. Er lächelte. Sie schwiegen lange.
Dann begann sie zu erzählen. Sie erzählte von den Männern vor Fähner, von Enttäuschungen und Fehlern, aber vor allem von dem französischen Oberleutnant, der sie geschwängert hatte, und von der Abtreibung, die sie fast getötet hätte. Sie weinte. Er erschrak und nahm sie in die Arme. Auf seiner Brust spürte er ihren Herzschlag, er war hilflos. Sie ist mir anvertraut, dachte er.
»Du musst mir schwören, dass du auf mich aufpasst. Du darfst mich nie verlassen.« Ingrids Stimme zitterte.
Es rührte ihn, er wollte sie beruhigen, er habe das doch schon in der Kirche bei der Hochzeit geschworen, er sei glücklich mit ihr, er wolle …
Sie unterbrach ihn hart, ihre Stimme wurde lauter, sie hatte jetzt den metallisch-farblosen Klang. »Schwöre es!«
Und plötzlich verstand er. Das war kein Gespräch unter Liebenden, der Ventilator, Kairo, die Pyramiden, die Hitze des Hotelzimmers – alle Klischees verschwanden schlagartig. Er schob sie ein Stück von sich, um ihr in die Augen sehen zu können. Dann sagte er es. Er sagte es langsam, und er wusste, was er sagte. »Ich schwöre es.«
Er zog sie wieder zu sich und küsste ihr Gesicht. Sie schliefen noch einmal miteinander. Diesmal war es anders. Sie saß auf ihm, sie nahm sich, was sie wollte. Sie waren ernst, fremd und einsam. Als sie kam, schlug sie ihm ins Gesicht. Später lag er noch lange wach und starrte an die Decke. Der Strom war ausgefallen, der Ventilator bewegte sich nicht mehr.
Natürlich bestand Fähner sein Examen mit Auszeichnungen, legte seine Promotion ab und bekam eine erste Stelle im Kreiskrankenhaus Rottweil. Sie fanden eine Wohnung, drei Zimmer, Bad, Blick auf den Waldrand.
Als der Hausrat in München eingepackt wurde, warf sie seine Plattensammlung weg. Er bemerkte es erst beim Einzug in die neue Wohnung. Sie sagte, sie könne die Platten nicht ausstehen, er habe sie mit anderen Frauen gehört. Fähner war wütend. Sie sprachen zwei Tage fast nicht miteinander.
Fähner mochte die Klarheit des Bauhauses – sie richtete die Wohnung in Eiche und Kiefer ein, hängte Gardinen vor die Fenster und kaufte bunte Bettwäsche. Selbst die gestickten Untersetzer und die Zinnbecher nahm er hin, er wollte sie nicht bevormunden.
Einige Wochen später erklärte Ingrid, es störe sie, wie er sein Besteck halte. Anfangs lachte er und meinte, sie sei kindisch. Sie wiederholte den Vorwurf am nächsten Tag und die Tage darauf. Und weil sie es ernst nahm, hielt er das Messer anders.
Ingrid beschwerte sich, dass er den Müll nicht runterbringe. Er redete sich ein, dass das nur Anfangsschwierigkeiten seien. Bald darauf warf sie ihm vor, dass er zu spät nach Hause komme, er habe mit anderen Frauen geflirtet.
Die Vorwürfe rissen nicht ab, bald hörte er sie täglich. Er sei unordentlich, er verschmutze seine Hemden, er zerknittere die Zeitung, er rieche schlecht, er denke nur an sich, er rede Unsinn, er betrüge sie. Fähner verteidigte sich kaum noch.
Nach einigen Jahren begannen die Beschimpfungen. Zuerst verhalten, dann immer massiver. Er sei ein Schwein, er quäle sie, er sei ein Schwachkopf. Dann kamen die Fäkalsprache und das Anschreien. Er gab auf. Nachts stand er auf und las Science-Fiction-Romane. Wie zu seinen Studentenzeiten joggte er täglich eine Stunde. Sie schliefen schon lange nicht mehr miteinander. Er bekam Angebote von anderen Frauen, aber er hatte keine Affären. Mit 35 übernahm er die Praxis seines Vaters, mit 40 war er ergraut. Fähner war müde.
Als Fähner 48 war, starb sein Vater; als er 50 war, seine Mutter. Von dem Erbe kaufte er ein Fachwerkhaus am Stadtrand. Zu dem Haus gehörten ein kleiner Park, verwahrloste Stauden, 40 Apfelbäume, zwölf Kastanien, ein Teich. Der Garten wurde Fähners Rettung. Er ließ sich Bücher kommen, abonnierte Fachzeitschriften und las alles, was es über Stauden, Teiche und Bäume zu lesen gab. Er kaufte die besten Geräte, beschäftigte sich mit Bewässerungstechnik und lernte alles mit der ihm eigenen systematischen Gründlichkeit. Der Garten erblühte, und die Stauden wurden in der Umgebung so bekannt, dass Fähner Fremde zwischen den Apfelbäumen sah, die dort fotografierten.
Unter der Woche blieb er lange in der Praxis. Als Arzt war Fähner gründlich und mitfühlend. Seine Patienten schätzten ihn, seine Diagnosen waren Maßstab in Rottweil. Er verließ das Haus, bevor Ingrid aufwachte, und kehrte erst nach neun zurück. Die Abendessen voller Vorwürfe nahm er schweigend hin. Die metallische Stimme Ingrids reihte modulationslos Satz um Satz Anfeindungen aneinander. Sie war fett geworden, ihre blasse Haut hatte sich mit den Jahren rosa gefärbt. Ihr wulstiger Hals war nicht mehr fest, vor ihrer Kehle hatte sich ein Hautlappen gebildet, der im Takt ihrer Beschimpfungen hin und her waberte. Sie litt unter Atemnot und Bluthochdruck. Fähner wurde immer dünner. Als er eines Abends mit vielen Worten vorschlug, Ingrid möge Hilfe bei einem befreundeten Nervenarzt suchen, warf sie eine Pfanne nach ihm und brüllte, er sei eine undankbare Sau.
In der Nacht vor seinem 60. Geburtstag lag Fähner wach. Er hatte das ausgeblichene Ägyptenfoto hervorgeholt: Ingrid und er vor der Cheopspyramide, im Hintergrund Kamele, Touristenbeduinen und Sand. Als sie die Hochzeitsalben weggeschmissen hatte, hatte er das Bild wieder aus dem Mülleimer gezogen. Seitdem verwahrte er es tief unten in seinem Schrank.
In dieser Nacht begriff Fähner, dass er immer weiter, bis zum Ende seines Lebens, ein Gefangener bleiben würde. Er hatte sein Versprechen in Kairo gegeben. Er musste es gerade jetzt, in den schlechten Tagen, halten; ein Versprechen nur für gute Tage gab es nicht. Das Bild verschwamm vor seinen Augen. Er zog sich aus und stellte sich nackt vor den Spiegel im Badezimmer. Er sah sich lange an. Dann setzte er sich auf den Rand der Badewanne. Zum ersten Mal in seinem Erwachsenenleben weinte er.
Fähner arbeitete in seinem Garten. Er war jetzt 72, vor vier Jahren hatte er die Praxis verkauft. Wie immer war er um sechs Uhr aufgestanden. Er hatte das Gästezimmer – er wohnte schon seit Jahren dort – leise verlassen. Ingrid schlief noch. Es war ein leuchtender Septembervormittag. Der Frühnebel hatte sich zurückgezogen, die Luft war klar und kalt. Fähner jätete mit der Hacke das Unkraut zwischen den Herbststauden. Es war eine anstrengende und eintönige Arbeit. Fähner war zufrieden. Er freute sich auf den Kaffee, den er wie immer in seiner Pause um halb zehn trinken würde. Fähner dachte an den Rittersporn, den er im Frühjahr gepflanzt hatte. Er würde im Spätherbst ein drittes Mal blühen.
Plötzlich riss Ingrid die Terrassentür auf. Sie brüllte, er habe schon wieder vergessen, das Fenster im Gästezimmer zu schließen, er sei einfach nur ein Idiot. Ihre Stimme überschlug sich. Blankes Metall.
Fähner würde später nicht genau beschreiben können, was er in diesem Moment dachte. Es habe in ihm, ganz tief unten, hart und scharf zu leuchten begonnen. Alles sei überdeutlich in diesem Licht gewesen. Gleißend.
Er bat Ingrid, in den Keller zu kommen, und nahm selbst die Außentreppe. Ingrid betrat schnaufend den Kellerraum, in dem er die Gartengeräte aufbewahrte. Sie hingen geordnet nach Funktion und Größe an den Wänden oder standen gereinigt in Blech- und Plastikeimern. Es waren schöne Geräte, die er in den vergangenen Jahren zusammengetragen hatte. Ingrid kam selten hierher. Als sie die Tür öffnete, nahm Fähner wortlos die Baumaxt von der Wand. Sie stammte aus Schweden, handgeschmiedet, sie war eingefettet und ohne Rost. Ingrid verstummte. Er trug noch die groben Gartenhandschuhe. Ingrid starrte auf die Axt. Sie wich nicht aus. Bereits der erste Schlag, der ihre Schädeldecke spaltete, war tödlich. Die Axt drang mit abgesplitterten Knochenstücken weiter bis in das Gehirn, die Schneide teilte ihr Gesicht. Noch bevor sie zu Boden fiel, war sie tot. Fähner hatte Mühe, die Axt aus ihrem Schädel zu hebeln, er stellte seinen Fuß auf ihren Hals. Mit zwei wuchtigen Hieben trennte er den Kopf vom Rumpf. Der Gerichtsmediziner verzeichnete später siebzehn weitere Schläge, die Fähner benötigte, um Arme und Beine abzutrennen.
Fähner atmete schwer. Er setzte sich auf den kleinen Holzschemel, den er sonst beim Pflanzen benutzte. Die Beine des Hockers standen im Blut. Fähner bekam Hunger. Irgendwann stand er auf, zog sich neben der Leiche aus und wusch sich am Gartenwaschbecken im Keller das Blut aus den Haaren und vom Gesicht. Er schloss den Keller ab und ging über die Innentreppe in die Wohnung. Oben kleidete er sich wieder an, wählte den Polizeinotruf, nannte seinen Namen und die Anschrift und sagte wörtlich: »Ich habe Ingrid klein gemacht. Kommen Sie sofort.« Der Anruf wurde aufgezeichnet. Ohne eine Antwort abzuwarten, legte er auf. Seine Stimme war nicht erregt.
Die Polizisten trafen ohne Sirene und Blaulicht ein paar Minuten nach dem Anruf vor Fähners Haus ein. Einer der Beamten war seit 29 Jahren im Polizeidienst, alle in seiner Familie waren bei Fähner Patienten gewesen. Fähner stand vor dem Gartentor und gab ihm die Schlüssel. Er sagte, sie sei im Keller. Der Polizist wusste, dass es besser war, keine Fragen zu stellen: Fähner trug einen Anzug, aber weder Schuhe noch Strümpfe. Er war sehr ruhig.
Der Prozess dauerte vier Tage. Der Vorsitzende der Schwurgerichtskammer war ein erfahrener Mann. Er kannte Fähner, über den er zu richten hatte. Und er kannte Ingrid. Falls er sie nicht genügend gekannt hatte, gaben die Zeugen Auskunft. Jeder bedauerte Fähner, jeder ergriff für ihn Partei. Der Postbote sagte, er habe Fähner ›für einen Heiligen‹ gehalten, ›wie er es mit der ausgehalten‹ habe, sei ›ein Wunder‹. Der Psychiater bescheinigte Fähner einen ›Affektstau‹, schuldunfähig sei er nicht gewesen.
Der Staatsanwalt beantragte acht Jahre. Er ließ sich Zeit, er schilderte den Tatablauf und watete durch das Blut im Keller. Dann sagte er, Fähner habe Alternativen gehabt, er hätte sich scheiden lassen können.
Der Staatsanwalt irrte, genau das hätte Fähner nicht gekonnt. Die letzte Reform der Strafprozessordnung hat den Eid als obligatorische Beteuerung einer Aussage im Strafprozess abgeschafft. Wir glauben schon lange nicht mehr daran. Wenn ein Zeuge lügt, lügt er eben – kein Richter denkt ernsthaft, das würde sich durch einen Eid ändern lassen. Dem modernen Mensch scheint der Schwur gleichgültig zu sein. Aber, und in diesem ›aber‹ liegt eine Welt, Fähner war kein moderner Mensch. Sein Versprechen war ernsthaft. Es hatte ihn sein ganzes Leben gebunden, mehr noch: Er wurde zum Gefangenen. Fähner konnte sich nicht befreien, das wäre Verrat gewesen. Die Gewalteruption war das Bersten des Druckbehälters, in den er lebenslang durch seinen Eid eingesperrt war.
Fähners Schwester, die mich um die Verteidigung ihres Bruders gebeten hatte, saß im Zuschauerraum. Sie weinte. Seine alte Praxisschwester hielt ihre Hand. Fähner war im Gefängnis noch dünner geworden. Er saß regungslos auf der Anklagebank aus dunklem Holz.
In der Sache gab es nichts zu verteidigen. Es war ein rechtsphilosophisches Problem: Was ist der Sinn von Strafe? Weshalb strafen wir? Im Plädoyer versuchte ich den Grund zu finden. Es gibt eine Fülle von Theorien. Strafe soll uns abschrecken, Strafe soll uns schützen, Strafe soll den Täter davon abhalten, nochmals eine Tat zu begehen, Strafe soll Unrecht aufwiegen. Unser Gesetz vereinigt diese Theorien, aber keine passte hier richtig. Fähner würde nicht erneut töten. Das Unrecht der Tat war offensichtlich, aber es war schwer zu wiegen. Und wer wollte Vergeltung üben? Es wurde ein langes Plädoyer. Ich erzählte seine Geschichte. Ich wollte, dass man verstand, dass Fähner am Ende angekommen war. Ich sprach, bis ich glaubte, das Gericht erreicht zu haben. Als ein Schöffe nickte, setzte ich mich wieder.
Fähner hatte das letzte Wort. Das Gericht hört am Ende eines Prozesses den Angeklagten, die Richter sollen seine Worte in die Beratung mitnehmen. Er verneigte sich, die Hände hatte er ineinandergelegt. Er hatte die Sätze nicht auswendig lernen müssen, es war die Zusammenfassung seines Lebens:
»Ich habe meine Frau geliebt, und am Ende habe ich sie getötet. Ich liebe sie immer noch, ich habe es ihr versprochen, sie ist immer noch meine Frau. Das wird sich bis zu meinem Tod nicht ändern. Ich habe mein Versprechen gebrochen. Ich muss mit meiner Schuld leben.«
Fähner setzte sich, verstummte und starrte wieder auf den Boden. Es war still im Saal, selbst der Vorsitzende wirkte beklommen. Dann erklärte er, dass sich das Gericht zur Beratung zurückziehe, das Urteil werde am nächsten Tag verkündet.
An diesem Abend besuchte ich Fähner noch einmal im Gefängnis. Es gab nicht mehr viel zu sagen. Er hatte einen zerknitterten Umschlag mitgebracht, aus dem er das Bild der Hochzeitsreise zog. Er strich mit dem Daumen über Ingrids Gesicht. Die obere Schutzschicht hatte sich längst von dem Foto gelöst, ihr Gesicht war fast weiß.
Fähner wurde zu drei Jahren verurteilt, der Haftbefehl wurde aufgehoben, und er wurde aus der Untersuchungshaft entlassen. Er konnte die Strafe im offenen Vollzug verbüßen. Offener Vollzug bedeutet, dass der Verurteilte in der Haftanstalt übernachten muss und sich tagsüber in Freiheit aufhalten darf. Voraussetzung ist, dass er einem Beruf nachgeht. Es war nicht einfach, einen neuen Beruf für einen 72-Jährigen zu finden. Schließlich fand seine Schwester die Lösung: Fähner meldete ein Gewerbe zum Obsthandel an – er verkaufte die Äpfel aus seinem Garten.
Vier Monate später traf in meiner Kanzlei eine Kiste mit zehn roten Äpfeln ein. In dem beigelegten Umschlag befand sich ein einzelnes Blatt Papier:
»In diesem Jahr sind die Äpfel gut. Fähner«
Tanatas Teeschale
Sie waren auf einer dieser öffentlichen Studentenpartys in Berlin. Dort gab es immer ein paar Mädchen, die auf Jungs aus Kreuzberg und Neukölln standen, einfach nur, weil sie anders waren. Vielleicht zog sie es an, in ihnen das Verletzliche zu suchen. Auch diesmal schien Samir Glück zu haben: Sie hatte blaue Augen und lachte viel.
Plötzlich tauchte ihr Freund auf, Samir solle verschwinden, oder man würde das auf der Straße austragen. Samir verstand nicht, was »austragen« hieß, aber er verstand die Aggression. Sie wurden nach draußen gedrängt. Ein älterer Student sagte zu Samir, der andere sei Amateurboxer und Meister der Uni. Samir sagte: »Mir scheißegal.« Er war erst 17, aber er hatte über 150 Straßenkämpfe hinter sich, und es gab nur wenige Dinge, vor denen er Angst hatte – Schlägereien gehörten nicht dazu.
Der Boxer war muskulös, einen Kopf größer und ein ganzes Stück breiter als Samir. Und er grinste blöde. Um die beiden bildete sich ein Kreis, und während der Boxer sich noch die Jacke auszog, trat Samir mit der Schuhspitze in seine Hoden. Die Schuhe hatten auf der Innenseite Stahlkappen, der Boxer gurgelte und wollte sich vor Schmerz zusammenkrümmen. Samir packte seinen Kopf an den Haaren, riss ihn runter und rammte ihm gleichzeitig das rechte Knie ins Gesicht. Obwohl es ziemlich laut auf der Straße war, konnte man hören, wie der Kiefer des Boxers knackte. Er lag blutend auf dem Asphalt, eine Hand vor dem Schoß, die andere vor dem Gesicht. Samir nahm zwei Schritte Anlauf; der Tritt brach dem Boxer zwei Rippen.
Samir fand, er habe sich fair verhalten. Er hatte nicht in das Gesicht getreten, und vor allem: Er hatte das Messer nicht benutzt. Es war einfach gewesen, er war kaum außer Atem. Er ärgerte sich, weil die Blonde nicht mit ihm abhaute, sondern heulte und sich um den Mann am Boden kümmerte. »Scheiß Schlampe«, sagte er und ging nach Hause.
Der Jugendrichter verurteilte Samir zu zwei Wochen Dauerarrest und zur Teilnahme an einem Antigewaltseminar. Samir war wütend. Er versuchte den Sozialarbeitern in der Jugendstrafanstalt zu erklären, dass das Urteil falsch sei. Der Boxer habe angefangen, er sei nur schneller gewesen. So etwas sei kein Spiel, man könne Fußball spielen, aber Boxen spiele niemand. Der Richter habe die Regeln nicht kapiert.
Özcan holte Samir nach den zwei Wochen vom Gefängnis ab. Özcan war Samirs bester Freund. Er war 18 Jahre alt, ein großer und langsamer Junge mit teigigem Gesicht. Er hatte schon mit zwölf eine Freundin gehabt und die Aktivitäten mit ihr mit dem Handy gefilmt. Das hatte ihm für alle Zeiten seinen Platz gesichert. Özcan hatte einen absurd großen Penis, und er stellte sich in den Pissoirs immer so hin, dass die anderen ihn sehen konnten. Er wollte unbedingt nach New York. Er war noch nie dort gewesen, er sprach kein Englisch, aber er war besessen von der Stadt. Man sah ihn nie ohne seine dunkelblaue Kappe mit der Aufschrift »N.Y.«. Er wollte in Manhattan einen Nachtclub mit Restaurant und Go-go-Tänzerinnen betreiben. Oder so etwas Ähnliches. Er konnte nicht erklären, wieso es ausgerechnet New York sein sollte, aber er dachte auch nicht darüber nach. Sein Vater hatte sein Leben lang in einer Glühbirnenfabrik gearbeitet, er war aus der Türkei nur mit einem Koffer eingewandert. Sein Sohn war seine Hoffnung. Die New-York-Sache verstand er nicht.
Özcan sagte zu Samir, er habe jemanden kennengelernt, der einen Plan habe. Er heiße Manólis, der Plan sei gut, aber Manólis »nicht ganz dicht«.
Manólis stammte aus einer griechischen Familie, die eine Reihe von Restaurants und Internetcafés in Kreuzberg und Neukölln betrieb. Er hatte Abitur gemacht, angefangen, Geschichte zu studieren, und sich nebenbei im Drogenhandel versucht. Vor ein paar Jahren war etwas schiefgelaufen. In dem Koffer waren anstelle von Kokain nur Papier und Sand gewesen. Der Käufer schoss auf Manólis, als er mit Wagen und Geld fliehen wollte. Der Käufer war kein guter Schütze, von den neun Kugeln traf nur eine. Sie drang in Manólis’ Hinterkopf ein und blieb dort stecken. Manólis hatte das Projektil noch im Kopf, als er mit einem Funkstreifenwagen zusammenstieß. Erst im Krankenhaus entdeckten die Ärzte es, und seitdem hatte Manólis ein Problem. Nach der Operation verkündete er seiner Familie, dass er ab jetzt Finne sei, feierte jedes Jahr den 6. Dezember als finnischen Nationalfeiertag und versuchte erfolglos, die Sprache zu lernen. Außerdem hatte er immer wieder Ausfälle, und vielleicht war deshalb sein Plan auch kein wirklich vollständiger Plan.
Aber Samir fand, dass es immerhin so eine Art Plan war: Manólis’ Schwester hatte eine Freundin, die als Putzfrau in einer Villa in Dahlem arbeitete. Sie brauchte dringend Geld, also hatte sie Manólis gegen eine kleine Beteiligung vorgeschlagen, in das Haus einzubrechen. Sie kannte den Code der Alarmanlage und den des elektronischen Schlosses, sie wusste den Ort des Tresors und vor allem, dass der Besitzer bald für vier Tage außerhalb Berlins sein würde. Samir und Özcan waren sofort einverstanden.
In der Nacht vor der Tat schlief Samir schlecht, er träumte von Manólis und von Finnland. Als er erwachte, war es zwei Uhr mittags. Er sagte »Scheiß Richter« und scheuchte seine Freundin aus dem Bett. Um vier Uhr musste er beim Anti-gewaltseminar sein.
Gegen zwei Uhr nachts holte Özcan die anderen ab. Manólis war eingeschlafen, Samir und Özcan mussten zwanzig Minuten vor der Tür warten. Es war kalt, die Scheiben beschlugen, sie verfuhren sich und schrien sich gegenseitig an. Kurz vor drei Uhr trafen sie in Dahlem ein. Im Auto zogen sie die schwarzen Wollmasken an, sie waren zu groß, verrutschten und kratzten, sie schwitzten darunter. Özcan hatte ein Wollknäuel im Mund, er spuckte es auf das Armaturenbrett. Sie streiften sich Plastikhandschuhe über und liefen über den Kiesweg zum Eingang der Villa.
Manólis tippte den Code in die Tastatur des Schlosses. Die Tür öffnete sich mit einem Klicken. Im Eingang befand sich die Alarmanlage. Nachdem Manólis auch dort eine Zahlenkombination eingegeben hatte, wechselten die Lämpchen ihre Farbe von Rot auf Grün. Özcan musste lachen. »Özcans Eleven«, sagte er laut, er liebte Kinofilme. Die Anspannung löste sich. So leicht war es noch nie gewesen. Die Eingangstür fiel ins Schloss, sie standen im Dunkeln.
Sie fanden den Lichtschalter nicht. Samir fiel über eine Stufe und schlug sich die linke Augenbraue an einem Garderobenständer auf. Özcan stolperte über Samirs Füße und stützte sich im Fallen auf seinen Rücken. Samir ächzte unter seinem Gewicht. Manólis stand noch, er hatte die Taschenlampen vergessen.
Ihre Augen gewöhnten sich an die Dunkelheit. Samir wischte sich das Blut aus dem Gesicht. Endlich fand Manólis den Lichtschalter. Das Haus war japanisch eingerichtet – Samir und Özcan waren davon überzeugt, dass niemand so wohnen könne. Sie brauchten nur ein paar Minuten, um den