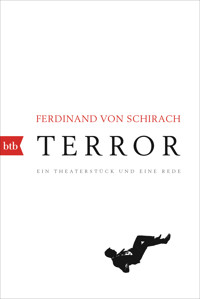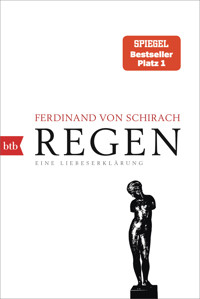11,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Luchterhand Literaturverlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Nummer 1-SPIEGEL-Bestseller. - Eines der persönlichsten Bücher des internationalen Bestsellerautors.
Ferdinand von Schirach erzählt von milden Frühsommermorgen, verregneten Nachmittagen und schwarzen Nächten. Seine Geschichten spielen in Berlin, Pamplona, Oslo, Tokio, Zürich, New York, Marrakesch, Taipeh und Wien. Es sind kurze Geschichten über die Dinge, die unser Leben verändern, über Zufälle, falsche Entscheidungen und die Flüchtigkeit des Glücks. Schirach erzählt von der Einsamkeit der Menschen, von der Kunst, der Literatur, dem Film und immer auch von der Liebe.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 158
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Buch
Wie schon Ferdinand von Schirachs Erzählband Kaffee und Zigaretten verwebt auch sein neues Buch autobiografische Erzählungen, Aperçus, Notizen und Beobachtung zu einem erzählerischen Ganzen, in dem sich Privates und Allgemeines berühren und wechselseitig spiegeln. Seine Geschichten spielen in Berlin, Pamplona, Oslo, Tokio, Zürich, New York, Marrakesch, Taipeh und Wien. Sie erzählen vom Reisen, von milden Frühsommermorgen, verregneten Nachmittagen und schwarzen Nächten. Es sind kurze Geschichten über die Dinge, die unser Leben verändern, über Zufälle, falsche Entscheidungen und die Flüchtigkeit des Glücks. Schirach erzählt von der Einsamkeit der Menschen, von der Kunst, der Literatur, dem Film und immer auch von der Liebe.
Autor
Der SPIEGEL nannte Ferdinand von Schirach einen »großartigen Erzähler«, die New York Times einen »außergewöhnlichen Stilisten«, der Independent verglich ihn mit Kafka und Kleist, der Daily Telegraph schrieb, er sei »eine der markantesten Stimmen der europäischen Literatur«. Seine Erzählungsbände und Romane wurden vielfach verfilmt und zu millionenfach verkauften internationalen Bestsellern. Sie erschienen in mehr als vierzig Ländern. Die Theaterstücke Terror und Gott zählen zu den erfolgreichsten Dramen unserer Zeit, und Essaybände wie Die Würde des Menschen ist antastbar sowie die Gespräche mit Alexander Kluge Die Herzlichkeit der Vernunft und Trotzdem standen monatelang auf den deutschen Bestsellerlisten.
Ferdinand von Schirach wurde vielfach mit Literaturpreisen ausgezeichnet. Er lebt in Berlin.
Zuletzt erschienen von ihm u. a. der Essayband Jeder Mensch sowie die Erzählsammlung Kaffee und Zigaretten.
Ferdinand von Schirach
NACHMITTAGE
Luchterhand
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.Der Verlag behält sich die Verwertung der urheberrechtlich geschützten Inhalte dieses Werkes für Zwecke des Text- und Data-Minings nach § 44 b UrhG ausdrücklich vor. Jegliche unbefugte Nutzung ist hiermit ausgeschlossen.Quellennachweise:Kapitel 1: F. Scott Fitzgerald, Der große Gatsby. Aus dem Amerikanischen von Bettina Abarbanell. Copyright der deutschsprachigen Übersetzung © 2006, 2007 Diogenes Verlag AG, ZürichKapitel 22: Knut Hamsun, Hunger. In der Übersetzung von Siegfried Weibel © 2017 Ullstein Buchverlage GmbH, Berlin. Kapitel 25: Giuseppe Tomasi di Lampedusa, Der Leopard. Copyright © Giangiacomo Feltrinelli Editore, Milano, 1969, 2002. All rights reserved. First published by Giangiacomo Feltrinelli Editore in 1968, used by permission of The Wylie Agency (UK) Limited. Deutsch von Burkhart Kroeber. © der dt. Übersetzung 2019 Piper Verlag, MünchenDer Abdruck der Zitate erfolgt mit freundlicher Genehmigung der jeweiligen Verlage.
Originalveröffentlichung August 2022
Luchterhand Literaturverlag, München,
in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH,
Neumarkter Straße 28, 81673 München
Copyright © 2022 Ferdinand von Schirach
Covergestaltung buxdesign | Ruth Botzenhardt
unter der Verwendung eines Motivs von © plainpicture/AWL/Peter Adams
Autorenfoto: © Michael Mann
Satz: Uhl + Massopust, Aalen
Alle Rechte vorbehalten.
ISBN 978-3-641-29881-4V008www.schirach.de
www.luchterhand-literaturverlag.de
www.facebook.com/luchterhandverlag
www.twitter.com/luchterhandlit
Der Mensch soll um der Güte und Liebe willen dem Tode keine Herrschaft einräumen über seine Gedanken.
Thomas Mann, Der Zauberberg
Eins
Es ist der letzte Tag in Taipeh. Ich gehe die Treppen hoch in das Café im ersten Stock des ASW Tea House, ein heller Raum mit großen Fenstern, in den Regalen Bücher und Teedosen. Ich sehe die Journalistin nicht gleich, sie winkt mir zu. Sie hat Tee und Sandwiches bestellt.
Die Journalistin sagt, sie habe drei Jahre in Heidelberg studiert, es sei eine schöne Zeit gewesen, dort habe sie ihren Mann kennengelernt. Sie stellt kluge Fragen, aber ich bin unkonzentriert, es waren zu viele Lesungen, zu viele Vorträge, Empfänge und Interviews in den letzten Tagen. Die Luft ist feucht, und die Kleidung klebt am Körper. Ich entschuldige mich, ich sei einfach nur schrecklich müde. Die Journalistin sieht mich an, dann steckt sie ihren Block in die Handtasche und schaltet das Handy aus, mit dem sie das Interview aufgenommen hat. Sie legt ihre Hand auf meinen Unterarm und lächelt.
»Ich werde Ihnen etwas zeigen, wenn Sie möchten«, sagt sie und steht auf. Ich will bezahlen, aber sie lässt es nicht zu.
Auf der Straße geht sie voraus, ich habe Mühe, ihr zwischen den vielen Menschen zu folgen. Unter den Kolonnaden werden getrocknete Früchte, Blüten, Gewürze, Fleisch und Fisch verkauft. Es ist laut und eng und riecht nach gebratenen Garnelen und Tofusuppe. Wir gehen an winzigen Straßencafés vorbei, an Haushaltsgeschäften, an Apotheken mit Kräutern und Wurzeln. Dann bleibt sie stehen. »Das ist der Xiahai-Tempel«, sagt sie, »dieser Gott beschützt unsere Stadt.« Es ist ein schmales Haus, eingeklemmt zwischen zwei Wohnblöcken.
Drinnen ist es noch stickiger und noch heißer, die engen Räume sind voller Menschen, es gibt unzählige Götterstatuen in Seidenkleidern, grimmige Fabelwesen und ein Pferd aus Bronze.
Die Journalistin reicht mir drei Räucherstäbchen, die ich an einer Kerze anzünden soll. Sie verbeugt sich vor dem »Kaiser des Himmels«, danach zeigt sie mir eine kleine Statue. Das hier sei kein Gott, sondern ein Mensch, sagt sie. Er habe unter der japanischen Besatzung die Reichen bestohlen und das Geld den Armen gegeben, ein taiwanesischer Robin Hood. Dann geht sie zu der Statue eines schwarzen kahlköpfigen Mannes mit langem Bart und goldenem Umhang. »Das ist Yue Lao, der Gott der Liebe. Wegen ihm sind alle hier.« Der Gott sieht freundlich aus. Wir verbeugen uns vor ihm. Ich bekomme ein kleines Stück Kuchen und einen Schluck heiligen Tee, und anschließend gibt sie mir einen dünnen roten Faden.
Wir gehen zurück auf die Straße. Ich sage, dass ich nichts verstanden hätte. Sie lacht und erzählt mir die Geschichte von einem jungen Mann vor tausend Jahren, der eine Frau suchte und keine fand. Eines Nachts, als er nicht schlafen konnte und spazieren ging, sah er einen alten Mann, der im Mondlicht in einem Buch las. Neugierig blickte der junge Mann dem Alten über die Schulter, aber er konnte kein einziges Schriftzeichen entziffern. Der Alte sagte, es sei ein Zauberbuch, alle Ehen der Welt seien darin verzeichnet. Der junge Mann glaubte das nicht, aber der Alte zog aus seiner Tasche einen roten Faden. Jeder Mensch, sagte der Alte, sei von seiner Geburt an durch einen solchen Faden mit einem anderen Menschen verbunden, ganz gleich, wie weit die beiden voneinander entfernt lebten. Ihr Schicksal stünde von Anfang an fest. Und alle diese Fäden seien in seinem Buch verzeichnet. Der junge Mann wollte natürlich sofort wissen, wen er heiraten würde. Der Alte lachte und sagte, er würde ihm seine Frau zeigen, wenn er das unbedingt wolle, aber es würde ihm nichts nützen.
Am nächsten Tag gingen die beiden zum Marktplatz der Stadt. »Dort«, sagte der Alte und zeigte auf eine blinde, hässliche und ärmliche Frau, die Gemüse an einem Stand verkaufte. Neben ihr spielte ein zweijähriges Kind im Dreck. »Dieses Kind wird in vierzehn Jahren Deine Frau werden«, sagte der Alte. Der junge Mann war entsetzt. Er war wohlhabend und gebildet, er wollte nicht in ein Armenhaus einheiraten, sondern eine schöne Frau von seinem Stand. Er befahl seinem Diener, das Kind zu töten. Auch vor tausend Jahren war das ein grausamer Befehl. Der Diener zögerte, verletzte das Kind nur an der Stirn, dann ließ er das Messer fallen und rannte weg.
Vierzehn Jahre später gab der Gouverneur der Provinz seine Tochter dem Mann zur Frau. Es wurde eine glückliche Ehe. Die Frau trug immer eine Blume auf der Stirn.
»Sie ahnen es«, sagt die Journalistin, »es war das Kind, das der Diener des Mannes verletzt hatte. Tatsächlich war das Mädchen nicht die Tochter der Gemüseverkäuferin, sondern sie stammte aus einem reichen Haus, ihre Eltern waren gestorben, und die alte Frau war nur ihre Aufpasserin. Der Gouverneur hatte das Mädchen als seine Tochter adoptiert. Der alte Mann unter dem Mond wurde als Gott der Liebe berühmt, und heute bittet jeder Taiwanese ihn um einen Partner.« Sie lacht wieder. »Schreiben Sie darüber«, sagt sie.
Ich bedanke mich für den Nachmittag und für die Geschichte und entschuldige mich noch einmal für meine Müdigkeit. Die Journalistin sagt, es sei nicht schlimm, sie habe genug für einen guten Artikel. Ich solle den roten Faden in meiner Brieftasche verwahren und auf ihn aufpassen, und irgendwann könne ich hierher zurückkehren und dem Liebesgott Yue Lao etwas mitbringen.
Auf dem Weg zum Hotel beginnt es zu regnen, die Straße dampft, der Himmel ist jetzt grün und gelb. Im Hotel packe ich den Koffer, dann gehe ich hinunter und setze mich in die Lobby, um auf den Fahrer zum Flughafen zu warten. Ein amerikanisches Ehepaar streitet am Nachbartisch. Er schreit sie an, dass sie immer alles vergesse und verliere, jetzt habe sie sogar seine Aktentasche im Taxi liegen lassen, aber er sei nicht zum Spaß hier, sondern müsse arbeiten, er könne ihre Dummheit einfach nicht mehr ertragen. Sein Gesicht ist rot, während er schreit, und sie sieht zu Boden und antwortet nicht. Er wird immer wütender und lauter. Ich gehe zu ihnen und frage, wo der Taipeh 101 sei, der berühmte Wolkenkratzer, das Wahrzeichen der Stadt. Der Mann verstummt, er sieht mich verwundert an, dann erklärt er mir den Weg. Ich bestelle Kaffee und Wasser für das Paar und für mich und stelle dem Mann viele Fragen, wie Touristen das tun, bis mein Fahrer kommt.
Im Flugzeug denke ich an die Journalistin und an den wütenden Mann und an das Buch des Liebesgottes, in dem alle roten Fäden verzeichnet sind. Goethe berichtet in den Wahlverwandtschaften, in England sei in sämtliche Tauwerke der königlichen Flotte ein roter Faden eingesponnen, der »durch das Ganze durchgeht, den man nicht herauswinden kann, ohne alles aufzulösen«. Und plötzlich ist alles wieder da, New York ist da, der warme Saal, sie ist da. Es war ein langweiliger Empfang damals gewesen, der Ausklang einer Konferenz für internationales Recht im Plaza am südlichen Central Park. Ich war eingeladen worden, um über Literatur und Recht zu sprechen. Die Veranstalter nennen so etwas »Kulturprogramm«, und natürlich interessiert sich niemand dafür.
Das alte Plaza-Hotel hatte längst seinen Glanz verloren, Donald Trump hatte es einmal gekauft und hier geheiratet, es hatte Indern, Arabern und Chinesen gehört, und alle guten Zimmer mit Blick zum Central Park waren jetzt Eigentumswohnungen. Touristen kamen von der Straße kurz herein, um die Kronleuchter und die Glaskuppel zu fotografieren, und nichts erinnerte mehr daran, dass Alfred Hitchcock in der Bar mit Cary Grant gedreht hatte, dass Truman Capote und Gore Vidal sich hier zum Mittagessen getroffen hatten und dass Scott Fitzgeralds Gatsby in einer der Suiten spielte: »Der Raum war groß und stickig, und obwohl es schon vier Uhr nachmittags war, brachte auch das Öffnen der Fenster nur den heißen Dunst der Sträucher vom Park zu uns herein.« Und weil es zu heiß und zu viel war, stritten sie sich, bis Jay Gatsby zu Tom Buchanan ruhig sagt: »Ihre Frau liebt Sie nicht. Und sie hat Sie auch nie geliebt. Sie liebt mich.« Das stimmte und stimmte auch wieder nicht, die Geliebte ist zu schwach, ihr Mann kann die Zeit nicht anhalten und Gatsby sie nicht zurückdrehen. Das Leben war am Ende nur ein Schwindel, Gatsbys Träume waren untergegangen, »irgendwo in jener unermesslichen Finsternis jenseits der Stadt, wo die dunklen Felder des Landes unter dem Nachthimmel wogten«.
Hier, in diesem Hotel im New York der 20er Jahre, war Scott Fitzgeralds beste Zeit. Später verlor er alles, seine Frau musste in Nervenkliniken, er trank zu viel, wurde depressiv, seine Ehe zerbrach. Elf Jahre vor seinem Tod brachten ihm alle seine Bücher nur noch eine Jahreseinnahme von 31,77 Dollar ein, davon 5,10 Dollar für Der große Gatsby. Fitzgerald starb mit 44 Jahren, erschöpft und gescheitert, seine Frau verbrannte acht Jahre später in einer psychiatrischen Anstalt. Aber damals, als er in New York 23 Jahre alt war und ein strahlendes Genie, hatten seine Geschichten Titel wie: Ein Diamant so groß wie das Ritz. In einem Brief an Fitzgerald schrieb Hemingway einmal, dass man nach Scotts Tod dessen Leber nach Princeton, aber sein Herz hier ins Plaza bringen solle.
Auf dem Empfang in diesem Hotel trug sie ein enges Kleid aus Rohseide, Ocker im sanften Licht des Nachmittags. Sie lachte hell zwischen den Männern, die sie umringten. Noch heute erinnere ich mich an jedes Bild, an ihren Hals mit der dünnen blauen Ader unter der hellen Haut, an den Schimmer ihrer Perlenkette. Sie war Seniorpartnerin in der Kanzlei, die diese Veranstaltung ausgerichtet hatte, und sie hatte mich eingeladen, weil sie meine Bücher mochte. Sie kam an meinen Tisch, und dann sprachen wir den ganzen Nachmittag, als wären wir alleine. Als sie gehen wollte, brachte ich sie zum Ausgang und legte mein Jackett über ihre Schultern, weil sie fror. Draußen war es bereits dunkel geworden, die Lichter der Schaufenster, der Restaurants, der Autos und Straßenlampen. Sie drehte sich um. »Sie machen alles richtig, glaube ich«, sagte sie. Das ist der einzige Satz, an den ich mich noch erinnere.
Viel später, immer wenn wir zusammen geflogen sind, hielt sie meine Hand beim Start und der Landung. Sie sagte nichts dazu, sie legte nur ihre Hand in meine Hand und schloss die Augen. Daran denke ich jetzt auf dem Flug zurück nach Europa.
»Der Mensch soll um der Güte und Liebe willen dem Tode keine Herrschaft einräumen über seine Gedanken.« Das ist der einzige Satz in Thomas Manns Zauberberg, der kursiv gedruckt ist. Der Satz wird nicht begründet, weil es für ihn keine Begründung gibt, so wie es für das Leben und das Weiterleben keine Begründung gibt. Ich sagte mir diesen Satz so viele Jahre vor, bis er nur noch ein Rhythmus war, ein Klang und ein Glaubenssatz. Und jetzt, nach sehr langer Zeit, gibt es manchmal Nachmittage, an denen ich nicht mehr in eine andere Richtung sehe, wenn ich an einem Café vorbeikomme, in dem wir zusammen waren.
Zwei
Isadora Duncan, genannt »Die Duncan«, war eine berühmte Tänzerin. Ihre Kinder und das Kindermädchen ertranken in der Seine in Paris, weil der Chauffeur vergessen hatte, die Handbremse des Wagens anzuziehen.
Später heiratete die Duncan den siebzehn Jahre jüngeren russischen Dichter Sergej Jessenin. Drei Jahre nach der Hochzeit schnitt er sich, inzwischen mit Sofia Tolstaja, der Enkelin Leo Tolstois, verheiratet, im Leningrader Hotel Angleterre mit einer Rasierklinge den Unterarm auf, tunkte die Feder ins Blut, schrieb ein letztes Gedicht und erhängte sich an den Heizungsrohren, die an der Zimmerdecke verliefen.
Zwei Jahre später verfing sich der lange rote Seidenschal der Duncan beim Anfahren in der rechten Hinterfelge des Bugatti, in dem sie saß. Ihr Körper schlug gegen das Wageninnere, Nase, Wirbelsäule und Kehlkopf brachen, die Halsschlagadern zerbarsten, sie starb im Krankenhaus.
Als Gertrude Stein vom Tod der Duncan erfuhr, sagte sie: »Affektiertheit kann gefährlich sein.«
Drei
»Je mehr man über sich selbst und über das, was man will, weiß, desto weniger lässt man an sich ran«, sagt Bill Murray in dem Film Lost in Translation. Es war Sofia Coppolas zweiter Film, Scarlett Johansson war erst siebzehn Jahre alt, und lange war unklar, ob Bill Murray überhaupt am Drehort erscheinen würde. Mit einem brillanten Drehbuch und sehr wenig Geld entstand einer der wunderbarsten Filme, die ich kenne. Murray und Johansson, ein alter Mann und eine junge Frau, sind fremd in Tokio, sie sind einsam und verloren in einer unverständlichen Welt. Alles, was sie tun, kommt ihnen flüchtig, albern und belanglos vor. Jeder andere Regisseur hätte mit den beiden eine Lolita-Story gedreht oder, schlimmer noch, eine bedeutungsschwangere Geschichte über tiefe Innerlichkeit. Aber Sofia Coppolas Film ist das Gegenteil: Die Traurigkeit verschwindet auch in ihm nie ganz, so wie sie im Leben nie ganz verschwindet. Aber hier ist sie leicht und warm, und vor allem ist sie oft unglaublich komisch.
Nach fast zwölf Stunden Flug landete ich abends in Tokio und fuhr mit dem Taxi direkt zum Park Hyatt, dem Hotel, in dem Lost in Translation spielte. Ich hatte das Zimmer gebucht, in dem Bill Murray im Film gewohnt hatte. Wie immer nach einem Flug gegen die Zeit konnte ich nicht schlafen. Ich stellte den Laptop auf das Fensterbrett, schob den Sessel dorthin und sah mir den Film wieder an. Vor dem Fenster blinkten die roten Positionslampen auf den Hochhäusern, und auf dem Computerbildschirm blinkten die gleichen roten Positionslampen. Ich dachte an die Gedichte von Bashô und die Romane von Mishima und an meine früheren Reisen in dieses Land, an das Torii-Tor über dem Meer, an die Burg Ōsaka während der Kirschblüte, an die Gärten von Hiraizumi und das Badehaus des Kaisers – ich hatte das alles gesehen, aber das Land war mir fremd geblieben. Die Schönheit dort ist unmittelbar wie Musik, sie braucht keine Übersetzung. Aber das andere, das Laute, das Moderne und Hektische, hatte ich nie verstanden. Jetzt sah ich Coppolas Film, Johansson liegt in ihrem grauen Pullover auf dem Bett, Murray wird in einer Spielshow von einem Moderator angeschrien, und alles schien mir plötzlich etwas weniger verloren und etwas weniger einsam.
Am nächsten Abend kam ich nach der Theaterpremiere todmüde und gleichzeitig überwach ins Hotel zurück. Ich hatte den ganzen Tag über so viele Interviews gegeben, dass ich am Ende nicht mehr wusste, was ich gesagt hatte, und selbst das war mir gleichgültig. Inzwischen war ich seit 24 Stunden fast durchgehend wach. Ich ging nicht in mein Zimmer, sondern in die Bar des Hotels. Sie liegt im obersten Stockwerk des Hauses, hier kann man ausgezeichnet essen, auch wenn es oft etwas zu laut und zu voll ist. Ich wurde zu einem Tisch vor den riesigen Fenstern gebracht und stapelte die drei Papiertüten mit Stofftieren, die ich dabei hatte, neben mir auf dem Boden. Aus meiner Aktentasche nahm ich die unendlichen Terminpläne, die mein japanischer Verlag mir gegeben hatte, und versuchte das Programm zu verstehen, das ich morgen zu erledigen hatte. Interviews seien für die Literatur hier entscheidend, hatten meine Lektorin und mein Übersetzer gesagt, allein Yomiuri Shimbun habe eine Auflage von fast zehn Millionen Exemplaren täglich, und es sei wichtig, dass dort über meine Bücher berichtet würde.
Eine Kellnerin brachte die Karte, ich bestellte Eiswasser und Kaffee, schloss kurz die Augen und nickte ein.
Ich wachte auf, als der Restaurantleiter vor meinem Tisch stand und leise redete. Er entschuldigte sich immer wieder, niemand wisse, wie dieser Fehler im Buchungssystem geschehen konnte, die ganze Sache sei ihm und dem Hotel und allen Angestellten furchtbar peinlich, er würde mich gerne einladen, er wisse gar nicht, wie er sich sonst entschuldigen könne. Er war zu höflich und zu umständlich, und ich war zu müde, sodass es ziemlich lange dauerte, bis ich begriff, dass mein Tisch zweimal vergeben worden war, dass also noch jemand heute Abend hier sitzen würde. Ich sagte, das wäre nicht schlimm, und tatsächlich war es mir auch gleichgültig. Der Restaurantleiter verbeugte sich, verschwand und kam mit dem angekündigten Gast wieder. Sie war eine elegante Frau, etwa 40 Jahre alt, sie trug ein schlichtes dunkles Kostüm und eine weiße Bluse. Ich stand auf und stellte mich vor. Sie war Amerikanerin, offenbar eine Geschäftsfrau. Wir setzten uns wieder, der Restaurantleiter entschuldigte und verbeugte sich noch ein paar Mal und zog sich dann zurück.
Sie zeigte auf meine offenen Tüten, aus denen die Stofftiere herausquollen.
»Interviews?«, fragte sie.