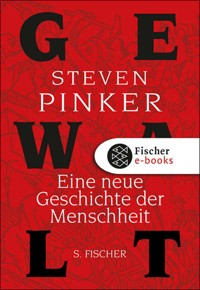14,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER E-Books
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Das faszinierende Porträt unseres Geistes - der Klassiker jetzt auf Deutsch! Wie kommt man direkt an das Denken heran? Über die Sprache. In ihr liegen unsere Vorstellungen von Raum und Zeit begründet, von Sex und Intimität, von Macht und Fairness. Bestsellerautor Steven Pinker sieht sich daher die alltägliche Sprachverwendung genau an – unsere Gespräche, Witze, Rechtsstreitigkeiten – und zeichnet ein lebendiges und überraschendes Porträt unseres Geistes und der menschlichen Natur. Mit viel Esprit, Sprachgefühl und Beispielen aus Alltag und Popkultur gelingt es ihm, schwierige Sachverhalte einfach und überzeugend zu erklären und uns zu einem neuen Blick auf uns selbst zu bewegen. »Klar, geistreich, gut geschrieben.« The New York Review of Books »Ein wichtiges Buch.« Science
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 1046
Veröffentlichungsjahr: 2014
Ähnliche
Steven Pinker
Der Stoff, aus dem das Denken ist
Was die Sprache über unsere Natur verrät
Über dieses Buch
Wie kommt man direkt an das Denken heran? Über die Sprache. In ihr liegen unsere Vorstellungen von Raum und Zeit begründet, von Sex und Intimität, von Macht und Fairness. Bestsellerautor Steven Pinker sieht sich daher die alltägliche Sprachverwendung genau an – unsere Gespräche, Witze, Rechtsstreitigkeiten – und zeichnet ein lebendiges und überraschendes Porträt unseres Geistes und der menschlichen Natur. Mit viel Esprit, Sprachgefühl und Beispielen aus Alltag und Popkultur gelingt es ihm, schwierige Sachverhalte einfach und überzeugend zu erklären und uns zu einem neuen Blick auf uns selbst zu bewegen.
»Klar, geistreich, gut geschrieben.«
The New York Review of Books
»Ein wichtiges Buch.«
Science
Weitere Informationen finden Sie auf www.fischerverlage.de
Biografie
Steven Pinker, geboren 1954, studierte Psychologie in Montreal und an der Harvard University. 20 Jahre lang lehrte er am Department of Brain and Cognitive Science am MIT in Boston und ist seit 2003 Professor für Psychologie an der Harvard University. Seine Forschungen beschäftigen sich mit Sprache und Denken, außerdem schreibt er regelmäßig für die »New York Times«, »Time« und »The New Republic«. Im S. Fischer Verlag ist zuletzt die viel diskutierte Studie ›Gewalt. Eine neue Geschichte der Menschheit‹ (2011) erschienen und ›Wie das Denken im Kopf entsteht‹ (2011). Sein Werk ist mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet worden.
Weitere Informationen, auch zu E-Book-Ausgaben, finden Sie bei www.fischerverlage.de
Impressum
Covergestaltung: buxdesign, München
Erschienen bei FISCHER E-Books
Die Originalausgabe erschien 2007 unter dem Titel »The Stuff of Thought. Language as a Window into Human Nature« beim Verlag Viking, New York
© 2007 by Steven Pinker. All rights reserved
Für die deutschsprachige Ausgabe:
© S. Fischer Verlag GmbH, Frankfurt am Main 2014
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.
ISBN 978-3-10-401618-4
Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
Dieses E-Book enthält möglicherweise Abbildungen. Der Verlag kann die korrekte Darstellung auf den unterschiedlichen E-Book-Readern nicht gewährleisten.
Wir empfehlen Ihnen, bei Bedarf das Format Ihres E-Book-Readers von Hoch- auf Querformat zu ändern. So werden insbesondere Abbildungen im Querformat optimal dargestellt.
Anleitungen finden sich i.d.R. auf den Hilfeseiten der Anbieter.
Inhalt
Inhalt
Vorwort
Kapitel 1 Wörter und Welten
Wörter und Gedanken
Wörter und Realität
Wörter und Gemeinschaft
Wörter und Emotionen
Wörter und soziale Beziehungen
Kapitel 2 Hinunter ins Kaninchenloch
Zehn Hoch
Ein Paradox des kindlichen Spracherwerbs
Perspektivenwechsel
Gedanken über Bewegen und Verändern
Gedanken über Haben, Wissen und Helfen
Gedanken über Handeln, Beabsichtigen und Verursachen
Kluge Sprecher oder kluge Sprache?
Eine Sprache des Geistes?
Unsere kognitiven Schrullen
Kapitel 3 50000 angeborene Konzepte (und andere radikale Theorien über Sprache und Denken)
Extremer Nativismus
Radikale Pragmatik
Sprachlicher Determinismus
Kapitel 4 Die Luft teilen
Mahlwerke, Päckchen und Schubladen – Gedanken über Substanz
Hier geht’s um Millimeter – Gedanken über Raum
Die digitale Uhr – Gedanken über Zeit
Dynamik – Gedanken über Kausalität
Rein und Angewandt
Kapitel 5 Die Metaphern-Metapher
Spielverderber und Messias
Die Relevanz der Metapher
Der Messias der Metapher
Unter der Metapher
Die Guten, die Schlechten und die Hässlichen
Metaphorik und der menschliche Geist
Kapitel 6 Was ist ein Name?
In der Welt oder im Kopf?
Bling-Bling, Blogs und Blimptaufen
Erfinder in Not – Geheimnisse des Unbenannten und Unnennbaren
Noch einmal Projekt Steve
Kapitel 7 Die sieben Wörter, die man im Fernsehen nicht sagen darf
Kodderschnauzen
Das gotteslästerliche Gehirn
Die Semantik des Fluchens – Gedanken über Götter, Krankheit, Dreck und Sex
Fünf Formen der Unflätigkeit
Pro und kontra Fluchen
In Kapitel 7 verwendete einschlägige Ausdrücke
Kapitel 8 Spielchen spielen
Tête-à-Tête
O rühret, rühret nicht daran – die Logik der Höflichkeit
Mach es undurchschaubar – Vagheit, Abstreitbarkeit und andere Konfliktstrategien
Teilen, Herrschen, Tauschen – Gedanken über Beziehungen
Gleich durchschaut – die Logik nicht allzu glaubwürdiger Dementis
Das will ich gar nicht wissen – das Paradox der rationalen Ignoranz
Kapitel 9 Die Flucht aus der Höhle
Literatur
Register
Inhalt
Vorwort
7
Kapitel 1:
Wörter und Welten
11
Kapitel 2:
Hinunter ins Kaninchenloch
41
Kapitel 3:
50000 angeborene Konzepte (und andere radikale Theorien über Sprache und Denken)
121
Kapitel 4:
Die Luft teilen
196
Kapitel 5:
Die Metaphern-Metapher
292
Kapitel 6:
Was ist ein Name?
344
Kapitel 7:
Die sieben Wörter, die man im Fernsehen nicht sagen darf
397
In Kapitel 7 verwendete einschlägige Ausdrücke
456
Kapitel 8:
Spielchen spielen
458
Kapitel 9:
Die Flucht aus der Höhle
520
Anmerkungen
535
Literatur
559
Register
592
Vorwort
Hinter der Art und Weise, wie wir Wörter verwenden, verbirgt sich eine Theorie über Raum und Zeit. Zudem finden wir dort eine Theorie über Materie und eine über Kausalität. Unsere Sprache umfasst ein Geschlechtsmodell (eigentlich zwei Modelle) sowie Vorstellungen über Vertrautheit, Macht und Fairness. Darüber hinaus sind mit unserer Muttersprache auch Göttlichkeit, Erniedrigung und Gefahr verwoben, gemeinsam mit einer Vorstellung von Wohlergehen und einer Philosophie des freien Willens. Diese Konzepte sind in ihren Feinheiten zwar von Sprache zu Sprache verschieden, doch sie alle verbindet eine übergeordnete Logik. Gemeinsam ergeben sie ein spezifisch menschliches Modell der Wirklichkeit, das sich in wichtigen Punkten von dem objektiven Verständnis der Realität unterscheidet, um das unsere beste Wissenschaft und Logik beständig ringen. Obwohl diese Ideen mit der Sprache verflochten sind, gehen ihre Ursprünge noch weiter, hinter die Sprache, zurück. In ihnen sind die Grundprinzipien angelegt, nach denen wir unsere Umwelt begreifen, unseren Mitmenschen Anerkennung zollen oder Schuld zuweisen und unsere Beziehungen zu ihnen gestalten. Demzufolge kann uns ein genauer Blick auf unsere Sprache – unsere Gespräche, Witze, Flüche, Rechtsstreitigkeiten oder die Namen unserer Kinder – Erkenntnisse darüber liefern, wer wir sind.
Genau darum geht es in dem Buch, das Sie in der Hand halten. Es ist das dritte einer Trilogie und wendet sich, wie seine beiden Vorgänger, an eine breite Leserschaft, die sich für Sprache und den menschlichen Geist interessiert. Das erste Buch, Der Sprachinstinkt, gab einen Überblick über das Sprachvermögen – es behandelte alles, was man schon immer über Sprache wissen wollte, sich aber nie zu fragen traute. Eine Sprache verknüpft Laute mit Bedeutungen, und darum behandeln die anderen beiden Bücher jeweils einen dieser zwei Bereiche. In Wörter und Regeln ging es um die Bausteine der Sprache und um die Art und Weise, wie sie im Gedächtnis gespeichert sind und sich zu der unüberschaubaren Menge an Kombinationen anordnen lassen, die der Sprache ihre immense Ausdruckskraft verleiht. Der Stoff, aus dem das Denken ist betrachtet nun das andere Glied dieser Verbindung, die Bedeutung. Dabei richtet sich das Augenmerk auf die Bedeutung von Wörtern und Konstruktionen sowie auf die Sprachverwendung in sozialen Kontexten, also auf das, was Linguisten Semantik und Pragmatik nennen.
Zugleich vollendet dieses Buch eine weitere Trilogie: drei Bücher über die Natur des Menschen. Wie das Denken im Kopf entsteht hat versucht, im Lichte der Kognitionswissenschaft und Evolutionspsychologie die Funktionsweisen der Psyche bis zu ihren menschlichen Anfängen zurückzuverfolgen und so zu ergründen. Das unbeschriebene Blatt hat den Begriff der menschlichen Natur mit seinen ethischen, emotionalen und politischen Schattierungen erforscht. Das vorliegende Buch nähert sich dem Thema aus einer noch anderen Richtung: Was sagt uns die Art und Weise, wie wir unsere Gedanken und Gefühle in Worte fassen, über unsere menschliche Beschaffenheit?
Wie in meinen anderen Büchern über Sprache unternehmen die ersten Kapitel gelegentliche Abstecher in technisches Terrain. Ich habe mir jedoch große Mühe gegeben, diese Passagen verständlich zu formulieren, und bin zuversichtlich, dass das, was ich hier behandle, jeden anspricht, der gerne wissen möchte, wie wir Menschen ticken. Sprache ist untrennbar mit dem menschlichen Leben verbunden. Wir nutzen sie, um zu informieren und zu überreden, aber auch, um zu drohen oder zu verführen, zu fluchen oder zu schwören. Sie spiegelt unsere Interpretation der Wirklichkeit wider, das Bild von uns, das wir anderen gerne vermitteln möchten, sowie die Bande, die uns mit ihnen verknüpfen. Sie ist, wie ich Ihnen gerne nahebringen möchte, ein Fenster zur Natur des Menschen.
Bei der Arbeit an diesem Buch haben mich viele Personen mit Rat und Tat unterstützt. Da sind zunächst meine Redakteure Wendy Wolf, Stefan McGrath und Will Goodlad sowie mein Agent John Brockman. Immens profitiert habe ich von der Klugheit einiger Menschen – Rebecca Newberger Goldstein, David Haig, David Kemmerer, Roslyn Pinker und Barbara Spellman –, die freundlicherweise das gesamte Manuskript gelesen haben, und von den Kommentaren der Sprachexperten zu denjenigen Kapiteln, die ihre jeweiligen Fachgebiete behandeln: Linda Abarbanell, Ned Block, Paul Bloom, Kate Burridge, Herbert Clark, Alan Dershowitz, Bruce Fraser, Marc Hauser, Ray Jackendoff, James Lee, Beth Levin, Peggy Li, Charles Parsons, James Pustejovsky, Lisa Randall, Harvey Silverglate, Alison Simmons, Donald Symons, J.D. Trout, Michael Ullman, Edda Weigand und Phillip Wolff. Ich danke auch denen, die meine Fragen beantwortet oder Vorschläge gemacht haben: Max Bazerman, Iris Berent, Joan Bresnan, Daniel Casasanto, Susan Carey, Gennaro Chierchia, Helena Cronin, Matt Denio, Daniel Donoghue, Nicholas Epley, Michael Faber, David Feinberg, Daniel Fessler, Alan Fiske, Daniel Gilbert, Lila Gleitman, Douglas Jones, Marcy Kahan, Robert Kurzban, Gary Marcus, George Miller, Martin Nowak, Anna Papafragou, Geoffrey Pullum, S. Abbas Raza, Laurie Santos, Anne Senghas, G. Richard Tucker, Daniel Wegner, Caroline Whiting und Angela Yu. Zum sechsten Mal hat Katya Rice ein Buch von mir redigiert, und wie immer hat es von ihrem Gefühl für Stil, ihrer Präzision und ihrer Neugier profitiert.
Ich danke Ilavenil Subbiah für die zahlreichen Beispiele subtiler semantischer Phänomene, die sie aus der Alltagssprache zusammengetragen hat, für das Design der Kapitel und für vieles mehr. Dank auch an meine Eltern Harry und Roslyn und meine Familie: Susan, Martin, Eva, Carl, Eric, Rob, Kris, Jack, David, Yael, Gabe und Danielle. Vor allem danke ich Rebecca Newberger Goldstein, meinem Bashert, der dieses Buch gewidmet ist.
Die Forschungen, die diesem Buch zugrunde liegen, wurden unterstützt vom Stipendium HD-18381 der National Institutes of Health und vom Johnstone Family Chair an der Harvard University.
Kapitel 1Wörter und Welten
Am 11. September 2001 um 8.46 Uhr bohrte sich ein entführtes Linienflugzeug in den Nordturm des World Trade Center in New York. Um 9.03 Uhr explodierte ein zweites Flugzeug im Südturm. In dem darauffolgenden Inferno brachen die Gebäude in sich zusammen – der Südturm, nachdem er eine Stunde und zwei Minuten lang gebrannt hatte, der Nordturm 23 Minuten später. Drahtzieher der Anschläge war Osama bin Laden, der Anführer des Terrornetzwerks Al Qaida. Er wollte die Vereinigten Staaten unter Druck setzen und sie dazu bewegen, ihre Streitkräfte aus Saudi-Arabien abzuziehen und Israel nicht länger zu unterstützen. Darüber hinaus hatte er das Ziel, die Muslime zu vereinen, um der Wiederherstellung des Kalifats den Weg zu bereiten.
9/11, wie die Geschehnisse jenes Tages gemeinhin kurz umschrieben werden, gilt als das politisch und kulturell bisher folgenreichste Ereignis des 21. Jahrhunderts. Es hat alle möglichen Arten von Debatten in Gang gesetzt: wie man am besten der Toten gedenkt und Lower Manhattan zu neuem Leben erweckt, ob die Anschläge in einem uralten islamischen Fundamentalismus wurzeln oder auf moderne revolutionäre Agitation zurückgehen, welche Rolle auf der Weltbühne die USA vor den Anschlägen gespielt haben und wie sie nun dastehen oder wie die Balance zwischen dem Schutz gegen den Terrorismus und den Bürgerrechten am besten zu halten ist.
Ich möchte hier jedoch eine Diskussion aufgreifen, die auch von 9/11 ausgelöst wurde, aber weniger bekannt ist: Wie viele Ereignisse genau haben an diesem Septembermorgen in New York stattgefunden?
Man könnte argumentieren, dass es nur ein Ereignis war. Demnach gehörten die Anschläge auf die Gebäude zu einem einzigen Plan, den ein einzelner Mann im Dienste eines ganz bestimmten Vorhabens entwickelt hatte. Sie erfolgten im Abstand von nur wenigen Minuten und Metern voneinander und zielten auf die Teile eines Gebäudekomplexes mit einem gemeinsamen Namen, Design und Eigentümer ab. Und sie zogen ein und dieselbe Kette an militärischen und politischen Aktivitäten nach sich.
Man könnte aber auch argumentieren, dass es zwei Ereignisse waren. Der Nordturm und der Südturm waren eigenständige, räumlich voneinander getrennte Gebilde aus Glas und Stahl; sie wurden zu unterschiedlichen Zeiten getroffen und brachen zu unterschiedlichen Zeiten in sich zusammen. Das Amateurvideo, das zeigt, wie das zweite Flugzeug auf den Südturm zufliegt, während aus dem Nordturm schon Rauchschwaden aufsteigen, führt uns die Zweiteilung nachdrücklich vor Augen: Jene grauenhaften Momente markieren das eine Ereignis als Vergangenheit, während sich das andere, zukünftige anbahnt. Und ein weiteres Geschehen an jenem Tage – der Aufstand von Passagieren, infolgedessen ein drittes entführtes Flugzeug am Boden zerschellte, bevor es sein Ziel in Washington erreichen konnte – nährt die Vermutung, dass der eine oder der andere Turm möglicherweise vor dem Anschlag hätte bewahrt werden können. In all diesen möglichen Welten lief jeweils ein separates Ereignis ab; demzufolge, so ließe sich argumentieren, müssen in unserer wirklichen Welt, so sicher, wie eins und eins zwei ist, auch zwei Ereignisse stattgefunden haben.
Angesichts der erschütternden Tragweite von 9/11 mag diese ganze Diskussion banal, wenn nicht gar geschmacklos erscheinen. Hier geht es um bloße »Wortklauberei«, wie wir sagen, um Spitzfindigkeit, Haarspalterei, Sophisterei. Doch dieses Buch dreht sich nun einmal um Semantik, und ich würde Sie nicht auf ein solches Problem hinweisen, wenn ich nicht der Überzeugung wäre, dass die Beziehung von Sprache zu unserer Innen- und Außenwelt ein faszinierendes und anspruchsvolles Thema mit einem ganz realen Wert für unser Leben ist.
Obwohl man einen »Wert« nicht immer leicht bestimmen kann, lässt er sich in diesem Fall ganz exakt beziffern – nämlich auf dreieinhalb Milliarden Dollar. Das war die Summe, um die in einer Reihe von Gerichtsverhandlungen gestritten wurde, bei denen es um die Versicherungsauszahlung an Larry Silverstein ging, den Pächter des World-Trade-Center-Komplexes. Silverstein besaß Versicherungspolicen, die eine maximale Entschädigung für jedes zerstörerische Ereignis vorsahen. Betrachtete man 9/11 als ein einziges Ereignis, so standen ihm dreieinhalb Milliarden Dollar zu. Ging man von zwei Ereignissen aus, waren es sieben Milliarden. Vor Gericht diskutierten die Anwälte die hier anzuwendende Bedeutung des Terminus Ereignis. Die Anwälte des Pächters definierten ihn physisch (zwei Zusammenstürze); die der Versicherungen definierten ihn geistig (eine Konspiration). Von wegen »bloße« Wortklauberei!
Ebenso wenig handelt es sich um eine intellektuell triviale Angelegenheit. Die Frage nach der Zahl der Ereignisse bei 9/11 betrifft nicht die Fakten, also die physischen Geschehnisse und von Menschen begangenen Handlungen, die an jenem Tag erfolgten – obwohl zugegebenermaßen auch darüber gestritten wurde: Verschiedenen Verschwörungstheorien zufolge wurden die Gebäude von amerikanischen Flugkörpern beschossen oder durch eine kontrollierte Implosion zum Einsturz gebracht, und zwar im Zuge einer Verschwörung von amerikanischen Neokonservativen, israelischen Spionen oder intriganten Psychiatern. Doch abgesehen von den Spinnern sind sich die meisten Leute über die Fakten einig. Uneinig sind sie sich, was die Interpretation dieser Fakten betrifft – in welche Begrifflichkeiten der menschliche Geist das komplizierte Gewirr aus Raum und Materie kleiden sollte.
Auch in Deutschland hat es in jüngster Zeit einen politisch hochbrisanten Fall gegeben, in dem um die Anzahl fragwürdiger Vorgänge gestritten wird. Es geht um die Vernichtung von Akten durch den Verfassungsschutz im Zusammenhang mit der ausländerfeindlichen Mordserie, die von der rechtsextremistischen Gruppierung Nationalsozialistischer Untergrund verübt wurde:
Als das ARD-Magazin Monitor jetzt berichtete, bei der Vernichtung der wichtigen Akten der »Operation Rennsteig« habe es zwei Durchgänge gegeben, reagierte eine Sprecherin des Bundesamtes für Verfassungsschutz in Köln äußerst spitzfindig. In dem Bericht hatte es geheißen, einige Tage nach der Schnipselaktion am 11. November 2011 habe ein Mitarbeiter einen weiteren Aktenordner schreddern lassen. Den Ordner habe der Mitarbeiter zufällig gefunden, sein Vorgesetzter habe die Vernichtung angeordnet. Das sei so nicht richtig, beharrte die Agenten-Behörde gestern pikiert: Ein Großteil der Akten sei am 11. November geschreddert worden, ein kleinerer Rest wenige Tage später. Es habe sich aber um ein- und denselben Vorgang in zwei Schritten gehandelt und allesamt um Akten zur »Operation Rennsteig«.[1]
Wie wir sehen werden, durchdringen die in dieser Debatte verwendeten Kategorien die Bedeutungen der Wörter in unserer Sprache, weil sie einen entscheidenden Einfluss darauf ausüben, wie wir die Wirklichkeit in unseren Köpfen repräsentieren.
Semantik betrifft die Beziehung von Wörtern zu Gedanken, aber ebenso die Beziehung von Wörtern zu anderen menschlichen Belangen. Semantik betrifft die Beziehung von Wörtern zur Realität, das heißt die Art und Weise, wie sich Sprecher auf ein gemeinsames Verständnis der Wahrheit einigen und wie ihre Gedanken in Dingen und Situationen in der Welt verankert sind. Sie betrifft die Beziehung von Wörtern zu einer Gemeinschaft – wie es dazu kommt, dass ein neues Wort, das in einem Schöpfungsakt eines einzelnen Sprechers entsteht, beim Rest der Bevölkerung ein und dieselbe Idee heraufbeschwört, so dass die Menschen einander verstehen, wenn sie das Wort benutzen. Sie betrifft die Beziehung von Wörtern zu Emotionen, also die Art und Weise, wie Wörter nicht einfach nur auf Dinge verweisen, sondern gefühlsbeladen sind und einen ganz speziellen Zauber entfalten, Tabus brechen und sündhaft sein können. Und schließlich betrifft Semantik Wörter und soziale Beziehungen – die Art und Weise, in der Menschen mit Sprache nicht nur Ideen von einem Kopf zum anderen transportieren, sondern auch die spezifische Beziehung zum Ausdruck bringen, die sie zu ihrem Gesprächspartner haben möchten.
Einer Eigenschaft des menschlichen Geistes werden wir auf den kommenden Seiten immer wieder begegnen: Selbst unsere abstraktesten Konzepte verstehen wir mit Hilfe konkreter Szenarien. Das trifft in vollem Umfang auch auf das Kernthema des vorliegenden Buches zu. In diesem Einführungskapitel stelle ich anhand von Ausschnitten aus Zeitungs- und Internetartikeln, die sich nur durch die Linse der Semantik erschließen, einige der behandelten Themen vor. Sie entstammen den verschiedenen Welten, die mit unseren Wörtern verknüpft sind – der Welt der Gedanken, der Realität, der Gemeinschaft, der Emotionen und der sozialen Beziehungen.
Wörter und Gedanken
Nehmen wir einmal den Zankapfel in der weltweit kostspieligsten semantischen Debatte in Augenschein – den dreieinhalb Milliarden schweren Streit über die Bedeutung von Ereignis. Was genau ist ein Ereignis? Ein Ereignis ist eine Zeitspanne, und Zeit ist, laut Physikern, eine kontinuierliche Variable, in Newtons Welt ein unerbittlicher kosmischer Fluss oder in der Welt Einsteins eine vierte Dimension in einem nahtlosen Hyperraum. Der menschliche Geist zerschneidet dieses Gewebe jedoch in die einzelnen Fetzen, die wir Ereignisse nennen. Wo verortet der Geist die Nähte? Manchmal, wie die Anwälte des Pächters vom World Trade Center hervorhoben, wird der Schnitt um die Zustandsveränderung eines Objekts gezogen, beispielsweise den Einsturz eines Gebäudes. Und manchmal, wie die Anwälte der Versicherer betonten, umkreist er das Ziel eines menschlichen Akteurs, beispielsweise die Durchführung eines Komplotts. Meistens sind die Kreisausschnitte deckungsgleich: Ein Akteur beabsichtigt, den Zustand eines Objekts zu verändern, die Absicht des Akteurs und das Schicksal des Objekts lassen sich längs ein und derselben Zeitachse verfolgen, und der Augenblick der Veränderung markiert die Ausführung der Absicht.
Das begriffliche Gerüst hinter der strittigen Sprache ist seinerseits eine Art Sprache (dieser Idee gehe ich in Kapitel 2 und 3 nach). Es repräsentiert eine analoge Wirklichkeit mit Hilfe digitaler Einheiten in Wortgröße (wie Ereignis) und kombiniert sie zu Anordnungen mit einer syntaktischen Struktur, statt sie wie einen Haufen Lumpen in einen Sack zu stopfen. So ist es für unser Verständnis von 9/11 nicht nur fundamental, dass bin Laden mit seinem Handeln den Vereinigten Staaten Schaden zufügen wollte und dass das World Trade Center zur beabsichtigten Zeit zerstört wurde, sondern vor allem, dass es bin Ladens Handeln war, das die Zerstörung verursachte. Es ist die Kausalbeziehung zwischen der Absicht eines bestimmten Mannes und der Zustandsveränderung eines bestimmten Objekts, die die allgemeine Auffassung über 9/11 von den Verschwörungstheorien unterscheidet. Linguisten bezeichnen das Inventar an Begriffen und die Schemata, die sie miteinander kombinieren, als »konzeptuelle Semantik«.[1] Die konzeptuelle Semantik – die Sprache des Geistes – muss von der Sprache als solcher verschieden sein, denn sonst hätten wir nichts mehr in der Hand, wenn wir über die Bedeutung unserer Wörter diskutieren.
Dass konkurrierende Interpretationen eines einzelnen Vorgangs Auslöser eines exorbitanten Gerichtsverfahrens sein können, sagt uns, dass nicht die Beschaffenheit der Wirklichkeit vorgibt, wie diese Wirklichkeit im Kopf der Menschen repräsentiert ist. Die Sprache des Geistes ermöglicht uns, eine Situation auf ganz unterschiedliche und miteinander unvereinbare Weisen zu betrachten. Der Lauf der Dinge am Morgen des 11. September in New York lässt sich als ein Ereignis oder zwei Ereignisse deuten, je nachdem, wie wir ihn im Geiste interpretieren. Und das wiederum hängt davon ab, worauf wir unser Augenmerk richten und was wir ignorieren möchten. Dabei bietet die Fähigkeit, ein Ereignis auf verschiedene Arten zu betrachten, nicht nur die Gelegenheit, vor Gericht zu ziehen – sie ist auch ein reichhaltiger Quell geistigen Lebens. Wie wir sehen werden, liefert sie das Material für wissenschaftliche und literarische Kreativität, für Humor und Wortspiele sowie für die Dramen des täglichen Miteinanders. Und sie schafft die Bühne für zahllose Streitgespräche. Zerstört die Stammzellenforschung einen Zellklumpen oder einen jungen Menschen? Ist der Einfall des amerikanischen Militärs in den Irak ein Akt der Invasion oder der Befreiung eines Landes? Bedeutet Abtreibung das Beenden einer Schwangerschaft oder das Töten eines Kindes? Dienen hohe Steuersätze dazu, Vermögen neu zu verteilen oder Einnahmen zu konfiszieren? Schützt ein staatliches Gesundheitssystem die Gesundheit der Bürger, oder vergrößert es nur die Macht der Regierung? In all diesen Diskussionen stehen zwei mögliche Interpretationen eines Ereignisses einander gegenüber, und die Kontrahenten kämpfen darum, ihre Interpretation als die passendere darzustellen (darauf gehen wir in Kapitel 5 näher ein). In den ersten Jahren des 21. Jahrhunderts ließen sich Vertreter der Demokratischen Partei der USA von bekannten Linguisten beraten; diese sagten ihnen, wie es die Republikaner bei den letzten Wahlen geschafft hätten, durch ihre Interpretationen zu punkten, und wie die Demokraten die semantische Herrschaft über den politischen Diskurs durch Umformulierungen wiedererlangen könnten. So könnten sie statt von Steuern von Mitgliedsbeiträgen sprechen oder den Begriff activist judges (»Aktivistenrichter«) durch freedom judges (»Freiheitsrichter«) ersetzen.[2]
Die Frage, ob es sich bei 9/11 um ein oder zwei Versicherungsfälle handelt, verdeutlicht noch ein weiteres merkwürdiges Phänomen im Zusammenhang mit der Sprache des Geistes. Hier wird mit den Ereignissen jenes Tages in New York umgegangen, als seien sie Objekte, die sich abzählen lassen, so wie sorgsam gestapelte Pokerchips. Die Diskussion über die Anzahl der Ereignisse mutet an wie eine Kontroverse darüber, ob auf dem Band an einer Schnellkasse im Supermarkt ein oder zwei Artikel liegen – beispielsweise zwei Schokoriegel, die man aus einer Viererbox herausgenommen hat, oder zwei Grapefruits, die es zum Sonderpreis von einem Euro gibt. Dass es beim Abzählen von Objekten und beim Abzählen von Ereignissen zu ähnlichen Mehrdeutigkeiten kommt, ist eines von vielen Beispielen dafür, dass der menschliche Geist Raum und Zeit häufig als äquivalent behandelt, und zwar schon lange bevor Einstein diese beiden Größen in der Realität als äquivalent darstellte.
Wie Kapitel 4 zeigen wird, kategorisiert unser Geist Materie als einzelne Dinge (wie eine Wurst) oder zusammenhängendes Zeug (wie Fleisch). Entsprechend kategorisiert er Zeit als einzelne Ereignisse (wie die Straße überqueren) und fortlaufende Tätigkeiten (wie schlendern). Bei Raum und Zeit gleichermaßen erlaubt uns dasselbe Zoom-Objektiv, das uns das Zählen von Objekten oder Ereignissen ermöglicht, auch das noch nähere Heranzoomen an die Beschaffenheit der beiden. Was den Raum betrifft, können wir uns auf die materielle Zusammensetzung eines Objekts konzentrieren (wenn wir zum Beispiel sagen Ich hatte überall Wurst auf meinem Hemd); was die Zeit betrifft, können wir uns auf eine Tätigkeit konzentrieren, die ein Ereignis ausmacht (wenn wir zum Beispiel sagen Sie überquerte die Straße). Mit diesem kognitiven Zoom-Objektiv können wir auch ein räumlich weiteres Panorama erfassen und eine Ansammlung von Objekten als eine Menge erkennen (wie bei der Unterscheidung von Kieselstein und Kies); entsprechend können wir ein zeitlich weiteres Panorama erfassen und eine Ansammlung von Ereignissen als Wiederholung identifizieren (wie bei der Unterscheidung von den Nagel mit dem Hammer treffen und den Nagel in die Wand schlagen). Wir können eine zeitliche Entität genau wie eine räumliche mental an einer bestimmten Stelle platzieren und sie dann woandershin verfrachten: Wir verschieben eine Sitzung von 3.00 Uhr auf 4.00 Uhr geradeso, wie wir ein Auto vom einen Ende der Straße ans andere bewegen. Apropos Ende – selbst einige Feinheiten unserer geistigen Geometrie lassen sich vom Raum in die Zeit übertragen. Das Ende einer Schnur ist streng genommen ein Punkt, doch da wir sagen können Heinz schnitt das Ende der Schnur ab, lässt sich ein Ende auch so interpretieren, dass noch ein Stückchen der daran angrenzenden Materie dazugehört. Das Gleiche gilt für die Zeit: Das Ende einer Vorlesung ist genau genommen ein bestimmter Moment, doch wenn wir sagen Ich komme nun zum Ende meiner Vorlesung, interpretieren wir den krönenden Abschluss eines Ereignisses so, dass er noch eine kleine daran angrenzende Zeitspanne umfasst.[3]
Wie wir sehen werden, ist Sprache voll von stillschweigenden Metaphern wie »Ereignisse sind Objekte« und »Zeit ist Raum«. Tatsächlich erweist sich Raum als konzeptueller Bildträger nicht nur für Zeit, sondern für viele Formen von Zuständen und Umständen. So wie sich eine Sitzung von 3.00 Uhr auf 4.00 Uhr verschieben lässt, springt eine Ampel von Grün auf Rot, kann ein Mensch vom Tellerwäscher zum Millionär aufsteigen und die Wirtschaft die Talsohle erreichen. Metaphern sind in der Sprache so allgegenwärtig, dass man kaum Ausdrücke für abstrakte Vorstellungen findet, die nicht metaphorisch sind. Was verrät uns die Konkretheit der Sprache über menschliches Denken? Impliziert sie, dass selbst die zartesten Ideengespinste in unserem Kopf als Brocken von Materie repräsentiert sind, die wir wie auf einer geistigen Bühne hin und her manövrieren können? Besagt sie, dass konkurrierende Behauptungen über die Welt niemals wahr oder falsch sein können, sondern lediglich alternative Metaphern, die eine Situation auf verschiedene Weisen interpretieren? Um diese fixen Ideen geht es in Kapitel 5.
Wörter und Realität
In den Nachwehen von 9/11 entspann sich eine weitere semantische Debatte, deren Konsequenzen sogar noch schwerwiegender waren als die Milliarden von Dollar, die beim Zählen der Ereignisse jenes Tages auf dem Spiel standen. Diese andere Debatte betrifft einen Krieg, der weitaus mehr Geld und Menschenleben gekostet hat als die ursprünglichen Anschläge von 9/11 und der den Lauf der Geschichte möglicherweise für den Rest des Jahrhunderts beeinflussen wird. Die Diskussion dreht sich um die Bedeutung einer weiteren Abfolge von Wörtern – 16 Wörtern, um es genau zu sagen:
The British government has learned that Saddam Hussein recently sought significant quantities of uranium from Africa.
Die deutsche Übersetzung lautet:
Die britische Regierung hat in Erfahrung gebracht, dass Saddam Hussein vor kurzem beträchtliche Mengen Uran aus Afrika beschaffen wollte.
Der englische Satz stammt aus der Rede zur Lage der Nation, die George W. Bush im Januar 2003 hielt. Er nahm Bezug auf Geheimdienstberichte, nach denen Saddam möglicherweise versucht hatte, 500 Tonnen eines Uranerzes namens Yellowcake aus Quellen in Niger in Westafrika zu kaufen. Für viele Amerikaner und Briten war die potentielle Gefahr, dass Saddam Nuklearwaffen bauen würde, der einzige vertretbare Grund, in den Irak einzumarschieren und Saddam zu entmachten. Im Frühling jenes Jahres erfolgte die Invasion unter Führung der Vereinigten Staaten; es war die am heftigsten kritisierte Initiative der amerikanischen Außenpolitik seit dem Vietnamkrieg. Im Laufe der Besatzung wurde klar, dass Saddam über keinerlei Vorrichtungen verfügte, um Nuklearwaffen herzustellen, und wahrscheinlich nie in Betracht gezogen hatte, Yellowcake aus Niger zu beziehen. Plakate und Schlagzeilen überall auf der Welt verkündeten: »Bush hat gelogen.«
Doch tat er das wirklich? Die Antwort ist nicht so offenkundig, wie Anhänger beider Seiten vielleicht meinen. Nachforschungen des britischen Parlaments und des US-Senats ergaben, dass der britische Geheimdienst tatsächlich glaubte, Saddam würde versuchen, Yellowcake zu kaufen. Sie zeigten, dass die Indizien, die den britischen Geheimdienstoffizieren zu jener Zeit vorlagen, nicht völlig aus der Luft gegriffen, aber auch bei weitem nicht wasserdicht waren. Und sie enthüllten, dass die amerikanischen Geheimdienstexperten die Korrektheit des Berichts anzweifelten. Wie sollen wir angesichts dieser Fakten entscheiden, ob Bush gelogen hatte? Dabei geht es nicht darum, ob es unklug von ihm war, dem britischen Geheimdienst Glauben zu schenken, oder ob er auf der Grundlage vager Informationen ein kalkuliertes Risiko einging. Es geht darum, ob er nicht ehrlich war, als er der Welt diesen Teil seiner Begründung für die Invasion verkündete. Und die Beantwortung dieser Frage hängt an der Bedeutung eines jener 16 Wörter, an dem Verb learn (bzw. in Erfahrung bringen, das sich semantisch genauso verhält).[1]
In Erfahrung bringen ist, wie Linguisten sagen, ein faktives Verb. Es impliziert, dass die dem Subjekt zugeschriebene Überzeugung wahr ist. Insofern entspricht es dem Verb wissen und unterscheidet sich von dem Verb glauben. Sagen wir einmal, ich habe einen Freund namens Mike, der fälschlicherweise annimmt, dass bei der Bundespräsidentenwahl 1949 Kurt Schumacher über Theodor Heuss triumphierte. Ich könnte dann wahrheitsgemäß sagen Mike glaubt, dass Schumacher Heuss geschlagen hat, aber nicht Mike weiß, dass Schumacher Heuss geschlagen hat, denn Schumacher hat Heuss in Wahrheit nicht geschlagen. Mike mag durchaus glauben, dass es so war, aber Sie und ich wissen, dass es nicht so war. Aus demselben Grund könnte ich nicht wahrheitsgemäß sagen, Mike habe zugegeben, entdeckt, beobachtet, sich daran erinnert, gezeigt oder (!) in Erfahrung gebracht, dass Schumacher Heuss geschlagen hat.
Das englische learn hat zwar auch noch die Bedeutung »lernen«, und die ist nicht faktiv. So kann ich sagen Auf dem Gymnasium haben wir gelernt, dass es vier Geschmacksqualitäten gibt, obwohl ich heute dank einer jüngeren Entdeckung weiß, dass es fünf sind. Doch normalerweise wird learn, und vor allem have learned, faktiv verwendet und bedeutet dann »eine wahre Information erlangen«.
Menschen sind also im philosophischen Sinne »Realisten«. Sie gehen in ihrem alltäglichen Sprachgebrauch stillschweigend davon aus, dass bestimmte Aussagen wahr oder falsch sind, ganz unabhängig davon, ob die Person, über die man spricht, sie für wahr oder falsch hält. Faktive Verben leiten eine Aussage ein, von der die jeweiligen Sprecher annehmen, dass sie unter allen Umständen wahr ist, und nicht nur etwas, was sie für sehr wahrscheinlich halten. Es ist kein Widerspruch zu sagen Ich bin ganz sicher, dass Oswald Kennedy erschossen hat, aber ich weiß es nicht mit Bestimmtheit. Aus diesem Grunde umweht faktive Verben immer ein Hauch des Paradoxen. Niemand kann sich der Wahrheit sicher sein, und die meisten von uns wissen, dass wir uns niemals sicher sein können, und doch verwenden wir ständig mit lauterem Herzen faktive Verben wie wissen und erfahren und sich erinnern. Wir müssen von einer intuitiven Gewissheit erfüllt sein, die so stark und durch allgemeingültige Sprecher-Hörer-Regeln so sehr abgesichert ist, dass wir bereit sind, für die Wahrheit einer bestimmten Überzeugung zu bürgen, obwohl uns im Allgemeinen (wenn auch mutmaßlich nicht in diesem speziellen Fall) bewusst ist, dass unsere Behauptungen falsch sein können.
Mark Twain schöpfte aus der Semantik der faktiven Verben, als er schrieb: »Das Problem auf dieser Welt ist nicht, dass die Menschen zu wenig wissen, sondern dass sie so viele Dinge wissen, die nicht zutreffen.«[2] (Angeblich schrieb er auch: »Als ich jünger war, konnte ich mich an alles erinnern, egal ob es passiert war oder nicht; nun aber lassen meine geistigen Kräfte nach, und bald … werde ich mich [nur] noch an die Dinge erinnern, die nie geschehen sind.«)
Hat Bush also nun gelogen? Vieles spricht dafür. Indem Bush sagte, die britische Regierung hätte »in Erfahrung gebracht«, dass Saddam sich Uran beschaffen wollte, schloss er sich der Behauptung an, dass die Bemühungen um den Urankauf wirklich erfolgt waren, und nicht, dass die britische Regierung dies nur glaubte. Falls er damals Grund für berechtigte Zweifel hatte – und sein Regierungsstab wusste von der Skepsis des amerikanischen Geheimdienstes –, enthielten die 16 Wörter tatsächlich eine wissentliche Unwahrheit. Laut Verteidigungsminister Donald Rumsfeld, der Bush in Schutz nahm, war die Aussage »technisch korrekt«, und die Nationale Sicherheitsberaterin Condoleezza Rice fügte hinzu, dass »die Briten dies gesagt« hätten. Doch hier ist der Austausch der Verben zu beachten: Bush hatte nicht behauptet, die Briten hätten gesagt, dass Saddam Yellowcake erwerben wollte. Das hätte der Wahrheit entsprochen, ungeachtet dessen, was Saddam wirklich getan hatte. Bush hatte behauptet, die Briten hätten es in Erfahrung gebracht, und das konnte nur der Wahrheit entsprechen, wenn Saddam tatsächlich auf Einkaufstour gegangen war. Es war also die Logik der Faktivität, auf die sich Bushs Kritiker stillschweigend beriefen, als sie ihn der Lüge bezichtigten.
Ein Präsident kann aufgrund einer Lüge angeklagt werden, insbesondere wenn diese in einen schrecklichen Krieg mündet. Können aus der Semantik wirklich solche Folgen für die Politikgeschichte erwachsen? Ist es plausibel, dass das Schicksal eines amerikanischen Präsidenten von den feinen Bedeutungsnuancen eines Verbs abhängt? In Kapitel 4 kehren wir zu dieser Frage zurück; dort werden wir sehen, dass die Bedeutung des Wortes is dabei eine wichtige Rolle spielt.
Wörter sind mit der Realität verknüpft, wenn ihre Bedeutungen, wie bei den faktiven Verben, davon abhängen, ob die Sprecher sich der Wahrheit verpflichten. Wörter können aber auf eine andere Weise noch direkter mit der Realität verbunden sein. Sie geben nicht nur im Kopf von Menschen gespeicherte Fakten über die Welt wieder, sondern sind unmittelbar mit dem Kausalgewebe der Welt an sich verwoben.
Natürlich ist eine Wortbedeutung von irgendetwas abhängig, das sich im Kopf befindet. Neulich stolperte ich über das Wort siderisch und musste einen belesenen Freund fragen, was es bedeutet. Nun kann ich es auch dann verstehen und verwenden, wenn mein Freund nicht in der Nähe ist (es bedeutet »auf die Sterne bezogen«, wie in siderischer Tag, der die Dauer einer Erdumdrehung in Relation zu einem Fixstern beschreibt). Etwas in meinem Gehirn muss sich in dem Moment, in dem ich das Wort gelernt habe, verändert haben, und eines Tages können uns kognitive Neurowissenschaftler vielleicht sagen, worin diese Veränderung besteht.
Natürlich lernen wir ein Wort meistens nicht dadurch, dass wir es nachschlagen oder jemanden fragen, sondern indem wir es in einem bestimmten Zusammenhang hören. Doch wie auch immer man ein Wort lernt – es muss im Gehirn irgendeine Spur hinterlassen. Die Bedeutung eines Wortes scheint also aus Informationen zu bestehen, die in den Köpfen der Personen, die das Wort kennen, gespeichert sind – aus den elementaren Konzepten, die es definieren, und, bei einem konkreten Wort, aus einem Bild dessen, worauf es sich bezieht.
Wie wir jedoch in Kapitel 6 sehen werden, muss ein Wort mehr sein als eine allgemeingültige Definition und ein Bild. Dies erschließt sich am ehesten, wenn wir die Semantik von Namen betrachten.[3] Was bedeutet ein Name, zum Beispiel William Shakespeare? Wenn wir ihn in einem Lexikon suchen, stoßen wir möglicherweise auf etwas in der Art von:
Shakespeare, William (1564–1616): englischer Dichter und Dramatiker, gilt als einer der bedeutendsten englischsprachigen Autoren. Zu seinen Stücken, von denen viele im Globe Theatre in London aufgeführt wurden, zählen Historiendramen wie Richard II., Komödien, darunter Viel Lärm um nichts und Wie es euch gefällt, sowie Tragödien wie Hamlet, Othello und König Lear. Außerdem verfasste er 154 Sonette [auch Shakspeare, Shakspere, der Barde].
Wahrscheinlich wird die Definition durch den berühmten Stich eines rehäugigen Mannes mit sehr hohem Haaransatz, spärlichem Schnurrbart und ausladendem steifem Kragen ergänzt. Vermutlich deckt sich diese Darstellung im Wesentlichen mit dem, was Sie mit diesem Namen verbinden.
Aber gibt dies tatsächlich die Bedeutung von William Shakespeare wieder? Historiker stimmen darin überein, dass ein Mann namens William Shakespeare existiert hat, der im späten 16. und frühen 17. Jahrhundert in Stratford-on-Avon und London lebte. Seit 250 Jahren bestehen jedoch Zweifel, ob dieser Mann tatsächlich die ihm zugeschriebenen Werke verfasste. Das klingt jetzt vielleicht wie die Theorie, dass die CIA das World Trade Center zum Einsturz gebracht hat, aber Walt Whitman, Mark Twain, Henry James und viele Wissenschaftler der heutigen Zeit haben diese Möglichkeit ernsthaft in Betracht gezogen, und eine Reihe erdrückender Beweise spricht dafür. Shakespeares Stücke wurden zu seinen Lebzeiten nicht als seriöse Literatur veröffentlicht, und Urheberschaft wurde damals nicht so sorgfältig festgehalten wie heutzutage. Der Mann selbst war relativ ungebildet, unternahm keinerlei Reisen, hatte Kinder, die nicht lesen und schreiben konnten, war in seiner Heimatstadt als Geschäftsmann bekannt, wurde bei seinem Tode nicht gepriesen und hinterließ in seinem Testament keine Bücher oder Manuskripte. Selbst die berühmten Porträts wurden nicht zu seinen Lebzeiten angefertigt, und wir haben keinen Grund zu der Annahme, dass sie dem betreffenden Mann ähneln. Weil das Schreiben von Theaterstücken zu jener Zeit eine anrüchige Tätigkeit war, wollte der wirkliche Autor, den verschiedene Theorien als Francis Bacon, Edward de Vere, Christopher Marlowe oder gar Königin Elisabeth identifiziert haben, seine Identität möglicherweise nicht preisgeben.
Mir geht es nicht darum, Sie davon zu überzeugen, dass William Shakespeare nicht der große englische Dichter und Dramatiker war, der Hamlet, Wie es euch gefällt und 154 Sonette verfasst hat. (Versierte Forscher sagen, dass er es war, und ich glaube ihnen.) Ich möchte, dass Sie über die Möglichkeit nachdenken, dass er es nicht war, und verstehen, welche Konsequenzen dies für die Vorstellung hat, dass Wortbedeutungen im Kopf gespeichert sind. Nehmen wir der Einfachheit halber an, forensische Untersuchungen hätten zweifelsfrei ergeben, dass das Shakespeare’sche Werk einen anderen Urheber hatte. Wenn nun die Bedeutung von William Shakespeare mehr oder weniger dem im Kopf gespeicherten Lexikoneintrag entspräche, müssten wir entweder zu dem Schluss kommen, dass sich die Bedeutung des Begriffs William Shakespeare geändert hat oder dass der eigentliche Autor von Hamlet posthum zu William Shakespeare umgetauft werden müsste, obwohl ihn zu seinen Lebzeiten niemand so genannt hat. (Außerdem müssten wir dem armen Studenten volle Punktzahl geben, der im Examen geschrieben hatte: »Shakespeares Stücke wurden von William Shakespeare oder einem anderen Mann dieses Namens verfasst.«) Doch es kommt noch schlimmer. Wir könnten gar nicht mehr erst fragen: »Hat Shakespeare Hamlet geschrieben?«, denn das hätte er per definitionem getan. Genauso gut könnten wir fragen: »Ist ein Junggeselle unverheiratet?« oder »Wer liegt in Schillers Grab?« oder »Wer sang ›Hey, hey, we’re the Monkees‹?« Und die Schlussfolgerung »William Shakespeare hat in Wirklichkeit gar nicht Hamlet geschrieben« wäre in sich widersprüchlich.
Doch diese Argumentation ist bizarr. Tatsächlich reden wir keinen Unsinn, wenn wir fragen, ob Shakespeare Hamlet geschrieben hat. Wir würden uns nicht selbst widersprechen, wenn wir zu dem Schluss kämen, dass er es nicht getan hat. Und wir hätten immer noch das Gefühl, dass William Shakespeare genau das bedeutet, was es immer bedeutet hat – irgendein Typ, der vor langer Zeit in England lebte –, wobei wir einräumen, dass wir bezüglich der Leistungen dieses Mannes auf dem Holzweg waren. Selbst wenn sich jedes uns über Shakespeare bekannte biographische Detail als falsch herausstellen würde – so könnte herauskommen, dass er nicht 1564, sondern 1565 geboren wurde oder nicht aus Stratford, sonden aus Warwick stammte –, hätten wir nach wie vor das Gefühl, dass sich der Name immer noch auf denselben Typen bezieht, auf den, über den wir die ganze Zeit gesprochen haben.
Was genau bedeutet also William Shakespeare, wenn nicht »bedeutender Autor, Verfasser von Hamlet« usw.? Für einen Namen gibt es keine Definition im Sinne anderer Wörter, Konzepte oder Bilder. Stattdessen verweist er auf eine Entität in der Welt, weil der Entität irgendwann dieser Name verliehen wurde und er an ihr haften geblieben ist. William Shakespeare verweist also auf das Individuum, dem Mr. und Mrs. Shakespeare um die Zeit seiner Geburt den Namen William gegeben haben. Der Name bleibt mit dem Kerl verbunden, was auch immer er später getrieben hat und wie viel oder wenig auch immer wir über ihn wissen. Ein Name verweist genauso auf eine Person in der Welt, wie ich in diesem Moment auf einen Stein vor mir deuten kann. Der Name hat für uns eine Bedeutung, weil ein durch mündliche (oder schriftliche) Überlieferung geschaffenes immerwährendes Band zwischen dem jetzt von uns verwendeten Wort und dem ursprünglichen Akt der Namensgebung besteht. Wir werden noch sehen, dass nicht nur Namen, sondern Wörter für viele verschiedenartige Dinge durch den Akt des Deutens, Benennens und Anheftens unauflöslich mit der Welt verknüpft sind, statt durch eine Definition festgelegt zu sein.
Dass Wörter an die Wirklichkeit gekettet sind, zerstreut ein wenig die Sorge, dass Sprache uns in ein hermetisch abgeschlossenes Gespinst selbstgenügsamer Symbole lockt. Es gibt die Befürchtung, dass Wortbedeutungen letztlich zirkulär sind, weil sich jede nur im Rückgriff auf andere definieren lässt. So stellte eine Semantikerin einmal dar, wie ein typisches Lexikon dieses Spiel spielt: »Befehlen bedeutet ›gebieten‹, anweisen und beauftragen ›sind schwächer als gebieten oder befehlen‹, gebieten bedeutet ›mit dem Recht auf Gehorsam anweisen‹, anweisen bedeutet ›befehlen‹, beauftragen bedeutet ›Befehle erteilen‹. Entsprechend bedeutet bitten ›höflich verlangen‹, verlangen ›rechtmäßig beanspruchen‹, beanspruchen ›fordern oder verlangen‹, fordern ›eine Bitte äußern‹ usw.«[4] Dieses »Schweinchen-auf-der Leiter«-Fadenspiel ist ein Graus für alle diejenigen, die sich nach in Stein gemeißelten Worten sehnen; Anhänger des Dekonstruktivismus und der Postmoderne machen es sich dagegen zu eigen, und Liebhaber hintergründiger Wortspielereien werden zu Lexikoneinträgen wie den folgenden inspiriert:
ewiger Kreislauf, m. Siehe Kreislauf, ewiger.
Kreislauf, ewiger, m. Siehe ewiger Kreislauf.
Die Logik von Namen und anderen Wörtern, die mit einem Akt der Benennung verknüpft sind, verringert diese Bedenken, indem sie das Bedeutungsgewebe an realen Ereignissen und Objekten in der Welt festmacht.
Für die Verknüpfung von Wörtern mit realen Menschen und Dingen, nicht nur mit Informationen über diese Menschen und Dinge, gibt es eine praktische Anwendung, die derzeit viele Schlagzeilen macht. Das Vergehen mit der rasantesten Zuwachsrate zu Beginn dieses Jahrhunderts ist Identitätsdiebstahl. Ein Identitätsdieb nutzt Informationen, die mit Ihrem Namen verknüpft sind, wie Ihre Sozialversicherungsnummer oder Nummer und Passwort Ihrer Kreditkarte oder Ihres Bankkontos, um einen Betrug zu begehen oder Ihr Vermögen zu stehlen. Opfern von Identitätsdiebstahl entgeht möglicherweise die Chance auf einen Job, ein Darlehen oder die Zulassung zum Studium; an Sicherheitsschleusen am Flughafen werden sie nicht durchgelassen, oder man verhaftet sie sogar wegen eines Verbrechens, das der Dieb begangen hat. Es kann sie viele Jahre und eine Menge Geld kosten, bis sie ihre Identität wiedererlangt haben.
Versetzen Sie sich in die Lage eines Menschen, der seine Geldbörse verloren oder versehentlich am Computer persönliche Informationen preisgegeben hat und nun einen Doppelgänger besitzt. Dieser Doppelgänger benutzt den fremden Namen (sagen wir Mats Klefisch), um sich Geld zu leihen oder Einkäufe zu tätigen. Nun stellen Sie sich vor, Sie müssten einen Beamten davon überzeugen, dass Sie und nicht der Hochstapler der wahre Mats Klefisch sind. Wie machen Sie das? Wie bei William Shakespeare kommt es auf die Bedeutung der Wörter Mats Klefisch an. Sie könnten sagen: »›Mats Klefisch‹ bezeichnet den Inhaber einer Reifendiscounter-Kette, der in Berlin-Charlottenburg geboren wurde, in Cottbus lebt, ein Girokonto bei der Ascor-Bank hat, verheirateter Vater von zwei Söhnen ist und den Sommer im Allgäu verbringt.« Doch dann erhielten Sie die Antwort: »Soweit wir wissen, bezeichnet ›Mats Klefisch‹ einen Fitnesstrainer, der in Trier geboren wurde, ein Postfach in Kaufbeuren besitzt, einer Briefkastenfirma in Reno eine kürzlich erfolgte Scheidung in Rechnung gestellt hat und den Sommer auf Sylt verbringt. Was das Bankkonto betrifft, stimmen wir mit Ihnen überein; es ist allerdings weit überzogen.«
Wie würden Sie also beweisen, dass Sie der rechtmäßige Träger des Namens Mats Klefisch sind? Selbst wenn Sie mit allen möglichen Informationen aufwarten könnten – Sozialversicherungsnummer, Führerscheinnummer, Geburtsname Ihrer Mutter –, könnte Ihr Imitator entweder ein Duplikat vorweisen (falls er dies ebenfalls gestohlen hat) oder die Richtigkeit der Angaben bestreiten (falls er die gestohlene Identität durch seine eigenen persönlichen Daten, einschließlich eines Passfotos, ergänzt hat). Genau wie bei der Feststellung der Identität des wahren Shakespeare, nachdem seine allseits bekannten biographischen Angaben angezweifelt wurden, müssten Sie sich letzten Endes auf eine Kausalkette berufen, die Ihren Namen in seiner heutigen Verwendung mit dem Moment verknüpft, an dem Ihre Eltern Ihre Ankunft auf dieser Welt bejubelten. Ihre Kreditkarte stammt von einem Bankkonto, das auf Vorlage eines Personalausweises eröffnet wurde, der auf Vorlage Ihrer Geburtsurkunde ausgestellt wurde, die auf die Bescheinigung des Krankenhauspersonals hin ausgehändigt wurde, das um die Zeit Ihrer Geburt mit Ihren Eltern in Kontakt stand und aus deren Munde hörte, dass Sie der Klefisch sind, den sie Mats nennen wollen. Bei Ihrem betrügerischen Doppelgänger verliert sich die Spur der Identitätsbelege schon bald in der jüngeren Vergangenheit, weit vor dem Moment der Namensgebung. Die Maßnahmen zur Vereitelung eines Identitätsdiebstahls sind abhängig von der Logik der Namen und der Verbindung von Wörtern zur Realität – diese bieten die Möglichkeit, eine lückenlose Identifizierungskette von Mensch zu Mensch über einen langen Zeitraum zurückzuverfolgen, bis hin zu einem ganz bestimmten Akt der Namensgebung in der Vergangenheit.
Wörter und Gemeinschaft
Ihrem Kind einen Namen zu geben, ist für die meisten Menschen die einzige Gelegenheit, eine Entität in der Welt mit einem Wort ihrer Wahl zu bekleiden. Abgesehen von kreativen Künstlern wie Frank Zappa, der seine Kinder Moon Unit und Dweezil nannte, wählen die meisten traditionellerweise vorgefertigte Namen wie Paul und Marie statt einer Lautfolge, die sie spontan erfunden haben. Theoretisch ist ein Vorname ein willkürliches Etikett ohne eine ihm anhaftende Bedeutung, und man interpretiert ihn lediglich als Verweis auf das Individuum, das ihn erhalten hat. In der Praxis erhalten Namen jedoch sehr wohl eine Bedeutung, weil man sie mit der Generation und der Gruppe von Personen, die sie tragen, assoziiert. Die meisten amerikanischen Leser, die über einen gewissen Mann nichts anderes erfahren, als dass er Murray heißt, würden vermuten, dass er die 60 überschritten hat, der Mittelschicht angehört und wahrscheinlich Jude ist. (Als Mel Gibson 2006 in angetrunkenem Zustand eine antisemitische Tirade vom Stapel ließ, kommentierte der Literaturredakteur Leon Wieseltier: »Mad Max macht Max wütend und Murray und Irving und Mort und Marty und Abe.«)[1] Das liegt an einer weiteren Besonderheit von Namen, auf die wir in Kapitel 6 eingehen. Namen folgen Modetrends, genau wie die Breite von Krawatten und die Länge von Röcken, und deshalb verraten Vornamen, welcher Generationengruppe ihre Träger angehören. Während seiner Blütezeit in den 1930er Jahren umgab Murray eine Aura angelsächsischer Respektabilität; Gleiches galt für Namen wie Irving, Sidney, Maxwell, Sheldon und Herbert. Sie schienen sich von den jüdischen Namen der vorhergehenden Generation, wie Moishe, Mendel und Ruven, abzuheben, die so klangen, als stünden ihre Träger noch mit einem Fuß im Land der Vorväter. Doch als die Murrays und Sids und ihre Ehefrauen den Babyboom ins Rollen brachten, gaben sie ihren Söhnen farblosere Namen wie David, Brian und Michael, die wiederum biblisch inspirierte Adams, Joshuas und Jacobs zeugten. Viele dieser alttestamentarischen Namensvettern schließen nun den Kreis mit Söhnen, die Max, Ruben und Saul heißen.
Namen folgen Trends, weil Menschen in einer Gemeinschaft in gespenstisch ähnlicher Weise auf Namen reagieren, die zur Auswahl stehen (so stellen Eltern bei der Einschulung ihres Kindes häufig fest, dass der einzigartige Name ihres Sprösslings von einer ganzen Reihe anderer Eltern ebenfalls für einzigartig befunden wurde). Seine Färbung verdankt ein Name zum Teil den Lauten, aus denen er besteht, und zum Teil einem Stereotyp der Erwachsenen, die ihn gerade tragen. Aus diesem Grunde fielen die quasibritischen Namen von Amerikanern der ersten Generation eine Generation später ihrer eigenen Mittelschicht-Respektabilität zum Opfer. In einer Szene aus dem Film Harry und Sally, der zu Beginn in den 1970er Jahren spielt, tragen zwei Produkte des Babybooms ein Scharmützel über Sallys sexuelle Erfahrungen aus:
HARRY
Mit wem hattest du großartigen Sex?
SALLY
Glaubst du vielleicht, ich würde dir das sagen?
HARRY
Dann sagst du’s eben nicht.
SALLY
Shel Gordon.
HARRY
Shel? Sheldon? Nein, nein, du hattest nie heißen Sex mit Sheldon.
SALLY
Natürlich war er großartig.
HARRY
Nie im Leben. So ein Sheldon hilft dir bei der Einkommensteuer. Wenn du Karies hast, ist Sheldon dein Mann. Aber kräftiges Auf und Ab ist nicht seine Stärke. Das liegt am Namen. »Gib’s mir, Sheldon.« »Du Bestie, Sheldon.« »Mach mich fertig, Sheldon.« Klingt nicht.
Obwohl Nachkriegseltern vermutlich nicht großartigen Sex im Sinn hatten, müssen sie selbst damals schon vor dem nichtssagenden Beiklang des Namens zurückgeschreckt sein – von den 1940er Jahren an versank Sheldon, genau wie Murray, im Meer des Vergessens und kämpfte sich nie wieder an die Oberfläche zurück.[2] Die Reaktion auf den Namen stellt sich mittlerweile in der gesamten englischsprachigen Welt so zuverlässig ein, dass Humoristen darauf bauen können. Die Dramatikerin Marcy Kahan, die Nora Ephrons Drehbuch für Harry und Sally vor einigen Jahren für die britische Bühne bearbeitete, bemerkt: »Ich habe den Witz über Sheldon in das Bühnenstück aufgenommen, und alle drei Schauspieler, die die Rolle des Harry übernommen hatten, ernteten damit regelmäßig jeden Abend große Heiterkeitsstürme.«[3]
Die Dynamik der Namensgebung für Babys ist mittlerweile, da die Modezyklen immer kurzlebiger werden, ein populäres Presse- und Gesprächsthema. Von einem der beliebtesten amerikanischen Mädchennamen aus dem Jahr 2006 hatte man erst fünf Jahre zuvor noch nie gehört: Nevaeh, oder »heaven« (»Himmel«) rückwärts geschrieben. Am anderen Ende der Skala erleben Menschen, dass ihre eigenen Namen oder die Namen ihrer Freunde und Verwandten immer lahmer daherkommen.[4] Ich glaube, ich habe mich nie älter gefühlt als in dem Moment, in dem mir eine Studentin sagte, dass Barbara, Susan, Deborah und Linda, die in meiner Generation zu den beliebtesten Mädchennamen zählten, in ihr die Vorstellung von Frauen in den mittleren Jahren weckten.
Beim Aussuchen eines Namens für ihr Baby haben Eltern weitgehend freie Hand. Natürlich werden sie von den Namen, die gerade im Umlauf sind, beeinflusst, aber wenn sie sich erst einmal für einen entschieden haben, behält er für das Kind und die Gemeinschaft, in der es lebt, normalerweise seine Gültigkeit. Bei der Benennung aller anderen Dinge hingegen entscheidet die Gemeinschaft mit, ob sich der neue Name einbürgert. Der soziale Charakter von Wörtern zeigt sich in Calvins vermutlich zum Scheitern verurteilten Versuch, eine Physikprüfung zu bestehen:
Dass wir »mit deinen eigenen Worten« so verstehen, dass damit die Kombination von Wörtern gemeint ist und nicht die Wörter an sich, zeigt, dass Wörter nicht einer Einzelperson gehören, sondern einer Gemeinschaft. Wenn ein Wort allen anderen in unserer Umgebung unbekannt ist, brauchen wir es gar nicht zu verwenden, weil niemand wissen würde, wovon wir sprechen. Dennoch muss jedes Wort einer Sprache irgendwann von einem einzelnen Sprecher geprägt worden sein. Bei einigen Schöpfungen ist der Rest der Gemeinschaft nach und nach bereit, das Wort als Verweis auf ein und dieselbe Sache zu benutzen, und stößt damit den ersten Dominostein in der Kette an, die das Wort auch für nachfolgende Generationen verfügbar macht. Doch wie sich diese stillschweigende Übereinkunft in einer ganzen Gemeinschaft fortpflanzt, ist ein Rätsel, dem wir uns später erneut zuwenden wollen.
Zuweilen macht auch die Not erfinderisch. So benötigten Computernutzer in den 1990er Jahren einen Begriff für große Mengen von E-Mails, und in die Bresche sprang Spam. Viele andere Breschen verwehren jedoch hartnäckig jeglichen Zutritt. Seit der sexuellen Revolution der 1960er Jahre sind wir auf der Suche nach einem Begriff für die Mitglieder eines unverheirateten heterosexuellen Paares. Bislang hat sich keiner der im Umlauf befindlichen Vorschläge festsetzen können – Geliebte/r ist zu romantisch, Mitbewohner/in nicht romantisch genug, Partner/in zu geschäftsmäßig und Lebensabschnittsgefährte/in zu ironisch. Auch Ähfreund, von »Dies ist mein, äh, Freund«, fand nicht allzu viele Nachahmer. Die Volkszählungsbehörde der USA, vergleichbar mit dem Statistischen Bundesamt, ersann einst die Umschreibung persons of opposite sex sharing living quarters (»Personen unterschiedlichen Geschlechts mit gemeinsamem Wohnsitz«), die findige Journalisten in die – nicht ganz ernst zu nehmende – Abkürzung POSSLQ umwandelten. Und was die Bezeichnung für Jahrzehnte betrifft – wie um alles in der Welt sollen wir die ersten zehn Jahre des 21. Jahrhunderts nennen? Die Nuller? Die Nixer? Die Null-Nulls?
Die traditionelle Etymologie hilft uns nur begrenzt, wenn wir herausfinden möchten, wodurch ein Wort ins Dasein befördert wurde und ob es Bestand haben wird. Etymologen können die meisten Wörter über einige Jahrhunderte hinweg oder noch weiter zurückverfolgen, aber die Spur ist schon lange kalt, bevor sie an den entscheidenden Punkt gelangen, an dem ein urzeitlicher Wortschmied erstmals ein Konzept mit einer Lautfolge seiner Wahl verknüpfte. Bei jüngeren Wortschöpfungen hingegen lässt sich der gewundene Pfad zur Wortwerdung in Echtzeit rekonstruieren.
Spam ist übrigens nicht, wie einige Leute vielleicht glauben, ein Akronym für Short, Pointless and Annoying Messages, also für kurze, sinnlose und nervige Nachrichten. In Wahrheit ist das Wort mit der Bezeichnung für das seit 1937 von Hormel verkaufte Frühstücksfleisch verwandt, die sich von SPiced hAM (»gewürzter Schinken«) herleitet. Wie aber kam es dazu, dass es sich nun auf gemailte Angebote zur Vergrößerung des männlichen Gliedes bezieht oder zur Teilhabe an dem unrechtmäßig erworbenen Vermögen entthronter afrikanischer Despoten? Meist wird vermutet, dass es sich ursprünglich um eine Metapher gehandelt hat. Wie Frühstücksfleisch (das in seiner Konsistenz Corned Beef ähnelt) sind die betreffenden Mails billig, im Übermaß vorhanden und unbeliebt, und in einer Version dieser Volksetymologie ist Spamming das, was passiert, wenn man Spam in einen Ventilator steckt. Doch obwohl diese intuitiven Deutungen für die weitere Verbreitung des Wortes gesorgt haben dürften, sind seine Ursprünge ganz anderer Art. Die Wortprägung wurde durch einen Sketch von Monty Python’s Flying Circus inspiriert, in dem ein Paar in ein Café kommt und von der Kellnerin (einem Python in Frauenkleidern) wissen möchte, was es zu essen gibt. Sie antwortet:
Wir haben Ei und Schinken; Ei, Würstchen und Schinken; Ei und Spam; Ei, Schinken und Spam; Ei, Schinken, Würstchen und Spam; Spam, Schinken, Würstchen und Spam; Spam, Ei, Spam, Spam, Schinken und Spam; Spam, Spam, Spam, Ei und Spam; Spam, Spam, Spam, Spam, Spam, Spam mit Backbohnen und Spam, Spam, Spam oder Hummer Thermidor au Crevette mit Mornay-Sauce und Trüffelköpfen, Brandy, einem Spiegelei und Spam.
Sie denken vermutlich: »Hoffentlich hört dieser Sketch bald auf – das ist ja einfach nur albern.« Trotzdem hat er die (englische) Sprache verändert. Die hirnlose Wiederholung des Wortes Spam inspirierte Hacker in den späten 1980er Jahren dazu, es als Verb für das Überfluten von Nachrichtenforen mit identischen Botschaften zu verwenden, und zehn Jahre später breitete es sich von ihrer Subkultur über die gesamte Bevölkerung aus.[5]
Es mag zwar unglaublich erscheinen, dass sich eine solch skurrile und auf Umwegen daherkommende Wortprägung durchsetzt, doch wie man sieht, war dies nicht das erste Mal, dass sich Albernheit im Wortschatz verewigt hat. Das auch im Deutschen gebräuchliche Wort Gerrymandering (»Verschiebung von Wahlkreisgrenzen«) hat seinen Ursprung in einem amerikanischen Cartoon aus dem 19. Jahrhundert; dort ist ein Wahlbezirk abgebildet, der von einem gewissen Gouverneur Elbridge Gerry in eine gewundene, salamanderähnliche Gestalt umgeformt worden war, weil Gerry versuchen wollte, die Wähler seines Konkurrenten auf einen einzigen Sitz zu konzentrieren. Die meisten neckischen Wortschöpfungen enden jedoch im Nichts, wie der englische Ausdruck bushlips für »unaufrichtige politische Rhetorik« – nach George H.W. Bushs Wahlkampfparole von 1988: Read my lips: No new taxes (»Lies mir von den Lippen ab: Keine neuen Steuern«). Ebenso ungewiss ist das künftige Schicksal des neugeprägten deutschen Verbs guttenbergen mit der Bedeutung »unrechtmäßig kopieren, plagiieren«, das seine rasche Verbreitung dem Skandal um die Dissertation des ehemaligen deutschen Verteidigungsministers verdankte.
Die American Dialect Society wählt jedes Jahr das Wort, das sich mit der größten Wahrscheinlichkeit durchsetzen wird. Dennoch geben die Mitglieder der Vereinigung unumwunden zu, dass ihre Erfolgsbilanz grottenschlecht ist. Kennt irgendwer noch den information superhighway oder die Infobahn?[6] Dagegen hätte wohl niemand vorhergesagt, dass sich to blog und to google in Windeseile im allgemeinen Sprachgebrauch etablieren würden – genau wie ihre eingedeutschten Varianten bloggen und googeln.
Die Dynamik des Gebens und Nehmens aus dem Wortpool, wenn es einerseits um das Benennen von Konzepten und andererseits um das Benennen von Babys geht, ist gleichbleibend chaotisch. Wie wir noch sehen werden, verhilft uns diese Unvorhersehbarkeit zu einem besseren allgemeinen Verständnis von Kultur. Wie die Wörter einer Sprache müssen auch die in einer Kultur gepflegten Praktiken – jeder Modetrend, jedes Ritual, jede verbreitete Überzeugung – einen innovativen Erzeuger haben, anschließend den Bekannten jener kreativen Person und danach den Bekannten dieser Bekannten und immer so weiter gefallen, bis sich die Neuschöpfung schließlich in der gesamten Gemeinschaft ausgebreitet hat. Der Aufstieg und Fall von Namen – den kulturellen Zeugnissen, deren Werdegang sich am leichtesten zurückverfolgen lässt – ist durch große Launenhaftigkeit gekennzeichnet. Dies legt nahe, dass wir den meisten Erklärungen für die Lebenszyklen anderer Sitten und Gebräuche (von der Frage, warum Männer keine Hüte mehr tragen, bis hin zu der Frage, warum sich manche Wohnviertel von anderen absondern) skeptisch gegenüberstehen sollten. Aber es weist auch auf die Muster individueller Entscheidungen und sozialer Ansteckung hin, die die Zusammenhänge vielleicht eines Tages offenbar werden lassen.
Wörter und Emotionen
Dass Vornamen so wechselvolle Assoziationen wecken, verdeutlicht, wie stark die emotionale Färbung eines Wortes sein kann – es hat nicht nur eine Denotation, sondern auch eine Konnotation. Was mit »Konnotation« gemeint ist, hat man oft mit Hilfe der »Konjugationsformel« erläutert, die Bertrand Russell in den 1950er Jahren in einem Radiointerview erfunden hat: Ich bin standhaft; du bist stur; er ist verbohrt. Die Formel diente als Vorlage für ein Wortspiel in einer Radioshow und einem Zeitungsfeature und brachte Hunderte von Ablegern hervor: Ich bin schlank; du bist dünn; sie ist dürr. Ich bin ein Perfektionist; du bist pedantisch; er ist ein Kontrollfreak. Ich erforsche meine Sexualität; du bist promiskuitiv; sie ist eine Schlampe. Die Bedeutung der Wörter in jeder Dreiergruppe bleibt konstant, doch der emotionale Gehalt reicht von attraktiv über neutral bis zu beleidigend.
Die affektive Sättigung von Wörtern offenbart sich besonders augenfällig in den merkwürdigen Phänomenen rund um obszöne Sprache, denen wir uns in Kapitel 7 zuwenden. Für die Wissenschaft des Geistes ist es noch ein großes Rätsel, warum unsere Gesprächsthemen angesichts einer unangenehmen Erfahrung – wir schneiden unseren Daumen gemeinsam mit dem Brötchen auf oder kippen uns ein Glas Bier in den Schoß – abrupt in die Bereiche der Sexualität, Ausscheidung oder Religion wechseln. Ein ebenso absonderliches Verhalten legen wir an den Tag, wenn ein Widersacher unsere Rechte beschneidet – beispielsweise indem er in eine Parklücke huscht, auf die wir bereits geraume Zeit gewartet haben, oder am Sonntagmorgen um sieben Uhr den Laubbläser anwirft – und wir ihm nur zu gern einen wohlgemeinten Rat à la Woody Allen geben würden, der erläuterte: »Ich sagte ihm ›Seid fruchtbar und mehret euch‹, aber nicht mit diesen Worten.«
Diese Ausbrüche scheinen aus einem tiefen und uralten Teil des Gehirns zu kommen, vergleichbar dem Aufjaulen eines Hundes, dem man auf den Schwanz tritt, oder seinem Knurren, wenn er einen Gegner einschüchtern will. Sie treten zutage in den unwillentlichen Tics von Tourette-Patienten oder in den erhalten gebliebenen Äußerungen hirngeschädigter Menschen, die ihr sonstiges Sprachvermögen verloren haben. Doch trotz der offenbar atavistischen Wurzeln des Fluchens bestehen Flüche aus normalen Wörtern und fügen sich ganz regelkonform in das Lautmuster der jeweiligen Sprache ein. Es hat den Anschein, als sei das menschliche Gehirn im Laufe der Evolution so verdrahtet worden, dass der Output eines alten Systems für Rufe und Schreie in den Input des neuen Systems für grammatische Sprache hineingeflickt worden sei.
Dass wir uns gewisser Wörter für Sexualität, Ausscheidungen und Religion befleißigen, wenn wir gereizt sind, ist das eine – wir vermeiden solche Wörter aber auch, wenn wir uns in einem anderen Gemütszustand befinden. Viele Schimpfnamen und Verwünschungen sind nicht nur unschön, sondern tabu. Allein ihre Äußerung ist ein Affront gegenüber etwaigen Zuhörern, selbst wenn es für die Konzepte synonyme Umschreibungen gibt, die keinen Einschränkungen unterliegen. Tabus und Wortzauber in Kulturen auf der ganzen Welt bezeugen die ehrfurchtgebietende Kraft, die Wörter entwickeln können. Im orthodoxen Judentum darf der Name Gottes, im internationalen Sprachgebrauch oft als YHWH transkribiert und gemeinhin als Jahwe ausgesprochen, nicht genannt werden; davon ausgenommen waren nur die Hohepriester im antiken Tempel, wenn sie am Jom Kippur ins »Allerheiligste« gingen, wo die Bundeslade aufbewahrt wurde. In Alltagsgesprächen verwenden strenggläubige Juden ein Wort zur Umschreibung des Wortes und bezeichnen Gott als haSchem, »der Name«.
Während Tabuwörter für das gesunde Volksempfinden eine Beleidigung darstellen, ist das Phänomen der Tabuwörter eine Beleidigung für den gesunden Menschenverstand. Mit Ausscheidungen ist jedes fleischgewordene Wesen tagtäglich beschäftigt, doch alle englischen und auch deutschen Wörter dafür sind anstößig, kindisch oder klinisch. Das elegante Wörterbuch angelsächsischer Einsilber, die der englischen Sprache ihren rhythmischen Elan verleihen, hat nichts vorzuweisen, wenn es um eine Tätigkeit geht, die niemand vermeiden kann. Durch Abwesenheit glänzt auch ein höfliches transitives Verb für Sex – ein Wort, das dem Kontext Adam verbte Eva oder Eva verbte Adam angemessen wäre. Die schlichten transitiven Verben für sexuelle Beziehungen sind entweder obszön oder despektierlich, und die gebräuchlichsten gehören zu den sieben Wörtern, die man im Fernsehen nicht sagen darf.