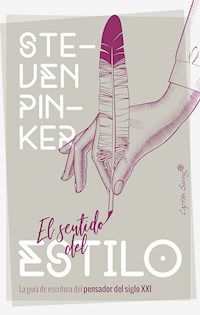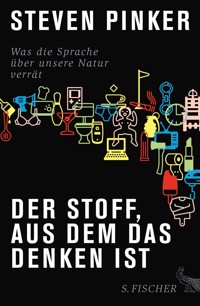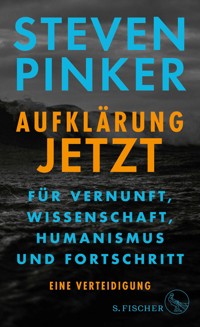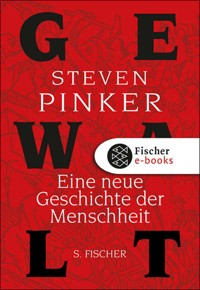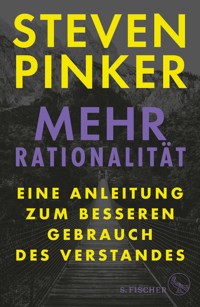
16,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 16,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 16,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER E-Books
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Nachdem Bestseller-Autor Steven Pinker die Aufklärung verteidigt hat, zeigt er nun in seinem neuen Buch die Bedeutung von Rationalität. Denn nur mit ihr kann man sich orientieren in einer Welt, die aus den Fugen zu geraten droht. Durch Rationalität entdeckt der Mensch Naturgesetze, fliegt zum Mond und entwickelt in kürzester Zeit Impfstoffe. Auch wenn manche Menschen an Verschwörungstheorien und Fake-News glauben – der Mensch ist rational. Das unterscheidet ihn von allen anderen Lebewesen. Steven Pinker verteidigt aber nicht nur die Rationalität und zeigt ihre Stärken auf; er erläutert auch die wichtigsten Werkzeuge für rationales Denken. Er führt den Leser durch die Grundlagen der Logik und des kritischen Denkens, er erklärt Wahrscheinlichkeit und die Rolle des Zufalls, das Verhältnis von Glaube und Evidenz, Risiko und Statistik. Nach diesem Grundkurs in Rationalität sind wir gewappnet, rationale Entscheidungen allein und mit anderen viel besser treffen zu können. Denn Rationalität ist immer noch das beste Werkzeug, um unser Schicksal in die Hand zu nehmen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 615
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Steven Pinker
Mehr Rationalität
Eine Anleitung zum besseren Gebrauch des Verstandes
Über dieses Buch
Wie kann man sich orientieren in einer Welt, die aus den Fugen zu geraten droht? Mit Rationalität! Mit ihrer Hilfe entdeckt der Mensch Naturgesetze, fliegt zum Mond und entwickelt in kürzester Zeit Impfstoffe. Auch wenn manche Menschen an Verschwörungstheorien und Fake News glauben – der Mensch ist rational. Das unterscheidet ihn von allen anderen Lebewesen.
In seinem neuen Buch verteidigt Steven Pinker nicht nur leidenschaftlich die Rationalität, sondern erläutert auch die wichtigsten Werkzeuge für rationales Denken. Er führt den Leser durch die Grundlagen der Logik, des kritischen Denkens, der Wahrscheinlichkeit, der Korrelation und der Kausalität und zeigt, wie wir rationale Entscheidungen allein und mit anderen treffen. Denn Rationalität ist immer noch das beste Werkzeug, um unser Schicksal in die Hand zu nehmen.
Weitere Informationen finden Sie auf www.fischerverlage.de
Biografie
Steven Pinker, geboren 1954, studierte Psychologie in Montreal und an der Harvard University. 20 Jahre lang lehrte er am Department of Brain and Cognitive Science am MIT in Boston und ist seit 2003 Professor für Psychologie an der Harvard University. Seine Forschungen beschäftigen sich mit Sprache und Denken, daneben schreibt er regelmäßig u. a. für die »New York Times« und den »Guardian«. Das Magazin »Prospect« zählte ihn zu den »Top 100 öffentlichen Intellektuellen«, das Magazin »Foreign Policy« zu den »100 globalen Intellektuellen« und das »Time Magazine« zu den »100 einflussreichsten Menschen in der heutigen Welt«.
Im S. Fischer Verlag ist zuletzt der Bestseller »Aufklärung jetzt. Für Vernunft, Wissenschaft, Humanismus und Fortschritt. Eine Verteidigung« erschienen (2018) sowie die viel diskutierte Studie »Gewalt. Eine neue Geschichte der Menschheit« (2011). Sein Werk ist mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet worden.
Weitere Informationen finden Sie auf www.fischerverlage.de
Impressum
Erschienen bei FISCHER E-Books
© Steven Pinker 2021
Für die deutschsprachige Ausgabe:
© 2021 S. Fischer Verlag GmbH, Hedderichstr. 114, D-60596 Frankfurt am Main
Die Originalausgabe erschien 2021 unter dem Titel »Rationality. What It Is. Why It Seems Scarce. Why It Matters« im Verlag Viking, New York
© Steven Pinker 2021
Covergestaltung: KOSMOS - Büro für visuelle Kommunikation
Coverabbildung: Oliver Roos / Rawpixel
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.
ISBN 978-3-10-491513-5
Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
Dieses E-Book enthält möglicherweise Abbildungen. Der Verlag kann die korrekte Darstellung auf den unterschiedlichen E-Book-Readern nicht gewährleisten.
Wir empfehlen Ihnen, bei Bedarf das Format Ihres E-Book-Readers von Hoch- auf Querformat zu ändern. So werden insbesondere Abbildungen im Querformat optimal dargestellt.
Anleitungen finden sich i.d.R. auf den Hilfeseiten der Anbieter.
Inhalt
[Widmung]
[Motto]
Vorwort
Kapitel 1
Drei einfache mathematische Probleme
Ein einfaches Logikproblem
Ein einfaches Wahrscheinlichkeitsproblem
Ein einfaches Prognoseproblem
Die Moral aus kognitiven Verzerrungen
Kapitel 2
Vernunftgründe für die Vernunft
Stop making sense?
Konflikte zwischen Zielen
Konflikte zwischen Zeithorizonten
Rationale Ignoranz
Rationale Unfähigkeit und rationale Irrationalität
Tabus
Moral
Rationalität rational betrachtet
Kapitel 3
Formale Logik und formale Fehlschlüsse
Formale Rekonstruktion
Kritisches Denken und informelle Fehlschlüsse
Logische versus empirische Wahrheiten
Formale versus ökologische Rationalität
Klassische Kategorien versus Kategorien der Familienähnlichkeit
Logische Berechnung versus Musterassoziation
Kapitel 4
Was ist Zufälligkeit? Wo kommt sie her?
Was bedeutet »Wahrscheinlichkeit«?
Wahrscheinlichkeit versus Verfügbarkeit
Konjunktive, disjunktive und bedingte Wahrscheinlichkeit
A-priori- und A-posteriori-Wahrscheinlichkeit
Kapitel 5
Prävalenzfehler und die Repräsentativitätsheuristik
Der Prior in der Wissenschaft und die Rache der Lehrbücher
Unzulässige Basisraten und bayesianisches Tabu
Letztlich doch Bayesianer
Kapitel 6
Eine Theorie der rationalen Entscheidung
Der Nutzen des Nutzens
Verstöße gegen die Axiome – irrational?
Zu guter Letzt doch rationale Entscheidungen?
Kapitel 7
Signale und Rauschen, Jas und Neins
Kosten und Nutzen und das Anbringen einer Schwelle
Sensitivität versus Antworttendenz
Signalentdeckung vor Gericht
Signalentdeckung und statistische Signifikanz
Kapitel 8
Ein Nullsummenspiel: Schere, Stein, Papier
Ein Nicht-Nullsummenspiel: das Freiwilligendilemma
Rendezvous und andere Koordinationsspiele
Chicken und Eskalationsspiele
Das Gefangenendilemma und die Tragik der Allmende
Kapitel 9
Was ist Korrelation?
Regression zur Mitte
Was ist Kausalität?
Von der Korrelation zur Kausalität – echte und natürliche Experimente
Ohne Experimente von Korrelation zu Kausalität
Multiple Ursachen, Addition und Interaktion
Kausale Netze und Menschen
Kapitel 10
Motiviertes Denken
Die Myside-Verzerrung
Zwei Arten von Überzeugungen: Realität und Mythologie
Die Psychologie der Apokryphen
Rationalität – und es gibt sie doch!
Kapitel 11
Rationalität in unserem Leben
Rationalität und materieller Fortschritt
Rationalität und moralischer Fortschritt
Literatur
Register der Verzerrungen und Fehlschlüsse
Register
Für Roslyn Wiesenfeld Pinker
Was ist der Mensch,
Wenn seiner Zeit Gewinn, sein höchstes Gut
Nur Schlaf und Essen ist? Ein Vieh, nichts weiter.
Gewiß, der uns mit solcher Denkkraft schuf,
Voraus zu schaun und rückwärts, gab uns nicht
Die Fähigkeit und göttliche Vernunft,
Um ungebraucht in uns zu schimmeln.
– Hamlet
Vorwort
Rationalität sollte der Leitstern all unseres Tuns und Denkens sein. (Falls Sie anderer Meinung sind – sind Ihre Einwände rational?) Doch obwohl wir in einer Zeit leben, die uns nie dagewesene Ressourcen für logisches Denken bietet, verpesten den öffentlichen Raum Fake News, Quacksalberei, Verschwörungstheorien und »postfaktische« Rhetorik.
Wie lässt sich rationales Verhalten – und das Gegenteil davon – rational erklären? Die Zeit drängt. Im dritten Jahrzehnt des dritten Jahrtausends sehen wir uns mit tödlichen Bedrohungen für unsere Gesundheit, unsere Demokratie und die Bewohnbarkeit unseres Planeten konfrontiert. Die Lage ist ernst, aber es gibt Lösungen, und unsere Spezies besitzt das geistige Rüstzeug, sie zu entdecken. Dennoch besteht eines unserer derzeit dringendsten Probleme darin, Menschen vom Sinn bereits gefundener Lösungen zu überzeugen.
Unsere Unvernunft wurde schon tausendfach beklagt, und mittlerweile weiß jeder, dass wir Menschen schlicht irrational sind. In den Sozialwissenschaften wie auch in den Medien wird Homo sapiens als aus der Zeit gefallener Höhlenbewohner dargestellt, der darauf geeicht ist, einem im Gras versteckten Löwen mit einer Salve von Vorurteilen, Fehleinschätzungen, Trugschlüssen und Illusionen entgegenzutreten. (Die englische Wikipedia-Seite für kognitive Verzerrungen enthält eine Liste mit fast 200 Einträgen.)
Als Kognitionswissenschaftler kann ich die zynische Sichtweise, dass das menschliche Gehirn ein Tummelplatz für wahnhafte Vorstellungen ist, jedoch nicht unwidersprochen lassen. Jäger und Sammler – unsere Urahnen wie auch Zeitgenossen – sind keine schreckhaften Kaninchen, sondern intellektuelle Problemlöser. Eine Liste, die aufzählt, auf wie viele Arten wir uns dumm anstellen, kann nicht erklären, warum wir so schlau sind – schlau genug, um die Naturgesetze entdeckt, die Erde umgestaltet, unser Leben verlängert und bereichert sowie nicht zuletzt die Regeln der Rationalität formuliert zu haben, gegen die wir so oft verstoßen.
Um eins vorwegzunehmen: Ich gehöre zu den Ersten, die darauf pochen, dass die menschliche Natur nur dann zu verstehen ist, wenn wir uns die Diskrepanz zwischen der Umwelt, in der sich unsere Evolution vollzog, und unserer Umwelt von heute vor Augen führen. Dennoch ist die Welt, an die unser Geist angepasst ist, nicht einfach nur die Savanne des Pleistozäns. Wir finden sie in jedem nicht akademischen, nicht technokratischen Milieu – also in den meisten Bereichen menschlichen Lebens – in denen die modernen Instrumente der Rationalität wie statistische Formeln und Datenmengen unzugänglich oder nicht anwendbar sind. Wie wir sehen werden, sind die Menschen nicht so dumm, wie sie aussehen, wenn man ihnen Probleme stellt, die mehr mit ihrer Lebenswirklichkeit zu tun haben und so formuliert sind, dass sie dem natürlichen Umgang mit der Welt entsprechen. Was nicht heißt, dass wir es dabei bewenden lassen sollten. Uns steht heutzutage ein ausgeklügeltes Instrumentarium der Vernunft zur Verfügung, und wir werden, als Individuen und als Gesellschaft, die besten Ergebnisse erzielen, wenn wir es verstehen und anwenden.
Dieses Buch verdankt seine Entstehung einem Kurs, den ich in Harvard gegeben habe. Darin erforschten wir das Wesen der Rationalität und gingen dem Rätsel, warum sie ein seltenes Gut zu sein scheint, auf den Grund. Wie viele andere Psychologen behandle ich im Unterricht gerne die fesselnden nobelpreisdekorierten Einsichten in die Schwächen menschlicher Vernunft. In meinen Augen gehören sie zu den tiefgründigsten Erkenntnissen, die wir der Wissenschaft verdanken. Und wie viele andere glaube ich, dass die Maßstäbe der Rationalität, denen wir Menschen so häufig nicht genügen, in den Kanon der schulischen Bildung und Populärwissenschaft eingehen sollten. So wie jeder Mensch grundlegende Kenntnisse in Geschichte, Naturwissenschaften oder Lesen und Schreiben besitzen sollte, sollte er auch über das geistige Rüstzeug eines soliden logischen Denkens verfügen. Dazu gehören Logik, kritisches Denken, Wahrscheinlichkeiten, Korrelation und Kausalität. Sie sind der Königsweg, wenn es gilt, unsere Überzeugungen zu justieren oder sich angesichts einer uneindeutigen Faktenlage ein Urteil zu bilden, und die Richtschnur für rationale Entscheidungen, die wir allein oder im Verbund mit anderen treffen. Diese Werkzeuge des logischen Denkens sind unverzichtbar, wenn wir in unserem Privatleben und in der Politik dumme Fehler vermeiden wollen. Sie helfen uns dabei, Risiken abzuwägen, fragwürdige Behauptungen zu bewerten oder verwirrende Paradoxien zu entschlüsseln, und gewähren einen klareren Blick auf die Wechselfälle und Tragödien des Lebens. Bisher kenne ich jedoch kein Buch, das versucht, sie alle zu erläutern.
Die zweite Inspiration für dieses Buch war die Erkenntnis, dass mir das Curriculum der Kognitionspsychologie trotz all seiner faszinierenden Inhalte keine befriedigenden Antworten auf die am häufigsten gestellten Fragen bot, wenn ich erzählte, dass ich einen Kurs über Rationalität gab: Warum glauben manche Leute, dass Hillary Clinton in einer Pizzeria einen Kinderpornoring betrieb oder dass Kondensstreifen von Flugzeugen in Wirklichkeit bewusstseinsverändernde Drogen sind, die auf Weisung eines geheimen Regierungsprogramms verbreitet werden? Die Stichpunkte, die ich in meinen Vorlesungen standardmäßig abarbeite, wie »Spielerfehlschluss« und »Prävalenzfehler«, boten nur geringe Einsicht in jene rätselhaften Phänomene, welche die menschliche Irrationalität gegenwärtig zu einem so drängenden Problem machen. Diese Phänomene verschafften mir Einblicke in neues Terrain, darunter das Wesen von Gerüchten, Volksweisheiten und Verschwörungstheorien, der Unterschied zwischen der Rationalität eines Individuums und der einer Gemeinschaft sowie die Unterscheidung von zwei Denkweisen – der realistischen und der mythologischen.
Und schließlich – auch wenn es vielleicht paradox anmutet, rationale Argumente für die Rationalität anzuführen – passt die Aufgabe, die ich mir gestellt habe, in diese Zeit. Einige Leute vertreten die entgegengesetzte Auffassung. Ihren Argumenten zufolge (die vermutlich rational sind, denn warum sollten wir sonst auf sie hören?) ist Rationalität überbewertet: Stets logisch denkende Menschen seien freudlos und verklemmt, analytisches Denken sei der sozialen Gerechtigkeit unterzuordnen und ein gutes Herz und ein verlässliches Bauchgefühl seien bessere Wegweiser zum Wohlbefinden als sture Logik und Argumentation. Viele verhalten sich, als sei rationales Denken überholt – als gehe es in Diskussionen nur darum, den Gegner zu diskreditieren, statt gemeinsam auf vernünftigem Wege zu den am ehesten vertretbaren Urteilen zu gelangen. In einer Zeit, in der Rationalität stärker bedroht und unverzichtbarer erscheint als je zuvor, soll Mehr Rationalität vor allem ein Plädoyer für rationales Denken sein.
Ein zentrales Thema dieses Buches lautet, dass niemand auf sich allein gestellt seinen Gedanken nachhängend rational genug ist, um zu durchweg vernünftigen Schlussfolgerungen zu gelangen – Rationalität erwächst aus einer Gemeinschaft denkender Menschen, die einander ihre Irrtümer aufzeigen. In diesem Sinne danke ich den Denkern, die dieses Buch rationaler gemacht haben. Ken Binmore, Rebecca Newberger Goldstein, Gary King, Jason Nemirow, Roslyn Pinker, Keith Stanovich und Martina Wiese nahmen den ersten Entwurf kritisch unter die Lupe. Charleen Adams, Robert Aumann, Joshua Hartshorne, Louis Liebenberg, Colin McGinn, Barbara Mellers, Hugo Mercier, Judea Pearl, David Ropeik, Michael Shermer, Susanna Siegel, Barbara Spellman, Lawrence Summers, Philip Tetlock und Juliani Vidal prüften Kapitel, in denen es um ihre jeweiligen Fachgebiete ging. Beim Planen und Schreiben des Buches taten sich zahlreiche Fragen auf; beantwortet wurden sie von Daniel Dennett, Emily-Rose Eastop, Baruch Fischhoff, Reid Hastie, Nathan Kuncel, Ellen Langer, Jennifer Lerner, Beau Lotto, Daniel Loxton, Gary Marcus, Philip Maymin, Don Moore, David Myers, Robert Proctor, Fred Shapiro, Mattie Toma, Jeffrey Watumull, Jeremy Wolfe und Steven Zipperstein. Verlassen konnte ich mich auf die fachkundigen Transkriptionen, Faktenchecks und Quellenrecherchen durch Mila Bertolo, Martina Wiese und Kai Sandbrink sowie auf die Analyse von Originaldaten durch Bertolo, Toma und Julian De Freitas. Sehr willkommen waren mir auch die Fragen und Anregungen der Studierenden und Lehrenden des Kurses »General Education 1066: Rationality«, insbesondere von Mattie Toma und Jason Nemirow.
Ein besonderes Dankeschön geht an meine kluge und stets hilfsbereite Redakteurin Wendy Wolf, die mit mir an diesem inzwischen sechsten gemeinsamen Buch gearbeitet hat, an Katya Rice, die zum neunten Mal meine Lektorin war, und an meinen Literaturagenten John Brockman, der mir ebenfalls schon bei neun Büchern mit Ermutigung und guten Ratschlägen zur Seite gestanden hat. Herzlich danken möchte ich auch Thomas Penn, Pen Vogler und Stefan McGrath von Penguin UK für ihre jahrelange Unterstützung. Ilavenil Subbiah war erneut für das Graphikdesign verantwortlich, und ich danke ihr für ihre Arbeit und Aufmunterung.
Rebecca Newberger Goldstein hat maßgeblichen Anteil an der Konzeption dieses Buches, denn sie ist diejenige, die mir stets eingeschärft hat, dass Realismus und Vernunft Ideale sind, die es hervorzuheben und zu verteidigen gilt. Liebe und Dankbarkeit gebühren auch den anderen Mitgliedern meiner Familie: Yael und Solly; Danielle; Rob, Jack und David; Susan, Martin, Eva, Carl und Eric – und meiner Mutter Roslyn, der dieses Buch gewidmet ist.
Kapitel 1
Mit Vernunft begabt?
Nach allem, was man mir gesagt und mich gelehrt hat, ist der Mensch mit Vernunft begabt. Ein ganzes langes Leben hindurch habe ich eifrig nach einer Bestätigung dieser These Ausschau gehalten – leider ohne den geringsten Erfolg.
Bertrand Russell[1]
Wer die Schwäche des menschlichen Geistes recht beredt oder scharf durchzuhecheln versteht, der wird wie ein göttliches Wesen angesehen.
Baruch Spinoza[2]
Homo sapiens bedeutet »weiser Mensch«, und in vielerlei Hinsicht haben wir das Epitheton specificum, den zweiten Teil unseres Linné’schen Artnamens, auch verdient. Unsere Spezies hat den Ursprung des Universums datiert, das Wesen von Natur und Energie ergründet, die Geheimnisse des Lebens decodiert, die Schaltkreise des Bewusstseins enträtselt und unsere Geschichte und Verschiedenartigkeit aufgezeichnet. Wir haben dieses Wissen genutzt, um unser eigenes Wohlergehen zu fördern und den Geißeln, die unsere Vorfahren fast die gesamte Menschheitsgeschichte hindurch plagten, ihren Schrecken zu nehmen. Wir haben unsere Lebenserwartung von 30 auf über 70 (in den Industriestaaten über 80) Jahre erhöht, von extremer Armut sind mittlerweile statt 90 Prozent der Menschheit weniger als neun Prozent betroffen, in Kriegen sterben zwanzigmal weniger Menschen, an Hunger hundertmal weniger.[3] Selbst als uns im 21. Jahrhundert erneut der uralte Fluch der Pestilenz heimsuchte, identifizierten wir die Ursache innerhalb von Tagen, sequenzierten ihr Genom innerhalb von Wochen und verfügten innerhalb eines Jahres über Impfstoffe gegen das Virus, womit die Zahl der Toten auf einen Bruchteil der Todesopfer historischer Pandemien eingedämmt werden konnte.
Das kognitive Rüstzeug, mit dessen Hilfe wir die Welt verstehen und zu unserem Vorteil gestalten, ist keine Trophäe der westlichen Zivilisation; es ist das Erbe unserer Spezies. Die in der Kalahari im Süden Afrikas lebenden San gehören zu den ältesten Völkern der Erde, und ihre Lebensweise als Wildbeuter, die sie bis vor kurzem aufrechterhalten konnten, erlaubt uns Einblicke in das Leben, das die Menschen den größten Teil ihrer Existenz über geführt haben.[4] Jäger und Sammler schleudern nicht einfach nur Speere auf vorbeilaufende Tiere oder suchen Früchte und Nüsse, die um sie herum wachsen.[5] Der Fährtensucher Louis Liebenberg, der mehrere Jahrzehnte unter den San geforscht hat, beschreibt, wie sie dank ihrer wissenschaftlichen Denkweise überleben können.[6] Sie erschließen sich den Weg von bruchstückhaften Daten bis zu weit entfernt liegenden Folgerungen mit einem intuitiven logischen Verständnis, kritischem Denken, statistischer Argumentation, Kausalschlüssen und Spieltheorie.
Die San betreiben die Hetzjagd, wobei sie von unseren drei hervorstechendsten Merkmalen profitieren: unserer Zweibeinigkeit, die effizientes Rennen ermöglicht, unserer Haarlosigkeit, die uns in heißem Klima erlaubt, Wärme zu verdunsten, und unseren großen Köpfen, die uns zu rationalem Denken befähigen. Die San nutzen diese Rationalität, um die flüchtenden Tiere mittels ihrer Hufabdrücke, Ausdünstungen und anderer Spuren aufzuspüren und sie so lange zu verfolgen, bis sie wegen Erschöpfung oder einem Hitzschlag zusammenbrechen.[7] Manchmal folgen die San einem Tier auf dessen üblichen Wegen, oder sie suchen es, wenn die Fährte kalt geworden ist, indem sie um seine letzten entdeckten Spuren immer weitere Kreise ziehen. Oft aber spüren sie die Tiere mit Hilfe von Schlussfolgerungen auf.
Jäger unterscheiden Dutzende Arten anhand der Form und des Abstandes ihrer Spuren und stützen sich dabei auf ihr Wissen über Ursache und Wirkung. So folgern sie, dass eine tiefe, spitz zulaufende Spur von einem agilen Springbock stammt, der auf gute Griffigkeit angewiesen ist, während eine flachfüßige Spur auf einen schweren Kudu schließen lässt, der sein Gewicht zu tragen hat. Sie können das Geschlecht der Tiere aufgrund der Anordnung ihrer Spuren und der relativen Entfernung ihres Urins von den Hinterfüßen und ihren Exkrementen bestimmen. Mit Hilfe dieser Kategorien ziehen sie syllogistische Schlussfolgerungen: Während der Regenzeit kann man Steinantilopen und Ducker zu Tode hetzen, weil der nasse Sand ihre Hufe spaltet und ihre Gelenke steif werden lässt; Kudus und Elenantilopen kann man in der Trockenzeit jagen, weil sie im lockeren Sand schnell ermüden. Wir haben Trockenzeit, und das Tier, das diese Fährte hinterlassen hat, ist ein Kudu; darum können wir dieses Tier zu Tode hetzen.
Die San ordnen Tiere nicht nur Kategorien zu, sondern nehmen auch feinkörnigere logische Differenzierungen vor. Sie halten Individuen derselben Art anhand ihrer Hufabdrücke auseinander, indem sie auf verräterische Kerben und Variationen achten. Und sie unterscheiden die dauerhaften Eigenschaften eines Individuums wie Spezies und Geschlecht von kurzfristigen Zuständen wie Müdigkeit, die sie aus Anzeichen wie dem Nachziehen der Hufe und Ruhepausen erschließen. Entgegen dem landläufigen Irrtum, dass prämoderne Völker über keinerlei Zeitkonzept verfügen, schätzen sie das Alter eines Tieres ausgehend von der Größe und Scharfkantigkeit seiner Hufabdrücke und können seine Spur aufgrund der Frische der Fährte, der Feuchtigkeit von Speichel oder Exkrementen, des Einfallswinkels der Sonne in Relation zu einem schattigen Ruheplatz und der Überlagerungen durch die Fährten anderer Tiere datieren. Ohne diese logischen Feinheiten würde die Hetzjagd nicht funktionieren. Ein Jäger darf nicht irgendeinen beliebigen Spießbock unter den vielen, die Spuren hinterlassen haben, verfolgen, sondern nur den einen, den er schon in die Erschöpfung getrieben hat.
Überdies beherrschen die San auch kritisches Denken. Sie wissen, dass sie nicht allein auf den ersten Eindruck vertrauen dürfen, und sind sich der Gefahr bewusst, nur das zu sehen, was sie sehen wollen. Zudem akzeptieren sie keine Argumente, die sich nur auf Autorität stützen. Jeder, auch ein junger Schnösel, darf eine Vermutung verwerfen oder selbst eine äußern, bis die Diskussion zu einem Konsens führt. Auch wenn hauptsächlich die Männer auf die Jagd gehen, sind die Frauen ebenso gute Spurenleserinnen; Liebenberg berichtet, dass eine junge Frau, !Nasi, »die Männer in den Schatten stellte«.[8]
Die San justieren ihre Überzeugung von einer Hypothese je nach der Aussagekraft der Indizien – hier operieren sie also mit bedingter Wahrscheinlichkeit. So weist der Fuß eines Stachelschweins zwei proximale Ballen auf, während ein Honigdachs nur einen besitzt. Es kann jedoch sein, dass sich auf hartem Untergrund nur ein Ballenabdruck abzeichnet. Das bedeutet: Obwohl es sehr wahrscheinlich ist, dass eine Fährte nur einen Ballenabdruck aufweist, falls sie von einem Honigdachs stammt, ist umgekehrt die Wahrscheinlichkeit, dass eine Fährte von einem Honigdachs stammt, falls sie nur einen Ballenabdruck aufweist, geringer (da es sich auch um die unvollständige Fährte eines Stachelschweins handeln könnte). Die San bringen diese bedingten Wahrscheinlichkeiten nicht durcheinander – sie wissen: Da zwei Ballenabdrücke nur von einem Stachelschwein stammen können, ist es sehr wahrscheinlich, dass es sich bei zwei Ballenabdrücken um ein Stachelschwein handelt.
Außerdem justieren die San ihre Überzeugung von einer Hypothese je nach ihrer A-priori-Plausibilität. Wenn eine Fährte uneindeutig ist, nehmen die San an, dass sie von einer häufig vorkommenden Art stammt; nur bei eindeutigen Indizien kommen sie zu dem Schluss, dass die Fährte von einer selteneren Art verursacht wurde.[9] Wie wir sehen werden, ist dies der Kern des Bayes’schen Schlussfolgerns.
Eine weitere von den San angewandte Fähigkeit kritischen Denkens ist die Unterscheidung zwischen Kausalität und Korrelation. Liebenberg erinnert sich: »Ein Spurenleser, Boroh//xao, sagte, wenn [die Lerche] singe, trockne sie das Erdreich, sodass die Wurzeln gut zu essen seien. Danach meinten !Nate und /Uase, Boroh//xao habe unrecht – es sei nicht der Vogel, der das Erdreich trockne, sondern die Sonne. Der Vogel erzähle ihnen nur, dass der Boden in den kommenden Monaten austrocknen werde und dies die Zeit des Jahres sei, in der die Wurzeln gut zu essen seien.«[10]
Die San nutzen das Wissen über die Kausalzusammenhänge in ihrer Umwelt nicht nur, um zu verstehen, wie sie beschaffen ist, sondern auch, um sich vorzustellen, wie sie beschaffen sein könnte. Indem sie im Geiste Szenarien durchspielen, sind sie den Tieren in ihrer Welt gedanklich um einige Schritte voraus und entwickeln komplizierte Fallen, um sie zu fangen. Das eine Ende eines elastischen Zweiges wird im Boden verankert und der Zweig in der Mitte gebogen; das andere Ende wird an einer Schlinge befestigt, die unter Zweigen und Sand verborgen ist und von einem Auslöser fixiert wird. Die San errichten die Fallen an der Öffnung von Barrieren, die sie um den Ruheplatz einer Antilope errichtet haben, und leiten das Tier über ein Hindernis, das es überwinden muss, an den todbringenden Ort. Wenn sie die Spuren eines Straußes unter einem Kameldornbaum ausmachen (dessen Hülsenfrüchte für den Strauß eine Delikatesse sind), locken sie das Tier in die Falle, indem sie dort auffällig einen Knochen platzieren, der zu groß ist, um vom Strauß verschluckt zu werden, ihn aber auf einen kleineren, jedoch immer noch nicht schluckbaren Knochen aufmerksam macht, der ihn wiederum zu einem noch kleineren Knochen führt – dem Köder in der Falle.
Doch trotz aller tödlichen Effizienz ihrer Jagdtechnik haben die San über 100000 Jahre in einer lebensfeindlichen Wüste überlebt, ohne die Tiere, von denen sie abhängig sind, auszurotten. Während einer Dürreperiode bedenken sie die absehbaren Folgen, wenn sie die letzte Pflanze oder das letzte Tier einer Spezies vernichten würden, und verschonen die Exemplare der bedrohten Art.[11] Sie berücksichtigen die unterschiedliche Empfindlichkeit von Pflanzen, die nicht auswandern können, sich aber schnell erholen, wenn die Regenzeit einsetzt, und von Tieren, die eine Dürreperiode überstehen können, deren Bestände aber nur langsam wieder anwachsen. Und sie setzen diese »Naturschutzmaßnahmen« auch gegen die permanente Versuchung zu wildern durch (weil jeder versucht sein könnte, die rare Spezies auszubeuten, weil ihm sonst alle anderen zuvorkommen würden), indem sie die Normen des wechselseitigen Gebens und Nehmens und des kollektiven Wohlergehens, denen all ihre Ressourcen untergeordnet sind, darauf ausweiten. Für einen Jäger der San ist es undenkbar, sein Fleisch nicht mit einem Mitglied seiner Gruppe, das leer ausgegangen ist, zu teilen oder eine benachbarte Gruppe auszugrenzen, die die Dürre aus ihrem Territorium vertrieben hat. Sie wissen, dass das Gedächtnis lange zurückreicht und sich das Blatt eines Tages auch wenden könnte.
Die Weisheit der San lässt das Rätsel der menschlichen Rationalität noch schärfer hervortreten. Trotz unserer uralten Vernunftbegabung sehen wir uns heute allerorten mit Belegen für die Trugschlüsse und Torheiten unserer Mitmenschen konfrontiert. Die Leute zocken und spielen Lotto, was ihnen Verluste garantiert, investieren aber nicht in ihre Altersvorsorge, was ihnen einen Gewinn garantieren würde. Drei Viertel der US-Amerikaner glauben an mindestens ein Phänomen, das nicht mit den Gesetzen der Naturwissenschaft vereinbar ist, darunter Geistheilung (55 Prozent), übersinnliche Wahrnehmung (41 Prozent), Spukhäuser (37 Prozent) und Geister (32 Prozent) – was auch bedeutet, dass manche Leute an Häuser glauben, in denen es spukt, ohne an Geister zu glauben.[12] In den sozialen Medien verbreiten sich Fake News (wie »Joe Biden bezeichnet Trump-Anhänger als ›Abschaum der Gesellschaft‹« und »Mann aus Florida verhaftet, weil er Alligatoren in den Everglades betäubt und vergewaltigt hat«) schneller und weiter als die Wahrheit, und Menschen verbreiten sie eher als Bots.[13]
Mittlerweile gilt es als Binsenwahrheit, dass Menschen schlicht irrational sind – mehr Homer Simpson als Mr. Spock, mehr Alfred E. Neumann als John von Neumann. Und was sonst, so fahren die Zyniker fort, würde man wohl von Nachfahren von Jägern und Sammlern erwarten, deren Verstand darauf hin selektiert wurde, nicht als Leckerbissen für Leoparden zu enden? Dagegen betonen Evolutionspsychologen, die von der Genialität der Wildbeutervölker wissen, dass sich der Mensch im Laufe seiner Evolution die »kognitive Nische« erobert hat – die Fähigkeit, die Natur mittels Sprache, Gemeinschaftssinn und Knowhow zu überlisten.[14] Wenn Ihnen also die Menschen von heute irrational erscheinen, geben Sie nicht den Jägern und Sammlern die Schuld dafür.
Wie können wir uns dann einen Reim auf dieses Ding namens Rationalität machen, das uns anscheinend in die Wiege gelegt wurde, aber so oft und eklatant mit Füßen getreten wird? Zunächst einmal müssen wir begreifen, dass Rationalität keine Kraft ist, die ein Akteur besitzt oder eben nicht, so wie der Röntgenblick von Superman. Sie ist ein Sortiment kognitiver Werkzeuge, mit deren Hilfe sich in ganz bestimmten Welten ganz bestimmte Ziele erreichen lassen. Um zu verstehen, was Rationalität bedeutet, warum sie ein seltenes Gut zu sein scheint und warum sie wichtig ist, müssen wir bei den Grundwahrheiten der Rationalität selbst ansetzen – also dabei, welche Überlegungen intelligente Akteure angesichts ihrer Ziele und der Welt, in der sie leben, anstellen sollten. Diese »normativen« Modelle stammen aus der Logik, Philosophie, Mathematik und Künstlichen Intelligenz; sie spiegeln unser bestmögliches Wissen über die »richtige« Lösung für ein Problem wider und dafür, wie wir sie finden können. Sich ihrer zu bedienen sollte ein Anspruch sein für all diejenigen, die rational sein wollen, und das sollte heißen: für alle Menschen. Ein zentrales Anliegen dieses Buches ist, die am häufigsten anwendbaren normativen Instrumente der Vernunft zu erläutern; sie werden in den Kapiteln 3 bis 9 behandelt.
Normative Modelle geben uns zudem Richtwerte an die Hand, die uns beurteilen helfen, wie menschliche Schlemihle tatsächlich ihre Schlüsse ziehen; damit befassen sich die Psychologie und die anderen Verhaltenswissenschaften. Auf wie viele Arten und Weisen normale Leute diese Richtwerte verfehlen, haben Daniel Kahneman, Amos Tversky und weitere Psychologen und Verhaltensökonomen in ihren berühmten und mit Nobelpreisen bedachten Studien aufgezeigt.[15] Wenn Menschen in ihren Urteilen von einem normativen Modell abweichen, was sie häufig tun, gilt es dieses Rätsel zu lösen. Zuweilen offenbart das Missverhältnis echte Irrationalität: Das Menschenhirn ist mit der Komplexität eines Problems überfordert oder sitzt einem Denkfehler auf, der es gemeinerweise immer wieder auf die falsche Fährte lockt.
In vielen Fällen hat der menschliche Wahnsinn aber auch Methode. Es kann sein, dass uns ein Problem in einem irreführenden Format präsentiert wird, und sobald es für unseren Geist leichter verdaulich verpackt ist, lösen wir es. Manchmal ist das normative Modell nur in einem bestimmten Umfeld gültig und man hat das berechtigte Gefühl, dass man sich momentan nicht in diesem Umfeld befindet, so dass das Modell nicht greift. Oder das Modell ist auf das Erreichen eines ganz bestimmten Zieles geeicht, während man auf Gedeih und Verderb ein anderes Ziel im Auge hat. In den nachfolgenden Kapiteln werden uns Beispiele für all diese mildernden Umstände begegnen. Im vorletzten Kapitel wird dargelegt, inwiefern sich einige der aktuellen überbordenden Ausbrüche von Irrationalität als rationales Verfolgen von Zielen verstehen lassen, wenn auch nicht als ein objektives Verständnis der Welt.
Erklärungen für Irrationalität mögen uns zwar vor dem Vorwurf purer Dummheit in Schutz nehmen, doch Verstehen bedeutet nicht Vergeben. Gelegentlich dürfen wir an Menschen strengere Maßstäbe anlegen. Man kann ihnen beibringen, unter dem oberflächlichen Äußeren ein tiefer liegendes Problem zu erkennen. Man kann sie dazu anspornen, aus ihrer Komfortzone herauszutreten und dabei ihre besten Denkgewohnheiten zu aktivieren. Und man kann sie dazu inspirieren, mehr als nur selbstzerstörerische oder für die Gemeinschaft schädliche Ziele anzuvisieren. Auch das möchte dieses Buch erreichen.
Da sich in der Urteils- und Entscheidungsforschung immer wieder gezeigt hat, dass sich Menschen rationaler verhalten, wenn die ihnen dargebotenen Informationen anschaulicher und einschlägiger sind, werde ich Ihnen einige Beispiele aus den Bereichen Mathematik, Logik, Wahrscheinlichkeit und Prognosen präsentieren. Jeder dieser Klassiker offenbart eine Laune unseres Denkapparats und dient als Vorschau auf die in den folgenden Kapiteln erläuterten normativen Rationalitätsstandards (und die Art und Weise, wie wir von ihnen abweichen).
Drei einfache mathematische Probleme
Jeder weiß noch, wie er sich auf der weiterführenden Schule mit Aufgaben in Algebra herumgequält hat – zum Beispiel: Wo wird der Zug, der Ostheim mit einer Geschwindigkeit von 110 km/h Richtung Westen verlassen hat, auf den Zug treffen, der mit 90 km/h Richtung Osten vom 420 Kilometer entfernten Westheim abgefahren ist? Die folgenden drei Aufgaben sind simpler – Sie können sie im Kopf lösen:
Ein Smartphone und seine Hülle kosten zusammen 110 Euro. Das Handy kostet 100 Euro mehr als die Hülle. Wie viel kostet die Hülle?
8 Drucker brauchen 8 Minuten, um 8 Prospekte zu drucken. Wie lange brauchen 24 Drucker, um 24 Prospekte zu drucken?
Auf einem Acker befindet sich ein Flecken mit Unkraut. Jeden Tag verdoppelt sich die mit Unkraut bedeckte Fläche. In 30 Tagen hat sich das Unkraut über den gesamten Acker ausgebreitet. Wie lange hat es gedauert, bis es den halben Acker bedeckte?
Die Lösung der ersten Aufgabe lautet 5 Euro. Die meisten Leute sagen 10 Euro. Aber dann würde das Handy 110 Euro kosten (100 Euro mehr als die Hülle) und der Gesamtpreis 120 Euro betragen.
Die Lösung der zweiten Aufgabe lautet 8 Minuten. Ein Drucker braucht 8 Minuten, um einen Prospekt zu drucken. Wenn so viele Prospekte gedruckt werden, wie es Drucker gibt, die alle gleichzeitig in Betrieb sind, bleibt die Zeit zum Drucken der Prospekte gleich.
Die Lösung der dritten Aufgabe lautet 29 Tage. Wenn sich das Unkraut jeden Tag verdoppelte, dann muss der Acker an dem Tag, bevor er komplett von Unkraut überwuchert war, zur Hälfte mit Unkraut bedeckt gewesen sein.
Der Ökonom Shane Frederick stellte diese Aufgaben (mit unterschiedlichen Beispielen) Tausenden Studierenden und stellte fest, dass fünf von sechs bei mindestens einer Frage falschlagen, während ein Drittel von ihnen alle falsch beantworteten.[1] Dennoch gibt es für jede Aufgabe eine einfache Lösung, die so gut wie jeder versteht, wenn man sie erklärt. Das Problem besteht darin, dass wir uns durch oberflächliche Merkmale der Aufgaben verwirren lassen, von denen wir fälschlich annehmen, dass sie für die Lösung relevant sind, so wie die glatten Zahlen »100« und »10« in der ersten Aufgabe und die Tatsache, dass bei der zweiten Aufgabe die Anzahl der Drucker identisch mit der Anzahl der Minuten ist.
Frederick nennt seinen simplen Aufgabenkatalog den Cognitive Reflection Test und behauptet, er offenbare eine Kluft zwischen zwei kognitiven Systemen, denen Kahneman (sein gelegentlicher Koautor) in seinem Bestseller Schnelles Denken, langsames Denken 2011 zu Berühmtheit verhalf. System 1 arbeitet rasch und mühelos und verführt uns zu den falschen Antworten; System 2 erfordert Konzentration, Motivation und die Anwendung erlernter Regeln und ermöglicht es uns, die richtigen Lösungen zu erfassen. Niemand geht davon aus, dass es sich hierbei buchstäblich um zwei anatomisch getrennte Systeme im Gehirn handelt – es sind zwei Arbeitsweisen, die viele verschiedene Hirnstrukturen beanspruchen. System 1 steht für vorschnelle Urteile; System 2 steht für gründliches Überlegen.
Der Cognitive Reflection Test lehrt uns: Denkfehlern liegt nicht zwingend Unfähigkeit, sondern vielleicht auch Gedankenlosigkeit zugrunde.[2] Selbst Studierende des mathematikaffinen Massachusetts Institute of Technology lösten durchschnittlich nur zwei Drittel der Aufgaben richtig. Wie zu erwarten, korreliert das Abschneiden bei den Aufgaben durchaus mit mathematischen Kenntnissen, aber auch mit Geduld. Personen, die sich selbst als nicht impulsiv bezeichnen und die lieber auf eine größere Auszahlung in einem Monat warten, als sofort eine kleinere zu erhalten, gehen seltener in die Falle.[3]
Die beiden ersten Aufgaben sehen wie Fangfragen aus, weil sie Details enthalten, die in einem normalen Gespräch für das, was der Sprecher wissen möchte, relevant wären. Hier aber sollen sie den Hörer in die Irre führen. (Wir schneiden besser ab, wenn das Smartphone, sagen wir, 73 Euro mehr kostet als die Hülle und beides zusammen 89 Euro kostet.)[4] Doch natürlich lauern im wirklichen Leben ebenfalls Holzwege und Sirenengesänge, die uns von den richtigen Entscheidungen fortlocken, und ihnen zu widerstehen trägt zu rationalem Verhalten bei. Personen, die beim Cognitive Reflection Test den verlockenden falschen Antworten erliegen, scheinen auch in anderen Belangen weniger rational zu sein – so lehnen sie lukrative Angebote ab, die ein wenig Wartezeit oder eine geringe Risikobereitschaft verlangen.
Die dritte Aufgabe, die mit dem Unkraut, ist keine Fangfrage, sondern deckt eine echte kognitive Schwäche auf. Die menschliche Intuition tut sich schwer mit dem Erfassen eines exponentiellen (geometrischen) Wachstums, also von etwas, das proportional zu seiner bereits erreichten Größe immer schneller ansteigt – zum Beispiel Zinseszinsen, Wirtschaftswachstum und die Ausbreitung einer ansteckenden Krankheit.[5] Wir glauben fälschlicherweise, es handle sich um einen langsamen und stetigen Prozess oder eine leichte Beschleunigung, und können uns die unerbittlich voranschreitende Verdoppelung nicht vorstellen. Wenn Sie auf ein Rentenkonto jeden Monat 400 Euro einzahlen, die jährlich zehn Prozent einbringen, wie umfangreich wird Ihr finanzielles Polster dann nach 40 Jahren sein? Viele Leute schätzen, etwa 200000 Euro. Das erhält man, wenn man 400 mal 12 mal 110 Prozent mal 40 rechnet. Einigen ist klar, dass das nicht stimmen kann, weshalb sie den Schätzwert nach oben korrigieren – aber nie weit genug. So gut wie niemand gibt die korrekte Antwort: 2,5 Millionen Euro. Man hat herausgefunden, dass die Personen mit der schwammigsten Vorstellung von exponentiellem Wachstum weniger für ihren Ruhestand zur Seite legen und mehr Kreditkartenschulden machen – gleich zwei Wege, die in die Armut führen.[6]
Auch Experten sind gelegentlich nicht in der Lage, sich das Ausmaß einer exponentiellen Beschleunigung auszumalen – selbst wenn es sich um Experten für kognitive Verzerrungen handelt. Als Covid-19 im Februar 2020 in den Vereinigten Staaten und Europa Einzug hielt, vertraten mehrere Sozialwissenschaftler (darunter zwei Helden dieses Buches, wenn auch nicht Kahneman selbst) die Auffassung, die um sich greifende Panik sei irrational, weil die Leute von nur einem oder zwei gruseligen Fällen gehört hätten und nun der »Verfügbarkeitsverzerrung« und der »Wahrscheinlichkeitsvernachlässigung« zum Opfer fielen. Das objektive Risiko, so behaupteten sie, sei niedriger als jenes bei Grippe oder einer Halsentzündung durch Streptokokken, das jeder gelassen hinnehme.[7] Der Denkfehler der Denkfehlerverteufler bestand darin, die steigende Rate zu unterschätzen, mit der sich eine so hochinfektiöse Krankheit wie Covid ausbreiten kann, da jeder Patient nicht nur andere Personen ansteckt, sondern sie zugleich zu Überträgern des Virus macht. Der eine Todesfall in den USA vom 1. März erhöhte sich in den darauffolgenden Wochen auf 2, 6, 40, 264, 901 und 1729 Todesopfer pro Tag, bis die Gesamtzahl am 1. Juni auf über 100000 Tote gestiegen war, womit sich das Virus in Windeseile zur tödlichsten Gefahr des Landes hinter Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Krebs und Demenz entwickelte.[8] Natürlich kann man die Verfasser dieser vereinzelten Kommentare nicht für die gefährliche Sorglosigkeit verantwortlich machen, mit der sich viele Führungspersönlichkeiten und Bürger in Sicherheit wiegten, doch ihre Äußerungen zeigen, wie tief verwurzelt kognitive Verzerrungen sein können.
Warum missunterschätzen Menschen exponentielles Wachstum, wie es George W. Bush vielleicht ausgedrückt hätte? In der großartigen Tradition des Arztes in Molières Stück Der eingebildete Kranke, der erklärt, Opium ermüde Menschen durch seine »virtus dormitiva, etwas, das zum Schlafen führt«, begründen die Sozialwissenschaftler die Irrtümer mit einer »exponentiellen Wachstumsverzerrung«. Um es weniger zirkulär zu formulieren, könnten wir auf die Kurzlebigkeit exponentieller Prozesse in natürlichen Umgebungen (wie sie vor historischen Innovationen wie Wirtschaftswachstum und Zinseszinsen existierten) verweisen. Dinge, die nicht ewig andauern können, tun das auch nicht, und Organismen können sich nur so lange vermehren, bis sie ihre Umwelt ausgezehrt oder verseucht haben oder diese gesättigt ist, was die exponentielle Kurve zu einem S krümmt. Das gilt auch für Pandemien, die abklingen, sobald genügend anfällige Wirte in der Herde getötet wurden oder immun werden.
Ein einfaches Logikproblem
Wenn irgendetwas das Herzstück der Rationalität ausmacht, dann ist es sicher die Logik. Der Prototyp einer rationalen Schlussfolgerung ist der Syllogismus »Wenn P, dann Q.P. Also Q.« Betrachten wir ein einfaches Beispiel.
Angenommen, das Münzgeld eines Landes weist auf einer Seite das Porträt eines seiner bedeutenden Staatsoberhäupter auf und auf der anderen Seite ein Exemplar seiner großartigen Tierwelt. Eine simple Wenn-dann-Regel könnte lauten: »Wenn auf der einen Seite einer Münze ein König abgebildet ist, dann ist auf der anderen ein Vogel abgebildet.« Unten sehen Sie vier Münzen mit einem König, einer Königin, einem Elch und einer Ente. Welche müssen Sie umdrehen, um festzustellen, ob gegen die Regel verstoßen wurde?
Die meisten Leute sagen »den König« oder »den König und die Ente«. Die richtige Antwort lautet »den König und den Elch«. Warum? Jedem leuchtet ein, dass man den König umdrehen muss, denn wenn auf der Rückseite kein Vogel wäre, so wäre die Regel eindeutig verletzt. Die meisten Leute wissen, dass es sinnlos wäre, die Königin umzudrehen, denn die Regel besagt: »Wenn König, dann Vogel.« Von Münzen mit einer Königin ist nicht die Rede. Viele meinen, man müsse die Ente umdrehen, aber mit ein bisschen Nachdenken zeigt sich, dass diese Münze irrelevant ist. Die Regel lautet »Wenn König, dann Vogel« und nicht »Wenn Vogel, dann König«. Würde sich die Ente ihre Münze mit einer Königin teilen, so wäre das kein Regelverstoß. Was aber ist mit dem Elch? Würden Sie diese Münze umdrehen und auf der anderen Seite einen König vorfinden, hätte man gegen die Regel »Wenn König, dann Vogel« verstoßen. Also lautet die Antwort »König und Elch«. Dafür entscheiden sich durchschnittlich nur zehn Prozent der Befragten.
Die Wason Selection Task (benannt nach ihrem Schöpfer, dem Kognitionspsychologen Peter Wason) wurde 65 Jahre lang mit verschiedenen »Wenn-P-dann-Q«-Regeln durchgeführt. (In der Originalversion stand auf der einen Seite der Karten ein Buchstabe und auf der anderen eine Zahl, und die Regel lautete: »Wenn auf einer Seite ein D ist, dann ist auf der anderen eine 3.«) Immer wieder drehen die Leute das P oder das P und das Q um, aber lassen das Nicht-Q liegen.[1] Es ist durchaus nicht so, dass sie außerstande wären, die richtige Antwort nachzuvollziehen. Sobald man ihnen die Lösung erklärt, schlagen sie sich, genau wie beim Cognitive Reflection Test, an die Stirn und akzeptieren sie.[2] Doch wenn sie auf sich allein gestellt sind, kapituliert ihre unreflektierte Intuition vor der Logik.
Was sagt uns das über die menschliche Rationalität? Eine verbreitete Erklärung lautet, es offenbare den Bestätigungsfehler (confirmation bias) – die schlechte Angewohnheit, nach Belegen zu suchen, die eine Überzeugung untermauern, und Belege, die sie entkräften könnten, zu ignorieren.[3] Darum glauben wir, dass Träume Omen sind, weil wir uns an einen Traum erinnern, in dem einer Verwandten ein Unglück zustieß, das dann wirklich eintraf, doch dabei vergessen wir die vielen Male, in denen es unserer Verwandten gutging, obwohl wir geträumt hatten, ihr sei etwas Schlimmes passiert. Oder wir sind der Meinung, dass Migranten zahlreiche Verbrechen begehen, weil in der Zeitung gestanden hat, ein Laden sei von einem Migranten überfallen worden, und ignorieren dabei, dass viel mehr Läden von Einheimischen überfallen werden.
Der Bestätigungsfehler wird häufig als Ursache menschlicher Dummheit diagnostiziert und ist ein beliebter Ansatzpunkt zur Förderung rationalen Verhaltens. Francis Bacon (1561–1626), dem man gemeinhin zuschreibt, die wissenschaftliche Methode entwickelt zu haben, berichtete von einem Mann, den man in den Tempel führte, um ihm Bildtafeln mit Seeleuten zu zeigen, die dank ihrer heiligen Gelübde einen Schiffbruch überlebt hatten. Darauf sagte er: »Wo sind denn jene aufgeschrieben, die trotz ihrer feierlich abgelegten Gelübde ertrunken sind?« Bacon bemerkte dazu: »In gleicher Weise verhält es sich etwa mit allem Aberglauben wie in der Astrologie, bei den Träumen, den Vorzeichen, den göttlichen Strafgerichten und dergleichen mehr. An Torheiten solcher Art haben die Menschen ihre Freude und schwören darauf, wo es eingetroffen ist; wo es aber fehlgeht, mag es auch weit öfter geschehen, wird es übersehen und übergangen.«[4] In Anlehnung an ein berühmtes Argument des Philosophen Karl Popper unterstreichen die meisten Wissenschaftler der heutigen Zeit, dass die Grenze zwischen Wissenschaft und Pseudowissenschaft dort verläuft, wo Verfechter einer Hypothese bewusst nach Belegen suchen, die sie falsifizieren könnten, und die Hypothese nur dann aufrechterhalten, wenn sie sich dagegen behaupten kann.[5]
Wie gelingt es uns, unser Leben zu meistern, wenn wir nicht einmal die elementarste Regel der Logik beherrschen? Zum einen ist zu bedenken, dass die Selection Task eine spezielle Herausforderung ist.[6] Die Aufgabe lautet weder, den Syllogismus anzuwenden, um eine sinnvolle Schlussfolgerung zu ziehen (»Hier ist eine Münze mit einem König drauf. Was ist auf der anderen Seite?«), noch, die Regel ganz allgemein zu testen (»Trifft die Regel auf die Münzen dieses Landes zu?«). Vielmehr wird gefragt, ob die Regel speziell auf einige Gegenstände zutrifft, die vor den Befragten auf einem Tisch liegen. Zum anderen denken Menschen durchaus logisch, wenn die Regel nicht arbiträre Symbole und eigens kreierte Gegenstände betrifft, sondern die Normen und Regeln des menschlichen Lebens.
Nehmen wir an, die Post verkauft 50-Cent-Briefmarken für Standardbriefe, verlangt aber 10-Euro-Briefmarken für Expressbriefe. Vorschriftsmäßig frankierte Post muss also der Regel genügen: »Wenn ein Brief einen Express-Vermerk trägt, muss eine 10-Euro-Briefmarke drauf kleben.« Angenommen, Adresse und Briefmarke passen nicht auf dieselbe Umschlagseite, so dass ein Postangestellter jeden Umschlag umdrehen muss, um zu prüfen, ob der Absender die Regel befolgt hat. Unten sehen Sie vier Umschläge. Welche müssten Sie umdrehen, wenn Sie bei der Post angestellt wären?
Die richtige Antwort lautet erneut P und Nicht-Q, also den Express-Umschlag und den Umschlag mit der 50-Cent-Briefmarke. Obwohl die Aufgabe logisch äquivalent zu der Aufgabe mit den vier Münzen ist, macht hierbei nun praktisch niemand einen Fehler. Der Inhalt eines logischen Problems spielt eine Rolle.[7] Definiert eine Wenn-dann-Regel einen Vertrag mit Rechten und Pflichten – »Wenn du Nutzen daraus ziehst, musst du dafür bezahlen« –, so ist ein Verstoß gegen die Regel (profitieren, ohne zu zahlen) gleichbedeutend mit einem Betrug, und wir wissen intuitiv, wie wir einen Betrüger entlarven können. Wir nehmen keine Leute unter die Lupe, die von dem Vertrag nicht profitieren, und auch keine, die ihren Obolus entrichtet haben, denn womit sollten sie davonkommen wollen?
Kognitionspsychologen erforschen sehr genau, welche Inhalte uns vorübergehend in Logiker verwandeln. Dabei kann es sich nicht um irgendwelche konkreten Szenarien handeln, sondern vielmehr um logische Herausforderungen von der Art, die wir während unserer Entwicklung zum Erwachsenen und vielleicht auch während unserer Evolution zum Menschen zu beherrschen gelernt haben. Eines dieser Themen, die die Logik in uns wachkitzeln, ist die Überwachung eines Privilegs oder einer Pflicht; ein anderes ist das Achten auf Gefahren. Wenn wir die Einhaltung der Sicherheitsmaßnahme »Wenn du Fahrrad fährst, musst du einen Helm tragen« gewährleisten wollen, müssen wir sichergehen, dass ein Kind auf einem Fahrrad einen Helm trägt und dass ein Kind ohne Helm nicht auf ein Fahrrad steigt.
Freilich ist ein Gehirn, das die Verletzung einer Wenn-dann-Regel entdecken kann, wenn diese Verletzung Betrug oder Gefahr bedeutet, nicht unbedingt ein logisch denkendes Gehirn. Logik beschäftigt sich per definitionem nicht mit den Inhalten von Aussagen, sondern mit ihrer Form – auf welche Weisen Ps und Qs durch WENN, DANN, UND, ODER, NICHT, EINIGE und ALLE miteinander verknüpft sind, und zwar ganz unabhängig davon, wofür sie stehen. Logik ist eine meisterliche Errungenschaft menschlicher Erkenntnisfähigkeit. Sie strukturiert unsere geistige Auseinandersetzung mit einer ungewohnten oder abstrakten Thematik, wie den Gesetzen eines Staates oder der Naturwissenschaft, und in Silizium eingebettet verwandelt sie träge Materie in denkende Maschinen. Was der ungebildete menschliche Geist jedoch beherrscht, ist kein inhaltsleeres Allzweckwerkzeug mit Formeln wie »[WENN P, DANN Q] ist logisch äquivalent zu NICHT-[P UND NICHT Q]«, in die sich jedes beliebige P und Q einpassen lässt. Er beherrscht ein Sortiment stärker spezialisierter Werkzeuge, die den für das Problem relevanten Inhalt mit den Regeln der Logik kombinieren (denn ohne diese Regeln wären die Werkzeuge unbrauchbar). Es fällt uns nicht leicht, die Regeln zu isolieren und sie bei neuartigen, abstrakten oder scheinbar bedeutungslosen Problemen anzuwenden. Dafür sind Bildungseinrichtungen und andere Institutionen zur Förderung der Rationalität zuständig. Sie erweitern die ökologische Rationalität, mit der wir geboren wurden und aufgewachsen sind – unseren gesunden Menschenverstand, unser Köpfchen – um die leistungsfähigeren und ein breiteres Spektrum abdeckenden Werkzeuge des logischen Denkens, die unsere besten Denker im Laufe der Jahrtausende perfektioniert haben.[8]
Ein einfaches Wahrscheinlichkeitsproblem
Eine der berühmtesten Spielshows aus der Blütezeit des Genres von den 1950er bis zu den 1980er Jahren war Let’s Make a Deal. Ihr Moderator Monty Hall erlangte zum zweiten Mal Berühmtheit, als man ein Dilemma der Wahrscheinlichkeitstheorie, das in gewisser Weise in der Show aus der Taufe gehoben wurde, nach ihm benannte.[1] Ein Kandidat steht vor drei Türen. Hinter einer befindet sich ein schnittiges neues Auto. Hinter den beiden anderen befindet sich je eine Ziege. Der Kandidat nennt eine Tür, zum Beispiel Tür 1. Um die Spannung zu erhöhen, öffnet Monty eine der beiden anderen Türen, sagen wir, Tür 3, hinter der eine Ziege zum Vorschein kommt. Um die Spannung noch zu steigern, erhalten die Kandidaten die Möglichkeit, entweder bei ihrer ersten Wahl zu bleiben oder zu der verbliebenen verschlossenen Tür zu wechseln. Nun sind Sie der Kandidat. Was würden Sie tun?
Fast alle bleiben bei ihrer ersten Wahl.[2] Sie denken sich, da das Auto nach dem Zufallsprinzip hinter eine der drei Türen gestellt wurde und Tür 3 nun ausgeschieden ist, besteht jeweils eine Fifty-fifty-Chance, dass sich das Auto hinter Tür 1 oder Tür 2 befindet. Sie glauben, es sei nicht von Nachteil zu wechseln, aber auch nicht von Vorteil. Also bleiben sie bei ihrer ersten Entscheidung – aus Bequemlichkeit, aus Stolz oder weil sie befürchten, sich mehr zu ärgern, wenn sich die Umentscheidung als Fehler entpuppt, als sich zu freuen, wenn es die richtige Entscheidung war.
Berühmt wurde das Monty-Hall-Dilemma im Jahr 1990, als es in der Kolumne »Ask Marilyn« des Magazins Parade vorgestellt wurde, das als Beilage in der Sonntagsausgabe Hunderter amerikanischer Zeitungen steckte.[3] Die Kolumnistin war Marilyn vos Savant, damals als »klügste Frau der Welt« bekannt, weil sie aufgrund der höchsten erreichten Punktzahl bei einem Intelligenztest ins Guinness-Buch der Rekorde Einzug gehalten hatte. Vos Savant schrieb, man solle seine Entscheidung revidieren – die Chance, dass sich das Auto hinter Tür 2 befinde, stehe zwei zu drei, die Chance, dass es sich hinter Tür 1 befinde, hingegen nur eins zu drei. Die Kolumne rief zehntausend Leserbriefe hervor, davon tausend von promovierten Mathematikern und Statistikern, und die meisten behaupteten, sie habe unrecht. Hier sind einige Beispiele:
Sie haben es vermasselt, und zwar richtig! Da Sie offenbar Probleme haben, das hier wirksame grundlegende Prinzip zu erfassen, werde ich es Ihnen erklären. Nachdem der Moderator eine Ziege präsentiert hat, gibt es eine Wahrscheinlichkeit von eins zu zwei, dass man richtigliegt. Die Chancen stehen gleich – ob man seine Meinung ändert oder nicht. Es gibt bereits genug mathematische Stümperei in diesem Land, und auf den welthöchsten IQ, der noch mehr davon verbreitet, können wir verzichten. Schämen Sie sich!
– Scott Smith, PhD, University of Florida
Ich bin sicher, dass Sie zu diesem Thema zahlreiche Briefe von Highschoolschülern und Collegestudenten erhalten werden. Vielleicht sollten Sie einige ihrer Adressen aufheben, um sich für künftige Kolumnen beraten zu lassen.
– W. Robert Smith, PhD, Georgia State University
Möglicherweise betrachten Frauen Mathematikaufgaben anders als Männer.
– Don Edwards, Sunriver, Oregon[4]
Einwände kamen auch von Paul Erdős (1913–1996), dem bedeutenden Mathematiker, der so produktiv war, dass viele Wissenschaftler mit ihrer Erdős-Zahl prahlen, die die kürzeste Verbindung über eine Koautorenschaft zwischen ihnen und dem großen Theoretiker angibt.[5]
Doch die schlauen Herren Mathematiker irrten, und die klügste Frau der Welt hatte recht. Man sollte tatsächlich seine Entscheidung revidieren. Das zu verstehen, ist gar nicht so schwer. Das Auto kann sich an drei möglichen Orten befinden. Nehmen wir uns mal jede der drei Türen vor und zählen nach, wie oft Sie jeweils mit den verschiedenen Strategien gewinnen würden. Sie haben Tür 1 ausgewählt, aber das ist natürlich nur ein willkürliches Etikett; solange Monty die Regel befolgt »Öffne eine nicht ausgewählte Tür, hinter der eine Ziege ist; wenn hinter beiden Türen Ziegen sind, öffne eine beliebige davon«, sind die Chancen immer gleich, egal, welche Sie vorher ausgewählt haben.
Angenommen, Sie verfolgen die Strategie »Nicht umentscheiden« (linker Teil der folgenden Abbildung). Befindet sich das Auto hinter Tür 1 (oben links), gewinnen Sie. (Welche von den beiden anderen Türen Monty geöffnet hat, spielt keine Rolle, weil Sie zu keiner von beiden wechseln.) Befindet sich das Auto hinter Tür 2 (Mitte links), verlieren Sie. Befindet sich das Auto hinter Tür 3 (unten links), verlieren Sie. Demnach haben Sie mit der Strategie »Nicht umentscheiden« eine Gewinnchance von eins zu drei.
Nun nehmen wir an, dass Sie die Strategie »Umentscheiden« verfolgen (rechter Teil der Abbildung). Befindet sich das Auto hinter Tür 1 (oben rechts), verlieren Sie. Befindet sich das Auto hinter Tür 2 (Mitte rechts), so hätte Monty Tür 3 geöffnet; also würden Sie sich nun für Tür 2 entscheiden und gewinnen. Befindet sich das Auto hinter Tür 3 (unten rechts), hätte er Tür 2 geöffnet; also würden Sie sich nun für Tür 3 entscheiden und gewinnen. Mit der Strategie »Umentscheiden« haben Sie also eine Gewinnchance von zwei zu drei und diese somit gegenüber der ersten Strategie verdoppelt.
Das ist kein Hexenwerk.[6] Selbst wenn Sie die logischen Möglichkeiten nicht durchdenken, könnten Sie allein ein paar Runden mit Papptüren und Spielfiguren spielen und die Ergebnisse zusammenrechnen, wie es auch Hall gemacht hat, um einen skeptischen Journalisten zu überzeugen. (Heutzutage kann man es auch online spielen.)[7] Oder Sie könnten Ihrem Bauchgefühl vertrauen, das Ihnen sagt: »Monty kennt die Lösung und hat mir einen Hinweis gegeben; es wäre dumm, nicht darauf zu reagieren.« Warum lagen die Mathematiker, Professoren und anderen großen Namen so daneben?
Zweifellos offenbarten sich darin Schwächen in kritischem Denken aufgrund von Sexismus, Ad-hominem-Fehlschlüssen und Berufsneid. Vos Savant ist eine attraktive und elegante Frau ohne Titel vor ihrem Namen, die für ein Boulevardblatt voller Rezepte und Klatschgeschichten schrieb und sich auf neckische Wortgeplänkel in Late-Night-Shows einließ.[8] Sie war das Gegenteil vom Stereotyp einer Mathematikerin, und ihre Berühmtheit und das Recht, mit ihrem Guinness-Buch-Eintrag anzugeben, machten sie zu einer wunderbaren Zielscheibe für Häme.
Zum Teil ist aber auch das Problem selbst das Problem. Wie die Kopfnüsse im Cognitive Reflection und Wason Selection Test zielt das Monty-Hall-Dilemma darauf ab, die Schwachstellen in unserem System 1 bloßzulegen. In diesem Fall jedoch schneidet System 2 auch nicht viel besser ab. Viele Leute wollen die korrekte Erklärung nicht wahrhaben, auch wenn man sie ihnen auf dem Silbertablett serviert. Das galt auch für Erdős, der sich gegen jegliche mathematische Berufsehre erst durch wiederholte Simulationen des Spiels überzeugen ließ.[9] Viele bleiben sogar stur bei ihrer Meinung, wenn sie solche Simulationen miterleben, und auch dann noch, wenn sie wiederholt um Geld spielen. Warum sind unsere Intuitionen und die Gesetze des Zufalls hier partout nicht unter einen Hut zu bringen?
Einen Hinweis bieten uns die vorschnellen Rechtfertigungen, die die Besserwisser für ihre Pleite parat hatten, weil sie teilweise unüberlegte Parallelen zu anderen Wahrscheinlichkeitsproblemen zogen. Viele Leute beharren darauf, dass alle unbekannten Alternativen (in diesem Fall die ungeöffneten Türen) den gleichen Wahrscheinlichkeitswert aufweisen. Für symmetrische Spielobjekte wie die Seiten einer Münze oder eines Würfels trifft das zu, und wenn man absolut nichts über die Alternativen weiß, ist es ein plausibler Ausgangspunkt. Aber es ist kein Naturgesetz.
Viele stellen sich die Kausalkette bildlich vor. Das Auto und die Ziegen wurden vor der Enthüllung platziert, und das Öffnen einer Tür kann sie nicht nachträglich an einen anderen Ort bewegen. Auf die Unabhängigkeit kausaler Mechanismen hinzuweisen, ist eine verbreitete Methode, um andere Illusionen wie den Spielerfehlschluss zu entzaubern: Wir glauben fälschlich, dass das Rouletterad nach einer Rotserie bei Schwarz stehenbleibt, aber weil das Rad kein Gedächtnis hat, sind alle Drehungen voneinander unabhängig. So erklärte einer der Leserbriefschreiber vos Savant männlich herablassend: »Stellen Sie sich ein Rennen mit drei Pferden vor, von denen alle gleiche Siegchancen haben. Wenn Pferd Nr. 3 nach 15 Metern tot zusammenbricht, haben die beiden verbleibenden Pferde jeweils nun nicht mehr eine Siegchance von eins zu drei, sondern eine von eins zu zwei.« Es liege auf der Hand, so schloss er, dass es keinen Sinn mache, nun nicht mehr auf Pferd Nr. 1, sondern auf Pferd Nr. 2 zu wetten. Doch so verhält es sich bei unserem Problem nicht. Stellen Sie sich vor, dass Gott, nachdem Sie auf Pferd Nr. 1 gesetzt haben, verkündet: »Der Sieger wird nicht Nr. 3 sein.« Er hätte auch davor warnen können, auf Nr. 2 zu setzen, aber das hat er nicht getan. Nun scheint es nicht mehr so abwegig zu sein, sich noch anders zu entscheiden. Bei Let’s Make a Deal ist Monty Hall Gott.[10]
Der gottgleiche Moderator führt uns die Exotik des Monty-Hall-Problems vor Augen. Es erfordert ein allwissendes Wesen, das die übliche Zielsetzung einer Unterhaltung ignoriert – nämlich das mitzuteilen, was der Hörer wissen muss (in diesem Fall, hinter welcher Tür sich das Auto verbirgt) – und stattdessen das Ziel verfolgt, die Spannung für die Zuschauer zu erhöhen.[11] Und im Gegensatz zur Welt, der unsere Detektivarbeit beim Hinweisgeben schnuppe ist, kennt der allmächtige Monty sowohl die Wahrheit als auch unsere Entscheidung und stimmt seine Offenbarung darauf ab.
Unsere mangelnde Sensibilität für diese lukrative, aber esoterische Information legt den Finger haargenau auf die kognitive Wunde, die den Kern des Rätsels ausmacht: Wir verwechseln Wahrscheinlichkeit (probability) mit Propensität (propensity). Die Propensität ist die Tendenz eines Objekts, sich auf bestimmte Weisen zu verhalten. Intuitionen bezüglich Tendenzen sind ein wichtiger Bestandteil unserer mentalen Modelle von der Welt. Wir wissen intuitiv, dass gebogene Zweige dazu neigen zurückzuschnellen, dass Kudus schnell ermüden können, dass Stachelschweine normalerweise Spuren mit zwei Ballenabdrücken hinterlassen. Eine Tendenz lässt sich nicht unmittelbar beobachten (entweder ist der Zweig zurückgeschnellt oder nicht), aber sie lässt sich erschließen, indem man die physikalische Beschaffenheit eines Objekts genau untersucht und die Gesetze von Ursache und Wirkung erforscht. Ein eher trockener Zweig kann brechen, in der Regenzeit hat ein Kudu mehr Ausdauer, ein Stachelschwein hat zwei proximale Ballen, die in weichem Untergrund Abdrücke hinterlassen, aber nicht zwangsläufig auf hartem Boden.
Doch Wahrscheinlichkeit ist etwas anderes – sie wurde im 17. Jahrhundert als ein konzeptionelles Instrument erfunden.[12] Das Wort hat verschiedene Bedeutungen, aber diejenige, die beim Treffen riskanter Entscheidungen relevant ist, ist die Stärke der eigenen Überzeugung angesichts eines unbekannten Sachverhalts. Jedes kleinste Indiz, das unser Vertrauen, dass ein bestimmtes Ergebnis eintritt, beeinflusst, wird seine Wahrscheinlichkeit und das damit verknüpfte rationale Verhalten verändern. Dass Wahrscheinlichkeiten eher von flüchtigem Wissen abhängen als nur von physikalischer Beschaffenheit, gibt uns einen Fingerzeig, warum wir bei diesem Dilemma so häufig scheitern. Wir erspüren intuitiv die jeweiligen Tendenzen des Autos, hinter den verschiedenen Türen gelandet zu sein, und wissen, dass das Öffnen einer Tür nichts an diesen Tendenzen geändert haben kann. Wahrscheinlichkeiten betreffen jedoch nicht die Welt – sie betreffen unsere Unkenntnis der Welt. Neue Informationen mindern unsere Unkenntnis und verändern die Wahrscheinlichkeit. Wenn das mystisch oder paradox klingt, denken Sie an die Wahrscheinlichkeit, mit der eine Münze, die ich gerade geworfen habe, mit dem Kopf nach oben landet. Für Sie ist sie gleich 0,5. Für mich ist sie gleich eins (ich hab nachgesehen). Selbes Ereignis, unterschiedliches Wissen, unterschiedliche Wahrscheinlichkeit. Beim Monty-Hall-Dilemma werden die neuen Informationen vom allwissenden Moderator geliefert.
Daraus folgt unter anderem: Sind die Hinweise des Moderators, die unsere Unkenntnis verringern, erkennbarer mit den physikalischen Gegebenheiten verknüpft, so lässt sich die Lösung des Problems intuitiv erfassen. Vos Savant lud ihre Leser ein, sich eine Abwandlung der Spielshow mit, sagen wir, 1000 Türen vorzustellen.[13] Sie wählen eine Tür aus. Monty präsentiert jeweils eine Ziege hinter 998 der verbliebenen Türen. Würden Sie sich nun für die Tür entscheiden, die er nicht geöffnet hat? Dieses Mal scheint es auf der Hand zu liegen, dass Montys Auswahl relevante Informationen preisgibt. Man kann buchstäblich sehen, wie er die Türen nacheinander durchgeht und dabei darauf achtet, nicht die Tür zu öffnen, hinter der das Auto wartet. Die geschlossene Tür ist ein Zeichen dafür, dass er das Auto ausgemacht hat, und somit eine Spur, die zum Auto führt.
Ein einfaches Prognoseproblem
Sobald wir uns daran gewöhnt haben, unbekannten Ereignissen Zahlen zuzuweisen, lassen sich unsere Intuitionen bezüglich der Zukunft quantifizieren. Das Prognostizieren von Ereignissen ist ein großes Geschäft. Es versorgt Politik, Investoren, das Risikomanagement und unser aller Neugier mit Informationen über das, was auf die Welt zukommt. Schauen Sie sich die im Folgenden aufgeführten Ereignisse einmal der Reihe nach an und notieren Sie jeweils die Wahrscheinlichkeit, mit der sie im kommenden Jahrzehnt eintreten werden. Weil viele davon äußerst unwahrscheinlich sind, nehmen wir feinere Differenzierungen am unteren Ende der Skala vor, so dass Sie zwischen den folgenden Wahrscheinlichkeitswerten wählen können: unter 0,01 Prozent, 0,1 Prozent, 0,5 Prozent, ein Prozent, zwei Prozent, fünf Prozent, zehn Prozent, 25 Prozent und 50 Prozent oder mehr.
Saudi-Arabien entwickelt eine Nuklearwaffe.
Nicolas Maduro tritt als Präsident Venezuelas zurück.
Russland bekommt eine Präsidentin.
Die Welt wird von einer neuen und noch tödlicheren Pandemie als Covid-19 heimgesucht.
Wladimir Putin wird durch eine Verfassungsänderung daran gehindert, für eine weitere Amtszeit als russischer Präsident zu kandidieren, und seine Frau nimmt seinen Platz auf dem Wahlzettel ein, was ihm ermöglicht, als graue Eminenz zu regieren.
Massive Streiks und Aufstände zwingen Nicolas Maduro, als Präsident von Venezuela zurückzutreten.
In China springt ein Atemwegsvirus von Fledermäusen auf den Menschen über, was zu einer noch tödlicheren Pandemie als Covid-19 führt.
Nachdem der Iran einen Atomsprengkörper entwickelt und mit einer unterirdischen Explosion getestet hat, reagiert Saudi-Arabien mit der Entwicklung einer eigenen Nuklearwaffe.
Im Zuge einer Erhebung legte ich mehreren hundert Befragten Aussagen wie diese vor. Im Durchschnitt waren sie der Meinung, es sei wahrscheinlicher, dass Putins Frau russische Präsidentin würde, als dass eine Frau Präsidentin würde. Sie hielten es für wahrscheinlicher, dass Maduro durch Streiks zum Rücktritt gezwungen würde, als dass er zurücktreten würde. Sie meinten, Saudi-Arabien würde mit größerer Wahrscheinlichkeit eine Nuklearwaffe in Reaktion auf eine iranische Bombe entwickeln als eine Nuklearwaffe entwickeln. Und sie glaubten, es sei wahrscheinlicher, dass von chinesischen Fledermäusen eine neue Pandemie ausgehen würde, als dass es eine neue Pandemie geben würde.[1]
Vermutlich haben Sie sich in mindestens einem Fall genauso entschieden; bei 86 Prozent der Probanden, die alle Aussagen bewerteten, war dies der Fall. Wenn es so ist, haben Sie gegen ein elementares Wahrscheinlichkeitsgesetz verstoßen, die Konjunktionsregel: Die Wahrscheinlichkeit für eine Verknüpfung von Ereignissen (A und B) muss geringer sein als oder gleich hoch wie die Wahrscheinlichkeit eines der beiden Ereignisse (A oder B). So muss die Wahrscheinlichkeit, eine geradzahlige Pik-Karte aus einem Kartendeck zu ziehen (geradzahlig und Pik), geringer sein als die Wahrscheinlichkeit, eine Pik-Karte zu ziehen, weil einige Pik-Karten keine geraden Zahlen aufweisen.
Bei jedem Paar der weltweit bedeutenden Ereignisse besteht das zweite Szenario aus einer Verknüpfung von Ereignissen, von denen eines dem Ereignis im ersten Szenario entspricht. So ist »Der Iran testet eine Nuklearwaffe und Saudi-Arabien entwickelt eine Nuklearwaffe« eine Verknüpfung, die »Saudi Arabien entwickelt eine Nuklearwaffe« enthält, und muss demnach mit geringerer Wahrscheinlichkeit eintreffen, da es auch andere Szenarien gibt, in denen die Saudis Nuklearwaffen bauen könnten (etwa, um es mit Israel aufnehmen zu können, um ihre Vormachtstellung am Persischen Golf zur Schau zu stellen, oder Ähnliches). Nach der gleichen Logik muss der Rücktritt Maduros wahrscheinlicher sein als der Rücktritt Maduros nach einer Streikwelle.
Was geht in den Köpfen der Leute vor? Eine durch eine einzelne Aussage beschriebene Klasse von Ereignissen kann generisch und abstrakt sein, ohne dass der Verstand etwas hat, woran er sich orientieren kann. Eine durch eine Verknüpfung von Aussagen beschriebene Klasse von Ereignissen hingegen kann lebensechter wirken, insbesondere wenn diese eine Geschichte heraufbeschwören, die wir vor unserem geistigen Auge ablaufen lassen können. Anschaulichkeit fördert intuitive Wahrscheinlichkeit – je leichter man sich etwas vorstellen kann, desto wahrscheinlicher erscheint es uns. Das lockt uns in die Falle des Konjunktionsfehlers (conjunction fallacy), wie Tversky und Kahneman ihn nennen, worin eine Verknüpfung von Ereignissen intuitiv eher einzutreffen scheint als eines ihrer Elemente.
Die Vorhersagen von Experten werden häufig durch lebhafte Narrative befeuert, Wahrscheinlichkeit hin oder her.[2] Eine berühmte Titelgeschichte in The Atlantic von 1994, die aus der Feder des Journalisten Robert Kaplan stammte, sagte »Das Heraufziehen der Anarchie« voraus.[3] Kaplan prognostizierte, dass in den ersten Dekaden des 21. Jahrhunderts Kriege über knappe Ressourcen wie Wasser ausgefochten würden. Nigeria werde Niger, Benin und Kamerun erobern. Weltkriege um Afrika würden entfacht. Die Vereinigten Staaten, Kanada, Indien, China und Nigeria würden sich aufspalten, woraufhin US-amerikanische Gebiete mit vielen Latinos die Grenze zu Mexiko abschaffen und Alberta und Montana sich zusammentun würden. Die Kriminalitätsrate in amerikanischen Großstädten werde ansteigen. AIDS