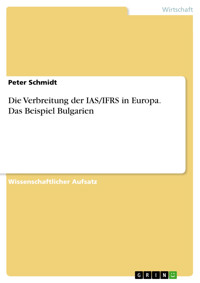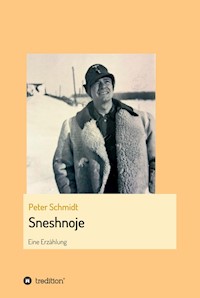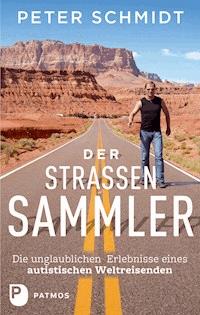
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Patmos Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Reisen ist mit Unwägbarkeiten verbunden. Und Autisten hassen Unwägbarkeiten. Umso erstaunlicher, dass Peter Schmidt, ein Asperger-Autist, ausgerechnet die Straßen der Welt einsammeln will. Doch die Sehnsucht und die Sammelwut sind stärker als die Furcht vor dem Unbekannten. Peter Schmidt durchquert Eiswüsten, gerät in Seenot auf offenem Ozean und bereist Syrien im aufziehenden Bürgerkrieg. In Panik gerät er erst, als bei Mc Donald's am Highway 95 die Cola ausgeht … denn das war nicht planbar. Peter Schmidt nimmt uns mit auf seine bizarre Tour rund um den Globus. Durch die Brille des Autisten verändert sich auch unsere Sicht auf die Welt. Ein unwägbares Leseabenteuer!
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 354
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
NAVIGATION
Buch lesen
Cover
Haupttitel
Inhalt
Über den Autor
Über das Buch
Impressum
Hinweise des Verlags
Bildtafeln
Peter Schmidt
Der Straßensammler
Die unglaublichen Erlebnisse eines autistischen Weltreisenden
Patmos Verlag
Inhalt
DIESSEITS DER MORGENRÖTE
Die Welt mit anderen Augen sehen
HAKUNA MATATA – SCHMIDT HAPPENS ON TOUR
Die erste und pannenreichste Straße – Kenia
Die mondigste Straße – Island
Die paradiesischste Straße – Südpazifik
Die zigarettenreichste Straße – Australien
Die eisigste Straße – Österreich
Die schienigste Straße – Sibirien, Russland
Die gefährlichste Straße – Bolivien
Die tür- und torreichste Straße – Namibia
Die verbotenste Straße – Hawaii
Die verdschungelteste Straße – Papua-Neuguinea
Die legendärste Straße – Karakorum, östliche Seidenstraße
Die atemloseste Straße – Tibet
Die staubigste Straße – Tansania
Die unmöglichste Straße – Amerika
Die stürmischste Straße – Argentinien
Die strömungsstärkste Straße – Indonesische Inselwelt
Die straßenloseste Straße – Sahara
Die kürzeste Straße – Spanien
Die kurvigste Straße – Laos
Die verschleierteste Straße – Iran, westliche Seidenstraße
Die maharadschigste Straße – Indien
Die elefantösigste und löwigste Straße – Südafrika
Die M-reichste Straße – Florida, USA
Die tollste, schönste und bildstärkste Straße – Utah, Arizona
Die heißeste Straße – Äthiopien
Die bedrohteste Straße – Syrien
Die verweigerteste Straße – Jordanien
Die moskitoreichste Straße – Dalton/Dempster, Alaska/Kanada
Die engste Straße – Reutlingen, Deutschland
Die letzte Straße – China
JENSEITS DER MORGENRÖTE
Strukturen geben Halt!
Eine kleine Reisestatistik
Liste der »blauen Routen« und ihre Komplettierung, was ich geschafft habe
Besuchte Länder
Besuchte Bundesstaaten der USA
Besuchte Landkreise Deutschlands
Liste der Orte mit Flughäfen, die ich für Starts und/oder Landungen nutzte
Eine Auswahl an Vulkanen, die ich bereits bestiegen habe
Liste der von mir besuchten Wüsten
Danke für tolle Zeiten in der großen weiten Welt
Für alle, die mir halfen, helfen und helfen werden, meinen Traum zu leben.
Durch seine Leidenschaft lebt der Mensch, durch seine Vernunft existiert er nur.
Nicolas-Sébastien de Chamfort
DIESSEITS DER MORGENRÖTE
Die Welt mit anderen Augen sehen
Liebe Leserin, lieber Leser!
Straßen kommen von irgendwoher und führen nach irgendwohin. Sie verbinden Nähe mit Ferne, Gewohntes mit Ungewohntem. Straßen erschließen die Welt und verbinden so die Vielfalt der Landschaften und Kulturen.
Früher, als ich noch Kind war, da ging es im seltenen Urlaub entweder auf der Straße nach Norden an die glibberquallige See oder auf der Straße nach Süden in die kuhglockenden Berge. Mit dem Auto. Das Schönste und Allerbeste am ganzen Familienurlaub war immer die Autofahrt!
Die Hinfahrt hätte gerne Tage, ja sogar Wochen dauern können. Viele neue Autokennzeichen gab es zu sehen. Viele neue Straßen. Und die endlos am Fenster vorbeiziehende Landschaft, in der es immer wieder neue, tolle Sachen zu entdecken gab, Bäume, Büsche und Blumen zum Beispiel, die es zu Hause nicht gab.
Die Welt der Straßen und die Straßen der Welt faszinieren mich seit frühester Kindheit. Ich stand als kleiner Junge oft an der Autobahn und beobachtete die zischend vorbeiziehenden Autos. Nahe der Raststätte »Hildesheimer Börde« an der A 7. Ich stellte mir damals vor, dass diese Autobahn ja irgendwie am Nordkap beginnen und am Nadelkap enden müsse.
1978 las ich als 12-Jähriger in einer Zeitschrift einen bebilderten Artikel über die »unmöglichste Straße der Welt«. Sage und schreibe 30000 Kilometer langer Urlaub auf der Straße von Alaska nach Feuerland. So was gibt es? Herrlich! Da war sofort klar: Diese Straße fährst du in diesem deinem Leben auch einmal ab. Meine erste große Vision!
Als 14-Jähriger wälzte ich wochenlang den Atlas. Und studierte das grüne Länderlexikon, das zu jener Zeit routenprägend jedes Quartal um einen weiteren Band ergänzt wurde. Schließlich nahm ich einen blauen Kugelschreiber und markierte im Atlas alle Straßen und Strecken, die ich in meinem Leben einmal abfahren wollte. Die »blauen Routen«. Mein Lebensplan!
Ich wurde für verrückt erklärt: »Vergiss es!«, hieß es. Denn aus Sicht anderer würde ich dafür wohl die schlechtesten Voraussetzungen mitbringen: Kein Geld, keine Zeit, und vor allem sei das nichts für jemanden, der irgendwie komisch ist und der keine Überraschungen mag, dem unerwartete Planänderungen stets schwer zu schaffen machen, der die Menschen nicht versteht.
Ich bin anders. Das weiß ich seit frühester Kindheit. Irgendwarum fühlte ich mich wie ein Blinder, der die Berge der Welt besteigt und zwangsläufig anders sieht – anders sehen muss! Was ich dagegen nicht wusste, war, was genau mich so krass von den meisten anderen Menschen unterscheidet.
Erst als ich 2007 mit 41 Jahren auf serendipischem Wege erfuhr, dass ich, so wörtlich fachärztlich bestätigt, ein »Autist mit lehrbuchartig ausgeprägtem Asperger-Syndrom« sein soll, bekam mein Anderssein Erklärungen und einen alle Facetten meines Seins auf einen gemeinsamen Punkt bringenden Namen: Autismus.
Vielleicht haben Sie sich gefragt, wie denn das gehen soll, ein Autist auf Reisen? Das kann doch gar nicht sein! Wie soll ein Mensch, der alles planen möchte, Spaß am Unterwegssein haben? Denn gerade straßige Abenteuer entziehen sich der Planbarkeit. Ein Mensch, der die Beziehungsebene in einer Kommunikation nicht erkennen kann, scheinbar keine Empathie hat, wie merkt der, was in sozialen Situationen und in Gesprächen zwischenmenschlich abläuft? Merkt er das überhaupt? Oder ist das vielleicht gar nicht nötig? Sieht der Autist stattdessen andere Dinge, die Sie nicht sehen? Nicht immer, aber sehr häufig! Reisen mit Autismus heißt anders reisen!
Vielleicht werden Sie das eine lustig, das andere sonderbar und wieder anderes äußerst interessant finden, weil Sie die Welt aus einer Perspektive begreifen, die Sie noch nie eingenommen haben. Da bleiben Aha-Erlebnisse vielfältigster Art nicht aus!
So ist eine Reise für mich toll, wenn mein Plan, was ich sehen wollte, erfüllt wird. Und zwar völlig unabhängig davon, wie andere Reiseteilnehmer sich mir gegenüber verhalten, was sie über mich denken. Ich wähle die Ziele aus, bestimme, wo es langgehen soll.
Ich stehe im fernen, fremden China grundsätzlich vor den gleichen Herausforderungen wie im nahen, heimatlichen Deutschland. Ich verstehe die Menschen nicht! Aufgrund meiner Sprachkenntnisse kriege ich in Deutschland immerhin die Sachebene, maximal 20 Prozent der Kommunikation, mit. Die übrigen mindestens 80 Prozent, die für das Zwischenmenschliche so wichtige Beziehungsebene, die bleibt dagegen für mich so gut wie unsichtbar.
Und da man mir das nicht unmittelbar ansieht, bleiben Erwartungshaltungen anderer an mein Verhalten besonders in der Heimat unerfüllt. In der Fremde dagegen habe ich jedoch meist weniger Probleme mit der Akzeptanz meines etwas andersartigen Verhaltens. Der kann ja noch nicht mal die Sprache, so heißt es, der ist hier nicht aufgewachsen, um Gepflogenheiten zu kennen. Es liegt also ein unmittelbar anerkanntes kommunikatives Problem vor. Woanders bin ich Alien per Pass!
Getrieben von der Sehnsucht, die Welt hinter dem heimischen Horizont kennenzulernen, ging es kurzerhand schon früh auf eigene Faust entschlossen los. Zunächst mit dem Fahrrad, später mit dem Auto. Und die Strecken wurden länger. Jedes Jahr ein Stückchen mehr. Tatsächlich erlebte Straßen und Wege werden später im Atlas rot übermarkiert. Die »roten Routen«.
Ich habe meine Pläne A, B, C, D, E und F. Wenn A nicht geht, dann B und so weiter. Meine selbst erarbeitete, geplante Flexibilität. Nur wenn auch der Plan F versagt, dann geht es mir richtig schlecht. Dann fährt und läuft nichts mehr. Es kam schon mehrmals vor, dass ich sogar 24 Stunden einfach stehen geblieben bin. Zum Beispiel in Alta in Nordnorwegen und bei Almeria in Südspanien.
Weil es dort regnete, wo es nach keinem meiner Pläne zu regnen hatte! Ich hasse Regen. Deshalb führen meine Routen meist durch wüstenhafte Landschaften. Nicht minder beeindruckend sind kurvenreiche Strecken durch das Hochgebirge: Alpen, Anden, Himalaya. Oder auf Vulkane!
Die höchste Straße, die ich fuhr, kurvte sich mehrmals über 5000 Meter hoch: die Qomolangma-Strecke, die das Himalaya- Gebirge quert. Die tiefste Straße führte mich entlang des Toten Meeres, 400 Meter unter dem Meeresspiegel. Und die spektakulärste, das ist die als Todesstraße gefürchtete Yungas-Straße, die von La Paz in Bolivien über die eisigen Anden in den heißen Amazonasdschungel führt.
Je mehr Meilen eine Strecke hat und je länger die Reise dauert, desto entspannter ist mein Erleben. So durchquere ich im Urlaub gerne ganze Kontinente auf dem Landweg. Von zu Hause nach Hongkong. Oder die Seidenstraße. Im Jahr 2000 fuhr ich die letzten Kilometer der »unmöglichsten Straße der Welt«, der legendären Traumstraße der Welt, der Panamericana. Ich (er-)lebte meinen Jugend- traum.
Im Jahr 2012 habe ich die letzten von allen 50 Bundesstaaten der USA selbst erfahren. Und 2014 ging die Sehnsucht aus der Kindheit in Erfüllung. Ich schloss die letzte große Lücke zwischen Kap und Kap: Sudan. Über die Jahre führte mich somit mein Weg vom Nordkap über Istanbul bis nach Ägypten. Weiter längs durch Afrika auf der Straße von Kairo nach Kapstadt. Von dort zum südlichsten Punkt, dem Nadelkap.
Heute ist der kleine Junge von einst einer der weltweit meist gereisten Autisten. Dank meiner Sehnsucht, die mich bis heute antreibt, allen Unkenrufen zum Trotz! Meine Geschichte zeigt, dass ein Handicap kein Grund sein muss, Ziele vorzeitig aufzugeben, nur weil sie aus Sicht anderer als eigentlich unmöglich erreichbar gelten.
Durch dieses Buch werden Sie die Welt mit anderen Augen sehen. Mit meinen. Den Augen eines autistischen Menschen. Wenn einer eine Reise tut, hat er was zu erzählen, heißt es. Ich erzähle Ihnen nun von vielen kuriosen Begebenheiten auf einigen ausgewählten Straßen unserer Welt, der Erdoberfläche. Viel Spaß mit meiner Perspektive auf das Reisen und das Leben!
Dr. Peter Schmidt
HAKUNA MATATA – SCHMIDT HAPPENS ON TOUR
Die erste und pannenreichste Straße – Kenia
Ich kann es kaum erwarten, endlich selber neue Straßen zu erfahren. Seit einem halben Jahr bin ich 18 Jahre alt, jung und frisch! Ich fühle mich jugendlich und dennoch gereift. Die Reifeprüfung kommt bald. Ich werde demnächst mein Abi machen. Doch vorher muss ich noch in das Land mit den schirmastigen Bäumen reisen, das mich als Kind am Fernseher geistig fesselte: Ostafrika! Kreuz und quer durch Kenia fahren. »Im Reich der wilden Tiere« unterwegs sein. Auf staubigen Wellblechpisten pirschen, gern auch quersavannenein, um die großen Tiere der Savanne selber zu beobachten.
Der Flieger landet pünktlich in Nairobi. Das Warten am Gepäckband wird zur Geduldsprobe. Eine komplette Expeditionsausrüstung haben wir, zwei Lehrerinnen meiner Schule und ich, in Frankfurt eingecheckt. Über die Startbahn West ging es direkt nach Süden. Via Rom. Und nun rattert ein Koffer nach dem anderen an uns vorbei. Ich werde immer nervöser. Oh, wie ungern gebe ich beim Check-in Gepäck ab! Wer weiß, ob man seine Lieblingsklamotten je wiedersieht? Als die allerletzten Gepäckstücke das Innere der Halle erreichen, kommt das Band zum Stillstand. Erst Panik, dann Entwarnung. Es sind unsere Sachen. Endlich! Was für eine Erleichterung! Doch die schwindet schnell, als die Dame am Tresen der Mietwagenfirma meinen frischen, graulappigen Führerschein in Augenschein nimmt. Denn die will uns den auf meinen Namen gebuchten Wagen nicht aushändigen.
Die »driver’s licence« sei zwar im Prinzip in Ordnung, aber diese müsse schon ein paar Jahre alt sein, um einen Mietwagen fahren zu dürfen, und ich sei viel zu jung! Innerliche Totalpanik kommt auf. Der bis ins letzte Detail ausgearbeitete Plan, die aus unzähligen Tierfilmen bekannten Safari-Landschaften Kenias Straßen sammelnd zu erleben, droht zu zerplatzen wie eine Seifenblase im hektisch böigen Wind.
Ich gefriere innerlich. Starre still steinern stehend auf regenbogenfarben schillernde schwarze Miniseen. Ölpfützen, die den geriffelten Betonboden der stickig-stinkenden Tiefgarage, in der sich das Office der Mietwagenfirma befindet, dekorieren.
Dann durchzuckt mich ein neurologischer Blitz. Moment mal! Mensch ja! Wir? Wir! Jaaaahh! Das ist sie! Die Lösung L! L wie Lösung! Die Rettung des Plans. Ich bin ja gar nicht alleine hier. Was für ein Glück! Ich bin ja in Begleitung zweier Damen hier, die wesentlich älter sind als ich und wohl auch einen Führerschein haben. Hoffentlich haben die den mitgenommen, meine einzige Sekundensorge.
Die eine ist Frau Fiene, jene Biologielehrerin vom Gymnasium, der ich schon in der fünften Klasse als bemerkenswerter Schüler aufgefallen war. Die andere ist eine Freundin von ihr. Frau Fiene habe ich in dem Raum näher kennengelernt, in dem ich oft Asyl vor mich gelegentlich ärgernden, vor allem aber lärmenden und sinnfrei smalltalkenden Mitschülern fand. Im Lehrerzimmer der Naturwissenschaften des Gymnasiums.
Dort entstand aus einer fixen, witzigen Idee binnen kürzester Zeit lebensechter Ernst. Zusammen nach Afrika zu fahren. Und nun sind wir tatsächlich gemeinsam hier im tiefgaragigen Office einer einheimischen, kleinen Mietwagenfirma. Inmitten des hochhausig getürmten Nairobi. Jener Skyline, die ich bisher nur aus Fernsehfilmen über Ostafrika kannte.
Ich will meinen Traum leben, darum bin ich hier. Ich schaffe es, nicht nur die stressigen Flughäfen, die ich wie die schmerzvolle Geburt einer hoffentlich tollen Fernreise empfinde, zu überleben, sondern auch diese ölig ätzende Tiefgaragen-Mietwagen-Check-in-Prozedur zu überstehen. Man muss auch mal was aushalten können, wenn man was erreichen will!
Es gibt Berge, über die man hinüber muss, sonst geht der Weg nicht weiter. Diese indische Weisheit lotst mich. Ich folge meinem inneren Lockruf, der Sehnsucht, die Welt zu erfahren. Wortwörtlich. Reisen ist für mich wie Sport. Es ist anstregend, aber dennoch schön. Und es macht besonders stolz, wenn man dann das spannend-spaßige Straßensammeln wie ein Rennen oder Spiel gewonnen hat.
Nach einer Stunde ist der zunächst alles ausbremsende und verstressende Organisations- und Papierkram endlich erleichternd vorbei. Schließlich und endlich bekommen wir doch noch unser gebuchtes Auto. Einen kleinen, engen, spartanisch ausgestatteten Suzuki- Geländewagen. Kennzeichen KVQ 872.
»Käi-wie-kju-eight-seven-two.« Echoartig muss ich das immer wiederholen. Denn das geht ja richtig rollend reimig die Zunge runter.
Drei Sitze hat er, der Wagen. Zwei vorne und einen hinten. Sein blechernes Outfit ist ein schlichtes, noch waschmittelreines, spiegelig glänzendes Weiß. Ein Zebraweiß, aber ohne die schwarzen Streifen. Nachdem wir uns mit dem meisten Gepäck eingepuzzelt und sperriges Gepäck auf dem Dach eingekistet und befestigt haben, geht es endlich los.
Obwohl ich der Bestimmer der Reise bin, darf ich nun den Wagen leider nicht fahren. Schade. Stattdessen bockt uns Frau Fiene noch etwas unsicher mit dem Gefährt raus aus Nairobi. Mit mir als beifahrendem Navigator. Das Gebocke des Wagens ist nervig und liegt nicht am Fahrstil, sondern kommt von der spartanisch-staubigen Technik.
Denn an einer Tankstelle erfahren wir, das Bumping läge am schlechten, dreckigen Sprit. So geben wir schließlich Gas, um noch heute in die ruhige, erhabene Wildnis zu kommen. Mehr als 80 Kilometer pro Stunde schafft der Wagen leider nicht. Wir sind bockig westwärts rollend unterwegs. Auf einer sehr gut ausgebauten Landstraße. Laut einem großen Schild auf einem der sogenannten Trans-African-Highways. Demnach sind es bis nach Lagos in Nigeria noch 5749 Kilometer. Schade, da werden wir wohl nicht hinfahren.
Wir halten, denn ein Schild-Foto fürs Album wird dennoch fällig. »Peter, du siehst irgendwie aus wie ein Otto, der doof daneben steht!«, meint Frau Fiene. Das allererste sogenannte Otto-Foto entsteht. Seither heißen Fotos, auf denen ich mit dem ganzen Körper vor Kulissen geknipst werde, Otto-Fotos.
Pünktlich zum Einbruch der Dunkelheit erreichen wir den Naivasha-See. Unter schirmigen, dickstämmigen Bäumen schlagen wir unsere Zelte auf. Umgeben von exotischem Vogelgegurr. Ja, wir sind tatsächlich im typisch tierischen Afrika angekommen. Am nächsten Tag geht es gleich weiter. Nach Nakuru, um dort die vielen rosafarbenen Flamingos zu bewundern. Das erste richtige Highlight im Reich der wilden Tiere!
Anschließend fahren wir vorbei an viel fruchtbarem Land und kissengrün exakt geschnittenen Tee-Plantagen. Am Viktoria-See beobachten wir ferne Gewitterwolken, die die aus dem Erdkunde-Unterricht bekannte »Innertropische Konvergenz«, kurz ITC, markieren, und deren gespenstisches, wolkenbandiges Wetterleuchten.
Bislang haben wir mit Ausnahme rund um den Nakuru-See praktisch nur europäisch anmutende Asphaltstraßen befahren. Das wahre savannige Afrika-Feeling, wie ich es in unzähligen Filmen als Kind gesehen habe, das fehlt mir bisher noch. Ganz im Südwesten Kenias biegen wir zivilisationsschließlich von der Hauptstraße runter, rein in eine rostbraune Rippelpiste. Der Beginn der Wildnis, des Abenteuers Afrika! Frau Fiene hält unvermittelt den Wagen an: »So, Peter, hier ist so wenig Verkehr, von jetzt an fährst du!«
»Wie jetzt …?«, frage ich verwundert, auf den Mietvertrag verweisend.
»Kein Aber! Du darfst jetzt das Steuer übernehmen, Peter, und ich übernehme die Verantwortung, okay?«
»Ja, aber wenn …«
»Kein Aber, ich bin müde und wenn du fahren willst, dann überlasse ich das ab hier gerne dir!«
Dann tauschen wir die Plätze. Ich setze mich auf den Fahrersitz. Ich schaue an meiner Brust runter. In rotem T-Shirt und meiner blauen Levis-Lieblingsjeans reift sich steigernd der Stolz im Sitz. So übernehme ich zunächst zaghaft zögernd das Steuer. Doch bevor ich Gas gebe, steige ich noch einmal aus. »Ich muss noch mal schnell meine B entleeren!«, erkläre ich die Verzögerung. Das B steht buchstabenkurz für Blasenentleerung, auch allgemein besser bekannt als Pinkelpause.
Ich steige wieder ein, drehe vorsichtig den Schlüssel immer weiter rum. Ein kurzes Tähötähötähö ertönt und schon rockt und ruckt er los, unser zebraweißer, streifenloser Geländewagen, der KVQ 872.
Meine erste selbst zu fahrende, neu zu entdeckende, richtige Straße beginnt hier. Vom hohen grüngelben Gras der Savanne gesäumt, zieht sich die rostbraunrote Piste mal gerade, mal im Slalom um schirmige und stachelig buschige Akaziengruppen. Der sandige Straßenbelag ist wattenmeerwellig. Diese Rippeln schütteln das Fahrzeug ordentlich durch. Da kann man nur im Schritttempo fahren.
Verdammt, mit diesem Kuhtempo kommen wir aber heute nicht mehr in die Masai Mara, jenen kenianischen Teil der berühmten Serengeti, wo es nur so von Großtieren, die ich bisher nur aus dem Zoo kenne, wimmeln soll. Um dahin zu kommen, bräuchten wir schon gepardiges Tempo.
Rechts und links säumen die für Afrika so typischen Akazien inselartig den Weg. Grünbaumige Flecken im ansonsten dürrbeigen, hohen Gras, in dem vielleicht auch ein Löwe lauern könnte. Vorsichtig geht es voran. Immer wieder halten wir an exotischen Pflanzen oder um einfach die Gegend zu beobachten und zu genießen. Menschen sehen wir dabei keine.
Langsam beginne ich, immer schneller zu fahren. Bis wir quasi mit Gepardentempo abheben. Bis die Reifen nur noch auf den Wellenbergen der Rippeln rütteln. Das ist bei etwa 70 bis 80 Kilometer pro Stunde! Im Takt der Rippeln vibrierend, rollen die Reifen auf der rostrotbraunen softsandigen Straße.
Achzig Sachen auf einem Feldweg, das hätte ich zwischen den Äckern zu Hause nie gewagt. Was auf dem Ozean die Salzspur des Schiffes ist, ist hier im Busch nun unsere Hunderte Meter lange Staubfahne, die wir hinter uns herziehen. Ich werde zum geborenen Pistenfahrer. Ein schlummerndes Talent darf sich endlich entfalten.
Immer wieder galoppieren wir reifenrollend an Weggabelungen und Abzweigungen vorbei, an denen keine Schilder stehen. Immer wieder rätseln wir, welchen Weg wir nehmen müssen. Ob wir nicht vielleicht doch die andere Piste hätten probieren sollen. Aber wir entscheiden uns stets für die Piste, die meistgenutzt erscheint, und folgen deren Reifenspuren. Wie war das noch mit meinem Lebensmotto? Wer neue Wege finden will, muss ohne Wegweiser auskommen!
Irgendwann kommt eine Abzweigung, da halten wir inne. Denn die geradeaus und eigentlich in unsere Richtung führende Strecke scheint wenig befahren, die allermeisten Fahrzeuge sind offenkundig rechts abgebogen. Da es sich laut Karte um eine Strecke mit überregionaler Bedeutung, wenn auch extrem verkehrsarm, handelt, folgen wir lieber den Spuren nach rechts. Denn fragen können wir leider niemanden. Alles scheint weiterhin menschenleer. Und sonstige technische Navigationshilfen haben wir auch keine.
Schon bald beginnt jedoch mein innerer Kompass immer öfter und lauter Alarm zu schlagen. Nach einer halben Stunde erhärten sich die Indizien, tatsächlich vom geplanten Weg abgekommen zu sein. Denn schon längst hätten wir das nächste auf der Karte eingetragene Dorf erreichen müssen. Doch stattdessen verwirren sich die Abzweigungen immer mehr zu weiteren Verirrungen. Irgendwann ist überhaupt nicht mehr klar, wo wir sind und demzufolge langmüssen. Wie in einem Geweih verzweigen sich die Wege immer und überall.
Plötzlich durchzuckt mich ein gewaltiges Déjà-vu: »Hier waren wir schon einmal!«, brülle ich ins Wageninnere. »Deeeehhhhn Busch habe ich heute schon einmal gesehen! Wir, wir, wir sind im Kreis gefahren!« Das kannte ich bisher nur aus Filmen. Und stets fragte ich mich, wie so etwas passieren kann. Jetzt weiß ich es!
»Peter, das kann gar nicht sein, hier gibt es so viele Büsche, die sehen doch alle gleich aus! Und außerdem sind wir immer weitergefahren!«, beschwichtigt Frau Fiene. Vielleicht hat sie ja recht, denke ich und fahre weiter.
Aber es dauert nicht lange, da erblicke ich eine schirmig krummkrüppelige Akazie, die ich definitiv heute schon einmal gesehen habe. Und dann die gleiche Bremsung vor dem absolut identischen Schlagloch! Diese Form, einfach einmalig. Davon gibt es sicherlich kein zweites, das genau so aussieht. Die von Frau Fiene verbreiteten Zweifel zischen ab. Ich bin mir nun absolut sicher: Diese Straße haben wir vor einiger Zeit heute schon einmal befahren! Keine Diskussion!
Aber niemand an Bord unseres kleinen weißen KVQ 872 will mir glauben. Na ja, vielleicht merken die beiden Damen, dass ich recht habe, wenn wir die Strecke dann ja irgendwann zum dritten Mal fahren!
Doch dazu kommt es nicht mehr. Denn wir erreichen erneut jene merkwürdig skeptische Stelle, an der ein kleiner, wenigst befahrener Weg geradeaus in die Wildnis führt. Diese Stelle erkennen endlich, ja endlich, auch beide Damen wieder. Zu lange haben wir hier doch denkend gestanden und gezögert. Seither sind zwei Stunden vergangen.
Der Blick zur Sonne ermahnt uns, endlich irgendwo anzukommen. In den Tropen geht die Sonne zügig unter, sie fällt förmlich hinter den Horizont. Nicht so wie im deutschen Sommer, wenn es einfach nicht dunkel werden will und die Sonne sich immer nach rechts ausweichend vor dem nahenden Horizont wegdrückt.
Und hier draußen im Busch gibt es keinen elektrischen Strom. Kein künstliches Licht. Nichts. Das bedeutet, dass wir die Fortsetzung der Fahrt in unbekanntes Terrain heute sicherheitshalber mal abbrechen sollten. Da wir nur noch eine Stunde haben und es bei Einbruch der Dunkelheit keine Chance mehr gibt, unser Ziel auf dem schmalen, wenig befahrenen Weg noch zu erreichen, beschließen wir, die Runde, die wir schon gefahren sind, noch einmal zu fahren, denn da haben wir unterwegs eine Mission gesichtet, bei der wir vielleicht notübernachten können.
Der schwedische Missionar heißt uns tatsächlich willkommen und warnt uns davor, hier herumzukurven: »Der Busch hat Augen!«
Büsche mit Augen, was für eine interessante Vorstellung. Aber es wird bald klar, was er wirklich meint. Die Gegend sei sehr unsicher. Und Überfälle seien keine Seltenheit. Wir seien sicherlich beobachtet worden. Und wir sollen niemals anhalten, wenn Menschen sich auf der Piste in den Weg stellen. Die würden schon wegspringen, wenn man statt der Bremse das Gaspedal durchdrückt.
Wir schlagen unser Zelt auf dem Missionsgelände auf und schlafen ruhig ein. Am nächsten Morgen wecken uns merkwürdige Taps- und Schmatzgeräusche, die durch das stoffige Dach dringen. Voller Neugier öffne ich die Zelttür. Und starre entgeistert auf eine wilde Horde krabbelnder Paviane, die unseren Wagen fellig überzogen haben. So wie Ameisen über liegen gelassene Speisen, Krümel und Zucker krabbelschwarz herfallen, haben diese Tiere unseren Wagen eingehüllt. Besonders den Gepäckbereich auf dem Dach. Den Standort von KVQ 872 markiert ein gelber Ring aus abgerissenen Bananenschalen.
Okay, das waren sie dann wohl mal. Unsere Obstvorräte, die wir gestern früh auf dem letzten Markt vor der Wildnis gekauft haben! Nun sind wir mitten im Busch, wie in einem Abenteuerfilm. Ohne Bananen!
Das Abenteuer, das wollen wir ja auch erleben. Aber wenn, dann doch bitte genau nach Plan. Und nicht bananenfrei anders! Wir haben Glück und können uns mithilfe der Mission obstig neu eindecken. Denn wer weiß, wo und wann es das nächste Essen zu kaufen gibt.
Nach dem outdoorigen Campingfrühstück brechen wir auf. 15 Minuten später biegen wir endlich in die wenigst befahrene Piste ein, die sich tatsächlich als der richtige Weg in Richtung Masai Mara erweist. Hätte ich nur bloß gleich meinem inneren Kompass geglaubt! Nach weiteren zehn Minuten durchfahren wir ein größeres ausgetrocknetes Flussbett. Die Araber würden es Wadi nennen. Kaum sind wir durch, bockt KVQ 872, so als wolle er sich wie ein störrisches Pferd aufbäumen.
Wenige Bockungen später herrscht Stille. Der Wagen weigert sich, wieder anzuspringen! Wir bewegen uns so schnell fort wie ein Baum. Inmitten des Busches, der hier Augen haben soll, stehen wir Wurzeln schlagend fest.
Erst sind wir zuversichtlich, Hilfe zu kriegen, doch nach einer Stunde vergeblichen Wartens stellt sich die stille Situation doch plötzlich schnell als sehr ernst heraus. Denn diese sogenannte Hauptverkehrsstrecke hat schon länger kein Fahrzeug mehr passiert. Darauf deuten meine Spurenlesefähigkeiten hin.
»Wenn ich das hier richtig deute, dann ist hier schon seit Tagen kein Auto mehr langgefahren. Wer weiß, ob da heute überhaupt noch eines kommt«, stelle ich verzweifelt fest. »Mit diesem alten, mickrigen Auto hätten wir das hier niemals machen dürfen! Da gehört ein vernünftiger Wagen her, wenn das hier eine Expedition ist!« Kein Echo von den Mitfahrerinnen.
Die allgemeine Ratlosigkeit triggert ein Konzert des Schweigens. Nur das gurrige Rufkonzert afrikanischer Vögel durchbricht die elefantengrasrauschende Stille des Buschlandes.
Nach drei Stunden stehender Stille in der sengenden Hitze beschließen wir schweren Herzens, dass einer von uns zu Fuß aufbrechen muss, um Hilfe zu holen. Wie in einem Abenteuerfilm soll ich mich entlang der Piste durch die buschige Wildnis bis ins nächste Dorf durchschlagen, das laut Karte und Hirnkompass Lolgorien sein müsste.
Wir sind gerade dabei, Wasservorräte entsprechend aufzuteilen und mein Marschgepäck zusammenzustellen, da ertönen von ferne Motorengeräusche, die keine Störung, sondern Erlösung in der heißen Savanne verheißen. Langsam, aber sicher werden sie lauter. Ein Auto kommt! Hilfe in Hörweite! Ich fühle mich wie ein Schiffbrüchiger, der schnell ein qualmreiches Feuer entzünden muss, damit das herannahende Schiff nicht vorbeifährt. Ich stelle mich voll in den Weg, um das Halten des herannahenden Fahrzeugs zu erzwingen. Schließlich staubt sich ein Wagen heran. Und hält!
Buntkettig behangene Afrikaner mit schokoladenbrauner Glanzhaut steigen aus. Nach einem kurzen, sprachholprig englischen Gespräch des Kennenlernens versuchen sie ebenfalls, unseren Wagen zu starten. Vergebens. Und dann sollen wir abgeschleppt werden. Nach Lolgorien. Das sind noch etwa 15 Kilometer. Da könne man uns vielleicht helfen. Okay, wir müssen es versuchen. Uns bleibt ja nichts anderes übrig, denn hier können und dürfen wir aus Sicherheitsgründen nicht stehen bleiben.
Alles habe ich vor wenigen Monaten erst in der Fahrschule gelernt, aber an einem Seil hängend, das jederzeit reißen könnte, gezogen zu werden und den Wagen mit der Bremse statt dem Gaspedal zu steuern, das hat mir niemand gezeigt. Und dann noch auf so einer Holperpiste.
Aber es klappt! Gas geben heißt, Bremse loslassen! Erst ganz langsam und dann immer schneller! Im Dorf angekommen, werde ich zum Highlight. Als würde ein König kommen. Interessanterweise interessieren sich die Menschen nämlich nur noch für mich, nicht für die beiden Lehrerinnen. Obwohl sie beide deutlichst älter sind als ich, der ja jugendlich frisch daherkommt. Wir vermuten, dass das an der hier vorherrschenden patriarchalischen Gesellschaft liegt, in der Frauen weder Autorität noch Rechte haben.
Schließlich kommt ein ölverschmierter Dorfbewohner auf mich zu: »Car problem fix!« Unser Patient, der KVQ 872, das Auto, es kommt unters Messer. Und ich schaue gespannt zu, was da nun passieren soll. Der nur mit lumpigen Hosenfetzen bekleidete, hautölige Chirurg schneidet hier und da was ab, baut dies und das aus und wieder ein. Bis er sagt: »Shit happens, Sir! Dirt! A lot of dirt!« Scheiße passiert. Dreck! Viel, viel Dreck!
Es scheint, als sei der Benzinfilter am Ende, zu viel Dreck im Sprit. Wenige Minuten später saugt der Mechaniker mit seinen Lippen am Benzinschlauch, bis er geysirartig Benzin spuckt, das seinen Mund erreicht hat. Dann befestigt er den Schlauch tesafilmartig an seinen alten Platz und meint wild gestikulierend: »Hakuna matata!«
Wir könnten jetzt erst mal weiter fahren. Und so schaffen wir es gerade bis zum nächsten Dorf. Zehn Kilometer. Ein Bruchteil der Strecke, die es hier noch zu fahren gilt. Zehn Kilometer, die fahrrade ich normalerweise in einer knappen halben Stunde!
Kaum im rundhüttigen Dorf angekommen, da ertönt das uns schon sehr vertraute Geräusch von unter der Haube: Tähähähähähä, tähähähä, tähähähtähäääääääääääääää. Nichts geht mehr. Wohl wieder Dreck in der Leitung. Oder immer noch.
Innerlich bin ich am Kochen. Denn mein sauber ausgearbeiteter Plan, an welchem Tag wir wo sein werden, der ist unaufholbar dahin. »Sir, you in Africa! Don’t worry! Be happy! Shit happens! – Every day! Believe me!« Doch ich bin untröstlich: »There are big problems!« Das sehen die Afrikaner hier ganz anders. »Hakuna Matata!« Es gibt keine Probleme! Wir schaffen es tatsächlich erneut, den Wagen mithilfe praktisch begnadeten Erfindungsreichtums der Dorfbewohner flott zu kriegen. Diesmal von größerer Haltbarkeit und Verlässlichkeit. So hoffen wir. Erneut werden wir von den dünnbeinigen Dorfbewohnern mit einem abschließenden »Good luck and Hakuna Matata!« auf den Weg gewiesen.
Wir sind so gut wie da und doch noch nicht da. Wenige Kilometer vor unserem Ziel, das wir schon vorgestern erreicht haben wollten, ver(d)reckt die Benzinleitung! So wie wenn man von weit her in eine Stadt fährt, man aber noch lange nicht in der City ist, weil Staus und Hindernisse das räumlich nahe Ziel zeitlich noch fern liegen lassen. Verstaut in den autovollen Straßen der Stadt. Und hier: pistenverstaubt im Busch!
Erneut finden sich erfindungsreiche Helfer und tun, was auch immer. Diesmal kommen wir voran. Nach dem letzten Dorf wird die Landschaft zunehmend wilder. Es fehlen die Spuren grasender Herden, die den Dorfbewohnern gehören. Rinder. Schafe. Ziegen. Stattdessen tauchen immer mehr Impalas auf. Haus- und Nutztiere werden weniger, Wildtiere nehmen zu.
Plötzlich stehen ganz bunt und leicht bekleidete, brettschlanke und stangenbeinige Menschen sperrig auf der Straße. Mit Speeren in der Hand! Wie Indianer im Wilden Westen, die auf Kriegspfad sind. Wie war das? Wir sollen hier niemals anhalten! Also gebe ich Gas. »Bodenblech!«, rufe ich, denn tiefer lässt sich das Pedal nicht mehr treten. Die werden doch hoffentlich noch rechtzeitig da wegspringen?!
Ich habe weder Lust auf einen Überfall noch auf einen Unfall. Denn überfahren möchte ich hier auch niemanden. Oh Gott, Manitu, Allah oder wie du auch immer heißen magst, hilf! Buddha, hilf mit Weisheit! Diese flehenden Gedanken schießen in Sekundenbruchteilen durch den ganzen Kopf.
Keine Zeit für parlamentarische Beratungen. Es wäre anmaßend, wenn hinterher ein Gericht entscheiden soll, ob das, was ich tat, richtig oder falsch war. Weil es kein Gericht der Welt gibt, das in Sekundenbruchteilen Entscheidungen fällen kann und muss. Also Augen zu und durch. Die bunten Wesen springen schließlich schwungvoll in letzter Sekunde ins hohe Gras. Ich werde wieder langsamer. Aus dem Gebüsch erhebt sich plötzlich großes Gejohle.
Im Rückspiegel zeigt sich eine Meute, die hinter uns herzurennen versucht. »Peter, gib Gummi!«, schreit Frau Fiene schrill. »Die meinen es ernst! Die fanden das nicht lustig!« Ob die nur sauer sind, dass ich nicht angehalten habe, oder ob hier ernste Gefahr besteht, diese Antwort werden wir nie erfahren. Aber wir müssen uns zu unserem eigenen Schutz von hier entfernen und das Schlimmste annehmen.
Wir schaffen es, friedlich und staubig zu entkommen. Dramatisch war sie, unsere erste Begegnung mit den stolzen Massai! Es ist ihr Land. Ihre Heimat. Und wir müssen da so durchbrettern. War wohl ein kommunikatives Missverständnis.
Noch während ich über die Situation sinniere, lichtet sich vor uns der Busch.
Plötzlich und unerwartet strahlt voraus nur noch afrikanisch-äquatorialer, stahlblauer Himmel, gespickt mit einigen wenigen weißen Wattewolken, die tierisch passend zum Ort an geplättete, kopflose Schäfchen erinnern.
Die rostrotbraun wellige Piste schwingt in einem großen Bogen nach links. Wir halten an und steigen aus. Ich komme mir vor wie Winnetou, der von seinem Pferd steigt und dem Anbruch eines neuen Kapitels in seinem Abenteuer entgegenschaut. Und genau deswegen erklingt in meinem tiefsten seelischen Innern die Melodie, die immer dann im Film kam, wenn der Reiter an einem grandiosen Aussichtspunkt steht: die alles öffnende und befreiende »Winnetou«-Melodie. Die das Geschaffte und den Aufbruch gleichzeitig markiert. Die das gerade bestandene, zurückliegende Abenteuer mit einer Dominante abschließt und das vor einem liegende Abenteuer auftakten lässt.
Ich genieße dieses großartige Konzert in meinem Innern. Denn wir stehen hoch oben am Oloololo Escarpment. Jener markanten geografischen Grenze, die den Übergang in die Serengeti markiert. Zu Füßen die weitestgehend baumlose Trockensavanne der Masai Mara. Ein Punkt zum Innehalten. Eben noch Busch, Busch, Busch und hohes elefantöses Gras um uns herum. Kaum mehr als wenige Hundert Meter konnte man ins Land blicken. Und nun das! Was für eine plötzliche Weite! Was für eine Fernsicht!
Erstmalig stehe ich im echten Leben in einer solchen Szenerie. Einem Ort, wie er stereotyp in unzähligen Abenteuerfilmen vorkommt. Dass ich das tatsächlich so jung schon selber erleben darf, darauf bin ich besonders stolz. Ich muss mich abzappeln. Arm- und beinzappelnd durchzuckt es mich. Denn ich habe soeben mein erstes echtes, riesiges und nicht immer lustiges, aber äußerst spannendes Straßenabenteuer erfolgreich bestanden. Ich muss das einfach abfreuen. Denn ich hatte mich schon damit abgefunden, dass alles vorbei ist, bevor es wirklich angefangen hat. Weil keiner von uns wirklich weiß, wie man Afrika erfährt.
Beim Anblick dieser grandiosen Aussicht halte ich inne. Ich muss an meinen Plan denken. Sauber, Tag für Tag, alles hatte ich ausgearbeitet. Wann wir wo wie lange sein wollen werden. Der Plan, er ist noch nicht ganz gestorben, aber er kann wohl nicht mehr eingehalten werden. Das Programm muss angepasst werden. Mehr Zeit für Pannen muss hier eingeplant werden. Und überhaupt stellt sich mir nun die Frage: Wie lange sollen wir pirschen, um bestimmte Tiere wirklich zu sehen? Welche Tiere werden wir überhaupt finden? Ich kann es nicht planen, ob wir Elefanten und Löwen sehen werden. Es ist der Moment, in dem meine geplante Flexibilität geboren wird. Der Moment, in dem ich begreife, dass ich das Reisen nur genießen kann, wenn es mir gelingt, das Unplanbare zu planen: das Abenteuer!
Wie ein Schachspieler, der auch viele Züge im Voraus mit einem »Was-wäre-wenn?« durchdenkt, bevor er selbst einen Zug tätigt, überlege ich mir, was wäre, wenn das Auto eine Panne hat, wir innerhalb von 72 Stunden keine Löwen sehen sollten, ich die Route anpassen muss, wir einen Unfall haben sollten oder es kein Hotel oder keinen Campingplatz gibt. Im Laufe der Zeit reifen für all diese Alternativen Lösungen heran, teils aus der Theorie, teils basierend auf vergangenen Erfahrungen. So wie jetzt mit der pannenreichsten Straße, meiner ersten Straße. Ich werde zukünftig Pläne A, B, C, D, E, F und einen Worst-Case-Plan machen müssen, um für möglichst viele Fälle, die auftreten können, eine Antwort parat zu haben. Nur so wäre ich im Falle des Falles auch handlungsfähig und nicht blockiert wie ein Computer, der sich aufgehängt hat, bei dem man jede Taste vergebens drückt und nur ein Neustart hilft.
Das Kennenlernen der Länder jenseits des heimatlichen Horizonts, das ist mit dem Finger auf der Landkarte kein Problem. Aber die wahre Faszination, die kommt nur, wenn man wirklich vor Ort ist. Ich erfahre erneut, dass man auch mal was aushalten muss, wenn man was erreichen will. Und ich bin bereit, mich zu überwinden, wenn ich die Welt dafür kennenlernen kann. Wenn ich die Straßen in aller Welt abfahren kann. Wüsten durchqueren. Vulkane besteigen. Tiere beobachten.
Schließlich fahren wir das Abenteuer weiter. Wir kurven uns in Kurven hinunter in die grandiose Ebene und erreichen ein großes, hölzernes Tor.
In einem Häuschen liegt ein eselsohrreiches Buchheft, in das der Ranger am Gate auf meinen mündlichen Zuruf handschriftlich unser Fahrzeugkennzeichen einträgt: KVQ 872. »Käi-wie-kju-eight-seven-two.« Der rhythmisch-reimische Klang des Kennzeichens wird uns noch an vielen Gates begleiten. Willkommen! Und wir sind endlich da angekommen, wovon ich schon als kleiner Junge träumte: im Reich der wilden Tiere!
Die mondigste Straße – Island
Das Abenteuer mit KVQ 872 ist Geschichte. Stattdessen fahrrade ich wieder jeden Tag 3,8 Kilometer hin und 3,8 Kilometer zurück. Zum Gymnasium. Seit Jahren suche und finde ich dort mein Pausenasyl in der stillen Bibliothek. Das Regal mit Büchern über Astronomie, die Erde und ihre heimatfernen Länder ist das allerbeste. Dort starre ich es immer wieder an, dieses eine, landschaftsfaszinierende Buch: Island – Feuerinsel am Polarkreis.
Bilder spektakulärer Landschaften in Grauschwarz, die violett im Sonnenlicht schimmern, regen meine Träume an. Solche Gegenden einmal selbst zu erleben, sie selbst zu erwandern, diese Sehnsucht, sie wächst ins Unermessliche. Island klettert mit jedem Tag in der Bibliothek höher auf meiner Prioritätenliste. Und steht bald auf Platz 1 der in diesem Leben noch zu tätigenden Reisen. Denn ich sammle nicht nur Straßen, sondern auch Vulkane und Wüsten sowie Klimazonen und Landschaften. Und ganz nebenbei natürlich auch Länder. Wobei Letztere nicht ganz so wichtig sind, weil die von Menschenhand oft willkürlich definiert sind. Ganz im Gegensatz zu den großen sogenannten Naturwundern unserer Erde.
Vulkantechnisch brauche ich noch den Besuch einer Gegend, die mir zeigt, wie es in den Tiefen der Ozeane zugeht. Nämlich genau dort, wo der Grund sich öffnet und die Massen diesseits und jenseits des großen Risses sich immer weiter voneinander entfernen. Es gibt nur genau eine ganz großräumige Stelle auf der ganzen Welt, wo sich das Mittelozeanische Gebirge auch an Land beobachten lässt – Island! Deswegen muss ich genau dort unbedingt hin! Auf Island kann man auf dem Landweg von Europa nach Amerika gelangen! In Island, da geht das ohne Umweg!
Durch die gewaltigen Vulkangebirge und Schluchten des Mittelatlantischen Rückens führen aschgraue weiche und lavaschwarze harte und spitzkantige Mondstraßen. Auf der mondigsten Straße fahren und sehen, wie die Berge das Land verwüsten und aufbauen zugleich, das ist mein Ziel.
Schon zwei Tage nach dem Abi sitze ich im Flieger. Natürlich habe ich mir wieder einen Fensterplatz ergattert. Auf der rechten Seite, damit ich gemäß zu erwartender Flugroute möglichst viel von Island aus der Luft sehen kann. Ich habe Glück. Island präsentiert sich entlang der Flugroute vielerorts wolkenfrei. Und so blicke ich 10000 Meter unter mir auf die klaffende Eldgjá-Spalte. Sie ist ein Teil des zentralen Grabens, der geologisch gesehen Amerika von Europa trennt. Lang gestreckte, schmale Schneefelder und große Risse, die das Auseinanderbrechen von Europa und Amerika markieren, durchziehen endlos grauschwarze Landschaften. Endlich kann ich wahre vulkanische Mondlandschaften und ganz nebenbei auch die subpolare Zone erleben.
Während ich dann so auf die unter mir vorüberziehenden großen Inlandeisfelder mit ihren Gletscherzungen schaue, kommen mir Zweifel bezüglich der Klamotten, die ich eingepackt habe. Pullover und T-Shirts, Trainingshosen sowie eine graue und eine blaue Cordjeans, wenn es etwas kälter ist. Aber ich habe definitiv keine wirklichen Wintersachen im Rucksack!
Ich schaffe es, Abenteuer zu planen, Berge zu erwandern, die richtigen Routen zu finden, aber ich habe Probleme, einen Rucksack richtig zu packen. Zum einen macht mir die Auswahl der Klamotten Probleme, zum anderen kriege ich sie nicht ordentlich in den Rucksack. Beides fast unmöglich. Das Packen ist das Schwierigste am Straßensammeln. Reisen ohne zu packen, die gibt es leider nicht. Um Straßen zu erleben, muss ich mich beim Packen überwinden. So wie ich irgendwie den schwierigen Alltag bewältigen muss, um mein Leben ausleben zu können. Denn mein Können kommt erst weit abseits der Routen des Alltags zur Geltung.
In Reykjavik angekommen, bekomme ich einen finanziellen Schock. Ich wusste ja, dass Island teuer ist. Aber so teuer? Man kann sich nicht mal was Normales zu essen leisten. Wie soll ich denn das bezahlen? Allein die Jugendherberge kostet mich ein Vermögen. Gerade mal 1600 Mark habe ich dabei, davon müssen sechs Wochen Island inklusive allem bezahlt werden. Gut, da hilft nur der Campingkocher. Nudeln und Tütensuppen. So wartet auf mich ein tütensuppiges, dauerdiätisches Abenteuer.
Die Busse werde ich mir nur in Ausnahmefällen für längere Strecken leisten können. Meine Stadtflucht beginne ich in einem Stadtbus, der mich an den Rand von Reykjavik bringt. Dort marschiere ich los. Dort beginnt er, der Aufbruch ins Ungewisse.
Zum allerersten Mal im Leben halte ich den Daumen in den Wind. Sehr unsicher. Ich bin noch nie per Anhalter gefahren. Weil das nicht kalkulierbar ist. Und gefährlich soll es auch sein. Aber vielleicht ja und hoffentlich nicht auf Island. Nach einer tagelangen Stunde hält ein blauer Wagen. Endlich.
Ich darf und soll tatsächlich einsteigen. Und die Fahrt geht los. Ein Longlift. Denn ich darf sogar einige Stunden mitfahren! Was für ein herrliches Gefühl! Island ruft, der Peter kommt. Meine ganze Faszination gilt der geologisch großartigen Gegend, die wir durchsausen. Bei der Annäherung an den Eyjafjallajökull, einem Gletschervulkan, wechselt die Landschaft von grasig Sattsonnengrün nach staubig hungrig Mondschwarzgrau, der mittelatlantische Rücken.
Nachdem ich mir auf diese Weise die Südküste angeschaut habe, lasse ich mich von einem Bus an einer Stelle absetzen, wo laut Karte ein kleiner Weg ins Landesinnere führt. Mein Weg. Zu Fuß von der Küste in das mondstaubig grausandige Innere Islands. Allein. Schwer bepackt. Ich fühle mich wie Amundsen und Scott, die ins Unbekannte aufbrechen.
Ich bin ganz allein. So allein war ich noch nie zuvor im Leben. Ich bin in einer anderen und meiner Welt – ringsherum nur grauviolett glänzendes Land, das alles andere als irdisch zu sein scheint. Mehr als 40 Kilometer schleppe ich meinen 35-Kilo-Rucksack, seit ich die isländische Nationalstraße verlassen habe. Kurz vor völliger Erschöpfung errichte ich mein Zelt an einem plätschernden, glasklaren, tiefblauen Bach.
Am nächsten Tag lasse ich das Gepäck beim Zelt zurück und steige auf den Rand der gigantischen Lavaschlucht Eldgjá. Ein Traum geht in Erfüllung. Ich stehe nun tatsächlich an und auf der scharfen geologischen Grenze zwischen Europa und Amerika. Die meisten fliegen oder fahren über das große Wasser, um Amerika zu erreichen. Ich aber bin zu Fuß unterwegs, von Europa nach Amerika, durch eine atemberaubende, skurrile, bizarr grauviolette Mondlandschaft. So wie sie im Buche steht, das ich in der Schulbibliothek kaum aus den Händen legen konnte und deshalb oft dauerausgeliehen hatte.
Nach wie vor keine Menschen weit und breit. Ich bin noch alleiner mit mir selbst. Ich merke gar nicht, wie allein ich bin, denn wenn mir etwas passieren würde, man würde mich nie finden! Das hier ist kein Picknick um die Ecke. Das hier ist Wildnis pur. Risiko pur. Aber noch viel mehr Spaß pur! Ganz im Sinne des Mottos »No risk, no fun!«. Und ich will »fun«! Auf meine Weise! Straßen sammelnd!
Am nächsten Tag wandere ich mit meinem schweren, zeltbeladenen Rucksack weiter. Irgendwo zwischen Eldgjá und Landmannalaugar. Weiter ins Landesinnere Islands.
Ein typisch isländisches Problem ist natürlich das Wetter. Ich möchte meine Strecken bei möglichst gutem Wetter erleben. Regen ist mein allergrößter Feind auf Reisen! Und dieser Feind lauert auf Island hinter jedem Hügel! Um hier nicht am Wetter zu verzweifeln, definiere ich entgegen meinen sonstigen Gewohnheiten eine wichtige Regel, um Island möglichst oft bei Sonne erleben zu können: Wenn es regnet, ist für mich Nacht. Wenn die Sonne scheint, dann Tag. Fast allein das Wetter bestimmt den Wanderrhythmus, nicht die Uhr. Denn es ist 24 Stunden am Tag hell, wenngleich die Sonne für eine kurze Stunde hinter dem Nordhorizont verschwindet. Aber nicht tief genug, um es dunkeln zu lassen.
Über 100 Kilometer gehe ich durch eiskalte Flüsse, über ewige Schneefelder und vorbei an Treibsandfeldern. Tagelang sehe ich keinen einzigen anderen Menschen, das ist ein völlig neues Gefühl.
Wie allein auf einem erdfernen Planeten. Das, was ich immer gefühlt habe, es ist real, ich bin in lebensfeindlichem Gelände. Wie gefährlich das werden kann, merke ich, als der Thermometerstand sich von oben her der frostig festen Null-Grad-Marke nähert. Denn der H2O-molekulare Angriff des Wetters, der ist nicht mehr flüssig, sondern der verfestigt sich watteweich. Es ist Juli. Und es schneit.
Meine Ausrüstung mangelt an richtig daunendicken Winterklamotten. Ich finde Schutz in einer Hütte. Drei lange nachtlose Tage harre ich dort tütensuppend aus. Dann endlich gehe ich weiter.