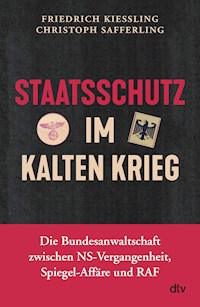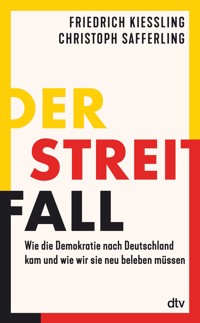
19,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: dtv
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Deutschland steckt in einer Polykrise, auch die Demokratie Die Herausforderungen für Rechtsstaat und Demokratie in Deutschland nehmen zu. Der Blick zurück auf die Gründung der Bundesrepublik und die Krisen der vergangenen 75 Jahre zeigt: Unsere Demokratie ist stabiler, als viele Schwarzseher wahrhaben möchten. Der gesellschaftliche Zusammenhalt während der stürmischen Krisen der zurückliegenden Jahre – Finanzkrise, Flüchtlingskrise, Pandemie, Ukrainekrieg – hat sich als resilient erwiesen. Und im europäischen Vergleich auffällig: Die radikalen Parteien können in Deutschland noch von der Macht ferngehalten werden. Aber die Anfechtungen sind groß und nur durch entschiedenes politisches Handeln, durch eine Reform des Rechtsstaats, kann Deutschland bleiben, was es ist: Eine freiheitliche Demokratie.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 313
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Über das Buch
Die Herausforderungen für Rechtsstaat und Demokratie in Deutschland nehmen zu. Der Blick zurück auf die Gründung der Bundesrepublik und die Krisen der vergangenen 75 Jahre zeigt: Unsere Demokratie ist stabiler, als viele Schwarzseher wahrhaben möchten.
Der gesellschaftliche Zusammenhalt während der stürmischen Krisen der zurückliegenden Jahre – Finanzkrise, Flüchtlingskrise, Pandemie, Ukrainekrieg – hat sich als resilient erwiesen. Und im europäischen Vergleich auffällig: Die radikalen Parteien können in Deutschland noch von der Macht ferngehalten werden. Aber die Anfechtungen sind groß und nur durch entschiedenes politisches Handeln, durch eine Reform des Rechtsstaats, kann Deutschland bleiben, was es ist: Eine freiheitliche Demokratie.
75 Jahre nach Gründung der Bundesrepublik blicken die beiden Autoren zurück auf die lange deutsche Demokratiegeschichte und gleichzeitig nach vorn auf die Herausforderungen der Zukunft.
Friedrich Kießling / Christoph Safferling
Der Streitfall
Wie die Demokratie nach Deutschland kam und wie wir sie neu beleben müssen
Inhaltsverzeichnis
Vorwort
Einleitung
I. Rückblicke
Kein Kaiserwetter: Die Anfänge der Demokratie in Deutschland
Parlamente
Wahlen
Zivilgesellschaft
Bürokratie und Verwaltung
Presse und Öffentlichkeit
Rechtsstaat
Feinde
Streit
II. Fundamente
Denazifizierung und Demokratieerziehung
Wiederaufbau der Länder
Herrenchiemsee
Parlamentarischer Rat
Das Grundgesetz mit »Leben« füllen
Den Rechtsstaat wieder aufbauen
Verwaltungsexperten und Wiederaufbau: Die Restauration des Berufsbeamtentums
Politisches Strafrecht und Demokratie
Ein neuer Fall Ossietzky? Die »Spiegel«-Affäre und die Pressefreiheit in der Bundesrepublik
Das Bundesverfassungsgericht
Auf dem Weg zum Verfassungspatriotismus
Erinnerungskultur und Demokratie
Grundrechte als objektive Werteordnung
Wiederbewaffnung zur Selbstverteidigung
Das Grundgesetz und Europa
Die »geglückte Demokratie«?
III. Ausblicke
Herausforderungen
Demokratie und neue Medien
Demokratie, Globalisierung und Internationalisierung
Die Krise der politischen Repräsentation. Oder: Wer darf wen vertreten?
Wege aus der Krise
Schluss: 1949 und wir
Anhang
Literatur
Personenregister
Vorwort
Die Demokratiegründung von 1949 kann auch heute noch erstaunen. Aus ziemlich unscheinbaren Anfängen in provisorischen Gebäuden in Bonn entwickelte sich eine stabile Demokratie, die heute keinen Vergleich mit den großen demokratischen Ländern des Westens, mit Frankreich, Großbritannien oder den USA, zu scheuen braucht. Eher im Gegenteil, das politische System der Bundesrepublik Deutschland erscheint in manchem sogar stabiler als das vieler vergleichbarer Staaten. Auf der anderen Seite ist die deutsche Demokratie, wie sie sich nach 1949 entwickelt hat, aber unverkennbar in der Krise. Die Idee der repräsentativen Demokratie, die der Bonner Gründung zugrunde lag, ist heute so erklärungsbedürftig wie nie. Umwelt- und Klimakrise, die Folgen von Globalisierung und Deglobalisierung, die rasende Entwicklung der Technik, der Aufstieg von Populismus und Extremismus und nicht zuletzt die anhaltende Revolutionierung der Kommunikation bilden Herausforderungen, die die bestehende demokratische Ordnung für viele in Frage zu stellen scheinen. Das Gespenst der gescheiterten Demokratie von Weimar zeigt mal wieder seine hässliche Fratze.
Vor diesem Hintergrund ist es essenziell zurückzublicken auf die lange Geschichte der Demokratie in Deutschland, aber auch nach vorne und zu fragen, wie wir die Demokratie bewahren können. Dieses Buch fragt deshalb zum einen danach, wie und warum die Demokratie nach 1945 erfolgreich sein konnte. Welche historischen Bedingungen sorgten dafür, dass der Versuch mit dem demokratischen System 1949 gelang? Es ist so gesehen eine Bestandsaufnahme. Zum anderen nimmt es den oft gehörten Satz, dass Demokratie ständige Arbeit sei, aber ebenso ernst und fragt danach, was heute geändert werden muss, um das freiheitliche politische System zu erhalten. Dabei ist eines klar: Um die richtige Form der Demokratie hat es stets harte Auseinandersetzungen gegeben. Die Demokratie war immer ein Streitfall. Das ist heute nicht anders als 1968/69, als 1949, als 1918 oder auch schon 1848/49. Und so gilt es einmal mehr zu diskutieren, was an der Demokratie verändert werden muss, damit sie bleibt.
Zu Beginn möchten wir uns bei den Menschen bedanken, die dieses Buch möglich gemacht haben. An erster Stelle danken wir dem dtv Verlag und seinem Senior Editor Sachbuch, Stefan Ulrich Meyer, der unsere Ideen einmal mehr so wunderbar aufgenommen und bei der Umsetzung begleitet hat. Unser Dank gilt zudem den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern an den beiden Lehrstühlen in Bonn und Erlangen. Mit ihrem Engagement haben sie ebenfalls entscheidend dazu beigetragen, dass dieses Buch, das uns Autoren ein wichtiges Anliegen war, entstehen konnte.
Einleitung
Erklärungen dafür, warum die Bundesrepublik Deutschland nach 1949 zu einer stabilen Demokratie wurde, gibt es einige. Das Wirtschaftswunder, so lautet eine gängige von ihnen, sei es gewesen. Die Westdeutschen seien Demokraten geworden, weil sie der ökonomische Erfolg am Ende auch an das neue politische System glauben ließ. Eine andere Deutung begreift die Demokratie vor allem als Importprodukt. Angesichts von NS-Verbrechen und Kriegsniederlage hätten die Bundesbürger und -bürgerinnen einen lange gepflegten, im Kern autoritären Sonderweg verlassen und sich (endlich) dem westlichen politischen Projekt angeschlossen. Sie wurden Demokraten, wie es Amerikaner, Briten und Franzosen schon längere Zeit waren. Eine dritte Erklärung zeigt sich zunächst einmal skeptisch, wie weit die Westdeutschen in den ersten Jahrzehnten ihrer neuen Republik überhaupt auf dem Weg zur Demokratie vorangekommen waren. Es brauchte, so die Vertreterinnen und Vertreter dieser These, zunächst eine neue Generation, neue Mentalitäten oder neue Fragen an die eigene Geschichte, damit es in den Jahren um 1970 zu einer »Umgründung« der Republik und damit zur eigentlichen Etablierung der Demokratie kommen konnte.
Die Suche nach Gründen für den Erfolg der Demokratiegründung von 1949 ist in den letzten Jahren auch deswegen noch drängender geworden, weil angesichts der vielen Aufarbeitungskommissionen, die sich mit den Nachwirkungen des Nationalsozialismus in der frühen Bundesrepublik beschäftigen, klar zutage trat, wie stark gerade die Ministerien in den Anfangsjahren der Bundesrepublik mit ehemaligen NSDAP-Mitgliedern belastet waren. Wie gelang also ihren Mitarbeitern und vielen anderen Deutschen der Weg zur stabilen Demokratie?
Auch wenn die genannten Erklärungsmuster wichtige Beobachtungen enthalten, so fehlt ihnen allen doch ein entscheidender Aspekt. Dieses Buch geht deshalb bei der Darstellung der Staatsgründung von 1949 über solche Ansätze hinaus. Unsere Erklärung dafür, warum der Versuch mit der deutschen Demokratie diesmal gelang, setzt historisch tiefer an. Sie fragt zunächst einmal, welche Traditionen nach dem Zweiten Weltkrieg bereitlagen, an die im Sinne einer demokratischen Umgestaltung bzw. Neugründung 1945 oder 1949 angeknüpft werden konnte. Solche Traditionen gab es einige und die Gründer und Gründerinnen der Bonner Republik kannten sie. Im Parlamentarischen Rat von 1948/49, in dem das Grundgesetz ausgearbeitet wurde, sahen sie sich sehr genau die lange deutsche Verfassungsgeschichte mit ihren Stärken und Schwächen an. Das Grundgesetz wurde so viel eher ein Produkt der eigenen Tradition als eine Übernahme anderer.
Ähnliches gilt für den Rechtsstaat, der auch heute noch auf Grundpfeilern ruht, die aus dem Kaiserreich stammen, wie etwa den Reichsjustizgesetzen (Gerichtsverfassungsgesetz, Straf- und Zivilprozessordnung) oder auch dem materiellen Recht (das Strafgesetzbuch und das Bürgerliche Gesetzbuch). Auch bei dem Wiederaufbau der Verwaltungsstrukturen – mit dem Berufsbeamtentum als seinem vielleicht wichtigsten Element – knüpfte das neue politische System an bekannte Strukturen an. Selbst die Ausbildung von Juristinnen und Juristen den Trägerinnen und Trägern von Judikative und Exekutive, hat sich seit der Reichsgründung strukturell nicht verändert. Nicht alles an diesen Aspekten erwies sich auch langfristig als tauglich für den demokratischen Neuanfang und wurde deswegen nach und nach massiv umgestaltet. Anderes, etwa der Umgang mit gesellschaftlichem Pluralismus oder der mit den tatsächlichen oder vermeintlichen Feinden der Demokratie, musste tatsächlich erst mühsam erlernt werden. Dennoch: Zu einem nicht unerheblichen Teil gelang den Westdeutschen der Start in die demokratische Zukunft mit Bausteinen, die ihnen aus der eigenen Geschichte bekannt waren und an die auch die alliierte Entnazifizierung anknüpfen konnte. Vermutlich liegt darin sogar die wichtigste Erklärung dafür, dass die Demokratiegründung erfolgreich war. Sie gelang nicht gegen, sondern mit der eigenen Tradition, die nun für die neue Zeit fruchtbar gemacht wurde.
An die demokratischen Wurzeln zu erinnern, die vor 1933 zurückreichen, schafft aber nicht nur neue Erklärungsmöglichkeiten für die Zeit nach 1945/49 oder verschafft den nicht wenigen Menschen Gehör, die sie vertraten und für sie kämpften. Nein, der Blick zurück ist ebenso für die aktuelle Diskussion um die Gefährdung von Rechtsstaat und Demokratie von Bedeutung. Denn unsere Demokratie, das macht die historische Bestandsaufnahme deutlich, ruht auf breiten Fundamenten, die keineswegs erst nach dem Zweiten Weltkrieg gelegt wurden, sondern bereits in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts und teilweise schon im 19. Jahrhundert.
Dies gilt selbst für die Institution des Bundesverfassungsgerichts, die immensen Einfluss auf die Entwicklung der Demokratie genommen hat. Diese ist zwar ohne exaktes historisches Vorbild, sondern eine Weiterentwicklung aus den Erfahrungen mit der Verfassungswirklichkeit der Weimarer Jahre. Warum aber verlegte man sich auf eine starke richterliche Kontrolle und setzte damit der Parlamentssuprematie – weltweit einzigartig – eindeutige Grenzen, obwohl die Justiz im Nationalsozialismus kollektiv als Kontrollinstanz gegenüber politischem Extremismus versagt hatte? Das Urvertrauen in die Justiz in Deutschland ist ein »historiografisches Rätsel« (Michael Stolleis). Das Bundesverfassungsgericht erwies sich denn auch für die Politik in den ersten Jahren der Bundesrepublik häufig zunächst als Stein des Anstoßes, erarbeitete sich aber in der Gesellschaft als Respekt und fungierte alsbald als Brückenpfeiler der Demokratie. Nicht zuletzt deshalb wird die Bundesrepublik auch (durchaus kritisch) als »Richterstaat« bezeichnet (Bernd Rüthers).
Unserem demokratischen Selbstbewusstsein kann solches Wissen um die Wurzeln von Rechtsstaat und Demokratie nur guttun. Die bundesdeutsche Demokratie war stets weit mehr als »nur« die Negation des Nationalsozialismus in einer spezifischen, nachkatastrophalen historischen Situation. In der Erinnerung an die langfristigen Prägungen der Demokratie liegt damit ein sehr gegenwärtiges Interesse des Buches. Auf der anderen Seite, so die zweite Stoßrichtung des Bandes, liegt die Demokratiegründung von 1949 inzwischen ein Menschenalter zurück. Vor diesem Hintergrund schaut der Band nicht nur zurück in eine lange deutsche Demokratiegeschichte, sondern auch auf die Gegenwart beziehungsweise in die Zukunft. Zum Rückblick sowie zu der Darstellung der Etablierung kommt der Ausblick auf die Gegenwart und in die Zukunft.
Die weltweiten Gefährdungen der westlichen Demokratien stellen auch an die bundesdeutsche politische Ordnung die Frage, inwieweit sie diesen Herausforderungen gewachsen ist oder an welchen Stellen sie überdacht und modifiziert werden muss. Im Falle der Bundesrepublik geschieht dies vor einer Verfassungsordnung, bei der in der Nachkriegszeit überaus stark auf Stabilität und Sicherungen gesetzt wurde. Veränderungen fallen deswegen besonders schwer. Hinzu kommt, dass die alte Bundesrepublik vor allem als Erfolgsgeschichte in Erinnerung ist. Die erfolgreiche Etablierung des politischen Systems der alten Bundesrepublik geschah allerdings in einem anderen historischen Umfeld. Die heutigen Bedingungen sind damit nicht gleichzusetzen. Unter Herausforderungen wie dem neuen Autoritarismus, neuer Kommunikationsmittel, der Europäisierung und Internationalisierung von Entscheidungsprozessen sowie einem sich deutlich ändernden Verständnis von und Erwartungen an die Politik stellt sich nicht mehr die Frage, wie die Demokratie etabliert werden kann, sondern was wir dafür tun müssen, dass sie bleibt. Zu dieser Diskussion beizutragen, ist das Anliegen des Buches.
I.Rückblicke
Kein Kaiserwetter: Die Anfänge der Demokratie in Deutschland
Es herrschte kein Kaiserwetter, als sich am 9. Juni 1884 die Honoratioren des Deutschen Reichs versammelten, um feierlich die Grundsteinlegung des Reichstagsgebäudes in Berlin zu begehen. Der offizielle Bericht, der in vielen Zeitungen unverändert abgedruckt wurde, verschweigt, dass es in Strömen regnete, aber auf einer zeitgenössischen Fotografie verschwinden die Tribünen unter Schirmen. Kaiser Wilhelm I., der den Grundstein persönlich legte, mag der Regen unter seinem Paradehelm wenig ausgemacht haben. In anderer Hinsicht hat der Bau den Spitzen des Reichs allerdings einigen Ärger bereitet. Vor allem Wilhelms Enkel, der spätere Kaiser Wilhelm II., schmähte den Bau regelmäßig, zum Beispiel als »völlig verunglückte Schöpfung«. Gerade die große und hohe Kuppel, einst als herrschaftliches Zeichen Schlössern und Kirchen vorbehalten, hatte ihn gestört. Immerhin war das Gebäude in angemessenem Abstand zum Stadtschloss entstanden und mit einigem guten (oder besser schlechten) Willen konnte man behaupten, mit dem Bau jenseits des Brandenburger Tores und damit außerhalb des engeren Berliner Machtbereichs von Schloss, preußischen Ministerien und selbst dem preußischen Landtag mit Herren- und Abgeordnetenhaus geblieben zu sein. Die Zeremonie am 9. Juni 1884 war monarchisch-militärisch geprägt, aber immerhin durfte der Präsident des Reichstags, der deutschkonservative Abgeordnete Albert von Levetzow eine kurze Ansprache halten und dem Kaiser einen Hammer überreichen, mit dem Wilhelm dreimal für sich und dreimal für seine Frau auf den Grundstein schlug. Auch das Hoch auf den Kaiser, mit dem die Feier schloss, brachte Levetzow aus.
Ganz so machtlos, wie es sich die Hohenzollern-Herrscher vermutlich gewünscht hatten, war der Reichstag schon 1884 nicht mehr. In den ersten Jahren nach der Reichsgründung 1871 hatte er mit seiner liberalen Mehrheit eine ganze Reihe von fortschrittlichen Gesetzen verabschiedet, darunter ein neues Pressegesetz, das die politische Zensur weitgehend abschaffte und Pressevergehen an die allgemeinen Strafgesetze band. Gut 20 Jahre nach der Grundsteinlegung, im Dezember 1906, verweigerte ebendieser Reichstag der kaiserlichen Regierung die Gefolgschaft, indem er einen Nachtragshaushalt zur Finanzierung des Kolonialkrieges in Deutsch-Südwestafrika ablehnte. Matthias Erzberger, Kolonialexperte der katholischen Zentrumspartei und größten Fraktion im Parlament, die die Vorlage zusammen mit den Sozialdemokraten ablehnte, begründete das Votum am 4. Dezember 1906 mit den »schweren Verfehlungen« der Kolonialverwaltungen, die nicht abgestellt würden. Auch der SPD-Vorsitzende August Bebel sprach in seiner Rede vom 4. Dezember 1906 ausführlich von den »begangenen schweren Verbrechen« in den Kolonien und einem »Vertuschungssystem« der Reichsregierung. Vielleicht seien, so Bebel, »unsere Kolonialhelden […] zu einem erheblichen Teile verrückt«, nur so könne »man sich allenfalls die scheußlichen Unmenschlichkeiten, die sie begangen haben, erklären«. Im Ersten Weltkrieg taten sich die beiden Fraktionen erneut zusammen und bildeten mit Teilen der Liberalen die Gruppe, die dann die erste Phase der Weimarer Republik bestimmte. Mit Fug und Recht kann somit gesagt werden, dass wichtige Voraussetzungen der ersten Demokratie auf deutschem Boden noch im Parlament des kaiserlichen Deutschland gelegt worden waren.
Steht also vielleicht das Parlament von 1871 am Beginn der deutschen Demokratiegeschichte? Historikerinnen und Historiker hätten diese Frage lange empört zurückgewiesen. Zu gering erschienen die Kompetenzen des Reichstages, der vor allem kein Kontrollrecht gegenüber der allein vom Kaiser abhängigen Regierung besaß. Und natürlich war das Kaiserreich keine Demokratie. Neben der Machtfülle von Kaiser und Kanzler stand dem auch die Verfassungslage im bei Weitem größten deutschen Teilstaat Preußen entgegen, wo ein eingeschränktes Wahlrecht die national-konservative Macht sicherte und eine liberale Weiterentwicklung des politischen Systems auch auf Reichsebene nahezu unmöglich machte. Für den Reichstag selbst galt zwar auch in Preußen das allgemeine, gleiche und geheime Wahlrecht, es war aber auf erwachsene Männer beschränkt. Frauen durften bis 1908 nicht einmal Parteien beitreten. Wollten die Abgeordneten nicht so, wie sich das Kaiser und Kanzler vorstellten, konnten diese den Reichstag im Übrigen mit Hilfe des Bundesrates auflösen, was insgesamt viermal geschah, so auch 1906 nach Ablehnung des Nachtragshaushaltes. Auf die meisten außenpolitischen Entscheidungen hatte das Parlament gar keinen Einfluss. Politische Bündnisse schloss allein der Kaiser in Übereinstimmung mit dem Kanzler.
Doch die (verfassungs-)rechtliche Situation beschreibt nicht die ganze Geschichte. Und inzwischen wissen wir, dass wir selbst hier genauer hinsehen müssen. Die Demokratie entstand nicht einfach 1919 mit der Verabschiedung der ersten demokratischen Verfassung in Deutschland oder 1949 unter den Auspizien der West-Alliierten. Demokratien haben vielmehr eine lange Vorgeschichte. Sie müssen nach und nach eingeübt werden (Historiker und Historikerinnen sprechen gerne von notwendigen, kollektiven Lernprozessen). In Frankreich dauerte es ausgehend von der Revolution von 1789 beinahe 90 Jahre, bis sich eine parlamentarische Republik etablieren konnte. Dazwischen wechselten sich reaktionäre und reformorientierte Phasen ab. Nicht anders sah es in Großbritannien aus, wo sich zum Beispiel ein demokratisches Wahlrecht nach und nach über fast ein Jahrhundert seit den 1830er Jahren entwickelte. Noch 1918, als in Großbritannien das Wahlrecht für Frauen eingeführt wurde, durften diese erst ab 30 wählen, Männer dagegen ab 21. Erst 1928 wurde diese Diskriminierung beseitigt.
Eine lange Einübungsphase für demokratische Momente ist nichts anderes als der europäische Normalfall und lässt sich ebenso in der deutschen Geschichte ausmachen. Dabei darf nicht nur auf die Verfassung oder Parlamentsrechte gesehen werden. Moderne Demokratien definieren sich ebenso über plurale Öffentlichkeiten, die Existenz einer starken Zivilgesellschaft und entsprechende Partizipationsrechte, über den Umgang mit Minderheiten oder über einen gesicherten Rechtsstaat. All dies war nicht plötzlich zu Beginn von Weimar oder der Bonner Republik da, sondern baute auf Vorläuferentwicklungen auf.
Der Blick auf eine solche lange deutsche Demokratiegeschichte hält aber auch Schattenseiten bereit. So fiel dem politischen Konservatismus das Arrangement mit den Entwicklungen der europäischen Moderne, die den historischen Hintergrund für die beginnende Demokratisierung bildete, in Deutschland besonders schwer. Große Teile der deutschen Konservativen machten diesen Schritt endgültig erst nach dem Zweiten Weltkrieg. Sie trugen damit erheblich zu deren Zerstörung der Demokratie in der Zwischenkriegszeit bei. Die Nationalsozialisten wiederum, denen sie damit in die Hände spielten und die die Zerstörung vollendeten, beriefen sich ihrerseits auf die Demokratie. Es war freilich nicht mehr als ein Zerrbild, das sie zeichneten. Dieses zeigt, mit welcher Gewissenlosigkeit und am Ende Brutalität sich die Gegner der Demokratie ans Werk machten.
Der Rückblick auf die lange Geschichte der Demokratisierung Deutschlands hält somit zwei Einsichten bereit. Beide sind bis heute relevant: Einerseits zeigen sich die massiven Widerstände, die zu überwinden waren, bis tatsächlich von einer Demokratie gesprochen werden konnte. Mehr noch als in anderen Nationalgeschichten wird dabei deutlich, wie groß die Zahl der Feinde war, wie aggressiv diese vorgingen und wie es ihnen gelang, die Demokratie nicht nur zu behindern, sondern auch bereits einmal zu zerstören. Andererseits wird aber ebenso deutlich, wie fest und lange schon demokratische Prozesse in der deutschen Geschichte verankert sind. Auch in Deutschland ist die Demokratiegeschichte deutlich länger als »nur« eine Geschichte, die irgendwann in den Jahrzehnten nach 1945 begann, vielleicht versehen mit einer kurzen, aber erfolglosen Vorgeschichte, die von 1918/19 bis 1933 reichte, oder einzelnen, punktuellen, am Ende aber gescheiterten Anläufen wie der Revolution von 1848/49. Nein, die Entstehung der Demokratie in Deutschland reicht weiter zurück und sie beruht auf breiteren sozialen, politischen und kulturellen Entwicklungen, als es ein solcher verkürzter Blick suggeriert. Dass sie 1949 so richtig Fahrt aufnehmen konnte, lag nicht zuletzt an diesen tiefen historischen Fundamenten.
Mögliche Anfänge einer langen deutschen Demokratisierungsgeschichte gibt es dabei vermutlich so viele, wie es Kennzeichen einer modernen Demokratie gibt. Diese setzt sich aus vielen unterschiedlichen Elementen zusammen. Mit »Herrschaft des Volkes« oder »Entscheidungen durch Mehrheit« sind sie höchst unzureichend beschrieben. Moderne Gesellschaften sind viel zu komplex, als dass sich ein einheitlicher Wille ermitteln ließe. Wer sich auf einen einheitlichen Volkswillen beruft, beschwört eine Schimäre. Charakteristischer für Demokratien sind Auseinandersetzungen und Streit. An kaum einer Stelle wird dies so deutlich wie in modernen Parlamenten, mit deren Geschichte deswegen unser Rückblick beginnt.
Parlamente
Wenn man auf die Anfänge des modernen Parlamentarismus in Deutschland sehen möchte, muss man historisch vor den Reichstag von 1871 zurückgehen und auch vor die Paulskirche von 1848/49. Man stößt dann auf die beiden gerade zum Königreich erhobenen Staaten Bayern und Württemberg in den Jahren nach 1815. Bayern mit etwa 3,5 Millionen Einwohnern gerade einmal so groß wie das heutige Berlin, Württemberg mit 1,4 Millionen Einwohnern noch einmal deutlich kleiner. Während es in den beiden größten damaligen deutschen Staaten, Österreich und Preußen, noch Jahrzehnte dauern sollte, waren in München und Stuttgart nach dem Ende der Napoleonischen Kriege Abgeordnetenkammern eingerichtet worden, die aus Wahlen hervorgingen und die die »Nation« als Ganzes – und nicht einzelne Stände – vertreten sollten. Auch wenn das Wahlrecht auf eine sehr begrenzte Anzahl von Männern beschränkt war und der Abgeordnetenversammlung eine weitere Kammer aus nicht gewählten Honoratioren gegenüberstand, war damit doch die Idee eines modernen, repräsentativen Parlaments ins Leben getreten. Das galt auch für das noch kleinere Großherzogtum Baden, das sich nach und nach zu etwas wie einem liberalen Musterstaat entwickelte.
Was ein solches Parlament bedeutet und welche politische Kraft die repräsentative Idee entfalten kann, wird beim Blick in die frühen Protokolle dieser Versammlungen klar. Faszinierende Beispiele bieten die ersten Sitzungen der badischen Abgeordnetenkammer in den Jahren 1819/20. Zunächst lief für den Großherzog in Karlsruhe alles nach Plan. Die beiden Kammern der neuen »Ständeversammlung« wurden nicht nur von ihm einberufen, huldvoll verkündete der Monarch bei der nach höfischem Protokoll vollzogenen Eröffnung auch, dass er die »Wünsche« seines Volkes, die nun durch das Parlament zu ihm gelangen würden, »gerne anhören und, wann sie geprüft sind, erfüllen« werde.[1] Doch schnell stellte sich heraus, dass es die Abgeordneten ernst meinten und ihre Anliegen keineswegs als »Wünsche« verstanden wissen wollten.
Als bei der Wiedereröffnung der Abgeordnetenversammlung im Juni 1820 die badische Regierung einigen Mitgliedern, die Beamte waren, die Teilnahme an der Plenarsitzung untersagte, drohten andere Parlamentarier damit, erst mit den Beratungen fortzufahren, wenn ihre fehlenden Kollegen eingetroffen waren. Die Verfassung, so ihr Argument, sehe eine solche Einschränkung des Mandats nicht vor. Es gelte, so der Abgeordnete und Pfarrer Gottlieb Bernhard Fecht, »die Constitution« mit »fester Entschlossenheit, aber auch mit ruhiger Mäßigung« zu verteidigen. Das »ganze badische Volk« müsse sehen, »dass seine Vertreter die Aufrechterhaltung der Constitution als ihre erste Pflicht erkennen.«[2] Nach einigem Hin und Her lenkte die Regierung tatsächlich ein und ermöglichte den Abgeordneten die Teilnahme. Ein Gesetz, das die Frage im Sinne der Regierung neu regeln sollte, zog sie zurück. Die Sache zog sich noch länger hin und für die Abgeordneten war die Gefahr, an der Ausübung ihres Mandats durch die Regierung gehindert zu werden, noch nicht völlig beseitigt. Sie hatten aber die Regierung mit Verweis auf die Verfassung erst einmal zum Nachgeben gezwungen. Im Jahr 1820, ein Jahr nach der Einrichtung der Kammer, war das ein bemerkenswerter Erfolg. Die Verfassung, das war nun klar, stand nicht nur auf dem Papier, sie band den Großherzog auch in der Praxis.
Dass die Regierungen immer häufiger gezwungen waren, den neuen Kammern entgegenzukommen – so es diese denn gab –, lag an zwei weiteren Momenten der frühen Parlamentsgeschichte in Deutschland. Zum einen: Die Landesherren und ihre Kabinette brauchten die Zustimmung der Parlamente. Formal lag das daran, dass nur so Gesetze und insbesondere der Haushalt gültig wurden. Sie benötigten die Zustimmung aber auch, um ihre eigene Legitimität zu stärken. In Zeiten steigender Staatsausgaben und nach einer Revolution wie der Französischen von 1789, die bisherige Herrschaftsbegründungen hinweggefegt hatte, suchten auch deutsche Monarchen nach neuen Legitimationspfeilern. Wenn man so möchte, waren die frühen Parlamente auf diese Weise nicht zuletzt ein Instrument fürstlicher Herrschaftssicherung, ein Instrument freilich, das zunehmend Eigendynamiken entwickelte und unbequem wurde.
Das zweite Moment, das den Parlamenten Macht verlieh, ist bis heute gut bekannt, das Prinzip der Öffentlichkeit ihrer Verhandlungen. »Die Sitzungen beider Kammern sind öffentlich«, hieß es in der badischen Verfassung von 1818. Geheime Beratungen waren nur unter bestimmten Bedingungen möglich. Darüber hinaus wurden die Protokolle publiziert; Zeitungen druckten die Reden schnell seitenweise nach. Wer wollte, konnte die Verhandlungen ausführlich nachlesen. Und dies konnten und wollten im Verlauf des 19. Jahrhunderts immer mehr Menschen. Zu lesen waren dann kontroverse Diskussionen über die richtige Politik, in denen gewählte Abgeordnete selbstbewusst und auf Augenhöhe den Regierungsvertretern gegenübertraten. Diese Debatten wurden damit nicht von außen an die Regierungen herangetragen, das gab es schon zuvor, sondern sie kamen ab jetzt aus den politischen Institutionen selbst, in denen die Kritiker der Regierung, wie es die Badener Abgeordneten 1820 getan hatten, gleichsam mit der Verfassung in der Hand ihren Argumenten Nachdruck verleihen konnten.
Da auch damals schon regelmäßig gewählt wurde und die Kabinette die Parlamente für ihre Beschlüsse brauchten, konnte die öffentliche Meinung den Regierungen nicht egal sein. Aus seinen ersten Kompetenzen, Gesetzgebung und Budgetrecht, in Kombination mit dem Prinzip der Öffentlichkeit seiner Sitzungen zog der frühe Parlamentarismus seine erstaunliche Kraft. Politische Entscheidungsprozesse wurden durch ihn zur öffentlichen Sache, über die sich zudem jeder und jede eine Meinung bilden konnte, die wiederum zumindest potenziell durch Wahlen an die Machtverhältnisse zurückgebunden war.
Zu im vollen Sinne demokratischen Parlamenten oder zu einer parlamentarischen Regierungsweise war es allerdings noch ein weiter Weg. Von den süddeutschen Anfängen ausgehend, ging es in den nächsten Jahrzehnten nicht so recht weiter. Zwar bestimmten Parlamentarier die politische Agenda erheblich mit, und in Folge der 1830 von Frankreich ausgehenden revolutionären Bewegungen kam es in der deutschen Staatenwelt zu einer zweiten Welle von Verfassungsgründungen zum Beispiel im Königreich Sachsen, das damit ebenso zu den frühen deutschen Verfassungsstaaten gehört. Aber die Ausweitung der Rechte der Parlamente kam nicht wirklich voran. Es etablierten sich vielmehr in den deutschen Staaten politische Systeme, in denen die Parlamente zwar Budget- und Gesetzesrecht besaßen, die Regierungen darüber hinaus aber nicht kontrollieren konnten. Diese wurden nach wie vor von den Monarchen eingesetzt.
Selbst die Verfassung der revolutionären Paulskirche vom 27. März 1849 ging in dieser Hinsicht nur einen kleinen Schritt weiter. Die Minister wurden auch hier vom Monarchen ernannt und entlassen. Über ihre »Verantwortlichkeit« sollte erst ein späteres Reichsgesetz genauere Bestimmungen enthalten. Einen Rückschlag erlebten Versuche, die parlamentarischen Kompetenzen auszuweiten, zehn Jahre später im sogenannten preußischen Verfassungskonflikt zwischen 1859 und 1866, als der preußische Ministerpräsident Otto von Bismarck – auch Preußen war inzwischen Verfassungsstaat – in harten Auseinandersetzungen mit dem Abgeordnetenhaus die Weiterentwicklung der parlamentarischen Kontrolle der Regierung verhinderte. Um ein effektives Regieren nicht zu blockieren, einigte man sich mit einigem zeitlichen Abstand auf die Festschreibung des Status quo: Jedes Gesetz einschließlich des Haushaltsgesetzes bedurfte der Zustimmung des Parlaments und also auch der der gewählten Abgeordnetenkammer. Die Regierungsbildung allerdings blieb allein Sache des Monarchen. Von diesem Kompromiss rückte dann auch die Verfassung des Kaiserreichs von 1871 nicht ab. Die Kontrolle der Regierungen durch die gewählten Abgeordneten war damit weiterhin nur indirekt möglich.
Ungeachtet solcher Grenzen: Die Abgeordneten des Reichstags von 1871 blickten auf eine jahrzehntelange deutsche parlamentarische Tradition zurück. Viele von ihnen waren keine Anfänger, sie wussten sich im konstitutionellen System zu bewegen. Sie wussten, wie man Regierungen unter Druck setzen konnte, und sie wussten auch, wo man vielleicht keine Chance hatte und deshalb seinerseits besser nachgab. Liest man die Reichstagsprotokolle aus den Jahren nach 1900, ist es deswegen nur auf den ersten Blick überraschend, wie streitbar, diskussions- und kritikfreudig die Debatten verliefen. Harsche Kritik an Regierung und Kaiser waren beileibe kein Tabu, am politischen Gegner in den anderen Parteien erst recht nicht. Der parlamentarische Stil unterschied sich manchmal gar nicht so sehr von dem heutigen. Es lohnt sich – die Protokolle sind alle online abrufbar –, etwa Debatten über den Kolonialkrieg in Deutsch-Südwestafrika nachzulesen oder zu den zahlreichen politischen Affären der Zeit, die sich nicht selten um Kaiser Wilhelm II. und seinen Führungsstil drehten.
Die Abgeordneten des Reichstags stimmten auch keineswegs allem zu, was ihnen die Reichsregierung vorlegte. Schon vor dem Nachtragshaushalt von 1906 hatten sie 1895 eine »Umsturzvorlage« abgelehnt, mit der in einem erneuten gesetzgeberischen Anlauf gegen die SPD beispielsweise die Meinungs- und Pressefreiheit eingeschränkt werden sollte. In seiner Rede vom 10. Mai 1895, in der er die Ablehnung der Regierungsvorlage begründete, warnte der württembergische Zentrumsabgeordnete Adolf Gröber die Regierung davor, die Rechte des Parlaments zu missachten. Dieses sei alles andere als eine »bloße Bejahungs- und Bewilligungsmaschine, so eine Art Gesetzgebungsautomat«. Selbstbewusst verwahrte er sich gegen »Ausfälle« des preußischen Innenministers gegenüber dem Reichstag und wies die Reichsregierung genüsslich darauf hin, dass ihr auch keine Auflösung des Parlaments helfen werde, denn bei Neuwahlen seien keine anderen Mehrheiten zu erwarten. Da die Mehrheitsfindung so schwierig war, aber auch im Reich von 1871 jedes Gesetz die Zustimmung des Parlaments benötigte, gingen die Regierungen dazu über, Gesetzesentwürfe im Vorfeld mit den Fraktionsführern der im Reichstag vertretenen Parteien durchzusprechen. Die Reichsleitung brauchte das Parlament längst und es ist kein Wunder, dass bis 1914 aus dem Parlament selbst heraus kaum Rufe nach einer grundsätzlichen Verfassungsreform kamen. Man hatte sich im monarchischen Kaiserreich ganz gut eingerichtet.
In der zweiten Hälfte des Ersten Weltkriegs änderte sich das und noch in den letzten Kriegswochen begann die Phase des voll ausgebildeten Parlamentarismus in Deutschland. Das Parlament von Weimar war dann in mancher Hinsicht das mächtigste in der deutschen Geschichte. Nicht nur die Regierung insgesamt war nun vom Reichstag abhängig. Die Abgeordneten konnten jeden einzelnen Minister durch einfache Abstimmung aus dem Amt jagen. Der entsprechende Artikel 54 der Verfassung von 1919 war unmissverständlich: »Der Reichskanzler und die Reichsminister bedürfen zu ihrer Amtsführung des Vertrauens des Reichstags. Jeder von ihnen muss zurücktreten, wenn ihm der Reichstag durch ausdrücklichen Beschluss sein Vertrauen entzieht.«
Dieser starke parlamentarische Kern der Weimarer Reichsverfassung lässt sich nur aus der langen Geschichte von Parlamenten in Deutschland erklären. Auch die der Verfassung beigegebenen Sonderrechte des Reichspräsidenten relativieren diesen Befund nicht. Denn sie zielten auf Notlagen und unterlagen auch dann noch einer Kontrolle durch die Abgeordneten. Der Normalfall der politischen Praxis war in der Verfassung von Weimar vom Reichstag und dessen Tradition her gedacht. Zu den Mitgliedern des Verfassungsausschusses der Weimarer Nationalversammlung gehörte zum Beispiel jener Adolf Gröber, der 1895 die Parlamentsrechte so vehement gegen die Zumutungen der Regierung verteidigt hatte. Von 1919 aus gesehen lag die Gefahr der Weimarer Verfassung nicht auf einer zu starken Position des Reichspräsidenten, Befürchtungen richteten sich eher auf eine zu starke Stellung des Parlaments, im Übrigen bei manchen Parlamentariern selbst. Die Gefahr des »Parlamentsabsolutismus« war ein Schlagwort der Debatte. Da schwang selbst bei Unterstützern der Republik ein »latenter Antiparlamentarismus« mit (Andreas Wirsching).[3]
Mit dem Scheitern von Weimar änderte sich die Gefahrenanalyse. Die Mütter und Väter des Grundgesetzes, nicht wenige von ihnen wiederum mit langer parlamentarischer Erfahrung, sahen das Problem nach den Erfahrungen der Jahre 1930 bis 1933 vor allem bei den Sonderrechten des Reichspräsidenten. Entsprechend versahen sie das neue Staatsoberhaupt mit weit weniger Rechten als ihre Vorgänger 1919. Aber auch bei den Kontrollrechten des Parlaments gegenüber der Regierung justierten sie nach. Wo die Autoren der Verfassung von Weimar auf Basis der Erfahrungen des Kaiserreichs dem Reichstag mit der Verantwortlichkeit jedes einzelnen Ministers sehr starke Kontrollmöglichkeiten gegeben hatten, schränkte das Grundgesetz durch das Instrument des »konstruktiven Misstrauensvotums«, das ausschließlich gegen das Haupt der Regierung, den Kanzler, in Stellung gebracht werden kann, diese Rechte wieder ein. Wie 1919 Lehren aus der Parlamentsgeschichte zuvor gezogen worden waren, so versuchten auch die Mütter und Väter des Grundgesetzes aus der Geschichte des Reichstags von Weimar zu lernen.
Vielleicht sogar noch eindrucksvoller zeigen sich solche Verbindungen und Wechselwirkungen zwischen den unterschiedlichen Phasen der deutschen Parlamentsgeschichte, die das Verhältnis von 1949 zu 1919betreffen, aber teilweise auch ins 19. Jahrhundert hineinreichen, bei den Geschäftsordnungen, die sich die Abgeordneten für ihre Arbeit jeweils gaben. Manche Bestimmungen aus der Bundesrepublik Deutschland lassen sich sogar auf die parlamentarische Praxis um 1850 zurückführen.
Als der Bundestag im September 1949 zusammentrat, wurde beschlossen, zunächst einmal die Geschäftsordnung des Weimarer Parlaments »vorläufig« zu übernehmen. Als Ende 1951 dann eine eigene Geschäftsordnung stand, baute diese weiterhin in großen Teilen auf diesem Vorläufer auf. Dutzende Absätze wurden wortgleich übernommen, andere nur umformuliert, ein Vorgehen, das im Übrigen bei vielen Gesetzen der jungen Bundesrepublik ebenso zu beobachten ist. Zu Beginn der Weimarer Republik war man ganz ähnlich verfahren und so enthielt die Parlamentsgeschäftsordnung von 1922 viele Bestimmungen, die für den kaiserlichen Reichstag getroffen worden waren und die ihrerseits nicht unerheblich auf der Geschäftsordnung für das preußische Abgeordnetenhaus von 1851 aufbauten. Manche Bestimmungen, die sich so über die politischen Brüche hinweg von Mitte des 19. Jahrhunderts bis in die Bundesrepublik durch die parlamentarischen Verfahren zogen, mögen rein formal gewesen sein. Andere waren es nicht und sprechen für lange Kontinuitäten in der deutschen parlamentarischen Praxis. Ein Beispiel ist das Recht jedes einzelnen Abgeordneten, in der zweiten Lesung von Gesetzen Änderungsanträge einzubringen, während ansonsten für Änderungsanträge die Unterstützung durch weitere Abgeordnete oder durch Fraktionen notwendig ist. Die entsprechende Bestimmung stammt aus dem Kaiserreich.
Sogar Verfassungsrang besitzt eine andere international auffällige Verfahrensregel der deutschen Parlamentsgeschichte, die sich in der Geschäftsordnung des Bundestags von 1951 (und etwas gewandelt bis heute) findet. Regierungsmitglieder haben demnach wie bereits in Weimar und im Kaiserreich ein jederzeitiges Rederecht im Parlament. Für eine parlamentarische Demokratie ist dieses aus dem Konstitutionalismus des 19. Jahrhunderts stammende Regierungsprivileg keineswegs selbstverständlich.
Zu den auffälligen Kontinuitäten gehört auch die Ausgestaltung des Ältestenrates im Parlament, der als überfraktionelles Organ für die konstruktive Gestaltung der parlamentarischen Arbeit von eminenter Bedeutung ist. Auch hier hat der Bundestag 1951 die entsprechende Bestimmung des Weimarer Reichstags fast wortgleich übernommen, die ihrerseits wiederum auf einer allerdings ungeschriebenen Praxis des kaiserlichen Reichstags beruhte. »Der Ältestenrat«, so lautet der entsprechende Paragraf in der Geschäftsordnung von 1922, »hat die Aufgabe, den Präsidenten bei der Führung der Geschäfte zu unterstützen und insbesondere eine Verständigung zwischen den Fraktionen über den Arbeitsplan des Reichstags herbeizuführen. Auch verteilt er die Stellen der Ausschussvorsitzenden und ihrer Stellvertreter.« Die Geschäftsordnung von 1951 ersetzte lediglich »Reichstag« durch »Bundestag« und zog den zweiten in den ersten Satz hinein. Von nun an hieß es: »Der Ältestenrat hat die Aufgabe, den Präsidenten bei der Führung der Geschäfte zu unterstützen, insbesondere eine Verständigung zwischen den Fraktionen über den Arbeitsplan des Bundestages, über die Besetzung der Stellen der Ausschussvorsitzenden und ihrer Stellvertreter herbeizuführen.«
Warum taten die Abgeordneten 1951 nicht das aus heutiger Sicht so Naheliegende und gaben sich nach dem Scheitern der Weimarer Demokratie grundsätzlich neue Verfahrensregeln? Warum setzten sie auch in dieser Hinsicht keinen parlamentarischen Neuanfang? Vor dem Hintergrund der deutschen Parlamentsgeschichte kann die Antwort nur lauten: Viele Abgeordneten des frühen Bundestages hatten vermutlich gar nicht den Eindruck, am Anfang zu stehen. Sie schöpften vielmehr ganz selbstverständlich aus den Erfahrungen, die vermeintlich oder tatsächlich aus der jahrzehntelangen Geschichte der parlamentarischen Arbeit in Deutschland zu gewinnen waren. Gemessen an der Geschäftsordnung von 1951 hatte sich vieles davon offenbar bewährt, wobei wiederum persönlich-biografische Kontinuitäten nicht zu unterschätzen sind. Erster Alterspräsident des deutschen Bundestages war Paul Löbe von der SPD. 1875 geboren, war Löbe von 1920 bis 1932 mit einer kurzen Unterbrechung Reichstagspräsident gewesen. Zuvor war er Mitglied der Nationalversammlung. In Fragen der Geschäftsordnung hatte er sicher manchen guten Rat.
Wahlen
Am 19. Januar 1919 durften zum ersten Mal nicht nur Männer, sondern auch Frauen in Deutschland mit der Verfassungsgebenden Nationalversammlung ein landesweites Parlament wählen. Vor dem Ersten Weltkrieg war die Frage heftig umstritten gewesen. Jetzt geschah die Einführung erstaunlich geräuschlos. Den meisten Zeitungen war es kaum mehr als eine Zeile wert. Sie konstatierten es einfach und schrieben gelegentlich von »Wählern und Wählerinnen«. Überhaupt fällt eine fast schon routinierte Berichterstattung auf. Viele Artikel griffen auf die Erfahrungen von früheren Wahlen zurück, verglichen die noch höhere Wahlbeteiligung von 1919 mit der schon hohen von 1912 oder konstatierten doch etwas überrascht, dass trotz der chaotischen Lage im Reich der Wahltag selbst weitgehend störungsfrei geblieben war. Die »Deutsche Allgemeine Zeitung«, Bismarcks alte »Norddeutsche Allgemeine Zeitung«, kommentierte den ruhigen Verlauf am Morgen nach der Wahl: »Dem Deutschen ist nun einmal die Wahl kein nervenkitzelndes Mittel, sondern Überzeugungssache, die er mit dem schweren Ernst anpackt und vollzieht.«
Auch bei der Einführung des Frauenwahlrechts gibt es keinen Grund, den Deutschen eine Verspätung bei der politischen Modernisierung zu attestieren, wie es manchmal pauschal geschehen ist. Vor dem Ersten Weltkrieg gab es in Europa nur in Norwegen sowie im zu Russland gehörenden, aber politisch autonomen Finnland das Wahlrecht für Frauen auf nationaler Ebene. Der Durchbruch geschah europaweit nach dem Großen Krieg. Mit der Einführung 1919 befand sich Deutschland somit mitten in der ersten großen Welle der Ausweitung des Wahlrechts auf Frauen. Andere große Länder zogen sogar erst später nach. Zum Beispiel in Frankreich durften Frauen seit 1944 auf nationaler Ebene wählen, als nach dem Abzug der deutschen Besatzer die vierte französische Republik entstand.
Seit der Einführung des Frauenwahlrechts zu Beginn der Weimarer Republik lässt sich für Deutschland von einem demokratischen Wahlrecht im vollen Sinne sprechen – was nicht ausschließt, dass über weitere Ausweitungen, etwa beim Alter, zu sprechen ist. Doch vielleicht noch einmal stärker als bei der Parlamentsgeschichte erweist sich die Geschichte des Wählens in Deutschland als eine, die nicht 1949 oder 1919 begann, sondern viel weiter zurückreicht und bei der Erfahrungen aus dem 19. Jahrhundert noch für unsere heutige Demokratie relevant sind. Faires und demokratisches Wählen, so lehrt diese Geschichte, ist eine ziemlich voraussetzungsreiche Tätigkeit, die sich keineswegs von selbst erklärt und die gegen mannigfache Manipulationsversuche und -möglichkeiten erst erkämpft werden muss. Die Deutschen, so zeigen historische Studien, waren im Kampf gegen Wahlmanipulationen sogar besonders gut. Faire Wahlen gab es hier vermutlich früher und weiter verbreitet als andernorts. Doch zunächst von Anfang an.
Die Frage, wie der Wahlvorgang genau ablaufen solle, stellte sich bereits im frühen 19. Jahrhundert auf ganz unterschiedlichen Ebenen. Neben Wahlen zu den Parlamenten der einzelnen Länder gab es auch auf lokaler Ebene an immer mehr Orten Stadt- und Kommunalräte durch Wahl zu bestimmen. Letzteres galt seit der Städteordnung von 1808 auch für Preußen. Doch wie sollte abgestimmt werden? Neben dem offenen Abstimmen in Versammlungen durch Handheben oder dem öffentlichen Eintrag in Listen waren mancherorts, wie bei den preußischen Magistratswahlen, Urnen in Gebrauch, in die man kleine Kugeln von unterschiedlicher Farbe warf. Wurde mit Zetteln gewählt, mussten diese fast überall mitgebracht werden oder die Kandidaten verteilten sie an ihre Anhänger gleich selbst – natürlich bereits mit ihrem Namen darauf. Mit welchem Zettel man wählte oder in den Abstimmungsraum ging, konnte so schon Hinweise auf die Wahlentscheidung geben. Doch wie wurde zu den Wahlversammlungen eigentlich eingeladen, wie die Wahlberechtigung überprüft? Wie sollten Kandidaten aufgestellt werden können und wie sollte für diese geworben werden? Bis dies alles festgelegt war, gingen weitere Jahrzehnte ins Land und feste Regeln bedeuteten noch nicht, dass sie überall eingehalten worden wären. Zum Beispiel die frühen Wahlen zur badischen Abgeordnetenkammer liefen offenbar in den jeweiligen Stimmbezirken unterschiedlich ab.
Solche Probleme stellten sich natürlich nicht nur in Deutschland, sondern überall dort, wo sich das Wahlrecht im 19. Jahrhundert verbreitete. Berühmt-berüchtigt für Wahlmanipulationen wurden dabei insbesondere die USA. Dies galt für die Südstaaten, in denen nach dem amerikanischen Bürgerkrieg buchstäblich mit allen Mitteln und häufig bis zu physischer Gewalt und Mord versucht wurde, schwarze Männer von der Stimmabgabe abzuhalten. Es galt aber ebenso für die großen Städte im Nordosten, wo gleichermaßen bis Anfang des 20. Jahrhunderts an Wahltagen Gewalt gang und gäbe war. Hinzu kamen weitverbreitete Techniken der Wahlmanipulation. Organisierte Banden brachten an den Registrierungstagen Gruppen von außerhalb in die Städte, die sich dann als Wähler eintrugen. Sogenannte repeaters