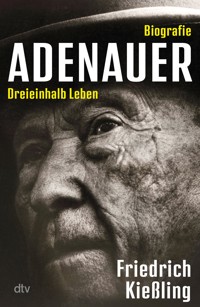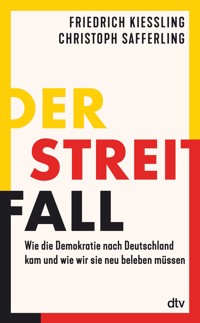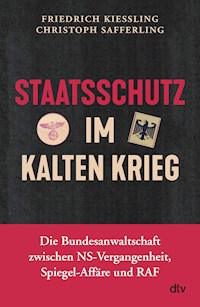
19,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: dtv
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Staatsdiener der Diktatur, Anwälte der Demokratie Die Bundesanwaltschaft hat den Auftrag, den Staat zu schützen und zur Rechtseinheit beizutragen. In der frühen Bundesrepublik ging sie mit harter Hand gegen Kommunisten vor, war in die Spiegel-Affäre verwickelt und musste sich Anfang der 1970er-Jahre mit der Bekämpfung der aufkommenden RAF einer bis dahin unbekannten Bedrohung stellen. Zugleich scheute die Bundesanwaltschaft eine Auseinandersetzung mit der Vergangenheit ihrer eigenen Mitarbeiter – obwohl viele bereits im »Dritten Reich« wichtige juristische Positionen bekleidet hatten. Erstmals wird in diesem Buch die Geschichte der Bundesanwaltschaft zwischen 1950 und 1974 erforscht. Es wirft ein Schlaglicht auf die heute hochaktuelle Frage, wie eine Demokratie den Staat schützen kann, ohne die eigenen Werte zu verraten.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 1015
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Friedrich Kießling / Christoph Safferling
Staatsschutz im Kalten Krieg
Die Bundesanwaltschaft zwischen NS-Vergangenheit, Spiegel-Affäre und RAF
dtv Verlagsgesellschaft mbH & Co. KG, München
Vorwort
Ende 2017 wurden wir vom Generalbundesanwalt beim Bundesgerichtshof, Dr. Peter FrankFrank, Dr. Peter, beauftragt, die Geschichte seiner Behörde zu untersuchen. Nachdem wir bereits zuvor in anderen Projekten die NS-Vergangenheit von Bundeseinrichtungen untersucht hatten (Bundeslandwirtschaftsministerium – Friedrich KießlingKießling, Friedrich; Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz – Christoph SafferlingSafferling, Christoph), war die vergleichsweise kleine Behörde der Bundesanwaltschaft für uns eine besondere Herausforderung. Das liegt einerseits an dem überschaubaren Auftrag der Behörde, die aber stark eingebunden ist zwischen Politik (Bundesjustizministerium) und rechtsprechender Gewalt (Bundesgerichtshof). Der geringe, rein juristische Personenkreis der Mitarbeiter bringt es andererseits mit sich, dass einzelne Personen einen viel stärkeren Einfluss auf die Institution haben als bei größeren Behörden.
Bei der Bundesanwaltschaft haben wir für unsere Forschungstätigkeit eine Menge Unterstützung erfahren, für die wir uns herzlich bedanken. Als unmittelbare Kontaktpersonen waren Abteilungsleiterin Frau Bundesanwältin Dr. Heike NeuhausNeuhaus, Dr. Heike und Herr Bundesanwalt Lienhard WeißWeiß, Lienhard für uns stets zu sprechen. Für Archivrecherchen im Haus boten uns Frau Sandra NeuhartNeuhart, Sandra und Frau Elke SchulteSchulte, Elke immer eine helfende Hand. Die gemeinsame Organisation eines Symposiums zum Staatsschutz im Sommer 2019 war deshalb nicht nur eine große Freude, sondern auch eine wichtige Bestätigung unserer Arbeit. Wir bedanken uns ebenso bei den ehemaligen Mitarbeitern, die sich als Zeitzeugen zur Verfügung gestellt haben.
Während in den Jahren 2018 und 2019 die Archive in Berlin, Koblenz, Freiburg oder Ludwigsburg unter den gewöhnlichen Bedingungen erreichbar waren, verschlechterte sich die Situation bedingt durch die Covid-19-Pandemie ab April 2020 dramatisch. Besonders hilfreich waren in dieser Zeit vor allem Gunnar WendtWendt, Gunnar und sein Team im Bundesarchiv in Koblenz, die bei der Erschließung von Verfahrensakten für uns einen Zahn zulegten.
Unser besonderer Dank gilt den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern unserer Lehrstühle in Erlangen, Eichstätt und Bonn, die nicht nur bei der Erstellung der Datenbanken und Durchsicht der Archivalien hilfreich waren, sondern sich auch um die Fertigstellung des Manuskripts verdient gemacht haben. Zu danken haben wir vor allem den wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen Yvonne Blomann, Jana Kuhlmann und den wissenschaftlichen Mitarbeitern Nicolas Dümmler und Philipp Graebke. Dazu kommen über die Jahre einige Hilfskräfte: Janelle Paul, Alena Gallmetzer, Anna Pacurar, Julia Gehrke und Tim Raab.
Wir danken darüber hinaus Herrn Stefan Ulrich Meyer vom Verlag dtv für seine Geduld, die wir Corona-bedingt strapaziert haben, und die Betreuung des Manuskripts durch das Lektorat.
Die Geschichte der Bundesanwaltschaft ist mit diesem Buch natürlich nicht abschließend beschrieben. Wir enden 1974 mit dem Ende der Amtszeit von Generalbundesanwalt Ludwig MartinMartin, Ludwig. Die darauffolgenden Jahre werden auch noch zu untersuchen sein. Sie zeigen in besonderer Weise, wie nah uns die Geschichte ist, denn einige der Verfahren zum »Deutschen Herbst« sind noch nicht abgeschlossen.
Wir hoffen, dass wir mit diesem Buch einen Beitrag leisten für das bessere Verständnis der Anfangsjahrzehnte der Bundesrepublik Deutschland und des schweren Erbes des Umgangs mit der nationalsozialistischen Vergangenheit.
Erlangen und Bonn im April 2021
Friedrich Kießling und Christoph Safferling
Einleitung: Staatsschutz im Kalten Krieg
Die Bundesanwaltschaft zwischen NS-Vergangenheit, Spiegel-Affäre und RAF
Der Generalbundesanwalt ist in der deutschen Öffentlichkeit heute das zentrale Gesicht im »Kampf gegen den Terror«. Neben dem Bundeskriminalamt und dem Bundesamt für Verfassungsschutz ist er für den Staatsschutz und damit für die Terrorabwehr maßgeblich verantwortlich. Seit den Anschlägen am 11. September 2001 hat weltweit die Furcht vor weiteren Attacken massiv zugenommen. Dazu haben nicht zuletzt das Erstarken des sogenannten Islamischen Staats und mehrere Anschläge in Europa, wie in Paris (Charlie Hebdo und Bataclan-Theater, 2015), Nizza (Promenade des Anglais, 2016) oder Berlin (Breitscheidplatz, 2016), beigetragen.
Im Verbund mit der internationalen Gemeinschaft wurde als Reaktion auch hierzulande der strafrechtliche Staatsschutz nachgerüstet. Die Gesetze wurden verschärft, die Eingriffsmaßnahmen ausgeweitet, die Koordination der Sicherheitsbehörden wurde verbessert und Personal massiv aufgebaut. Beim Generalbundesanwalt arbeiten heute 110 Bundesanwältinnen und -anwälte, Oberstaatsanwältinnen und -anwälte sowie Staatsanwältinnen und -anwälte, die wiederum von 50 abgeordneten Juristinnen und Juristen aus den Ländern unterstützt werden. Neben den Gefahren durch den internationalen islamistischen Terrorismus haben zuletzt aber vor allem rechte Netzwerke mit blutigen Anschlägen – auf die Synagoge in Halle 2019 oder vor einer Shisha-Bar in Hanau im Jahr 2020 – für Entsetzen gesorgt. In all diesen Situationen war und ist das Vertrauen in den Generalbundesanwalt im Allgemeinen groß. Die Öffentlichkeit erwartet die Übernahme der Ermittlungen durch die Karlsruher Staatsschützer und geht, wenn das geschieht, davon aus, dass die Strafverfolgung in den richtigen Händen liegt.
Dieses positive Image und das damit verbundene weitgehende Vertrauen der Öffentlichkeit genoss der Generalbundesanwalt oder der Oberbundesanwalt, wie die Amtsbezeichnung bis 1957 lautete, nach seinem Dienstantritt am 8. Oktober 1950 lange Zeit nicht. Die kleine Behörde – 1951 arbeiteten für den Oberbundesanwalt drei Bundesanwälte, vier Oberstaatsanwälte und drei Hilfskräfte – musste erst ihre Position in dem neu zu schaffenden Sicherheitsapparat der frühen Bundesrepublik finden. Diese Gründungsjahre von 1950 bis 1974, also bis zu den Anfängen des RAF-Terrors, sind Gegenstand dieser Untersuchung. Dabei geht es vor allem auch um das nationalsozialistische Erbe der Bundesanwaltschaft, die personellen Belastungen und deren Auswirkungen auf die Arbeit der Staatsanwaltschaft beim Bundesgerichtshof. Dazu wurde zum ersten Mal das Archiv der Behörde in Karlsruhe in seiner vollen Breite geöffnet und den Autoren Einsicht in Personalakten, Generalakten und auch Verfahrensakten gewährt. Darunter befanden sich auch etliche als »Vertraulich« und »Geheim« eingestufte Akten, die für diese Untersuchung deklassifiziert wurden. Diese Bestände aus dem Keller der Brauerstraße 30 in Karlsruhe bilden die Grundlage für die Geschichte der Bundesanwaltschaft zwischen NS-Vergangenheit, Spiegel-Affäre und RAF.
Der Staatsschutz ist aber nur die eine Seite des Aufgabenportfolios des Generalbundesanwalts. »Der Rechtspflege und dem Vaterlande« – das sei der Leitspruch der Reichsanwaltschaft, schrieb Reichsanwalt Richard NeumannNeumann, Richard im Jahr 1929 zum 50. Geburtstag von Reichsgericht und Reichsanwaltschaft. Umschrieben waren damit die beiden Tätigkeitsbereiche der Strafjuristen der Reichsanwaltschaft, die während der Weimarer Republik in Leipzig am Reichsgericht ihre Arbeit verrichteten. Ihre Aufgabe war die Fortentwicklung des Strafrechts durch Revisionen einerseits und die Verteidigung des Staatswesens gegen seine Feinde mit den Mitteln des Strafrechts andererseits. Das gilt im Grunde auch noch heute: Der Generalbundesanwalt dient der Rechtspflege, indem er die Revisionsverfahren im Strafrecht vor dem Bundesgerichtshof (BGH) vertritt, und er dient dem »Vaterland«, indem er die Ermittlungen bei Terror- oder Spionageverdacht und – seit 2002 – auch bei Verstößen gegen das Völkerstrafrecht durchführt. Die Aufgabenbereiche sind so unterschiedlich, dass man auch sagen könnte, unter dem Dach »Der Generalbundesanwalt beim Bundesgerichtshof«, wie die Behörde offiziell heißt, sind mindestens zwei, wenn nicht sogar drei beinahe eigenständige Behörden vereint: die Revisionsabteilung und die Abteilungen für erstinstanzliche Verfahren, die Terrorismusabteilung und die Spionageabteilung. Diese drei Abteilungen arbeiten nicht nur thematisch sehr unterschiedlich, sondern haben auch ganz andere Abläufe, andere Routinen und sind von einem anderen Selbstverständnis geprägt.
Das war nicht immer so. Gerade in den Anfangsjahren wurde versucht, keine starren Strukturen und Hierarchien aufkommen zu lassen, auch wenn bald klar wurde, dass das Revisionsdenken und die Ermittlungstätigkeit doch andere Expertisen und auch andere Charaktere verlangten. Mit zunehmender Größe der Behörde ließ sich deshalb eine solche Spezialisierung gar nicht verhindern. Genauso erschien es sinnvoll, zwischen Hoch- und Landesverrat und später zwischen innerer und äußerer Sicherheit bei Ermittlungsverfahren zu differenzieren.
Die Revisionen sind juristisch gesehen eine hohe Kunst. Es geht hier nicht um Tatsachenfragen, sondern allein um die richtige Anwendung des Prozessrechts und die korrekte Auslegung des Strafrechts. In der Revisionstätigkeit hat sich auch quantitativ seit 1950 wenig geändert: Im Jahr 1953 gab es etwa 3284 Neuzugänge an Revisionen beim Generalbundesanwalt, 1974 waren es 3179 und 2019 im vereinigten Deutschland 3257. Revision ist Denkarbeit am Schreibtisch, oft Routine, selten medienträchtig. Wenn sich die Öffentlichkeit dafür interessiert, was natürlich bei wichtigen Rechtsfragen auch vorkommt, wird nicht auf die Bundesanwaltschaft geschaut, sondern auf den Bundesgerichtshof, dessen Urteilsverkündungen mittlerweile häufig live im Internet zu sehen sind. Die Lorbeeren für die Arbeit ernten andere, nicht die Bundesanwaltschaft.
Die Bundesrepublik Deutschland hatte nach dem Ende des staatlichen Terrors der Nationalsozialisten keine einfache Aufgabe vor sich. Es galt, Sicherheitsstrukturen aufzubauen, die der Rechtsstaatlichkeit verpflichtet waren und demokratischer Kontrolle unterlagen. Beim Schutz freiheitlicher Strukturen lag in Deutschland eher ein Erfahrungsdefizit vor, denn das Projekt Weimar war, trotz vieler guter Ansätze, dramatisch gescheitert. Nach vier Jahren weitgehender Fremdbestimmung und alliierter Kontrolle sollte diese Bundesrepublik rasch Demokratie lernen und musste sich dafür geeignetes Personal suchen. Die damit verknüpfte Frage nach den personellen Kontinuitäten und deren Auswirkungen auf die sachliche Arbeit in Gerichten, Behörden und Ministerien ist in den vergangenen Jahren in das Zentrum der politischen und wissenschaftlichen Aufmerksamkeit gerückt und hat zu erheblicher und konzentrierter Forschungsaktivität geführt, die auch noch andauert.
Aufarbeitungsprojekte oberster Bundesbehörden
Im Jahr 2005 setzte der damalige Bundesaußenminister Joschka Fischer eine Historikerkommission ein, um die Geschichte des Auswärtigen Dienstes in Deutschland zu beleuchten und Kontinuitätslinien zwischen Nationalsozialismus und Bundesrepublik zu untersuchen. Spätestens zu diesem Zeitpunkt wurde für den, der es sehen wollte, deutlich, dass sich hier ein größeres Forschungsdefizit offenbarte. Auch wenn die Zeit des Nationalsozialismus eine der am besten erforschten Phasen der deutschen Geschichte überhaupt ist, fehlten weitgehend Studien zum Übergang der Ministerien und obersten Bundesbehörden in die Bundesrepublik.[1] Entsprechend große Aufmerksamkeit erfuhr die Veröffentlichung der Studie Das Amt und die Vergangenheit im Jahr 2010. Bereits im Jahr 2008 hatte die damalige Generalbundesanwältin Monika HarmsHarms, Monika die Initiative ergriffen, die Geschichte ihres Hauses und sämtlicher oberster Bundesgerichte unabhängig untersuchen zu lassen. Das Projekt scheiterte. Offenbar war man auf höchster Ebene der Gerichtspräsidentinnen und -präsidenten von der Notwendigkeit einer solchen historischen Arbeit nicht überzeugt. Die Zeit war noch nicht reif.
Im Jahr 2012 richtete die Bundesjustizministerin Sabine Leutheusser-SchnarrenbergerLeutheusser-Schnarrenberger, Sabine zunächst eine Kommission ein, mit dem Auftrag, die Geschichte ihres Ministeriums zu untersuchen. Der Generalbundesanwalt im Geschäftsbereich des Justizministeriums musste seine Ambitionen nun erst einmal zurückstecken. Erst nach der Veröffentlichung der Studie in der Amtszeit von Justizminister Heiko MaasMaas, Heiko unter dem Titel Die Akte Rosenburg[2] nahm man in Karlsruhe den Faden wieder auf.
Die Sicherheitsarchitektur der frühen Bundesrepublik war an anderer Stelle schon Gegenstand der Forschung. So liegt eine frühere Untersuchung zur Belastung des Bundeskriminalamts (BKA) aus dem Jahr 2008 vor,[3] ebenso eine Schrift zum Bundesamt für Verfassungsschutz.[4] Die Studie Hüter der Ordnung beschäftigt sich mit dem Bundesinnenministerium und ist für die Organisation der inneren Sicherheit in der Bundesrepublik ebenfalls hoch relevant.[5] Auch die Unabhängige Historikerkommission zur Erforschung der Geschichte des Bundesnachrichtendienstes (BND) hat eine einschlägige Studie veröffentlicht.[6] Über den Bundesgerichtshof gibt es eine frühe Studie mit wichtigen Einblicken.[7] Die Arbeit einer mittlerweile eingerichteten Kommission zur systematischen Aufarbeitung der Vergangenheit des Bundesgerichtshofs ist noch nicht abgeschlossen.
Die genannten Einrichtungen stehen in unmittelbarer Verbindung zum Generalbundesanwalt und sind daher einschlägig. Auch wenn dort nur wenige Angaben zur Bundesanwaltschaft selbst zu finden sind, so lassen sich doch Rückschlüsse auf die Arbeitszusammenhänge in den Anfangsjahrzehnten der Bundesrepublik Deutschland ziehen.
Täter, Opfer und Belastungsbegriffe
Die Frage, die sich in all diesen Studien stellt, ist, wie es gelingen konnte, das liberale Grundgesetz als Gegenentwurf zum Nationalsozialismus mit demokratischem Leben zu füllen, angesichts der schweren Hypothek, dass die Funktionseliten, nicht zuletzt die juristische, tief in den Nationalsozialismus verstrickt waren. Die Entnazifizierung der Gesetze und des Personals war von den Siegermächten begonnen worden. In den Nürnberger Prozessen mussten sich nicht nur die Hauptkriegsverbrecher vor dem internationalen Recht verantworten, sondern auch die Juristen wurden strafrechtlich zur Rechenschaft gezogen. Nach Art. 131 des Grundgesetzes musste jeder, der in der Bundesrepublik Deutschland in den Staatsdienst treten wollte, ein ihn entlastendes Entnazifizierungsverfahren durchlaufen haben. Eine Garantie für eine unbelastete Vergangenheit stellten diese Verfahren aber kaum dar. Wie stellte man also sicher, dass man geeignete Personen für den Neuanfang fand? Ganz ohne die frühere Elite wäre ein Staatsaufbau nicht gelungen. Das wäre allein quantitativ nicht möglich gewesen. Außerdem wurde auch die Expertise dringend benötigt.
Was aber bedeutet überhaupt »Belastung«? Der Begriff ist eng mit Vorstellungen von moralisch richtigem Verhalten verknüpft, der gesellschaftlichen Wandlungen unterworfen ist. Das zeigt sich schon in dem Untersuchungszeitraum von 1950 bis 1974. In den 1960er-Jahren wird ein anderer Umgang mit dem Begriff NS-Belastung wahrnehmbar. Gemeinhin wird unterschieden zwischen einem formalen und einem materiellen Belastungsbegriff. Formale Belastung bedeutet dabei die Mitgliedschaft in der NSDAP oder einer NS-Organisation wie der SA, der SS oder – im juristischen Kontext – dem NSRB, dem Nationalsozialistischen Rechtswahrerbund. Eine solche formale Belastung lässt sich anhand der NSDAP-Mitgliederkartei, die recht vollständig überliefert ist, gut nachvollziehen. Außerdem wurde von Anfang an bei der Einstellung jeder nach seiner Parteizugehörigkeit gefragt und die Mitgliedschaften wurden entsprechend in der Personalakte verzeichnet. Auch wenn bei der Einstellung kein entsprechender Abgleich mit der Mitgliederkartei beim Berlin Document Center vorgenommen wurde, entsprachen bei denen von uns untersuchten Personen die Angaben bis auf wenige Ausnahmen der Wahrheit. Offenbar musste hier nichts beschönigt werden.
Allerdings muss auch bei diesem formalen Ansatz unterschieden werden. So ist etwa zu fragen, ob jemand in der Partei eine Funktion ausgeübt hat, etwa als Blockleiter, oder nur einfaches Mitglied war. Auch das Eintrittsdatum hat hohe Relevanz. Wer vor der »Machtergreifung« in die Partei eingetreten war, tat das sicherlich aus einer anderen Überzeugung heraus als jemand, der erst später das Parteibuch erhielt. Wichtig ist auch der Aufnahmestopp, der im Frühjahr 1933 verhängt und am 1. Mai 1937 wieder aufgehoben wurde. In der von uns untersuchten Kohorte findet sich niemand, der vor 1933 den Parteieintritt erstrebte; die große Menge strömte im Mai 1937 in die NSDAP. Die Motive mögen vielfältig gewesen sein, Juristen geben meist Karrieregründe an. Aber völlig bedeutungslos ist eine Parteimitgliedschaft auch nicht. Es gibt Beispiele von Personen, die in die Partei eintreten wollten, die aber nicht aufgenommen wurden, weil sie als nicht »zuverlässig« eingeschätzt wurden.
Daneben ist nach der materiellen Belastung zu fragen, das heißt danach, was die Person – Parteimitglied oder nicht – zwischen 1933 und 1945 tatsächlich getan hat. Als Jurist gab es viele Betätigungsfelder, die eine unterschiedliche Affinität zum Regime nahelegen. Ein Militärrichter, ein Richter am Volksgerichtshof (VGH) oder ein Staatsanwalt an einem Sondergericht war sehr viel näher am Unrechtssystem als ein einfacher Amtsrichter. Diese Gruppenzugehörigkeit macht aber eine individuelle Betrachtung nicht überflüssig. Im Gegenteil, erst ein individualbiografischer Ansatz kann die tatsächliche Belastung zum Vorschein bringen.
Wie in anderen Studien auch prägen sehr unterschiedliche Einzelschicksale das Personal der Bundesanwaltschaft. Während die formale Belastung in dieser kleinen Behörde mit hoch besoldeten Spitzenjuristen erdrückend ist, fällt eine individuelle Betrachtung sehr viel differenzierter aus. Auffallend ist aber auch hier, dass sich eine relativ große Clique aus dem Kontext des Reichsgerichts und der Reichsanwaltschaft in Leipzig nach 1950 wieder in Karlsruhe am Bundesgerichtshof und in der Bundesanwaltschaft versammelte, sich wechselseitig empfahl und deckte.
Der eingangs zitierte ehemalige Reichsanwalt Richard NeumannNeumann, Richard war Jude. Bei der Reichsanwaltschaft hat er sich seit 1919 vor allem als Kommunistenjäger einen Namen gemacht. Dafür waren ihm auch die Nazis dankbar, sodass er nicht gleich nach der »Machtergreifung« mit dem »Gesetz zur Wiederherstellung des Berufsbeamtentums« seinen Posten räumen musste. Er arbeitete weiter und lebte auch nach seiner rassistisch motivierten Entfernung aus dem Amt bis 1944 in Berlin. Am Umgang mit seiner Person lässt sich das Selbstverständnis der Elitejuristen der Weimarer Zeit gut nachempfinden. Die Naziherrschaft wurde wie ein momentanes Unglück empfunden, die wie von einem anderen Stern plötzlich über das deutsche Staatswesen, die deutsche Justiz und Gesellschaft hereingebrochen war. Man arrangierte sich damit und arbeitete weiter, darauf bedacht, nicht aufzufallen. Dass NeumannNeumann, Richard gehen musste und 1944 dann auch unter großer Anteilnahme der Leipziger Kollegen nach Theresienstadt deportiert wurde, änderte nichts daran, dass er zu dem Kreis der alten Elitejuristen dazugehörte. 1945 wurde er, als wenn nichts passiert wäre, wieder aufgenommen und durfte, hochbetagt, als Senatspräsident am Bundesgerichtshof für ein paar Jahre dort weitermachen, wo er zehn Jahre vorher hatte aufhören müssen.
Das klappte auch deshalb so reibungslos, weil der Leipziger Juristenzirkel eine äußerst homogene Gruppe war. Gleicher konservativ-bürgerlicher Hintergrund, gleiche Sozialisation, gleiche juristische Ausbildung, gleiche politische Einstellung. Belegt wird dieses Zusammengehörigkeitsgefühl auch durch die Gegenbeispiele. Der Sozialdemokrat Fritz BauerBauer, Fritz, wegen seiner jüdischen Herkunft von den Nazimachthabern ins Exil gezwungen, erfuhr bei seiner Rückkehr in die Justiz zwar auch viel politische Unterstützung, zumal vom hessischen Ministerpräsidenten Georg-August ZinnZinn, Georg-August, der ihn in Frankfurt zum Generalstaatsanwalt machte, erlebte die Justiz und die deutsche Nachkriegsgesellschaft aber als »Feindesland«. Oder Rechtsanwalt Friedrich Karl KaulKaul, Friedrich Karl, Staranwalt der späteren DDR, der bis 1933 zunächst in Heidelberg, anschließend an der Universität Berlin bei James GoldschmidtGoldschmidt, James studierte und promovierte. Dabei lernte er Adolf SchönkeSchönke, Adolf und andere spätere Vorzeigejuristen der Bundesrepublik kennen, durfte dann aber aufgrund seiner jüdischen Herkunft nicht wie alle anderen ins Referendariat. Er begann, sich für die »Rote Hilfe« zu engagieren, kam ins Konzentrationslager Dachau und konnte später mit Unterstützung seines Doktorvaters nach Amerika fliehen. Als Kommunist war er in den Karlsruher und Bonner Juristenzirkeln im Unterschied zu NeumannNeumann, Richard nicht anerkannt. Beide, BauerBauer, Fritz und KaulKaul, Friedrich Karl, setzten sich auch für die strafrechtliche Verfolgung von nationalsozialistischen Verbrechen ein und stellten sich damit gegen die herrschende Exkulpations- und Schlussstrichmentalität der Mehrheit der Juristen in der Bundesrepublik.
Staatsschutz oder Schutz der Demokratie? Historische Dimensionen und aktuelle Problemstellungen
Der Umgang mit den Verbrechen im Nationalsozialismus stellt einen wichtigen Punkt dar bei der Frage, ob und wie sich das personelle »Weiter-So« auch in der Arbeit niedergeschlagen hat. Ein weiterer wichtiger Aspekt ist die Frage nach dem Schutzgut der Staatsschützer. Das Gesetz spricht von der »verfassungsmäßigen Ordnung«. Aber wie werden die Grundrechte von der Bundesanwaltschaft geachtet und geschützt? Wie ist der Umgang mit politisch Andersdenkenden und der Respekt vor der Meinungsfreiheit, vor allem gegenüber Kommunisten? Wie ist der Umgang mit der Pressefreiheit, dem so wichtigen demokratischen Kontrollinstrument? Welchen Staat schützen die Staatsschützer?
An diesen damals wie heute wichtigen Fragen lässt sich der gesellschaftliche Lernprozess und die Rezeption desselben durch die Juristenelite in Karlsruhe gut nachvollziehen. 1950 war der Feind schnell identifiziert: der Kommunismus. Das Fallaufkommen war immens: In der Hochzeit der Kommunistenverfolgung kämpfte die Bundesanwaltschaft zwischen 1958 bis 1962 mit jährlich etwa 3000 Neuzugängen. Im Vergleich dazu waren es 2017 und 2018, zu den Spitzenzeiten der vergangenen Jahre, jeweils etwa 1200 und 2019 nur noch 694. Die Angst vor Unterwanderung durch den »Osten« und vor einem schleichenden kommunistischen Umsturz war angesichts der politischen Lage im geteilten Deutschland und der militärischen Auseinandersetzung in Korea vielleicht nachzuvollziehen. Innenpolitisch war in Westdeutschland diese Gefahr aber nie real. Gleichwohl ging man mit aller Härte gegen die KPD vor, während man Bestrebungen einer Renationalsozialisierung nie als ähnlich gefährlich einschätzte. Von rechts vermutete man auch keinen Angriff auf den Staat, den man als abstraktes Schutzgut verstand, als Funktionieren der Regierung und der staatlichen Strukturen. Die Werte der Demokratie hatte man noch lange nicht verinnerlicht. Deswegen war man bei der Bundesanwaltschaft auch nachhaltig verwirrt von den gesellschaftlichen Reaktionen auf die Verhaftung der Spiegel-Redakteure und die Untersuchung der Redaktionsräume in Hamburg im Herbst 1962. In der Spiegel-Affäre zeigte sich die über Jahre schleichende Entfremdung der Staatsschützer von der westdeutschen Gesellschaft. Das Stichwort von der »wehrhaften Demokratie« war zwar in Bonn und Karlsruhe weit verbreitet. Die Vorstellungen von Demokratie war bei der Bundesanwaltschaft aber noch sehr vage.
Möglicherweise wirkte diese Entfremdung nach, als zehn Jahre nach der Spiegel-Affäre mit dem RAF-Terror eine wirkliche Bedrohung aufzog und der Generalbundesanwalt selbst ins Visier der Terroristen geriet. Die Strafjustiz ließ sich jedenfalls zu Beginn der RAF regelrecht vorführen und musste zusehen, wie die in Stammheim Inhaftierten jedenfalls teilweise die Sympathien der Öffentlichkeit auf ihrer Seite hatten. Die provokante Frage »Schützt sich der Rechtsstaat zu Tode?« verdeutlicht dieses Missverstehen zwischen Strafverfolgern und Gesellschaft.[8] Mit der Zunahme der gesellschaftlichen Bedrohung durch die zweite und dritte Generation der RAF begann sich das Bild zu wandeln. In Karlsruhe war man von den Reaktionen aber noch lange Zeit schockiert und fühlte sich – nicht ganz zu Unrecht – missverstanden. Immerhin hatten die Staatsschützer auch persönlich mit realen Bedrohungen umzugehen und verfolgten nun nicht mehr kommunistische Schimären, sondern gefährliche Gewaltverbrecher, die ihre politischen Forderungen mit massiver Waffengewalt durchsetzen wollten und damit teilweise erfolgreich waren.[9] Man kann an dem Umgang der Bundesrepublik mit dem RAF-Terror viel kritisieren, aber immerhin haben die demokratischen Strukturen nicht ernsthaft gewackelt. So lässt sich Ende der 1980er-Jahre seitens der Bundesanwaltschaft durchaus zu Recht resümieren: »[U]nser gefestigtes demokratisches Gemeinwesen und seine verfassungsmäßig berufenen Organe verdienen weiterhin Vertrauen. Sie sind im Stande und auch willens, den ständig wechselnden Herausforderungen in rechtsstaatlicher Weise zu entsprechen.«[10]
Die Fragen von damals sind heute angesichts des internationalen Terrorismus und der vielen kriegerischen Konflikte, die über die Flüchtlingsbewegungen unmittelbar auf unsere Gesellschaft in Deutschland einwirken, nicht minder aktuell. In welcher Gesellschaft, in welchem Staat leben wir? Wer ist der Feind, den wir mit strafrechtlichen Mitteln bekämpfen müssen? Diese Fragen müssen stets neu gestellt und beantwortet werden.
Eines jedenfalls zeigt die Bundesanwaltschaft von 1950 bis heute: Die Mittel, die wir aufwenden, müssen vor den Schranken eines Rechtsstaats Bestand haben. Auch hier werden die Grenzen angesichts sich wandelnder Herausforderungen ständig neu definiert. Der Generalbundesanwalt beim Bundesgerichtshof hat sich aber immer eine gewisse Mäßigung im Umgang mit »Feinden« auferlegt. Niemals stand wirklich infrage, dass die Suche nach der Wahrheit unter Einhaltung der Regeln der Strafprozessordnung das Zentrum der Tätigkeit bildete. Das gelang in der Geschichte mal besser und mal schlechter. Es gelang dann besonders gut, wenn man sich auf die Verfolgung von Straftaten und den Schutz von Werten konzentriert und sich nicht Ideologien einer abstrakten Staatsbedrohung verschrieben hatte. Wenn sich heute der Generalbundesanwalt auch der Verfolgung von Verbrechen gegen die Menschlichkeit widmet, ist dies eine Konsequenz dieser Entwicklung und zeigt, dass die Behörde sich zu internationalen Menschenrechten und demokratischen Werten bekennt.
Strafrecht ist kein Allheilmittel zur Lösung gesellschaftlicher Konflikte. Aber es kann dabei helfen, massive Bedrohungen und Verletzungen allgemein akzeptierter Werte zu benennen und zu stigmatisieren. Wird es politisch instrumentalisiert, entfernt es sich von seiner eigentlichen Funktion und wird unglaubwürdig. Die Geschichte dieses Buchs ist deshalb auch eine Geschichte der Entwicklung des Rechtsstaats.
Teil I:Das Erbe der Reichsjustiz
Oberste Gerichtsbarkeit und Staatsschutz im Deutschen Reich bis 1945
Es ließe sich viel schreiben über die Geschichte des Strafrechts und die Entwicklung der Staatsanwaltschaft in Europa und in Deutschland.[11] Die Etablierung einer vom Gericht unabhängigen Anklagebehörde, der Staatsanwaltschaft, ist sicherlich die wichtigste Errungenschaft des aufgeklärten Strafprozesses. Nur durch die Trennung von Anklage und Gericht können Richter in wirklicher Unabhängigkeit und Unvoreingenommenheit Recht sprechen. In Preußen, in Bayern und in anderen Staaten des untergegangenen Heiligen Römischen Reichs deutscher Nation hatte sich im frühen 19. Jahrhundert diese Reform im Strafprozess nach französischem Vorbild bereits durchgesetzt.
Unsere Geschichte beginnt mit der Gründung des Deutschen Reichs im Januar 1871. In der Folge wurde bereits im Mai desselben Jahres das Reichsstrafgesetzbuch als einheitliches Gesetzeswerk für das gesamte Reich erlassen. Wenige Jahre später folgte die Verabschiedung der Strafprozessordnung und des Gerichtsverfassungsgesetzes, womit ein einheitliches Strafverfahren und eine einheitliche Gerichtsstruktur im Reich geschaffen wurden. Als Garant für die Einheit des Rechts wurde das Reichsgericht als höchste Rechtsprechungsinstanz eingesetzt, das aber auch Kaiser und Staat mit den Mitteln des Strafrechts schützen sollte. Auch an diesem Gericht war nach preußischem Vorbild eine Staatsanwaltschaft angesiedelt, die Reichsanwaltschaft, die vom Oberreichsanwalt geleitet wurde. Die rechtlichen Grundlagen dieser Institutionen haben sich seit 1879 nicht geändert. Lediglich der Name wurde angepasst. Heute sprechen wir von der Bundesanwaltschaft und dem Generalbundesanwalt.
Die Kontinuitätsgeschichte der Bundesanwaltschaft zieht sich deshalb vom Kaiserreich über die Weimarer Republik und das »Dritte Reich« bis zur Bundesrepublik Deutschland. Damals wie heute bestand die Aufgabe der Staatsanwaltschaft beim höchsten Strafgericht darin, zur Rechtseinheit in Deutschland beizutragen und den Staat gegen seine Feinde zu verteidigen. Nur die Vorstellung von dem, was Recht ist und was es zu verteidigen gilt, hat sich in den fast 150 Jahren mehrfach und teilweise dramatisch verändert.
1.Die Reichsanwaltschaft im Kaiserreich und in der Weimarer Republik
Entstehung und Gründung 1879
Im partikularisierten Recht der deutschen Einzelstaaten des 19. Jahrhunderts gab es – nach der Auflösung des Reichskammergerichts 1806 – kein einheitliches Strafrecht und keine einheitliche Strafverfolgung. Die Reichsgründung von 1871 unter preußischer Führung sollte dann aber für eine Vereinheitlichung des Rechts sorgen. Die Reichsgründung war zwar in vielen Punkten kompromisshaft und wurde auch als »System umgangener Entscheidungen« bezeichnet.[12] Die Rechtseinheit im Reich war aber 1871 ein erklärtes Ziel. Grundrechte und Demokratie, heute Grundpfeiler der Staatlichkeit, mussten im preußisch geprägten ersten deutschen Nationalstaat – anders als in der Frankfurter Paulskirche 1848 gefordert – zurückstehen.[13] Bei der Reichsgründung ging am Ende »Einheit vor Freiheit«.[14] Gleichwohl war die Entwicklung eines Rechtsstaats, also eines Staatsgebildes, das nicht der Willkür eines Herrschers folgte, sondern allgemeinen Gesetzen und öffentlichen Verfahren verpflichtet war, ein wichtiges Ziel.[15] Und ob es die Staatsspitze wollte oder nicht, auch erste demokratische Tendenzen regten sich bereits im Kaiserreich.[16]
Kurz nach der Reichsgründung 1871 wurden ein gemeinsames Strafgesetzbuch, das im Wesentlichen dem Strafgesetzbuch des Norddeutschen Bundes entsprach, welches wiederum auf dem preußischen Strafgesetzbuch von 1851 beruhte,[17] und – neben den anderen Reichsjustizgesetzen – auch das Gerichtsverfassungsgesetz[18] und unmittelbar darauf die Strafprozessordnung[19] verabschiedet und in Kraft gesetzt. Mit der Errichtung des Reichsjustizamts als Vorläufer des späteren Reichsjustizministeriums wurde auch eine Reichsbehörde ins Leben gerufen, welche die Einheit des Rechts koordinieren und überwachen sollte.
Im Gerichtsverfassungsgesetz – nicht aber in der Reichsverfassung[20] – war neben der Gründung des Reichsgerichts als oberste gerichtliche Autorität für das Reich auch die Reichsanwaltschaft vorgesehen. Im Oktober 1879 wurde beides eingerichtet.[21] Als Sitz der obersten Reichsjustiz wurde Leipzig bestimmt, geografischer Mittelpunkt des Deutschen Reichs, das sich 1877 allerdings nur knapp gegen Berlin durchsetzen konnte. Mit der Verlagerung der obersten rechtlichen Autoritäten aus der Hauptstadt heraus wollte man einen Zentralismus nach französischem Vorbild vermeiden.[22] Zunächst tagte das Reichsgericht in der Georgenhalle an der Goethestraße.
Das neue Reich brauchte neue Gebäude. Nur kurz nachdem mit der Errichtung des Reichstags in Berlin begonnen worden war, wurde der Bau eines neuen Amtssitzes für das Reichsgericht im Leipziger Musikviertel ausgeschrieben. Die Gebäude sollten sich architektonisch aufeinander beziehen, um zu symbolisieren, dass die Legislative und die Judikative, als ihre höchste Kontrollinstanz, beide Teile des geeinten Staates sind. Reichstag und Reichsgericht ähneln sich daher in Grundriss und Größe und haben gemeinsam, dass sie dem Stil der italienischen Spätrenaissance nachempfunden sind. Wie viele andere Justizpaläste, die in dieser Zeit überall im Reich geplant und gebaut wurden, ist der ausladende Bau ein Symbol der Macht des Rechts. Über dem Recht thront – durch eine Skulptur auf der Spitze der Kuppel verkörpert – die Wahrheit. Die Grundsteinlegung erfolgte 1888 und bereits 1895 konnten die Reichsgerichtsräte und die Reichsanwälte in das neue Gebäude einziehen.
Institutionelle Entwicklung der Reichsanwaltschaft bis 1933
Die Zuständigkeit des Reichsgerichts ergab sich aus § 136 Gerichtsverfassungsgesetz. Danach gab es eine doppelte Zuständigkeit. Das Reichsgericht fungierte zum einen als Revisionsgericht in Strafsachen für das gesamte Reichsgebiet.[23] Das heißt, die wichtigen Fälle der Landgerichte und Oberlandesgerichte konnten dem Reichsgericht vorgelegt werden, um zu überprüfen, ob das Recht richtig angewendet worden war. Ziel war die Vereinheitlichung der Rechtsprechung und damit auch der Rechtsanwendung. Man folgte hier der Tradition des Preußischen Obertribunals, an dessen Vorgehen man sich in den Anfangsjahren orientierte.[24]
Dem Reichsgericht oblag zum anderen auch die erst- und letztinstanzliche Zuständigkeit in Staatsschutzangelegenheiten.[25] Die Zuständigkeit wurde später ausgeweitet. Seit 1893 umfasste sie auch das Gesetz gegen den Verrat militärischer Geheimnisse, den sogenannten Kriegsverrat.[26] Eine Kuriosität bot in den Anfangsjahren die Aufgabenaufteilung der am Reichsgericht eingerichteten Spruchgruppen, also die zur Entscheidung der einzelnen Fälle zuständigen Richterkollegien, genannt Strafsenate: Während der 1. Strafsenat für die Untersuchungshandlungen und auch für die Eröffnung des Hauptverfahrens in Staatsschutzsachen zuständig war, wurde das Hauptverfahren vor dem vereinigten 2. und 3. Strafsenat des Reichsgerichts geführt. Das heißt, nach den damals üblichen Besetzungen der Senate mit sieben Richtern waren insgesamt 14 Berufsrichter zuständig.[27]1922 wurde dieses Vorgehen geändert und ein Strafsenat für die erst- und letztinstanzlichen Hauptverhandlungen für ausreichend erachtet.
Die Reichsanwaltschaft war ebenfalls im neuen Reichsgerichtsgebäude untergebracht.[28] Sie hatte die Aufgabe, die Interessen des Staats vor den Senaten des Reichsgerichts zu vertreten. Damit hatte auch sie ein doppeltes Tätigkeitsfeld. Einmal war sie aufgerufen, in Revisionsverfahren den Fall dem Reichsgericht vorzutragen, außerdem war sie Ermittlungs- und Anklagebehörde bei Hoch- und Landesverratssachen. Das Reichsgericht und die Reichsanwaltschaft arbeiteten dabei eng zusammen, in den Worten von Reichsanwalt NeumannNeumann, Richard: »Die Entscheidungen des RG. in Strafsachen werden mit Recht als das Erzeugnis gemeinsamer Arbeit von RG. und Reichsanwaltschaft bezeichnet.«[29]
An der Spitze der Behörde stand der Oberreichsanwalt, der gemeinsam mit drei Reichsanwälten diese Aufgaben wahrnahm. Je ein Reichsanwalt fungierte gleichsam als Spiegel für die drei Strafsenate beim Reichsgericht, die damals mit dem Senatspräsidenten und sechs Reichsgerichtsräten besetzt waren. Der Arbeitsanfall wuchs rasch.[30]1881 wurden der Reichsanwaltschaft Hilfsarbeiter zugestanden. Diese wurden kurzfristig je nach Arbeitsaufkommen vom Reichsjustizministerium angefordert und von den Landesjustizverwaltungen abgeordnet. Zeitweise waren doppelt so viele Hilfsarbeiter wie Reichsanwälte in Leipzig tätig. 1885 kam ein vierter Reichsanwalt hinzu, 1908 ein fünfter und 1919 schließlich ein sechster. Im Jahr 1922 entschied man sich für eine gewisse Verstetigung der Hilfsarbeiterstellen und schuf in der Folge bis 1928 drei Stellen für Oberstaatsanwälte und eine für einen Ersten Staatsanwalt bei der Reichsanwaltschaft.
Die Reichsanwälte waren an die Weisungen des Reichsjustizministers gebunden. Wie extensiv seitens des Ministeriums davon Gebrauch gemacht wurde, ist umstritten und wird – offenbar auch aus politischen Gründen – jeweils unterschiedlich dargestellt und bewertet. Die Ansicht, dass aus dem Ministerium niemals Anweisungen kamen, kann jedenfalls als widerlegt gelten.[31] Zugleich ist aber auch die Betonung des »Legalitätsprinzips« (vgl. § 152 Strafprozessordnung) schon zur damaligen Zeit auffällig: Ist der Staatsanwalt bei seinen Ermittlungen streng dem Gesetz verpflichtet, minimiert das die Möglichkeiten politischer Einflussnahme.[32]
Die Reichsanwaltschaft fungierte nicht als Dienstaufsicht für die Staatsanwaltschaften der Länder. Aber die Staatsanwaltschaften der Bundesstaaten hatten in den Hoch- und Landesverratsfällen den Anweisungen des Oberreichsanwalts nach § 147 Abs. 2 des Gerichtsverfassungsgesetzes Folge zu leisten.[33] Die Staatsanwälte handelten in diesen Fällen im Auftrag des Oberreichsanwalts. Reichsanwalt Treutlein-Moerdes beschrieb das System anlässlich des 25-jährigen Bestehens der Reichsanwaltschaft in Staatsschutzangelegenheiten als eine einheitlich zentralistische Organisation der Staatsanwaltschaft mit der Reichsanwaltschaft an der Spitze.[34] Dazu gehörte auch die Polizei, die nach § 153 Gerichtsverfassungsgesetz dem Oberreichsanwalt ebenfalls Folge zu leisten hatte.[35]
Die (Ober-)Reichsanwälte im Kaiserreich
Fünf Oberreichsanwälte hatten seit deren Gründung an der Spitze der Behörde gestanden, als 1926 Karl August WernerWerner, Karl August die Reichsanwaltschaft übernahm, der sie bis 1936 leitete. In diesen 57 Jahren (1879 bis 1936) waren damit nur sechs Oberreichsanwälte im Amt, was von einer beachtlichen Kontinuität zeugt. Gleichzeitig gab es zwei Regimewechsel und allein in den Weimarer Jahren waren vom Kabinett ScheidemannScheidemann, Philipp1919 bis zum ersten Kabinett HitlerHitler, Adolf1933 insgesamt 21 Regierungswechsel zu verzeichnen.
Als erster Oberreichsanwalt wurde der vormalige Generalprokurator am rheinischen Appellationsgericht in Köln, Freiherr von Seckendorff,von Seckendorff, August Heinrich eingesetzt. Damit verfügte er, ähnlich dem heutigen Generalstaatsanwalt bei einem Oberlandesgericht, über Erfahrung sowohl in der Leitung einer großen staatsanwaltschaftlichen Behörde als auch in Revisionsangelegenheiten.[36] Von Seckendorff war Jahrgang 1807 und bei seinem Amtsantritt bereits in seinem 73. Lebensjahr. Sein Nachfolger, Hermann Tessendorf,Tessendorf, Hermann war Jahrgang 1831 und damit deutlich jünger. Er hatte sich bereits als »Sozialistenfresser« in Berlin einen Namen gemacht, als er nach Leipzig kam.[37] Er kam vom Berliner Kammergericht, war aber zuvor Berlins bekanntester Staatsanwalt, der viele politische Prozesse initiiert hatte und von »seinen Gegnern über das Grab gehaßt«[38] wurde. Sozialdemokraten hielt er für Anarchisten, die als gemeinsames Endziel einen gewaltsamen Umsturz der bestehenden staatlichen und sozialen Ordnung verfolgten.[39] Die von ihm initiierte Verfolgung von Sozialisten, Arbeitern und Gewerkschaften wurde in Berlin auch als »Ära Tessendorf« bezeichnet. Diese Härte brachte ihm das Vertrauen von Reichskanzler Otto von Bismarckvon Bismarck, Otto ein.[40]
Die gesamte Kaiserzeit hindurch wurde die Reichsanwaltschaft von preußischen Oberreichsanwälten geleitet.[41] Sie hatten alle an renommierten Juristischen Fakultäten wie Heidelberg, Göttingen, Bonn und Berlin studiert. Bis man damals allerdings als Jurist Geld verdienen konnte, musste man nicht nur das Studium finanzieren. Auch die Referendarszeit glich eher einem unbezahlten Praktikum und dauerte vier lange Jahre. Als Assessor mussten die Juristen ebenfalls selbst für ihr Auskommen sorgen. Erst mit einer Festanstellung gab es auch ein Gehalt. Ohne eine betuchte Familie war eine solche Karriere demnach nicht zu schaffen. Dazu kam in aller Regel, dass die angehenden Staatsanwälte eine militärische Laufbahn absolviert und als Reserveoffiziere Befehl und Gehorsam gelernt hatten.[42] Es überrascht daher nicht, dass die Oberreichsanwälte sich an der jeweils in Preußen vorherrschenden Praxis der Justizverwaltung orientierten. Die Reichsanwaltschaft fungierte so im Wesentlichen als Bewahrerin des preußischen Obrigkeitsstaats.[43]
Die Oberreichsanwälte in der Weimarer Zeit
Nach dem Ersten Weltkrieg und der Gründung der Weimarer Republik blieb die Reichsanwaltschaft bestehen und wurde weiterhin von dem bisherigen Amtsinhaber Arthur ZweigertZweigert, Arthur geleitet, der seit 1907 Oberreichsanwalt war. Anlass zu einer personellen Neuausrichtung sah man offensichtlich nicht, auch wenn die Reichsanwaltschaft für Staatsschutzangelegenheiten zuständig blieb. Der Staatsschutz betraf nun aber nicht mehr Kaiser und Reich, sondern die Demokratie der Weimarer Verfassung. Die Revolution von 1918/19 wurde zwar – zumal nach dem verlorenen Krieg – mehrheitlich als rechtmäßig akzeptiert; allerdings waren jetzt SPD-Politiker an der Macht, die man wenigstens bis Ende des 19. Jahrhunderts in Leipzig noch als Staatsfeinde verfolgt hatte. Die Vorbehalte der monarchistisch-militärisch geprägten Juristenelite gegen Demokratie und Liberalismus waren groß.
Das Personal der Behörde wuchs in der Weimarer Zeit auf sechs Reichsanwälte, zwei Oberstaatsanwälte, zwei Staatsanwälte und mehrere Hilfsarbeiter an. Darunter finden sich auch schon Namen, die nach 1945 wieder Bedeutung erlangen sollten. Etwa der von Emil NiethammerNiethammer, Emil, der seit 1921 bei der Reichsanwaltschaft beschäftigt war, bevor er 1930 an das Reichsgericht wechselte, wo er, ohne NSDAP-Mitglied zu sein, bis 1945 als Reichsgerichtsrat blieb. Nach 1945 wurde er Präsident des Oberlandesgerichts Tübingen und war später auch Mitglied der »Großen Strafrechtskommission«. Das Gleiche gilt für den späteren ersten Präsidenten des Bundesgerichtshofs, Hermann WeinkauffWeinkauff, Hermann, der 1925 an die Reichsanwaltschaft abgeordnet wurde, wo er mit wenigen Unterbrechungen bis 1935 blieb, bevor er als Hilfsrichter und späterer Reichsgerichtsrat an das Reichsgericht wechselte.[44]
Nach der Übergangszeit unter Zweigert wurde 1921 Ludwig EbermayerEbermayer, Ludwig Oberreichsanwalt. Erstmals trat ein Mann an die Spitze der Reichsanwaltschaft, der nicht aus Preußen stammte. EbermayerEbermayer, Ludwig wurde 1858 im bayerisch-schwäbischen Nördlingen als Sohn eines protestantischen Pfarrers geboren (ein Katholik kam nach wie vor nicht infrage). Nach dem Studium in Würzburg und München verfolgte er zielstrebig seine juristische Karriere und stieg in der bayerischen Justiz »kometenhaft« auf.[45] Bereits 1902 war er Reichsgerichtsrat geworden, mit noch nicht einmal 44 Jahren in der damaligen Zeit sicherlich außergewöhnlich. Nach dem Krieg übernahm er den Vorsitz des 2. Strafsenats des Reichsgerichts. Er war persönlich und beruflich durch das Kaiserreich geprägt und blieb, wie sein Sohn bestätigte, Monarchist.[46] Ferner stand er der nationalliberalen Deutschen Volkspartei (DVP) nahe.[47] Auch wenn er politisch unauffällig blieb, wie Godau-Schüttke ihn charakterisiert,[48] hatte er doch maßgeblichen Einfluss auf Kriminalpolitik und Kriminalwissenschaft. Seit 1911 war EbermayerEbermayer, Ludwig Mitglied der Strafrechtskommission,[49] außerdem war er Mitbegründer des Leipziger Kommentars zum Strafgesetzbuch, des jahrzehntelang führenden und heute noch fortbestehenden mehrbändigen Großkommentars.[50] Er wurde deshalb als »der erste Kriminalist« an der Spitze der Reichsanwaltschaft bezeichnet.[51]EbermayerEbermayer, Ludwig hatte nach dem Abgang Zweigerts keinen Grund, seinen ehrwürdigen Posten als Senatspräsident zu verlassen und die Leitung der Reichsanwaltschaft zu übernehmen. Angeblich wurde EbermayerEbermayer, Ludwig von Regierungsseite gedrängt, das Amt zu übernehmen. Offenbar suchte man einen festen, aber zugleich ausgleichenden Charakter für die Nachkriegsjahre, die NeumannNeumann, Richard im Jahr 1929 als »Deutschlands schwierigst[e] Zeit« bezeichnete.[52]
Lobeshymnen auf EbermayerEbermayer, Ludwig als Behördenleiter gibt es viele: »[Er] war als Mensch, als Jurist, als Kollege, Vorgesetzter und Gelehrter gleich überragend und einzigartig«, schreibt Carl KirchnerKirchner, Carl, der von 1920 bis 1945 mit nur einer kurzen Unterbrechung bei der Reichsanwaltschaft tätig war und nach 1950 einer der ersten Bundesrichter wurde. Er erinnerte sich gern an »gütige und warmherzige« Gespräche im Eckzimmer des Reichsgerichts.[53] »Geistreich und schlagend, schlicht und herzlich, von erfrischendem Humor, frei im Geiste nach jeder Richtung«, beschreibt ihn NeumannNeumann, Richard.[54] Kein Wunder, dass man bei der Reichsanwaltschaft die Köpfe hängen ließ, als EbermayerEbermayer, Ludwig eine Verlängerung seiner Amtszeit ablehnte und 1926 in den Ruhestand trat.[55]
Einen Nachfolger zu finden erwies sich dann als nicht ganz einfach. Curt JoëlJoël, Curt, der einflussreiche Staatssekretär im Reichsjustizministerium, machte sich für Karl August WernerWerner, Karl August als Nachfolger von EbermayerEbermayer, Ludwig stark, einen Ministerialrat aus »seinem« Ministerium. Ein Ministerialer als Leiter der Reichsanwaltschaft war für die Behörde keine leicht zu schluckende Kröte. Der Mann aus dem Ministerium verfügte über keinerlei »Stallgeruch«, also über keine Erfahrung als Staatsanwalt oder Richter – schon gar nicht auf Reichsebene; entsprechend »fremdelten« die Reichsanwälte mit ihrem neuen Chef, dessen Charakter offenbar auch mögliche Vorurteile gegenüber den kühlen Ministerialbeamten bestätigte.
WernerWerner, Karl August führte die Reichsanwaltschaft bis zu seinem Tode im Jahr 1936. Er schien sich früh mit der NSDAP arrangiert zu haben und ließ sich instrumentalisieren.[56] Die nationalsozialistischen Machthaber sahen offenbar keine Notwendigkeit, Werner, der bei der »Machtergreifung« bereits sieben Jahre lang im Amt war, zu ersetzen. Auch an dieser politisch bedeutsamen Position baute HitlerHitler, Adolf demnach auf die Unterstützung der Juristenelite aus Weimar, die ihm wie August Werner auch gehorsam folgte.
Staatsschutz im Kaiserreich: Der Kampf gegen Anarchisten
Die Verfolgung von Hochverrat und Landesverrat war von Anfang an Sache der Reichsanwaltschaft. Das betraf den ersten Abschnitt des Besonderen Teils des Reichsstrafgesetzbuchs, die §§ 80–93RStGB1871. Als Hochverrat war nach § 81RStGB1871 bei Androhung von lebenslangem Zuchthaus verboten, es zu unternehmen, »die Verfassung des Deutschen Reichs oder eines Bundesstaats oder die in demselben bestehende Thronfolge gewaltsam zu ändern«. Es handelte sich beim Hochverrat um ein »Unternehmensdelikt«, das heißt, bestraft wurde bereits der Versuch des Umsturzes. Strafbar war aber auch die Verabredung (§ 83RStGB1871), die Vorbereitung (§§ 84 und 86RStGB1871) und besonders auch die öffentliche Aufforderung zum Hochverrat (§ 85RStGB1871). Die Reichsanwaltschaft konnte also weit im Vorfeld eines möglichen hochverräterischen Unterfangens ermitteln und Verfahren anstrengen.
Die Landesverratsvorschriften im Reichsstrafgesetzbuch von 1871 zielten – kurz gesprochen – vor allem darauf ab, Kriegstreiberei gegen das Reich zu verhindern.[57] Dazu kam in § 92RStGB der »zivile Landesverrat«, also das Preisgeben von Staatsgeheimnissen, später noch ergänzt durch den »militärischen Landesverrat«.[58]
Der erste Hochverratsprozess vor dem Reichsgericht richtete sich im Jahr 1881 gegen die »Breuder-Gruppe«.[59] Die insgesamt 14 Angeklagten standen in Kontakt mit bekannten Anarchisten und wurden von der Reichsanwaltschaft wegen der Vorbereitung zum Hochverrat, der Aufforderung von Soldaten zum Ungehorsam, der Teilnahme an einer staatsfeindlichen Verbindung und der Verbreitung verbotener Druckschriften angeklagt.[60] Eine besondere Rolle spielte in diesem Prozess ein Frankfurter Polizeirat, auf den die Gruppe angeblich ein Attentat geplant hatte.[61] Die Beweisführung basierte aber maßgeblich auf der Aussage des vermeintlichen Opfers und eines von diesem in die Gruppe eingeschleusten bezahlten Spitzels. Die Reichsanwaltschaft, im Prozess vertreten durch Reichsanwalt Hofinger, Reichsanwalt der allerersten Stunde,[62] vertraute auf die »bezahlte« Aussage des Spitzels und auf die Verlesung einiger Flugblätter und Broschüren.[63] Die meisten Angeklagten wurden zu zweijährigen Zuchthausstrafen verurteilt.
Erwähnenswert scheint noch der Hochverratsprozess gegen Karl LiebknechtLiebknecht, Karl im Jahr 1907. LiebknechtLiebknecht, Karl hatte mit seiner Schrift Militarismus und Antimilitarismus unter besonderer Berücksichtigung der internationalen Jugendbewegung den preußischen Kriegsminister aufgeschreckt, der den Oberreichsanwalt davon überzeugen konnte, dass LiebknechtLiebknecht, Karl einen gewaltsamen Umsturz plane.[64] Die Anklage lautete auch hier auf Vorbereitung eines hochverräterischen Unternehmens. Dafür musste sich der Oberreichsanwalt argumentativ ziemlich strecken, aber er konnte letztlich die vereinigten Senate davon überzeugen, dass mit der Forderung nach einer Abschaffung des Militärs eine »gewaltsame Änderung der Reichsverfassung« intendiert war. Ein Jahr und sechs Monate Festungshaft lautete das Urteil, da das Gericht – anders als der Oberreichsanwalt – keine »ehrlose Gesinnung« aufseiten des Angeklagten feststellen konnte.[65]
Die strafrechtliche Verfolgung des Hochverrats stellte nur einen in den Anfangsjahren des Reichsgerichts eher vernachlässigbaren[66] Teil des Kampfes gegen die Arbeiterschaft dar. Nach zwei erfolglosen Attentaten auf Kaiser Wilhelm I.Wilhelm I. machte Otto von Bismarckvon Bismarck, Otto Stimmung gegen die Sozialdemokratie. Am 22. Oktober 1878 trat das sogenannte Sozialistengesetz in Kraft.[67] Es handelte sich um ein befristetes Ausnahmegesetz, das jährlich verlängert werden musste. Darin enthalten waren vor allem Vereinigungs- und Versammlungsverbote, Verbote von Druckschriften und des Einsammelns von Beiträgen. Die gesetzgeberische Verfolgung von Arbeiterschaft und Sozialdemokratie machte Eindruck auf die Reichsanwaltschaft und das Reichsgericht. So ist es auch zu erklären, dass die kollektive Androhung von Streik in einer Holzarbeiterfabrik, um bessere Arbeitsbedingungen durchsetzen zu können, vom 3. Strafsenat als Nötigung und Erpressung angesehen wurde.[68] Das Gesetz konnte aber den zunehmenden Erfolg der Sozialdemokratie nicht aufhalten. 1890 scheiterte eine weitere Verlängerung im Reichstag. Damit war – zumindest von gesetzgeberischer Seite – die strafrechtliche Sonderbehandlung der Sozialdemokraten beendet.
Allerdings war die Rechtsprechung nach wie vor findig. So wurde im Juni 1912 vom 4. Strafsenat des Reichsgerichts der Freispruch eines SPD-Vorstandsmitglieds nach Revision der Staatsanwaltschaft, die vom Oberreichsanwalt vertreten wurde, aufgehoben. Der Angeklagte hatte mit der Druckschrift Beamtenschaft und Sozialdemokratie unter den Beamten des Reichs dafür Werbung gemacht, die SPD zu wählen. Der Strafsenat urteilte: In diesem Verhalten liege eine Beleidigung des Beamten. Die Annahme, diese Ehrenkränkung sei gerechtfertigt, weil es einer Partei gestattet sein müsse, Werbung für sich und ihre Ziele zu machen, wie sie das Landgericht vertreten und daher freigesprochen habe, sei indes nicht zutreffend.[69] Werbung für die SPD entspreche im Falle eines Beamten nämlich der Aufforderung, seinen Treueeid zu brechen und staatsfeindliche Bestrebungen zu unterstützen.[70] Diese Entscheidung wurde am 28. Juni 1912 gefällt – nur sechs Monate nach der Wahl zum 13. Deutschen Reichstag, welche die SPD mit 34,8 % deutlich gewonnen hatte.[71] Sie zeigt eindrucksvoll, wie sich die Reichsjuristen der Kaiserzeit zur Sozialdemokratie verhielten. Für sie waren Sozialdemokraten noch immer Feinde des Reichs.
Schutz der neuen Republik gegen links und rechts
Mit der Ausrufung der Republik durch den SPD-Politiker Philipp ScheidemannScheidemann, Philipp am 9. November 1918 endete das Kaiserreich. Es folgte die erste Republik auf deutschem Boden und die Verabschiedung einer liberalen, demokratischen Verfassung, der sogenannten Weimarer Verfassung. Was sich nicht änderte, waren die Justizstrukturen, also Reichsgericht und Oberreichsanwalt, sowie das dort tätige Personal. Unverändert galt auch das Staatsschutzstrafrecht des Strafgesetzbuchs fort.[72] Dieselben Personen wandten also dieselben Vorschriften an, um einen völlig verwandelten Staat zu schützen. Wäre die Novemberrevolution nicht erfolgreich gewesen, hätte die Reichsanwaltschaft wahrscheinlich ScheidemannScheidemann, Philipp, EbertEbert, Friedrich und LiebknechtLiebknecht, Karl als Hochverräter angeklagt. So musste sie nun die neue Republik schützen. Dazu bekam sie auch gleich Gelegenheit, als Anfang 1919 der »Spartakusaufstand« den Bestand der Republik gefährdete. Den Aufständischen war die Revolution nicht weit genug gegangen. Ihnen schwebte eine weitere Sozialisierung und Entmachtung des Militärs vor, während die gemäßigte SPD rasch »geordnete Verhältnisse« herstellen wollte. Nach der Absetzung des Berliner Polizeipräsidenten Emil EichhornEichhorn, Emil durch den Rat der Volksbeauftragten, die dieser nicht akzeptieren wollte, folgte eine länger andauernde bewaffnete Auseinandersetzung und Gewalt beherrschte viele Wochen lang die Straßen.[73]
Die bewaffneten Aufständischen wurden von der Berliner Justiz wegen Aufruhrs (§ 115RStGB1871), Landfriedensbruchs (§ 125RStGB1871) und Bildung eines bewaffneten Haufens (§ 127RStGB1871) strafrechtlich verfolgt. Ihnen wurden also Verstöße gegen die öffentliche Ordnung vorgeworfen und nicht Hochverrat. Sie legten aber Revision ein und argumentierten, dass man nicht gegen eine bestehende Regierung gekämpft habe, weil zum Zeitpunkt der Tat die Regierung Ebert-Scheidemann die Staatsgewalt nicht allein innegehabt habe. Vielmehr – so die Verteidiger – habe es sich um ein offenes Auskämpfen der Macht zwischen »ebenbürtigen Parteien« auf der Straße gehandelt.[74] So kam der Fall zum Reichsgericht, dessen 2. Strafsenat sich mit seinem Urteil vom 19. April 1919 hinter die Republik stellte.[75] Die oberste Regierungsgewalt habe beim Rat der Volksbeauftragten gelegen, stellte das Reichsgericht fest. Der Kampf um die Macht sei im Januar 1919 schon »zu einem gewissen Abschlusse« gekommen, und die Staatsgewalt habe sich ausschließlich in den Händen des Rates befunden, der auch willens gewesen sei, diese zur Durchsetzung der »Volksregierung« einzusetzen. Die Strafgesetze könnten hier angewendet werden, auch wenn die vormalige »monarchistisch-kapitalistische Staatsordnung« nicht mehr existiere.
Die Gesetze galten also weiter.[76] In anderen Fällen subsumierte das Reichsgericht in Revisionsentscheidungen die Ziele der »Spartakisten«, die »bestehende demokratische Staatsordnung umzustürzen und den Willen der Mehrheit des Volkes durch den einer bewaffneten, gewalttätigen Minderheit zu ersetzen«, als hochverräterische Unternehmung nach § 81 Abs. 1 Nr. 2RStGB1871.[77] Schließlich wurde auch in einem erstinstanzlichen Verfahren vor dem 2. und 3. Strafsenat der Putschversuch und die Besetzung des Berliner Rathauses vom 20./21. August 1920 mit dem Versuch der Errichtung einer Räterepublik als Hochverrat abgeurteilt.[78] Auch hier wird noch einmal festgestellt, dass die Vorschriften zum Schutze des Staats nicht für den Monarchen geschaffen waren, sondern nun mutatis mutandis eben dem Schutz der neuen Reichsverfassung dienen. Der gewaltsame Versuch, diese neue Reichsverfassung zu beseitigen und durch eine Räterepublik, die »auf der Diktatur des Proletariats beruht«, zu ersetzen, war somit Hochverrat. Diese und andere Fälle belegen, dass Reichsanwaltschaft und Reichsgericht – gegen eine durchaus verbreitete legalistische, deutschnationale Ansicht in Politik und Rechtswissenschaft[79] – das Staatsschutzstrafrecht zum Schutz der staatlichen Organe der Weimarer Reichsverfassung und zum Schutz der Demokratie eingesetzt haben.[80]
Die Angriffe gegen die neue Republik waren zunächst von kommunistischer Seite gekommen. Wenige Monate später musste die Demokratie aber auch gegen rechts verteidigt werden. Die Unzufriedenheit mit der im Versailler Vertrag angeordneten Reduzierung des deutschen Heeres brach sich im »KappKapp, Wolfgang-Putsch« Bahn. Die Reichsregierung unter der SPD-Führung von Gustav BauerBauer, Gustav konnte sich im Februar 1920 – anders als ein Jahr zuvor bei der Niederschlagung des Spartakusaufstands – nicht mehr auf die eigenen Truppen verlassen. Sie floh vor dem »Marsch auf Berlin« und rief im Gegenzug zum Generalstreik auf.[81] Zu der selbst ernannten Reichsregierung zählten: Wolfgang KappKapp, Wolfgang als Reichskanzler, Walther von Lüttwitzvon Lüttwitz, Walther als Oberbefehlshaber, Traugott von Jagowvon Jagow, Traugott als Innenminister, Konrad von Wangenheimvon Wangenheim, Konrad als Landwirtschaftsminister und Georg SchieleSchiele, Georg als Wirtschaftsminister. Doch die Putschisten mussten nach wenigen Tagen zurücktreten, da auch die Ministerialverwaltung – heute würde man sagen: deep government – die Zusammenarbeit verweigerte.[82]
Bereits am Tag nach dem Scheitern, dem 18. März 1920, stellte die Reichsregierung Strafanträge beim Oberreichsanwalt wegen versuchten Hochverrats gegen KappKapp, Wolfgang, Lüttwitz, Jagow und andere Anführer des »Kapp-Putsches«. Den Mitverschwörern wurde vom Reichstag zwar Amnestie gewährt,[83] gegen insgesamt 13 Aufständische begann Oberreichsanwalt Zweigert aber ein langwieriges Untersuchungsverfahren, das sein Nachfolger EbermayerEbermayer, Ludwig zu Ende brachte. Er erhob schließlich gegen Jagow, Wagenheim und SchieleSchiele, Georg Anklage. Der vereinigte 2. und 3. Strafsenat verurteilte am 21. Dezember 1921 allein Jagow zu fünf Jahren Festungshaft, der als Innenminister im Zentrum des Putschversuchs gestanden habe, während Wagenheim und Schiele als Randfiguren unter das Amnestiegesetz gezogen und freigesprochen wurden.[84]
Das Reichsgericht bestätigte hier noch einmal den Fortbestand der Staatsschutzvorschriften, die nunmehr die Republik schützen sollten. Für die Richter war der Umsturzversuch ein hochverräterisches Unternehmen, auch wenn KappKapp, Wolfgang die Macht nur vorübergehend behalten wollte. Schließlich lehnten sie auch eine Rechtfertigung des Staatsstreichs aus Gründen der Notwehr oder des Notstands deutlich ab. Eine solche Notwehr setze nämlich voraus, dass die Verfassung selbst angegriffen worden sei und die Täter zu ihrer Verteidigung handelten. Das sei aber gerade nicht der Fall gewesen. Man habe die Verfassung aushebeln und eine Militärdiktatur errichten wollen. Es bleibt gleichwohl ein fahler Beigeschmack. Oberreichsanwalt EbermayerEbermayer, Ludwig drückte später sein Bedauern darüber aus, dass man die »Großen« habe laufen lassen müssen und die Amnestien zu großzügig gewährt worden seien.[85]
Republikschutz verstärken
Diese Fälle waren aber nur die Spitze des Eisbergs. Die Weimarer Republik bekam die Gewalt auf der Straße nicht in den Griff. Radikale Kräfte von beiden Enden des politischen Spektrums verübten permanent Anschläge. Eine zeitgenössische Statistik verzeichnete zwischen 1919 und 1922 insgesamt 376 politisch motivierte Morde. Davon waren 354 dem rechten Spektrum zuzuordnen und lediglich 22 dem linken. Umgekehrt verhielt es sich mit der Strafverfolgung. Die Anschläge aus dem rechten Milieu wurden nur einmal mit lebenslänglich und insgesamt mit 90 Jahren und zwei Monaten Freiheitsstrafe gesühnt. Die 22 Anschläge aus dem linken Spektrum wurden mit zehn Todesstrafen, drei lebenslänglichen Zuchthausstrafen und insgesamt 248 Jahren und acht Monaten Freiheitsstrafe geahndet.[86] Diese Proportionen verdeutlichen das spektakuläre Versagen der Polizei und der Strafjustiz in der Weimarer Republik bei der Verfolgung politischer Morde. Die Blindheit der Justiz auf dem rechten Auge war ebenso deutlich wie deren schweren Defizite im Bereich Demokratisierung und Sozialisierung.[87]
Als mit der Ermordung Walter RathenausRathenau, Walther am 24. Juni 1922 ein weiteres Verbrechen die Republik erschütterte, versuchte der Reichstag, mit dem »Gesetz zum Schutze der Republik« verlorenes Vertrauen wiederherzustellen.[88] In diesem Republikschutzgesetz wurden nicht nur neue Straftatbestände und Befugnisse zur Auflösung von Versammlungen und Vereinen festgelegt; es wurde auch der Staatsgerichtshof zum Schutz der Republik beim Reichsgericht eingeführt, der zukünftig neben anderen versammlungs-, vereins- und presserechtlichen Fragen auch für das Staatsschutzstrafrecht zuständig sein würde. Dieses neue Gericht sollte einen republikanischen und demokratischen Neuanfang in der Justiz symbolisieren,[89] was sich vor allem darin ausdrückte, dass neben sechs weiteren Mitgliedern – Laien, die vom Reichspräsidenten ernannt wurden – nur drei Reichsgerichtsräte dem Spruchkörper angehörten.[90] Das Beispiel zeigt, dass die Weimarer Republik nicht so »wehrlos« gegen ihre Feinde war, wie es nachträglich häufig dargestellt worden ist. Allein erfolgreich war sie am Ende damit nicht.[91]
Die Aufgaben der Staatsanwaltschaft beim Staatsgerichtshof oblagen allerdings auch der Reichsanwaltschaft.[92] Damit war aufseiten der Anklage keine institutionelle oder personelle Veränderung eingetreten. Leiter der Abteilung war Reichsanwalt NeumannNeumann, Richard. Der Staatsgerichtshof existierte aber nur bis zum 23. Juli 1927, seine strafrechtlichen Kompetenzen waren bereits am 1. April 1926 wieder an das Reichsgericht zurückgeflossen. Der ursprüngliche Plan, das Vertrauen in die Justiz zu stärken, war nicht aufgegangen. Zudem hatte der Freistaat Bayern das Republikschutzgesetz und den Staatsgerichtshof nie akzeptiert. Deswegen konnte das vom preußischen Innenminister verfügte Verbot der NSDAP sich nicht durchsetzen[93] und deswegen wurde auch der Hitler-Ludendorff-Putsch vom 8./9. November 1923 (»Marsch auf die Feldherrnhalle«) nicht von der Reichsanwaltschaft vor dem eigentlich zuständigen Staatsgerichtshof angeklagt. Die Staatsanwaltschaft in München hat das Verfahren vor dem Volksgericht für den Landgerichtsbezirk München I geführt, das mit dem bekanntermaßen milden Urteil gegen Adolf HitlerHitler, Adolf zu fünf Jahren Festungshaft und dem Freispruch Ludendorffs endete.[94]
Vor dem Staatsgerichtshof wurden die RathenauRathenau, Walther-Attentäter und deren Mitwisser angeklagt, wobei es nicht gelang, der hinter dem Mord stehenden nationalistischen und antisemitischen terroristischen Vereinigung »Organisation Consul« (O.C.), die aus dem »Kapp-Putsch« hervorgegangen war, eine Beteiligung nachzuweisen.[95] Ganz ähnlich lief es in einem Verfahren nach dem Attentat auf Philipp ScheidemannScheidemann, Philipp am 4. Juni 1922. Die Täter wurden gefasst, zeigten sich geständig und wurden verurteilt. Trotz starker Verdachtsmomente konnte eine Beteiligung der O.C. seitens der Reichsanwaltschaft aber wiederum nicht nachgewiesen werden.[96]
In einem gesonderten Verfahren gegen die O.C. wegen »Geheimbündelei« blieb Oberreichsanwalt EbermayerEbermayer, Ludwig auffällig vorsichtig. Möglicherweise stand für die Republik außenpolitisch viel auf dem Spiel und es sollte kein Staub aufgewirbelt werden. Jedenfalls versuchte EbermayerEbermayer, Ludwig alles, um zu deeskalieren. Im Prozess vertrat Reichsanwalt Emil NiethammerNiethammer, Emil die Reichsanwaltschaft und zeigte viel Verständnis für die angeklagten Mitglieder der Organisation.[97] Das sah das Gericht dann aber anders. Die Verdachtsmomente, in die Morde an Matthias ErzbergerErzberger, Matthias, Walther RathenauRathenau, Walther und den Anschlag auf Philipp ScheidemannScheidemann, Philipp involviert zu sein, waren zu stark. So ging der Staatsgerichtshof in seinem Urteilsspruch deutlich über die Anträge der Reichsanwaltschaft hinaus.[98] Mag das Urteil auch als Sieg der Republik angesehen werden,[99] die Reichsanwaltschaft hatte sich hingegen für eine militärische Staatsräson starkgemacht, weil sie die O.C. für den Kampf gegen den Kommunismus als nützlich erachtete.[100]
Ein ganz anderes Beispiel ist der »Tscheka-Prozess«. Hier ging es um die Ermordung eines Polizeiinformanten durch Mitglieder der Tscheka, einer Sondergruppe innerhalb der KPD, die sich um den Schutz vor Spitzeln kümmern sollte. Richard NeumannNeumann, Richard war in diesem Verfahren der Sitzungsvertreter vor dem Staatsgerichtshof.[101] Die feindliche Stimmung gegenüber der KPD und den Angeklagten gipfelte im Prozessverlauf im Ausschluss des Strafverteidigers, Rechtsanwalt Arthur Samter,Samter, Dr. Arthur durch den Senatspräsidenten Niedner. Reichsanwalt NeumannNeumann, Richard hatte im Prozess diesem Ausschluss zugestimmt.[102] Das Prozessverhalten entsprach insgesamt dem in der Reichsanwaltschaft vorherrschenden Bild von der KPD als hochverräterische Vereinigung: »Die kommunistische Partei hat stets frei und offen bekannt, daß ihr Ziel der gewaltsame Umsturz der bestehenden republikanischen Verfassung und deren Ersetzung durch eine […] Räterepublik nach russischem Muster ist.«[103] Dieser Ansicht entsprach auch die Überzeugung, KPD-Funktionären letztlich allein wegen der Parteimitgliedschaft hochverräterische Absichten unterstellen zu können und entsprechend wegen Vorbereitung eines Hochverrats nach § 86RStGB1871 strafrechtlich zu verfolgen, solange sie keine Abgeordnetenimmunität davor schützte.[104] Der »Tscheka-Prozess« endete am 22. April 1925 mit drei Todesurteilen und einer Verurteilung zu 15 Jahren Zuchthaus.[105]
Adolf Hitlers Legitimation des hochverräterischen Parteiprogramms
Nach dem Scheitern des Projekts »Staatsgerichtshof« kehrte der Staatsschutz an das Reichsgericht zurück. Zwischenzeitlich war die Zusammensetzung der Senate geändert worden. Nunmehr entschieden fünf Berufsrichter in einem Senat, die Zuständigkeit des vereinigten Senats in Staatsschutzsachen war entfallen.[106] Die am Staatsgerichtshof ausgemachten Tendenzen, gegen rechts – nun gegen die aufkommende NSDAP – Milde walten zu lassen, während Kommunisten mit aller Härte verfolgt wurden, setzte sich auf dramatische Art und Weise fort.[107] Im »Ulmer Reichswehrprozess«, in dem sich vom 23. September bis 4. Oktober 1930 drei Offiziere der Reichswehr vor dem 4. Strafsenat unter Vorsitz des Senatspräsidenten Alexander Baumgarten wegen Hochverrats verantworten mussten, wurde etwa Adolf HitlerHitler, Adolf am 25. September 1930 als Zeuge das Podium geboten, in der geschützten Öffentlichkeit des Gerichtssaals ausführlich die Ziele seiner Partei darzulegen.[108] Über zwei Stunden durfte er ausführen, dass die NSDAP es nicht nötig habe, Gewalt anzuwenden, sondern auf legalem Wege die Macht erlangen werde. Die Angeklagten wurden wegen gemeinschaftlicher Vorbereitung eines hochverräterischen Unternehmens zu milden 18 Monaten Festungshaft verurteilt. Wegen ihrer guten Absichten und ihrer Vaterlandsliebe sei keine ehrlose Gesinnung erkennbar, die eine Zuchthausstrafe erforderlich mache, so das Gericht.[109]
Das Fatale an diesem Prozess waren tatsächlich nicht Anklage und Verurteilung. Der Auftritt Hitlers blieb in Erinnerung. Die Legalitätsbeteuerungen des NSDAP-Führers blieben im Prozess ohne Widerspruch ebenso wie seine Ankündigung, dass im Falle einer Machtübernahme das »Novemberverbrechen von 1918 seine Sühne finden« und dann »Köpfe in den Sand rollen« würden.[110] Reichsanwalt Nagel, der die Anklage im Prozess vertrat, hätte hier einschreiten bzw. ein Strafverfahren gegen Adolf HitlerHitler, Adolf in Gang setzen müssen, denn eine solche Ankündigung entsprach der Vorbereitung eines hochverräterischen Unternehmens auf sonstige Weise nach § 86RStGB1871. Da dies unterblieb, wurde jedenfalls die Chance vertan, das hochverräterische Parteiprogramm der NSDAP nebst dem Parteiführer zu delegitimieren. Umgekehrt durfte dieses Unterlassen als Tolerierung, ja Legitimierung verstanden werden.[111]
Der Weltbühne-Prozess: Der Rechtsstaat vor dem Ende
Unter dem Vorsitz des zuvor bereits erwähnten Senatspräsidenten Alexander Baumgarten, der übrigens nach der »Machtergreifung« selbst aus dem Dienst entfernt wurde, da er »nicht-arischer« Abstammung war, hatte sich auch Carl von Ossietzkyvon Ossietzky, Carl wegen Landesverrats strafrechtlich zu verantworten. Dieser Prozess lief nun unter völlig anderen Vorzeichen ab. Der Publizist und Herausgeber der kritischen Zeitschrift Weltbühne hatte einen Artikel mit dem Titel »Windiges aus der deutschen Luftfahrt« abgedruckt. Darin hatte der Journalist Walter KreiserKreiser, Walter dargelegt, dass die Reichswehr mit Unterstützung der Roten Armee heimlich den Aufbau der Luftwaffe betreibe, um so die Vorgaben des Versailler Vertrags zu umgehen.[112]
Die Weltbühne wurde in Regierungskreisen sorgfältig gelesen. Reichswehrminister Groener regte nun strafrechtliche Ermittlungen durch die Reichsanwaltschaft an, weil seines Erachtens in dem Artikel militärische Geheimnisse verraten worden seien. Im Auswärtigen Amt wollte man hingegen ein öffentliches Strafverfahren vermeiden, um nicht noch mehr Staub aufzuwirbeln.[113] Einige Monate später, Ende März 1931, wurde dann doch gegen Walter KreiserKreiser, Walter und Carl von Ossietzkyvon Ossietzky, Carl Anklage erhoben. Der 4. Strafsenat verhandelte unter Ausschluss der Öffentlichkeit.[114] Das Urteil vom 23. November 1931 blieb ebenfalls geheim. Damit hatten Reichsanwaltschaft und Reichsgericht den Boden eines demokratischen Justizverständnisses endgültig verlassen, denn die Öffentlichkeit der Verfahren und der Entscheidungen sind Voraussetzung und Rückgrat jeder demokratischen Kontrolle und deshalb elementare Bedingungen für das aufgeklärte Strafverfahren. Geheimverfahren erinnerten demgegenüber an einen Rückfall in die Zeit der Heiligen Inquisition oder der »Star Chamber« unter Heinrich VIII. und Karl I.
Bei der Auslegung der Vorschriften zum Landesverrat, wie sie von Reichsanwalt Paul JornsJorns, Paul, der auch schon im Prozess gegen die Attentäter von Rosa LuxemburgLuxemburg, Rosa und Karl LiebknechtLiebknecht, Karl eine unrühmliche Figur gemacht hatte,[115] vertreten wurde, sind zwei Aspekte bemerkenswert: Das in § 92 Abs. 1 Nr. 1RStGB1871 erwähnte »Staatswohl«, das durch den Verrat des Staatsgeheimnisses beeinträchtigt sein muss, wurde bezogen auf die Machtstellung des Staats gegenüber anderen Staaten.[116] Zum anderen wurde ein völkerrechtswidriges Verhalten des Staates protegiert. Illegale Aktivitäten des Militärs waren demnach als Staatsgeheimnisse geschützt. Prozessual bemerkenswert ist außerdem, dass die Frage, ob ein Geheimnisverrat vorlag, durch ein Gutachten des Reichswehrministeriums belegt wurde. Als Strafgrund blieb in diesem Fall kaum mehr als der Verstoß gegen die »Staatsräson« übrig. Die beiden Angeklagten wurden letztlich wegen Verstoßes gegen § 1 Abs. 2 des Gesetzes über Verrat militärischer Geheimnisse vom 3. Juni 1931 zu jeweils 18 Monaten Gefängnisstrafe verurteilt.[117] Der Vorwurf des Landesverrats wurde zwar als erfüllt, aber als nachrangig erachtet, weshalb er nicht Teil des Urteilsspruchs war. Abgestempelt als Landesverräter war der spätere Friedensnobelpreisträger Carl von Ossietzkyvon Ossietzky, Carl dennoch. Er musste seine Haft antreten, wurde aber Weihnachten 1932 amnestiert.
Der Prozess war ein fataler Wegbereiter der nationalsozialistischen Justiz. Hier wurde nicht die demokratische Rechtsordnung aus Gesetz und Verfassung der Beurteilung zugrunde gelegt, sondern eine eigene Rechtsordnung, basierend auf den Begriffen »Vaterlandsverrat«, »Treuepflicht« und »Staatswohl«. In den Worten eines der Strafverteidiger von Ossietzkyvon Ossietzky, Carl:
»Von hier stammt jene Verrottung des Rechts und des Rechtsgefühls, die den obersten Gerichtshof bis zur nationalsozialistischen Verdrehung aller Rechtsbegriffe, bis zur Legitimierung des Mords führt, wenn er nur dem ›Staatswohl‹ dient.«[118]
Es gibt eine Vielzahl weiterer Beispiele dafür, dass sich die Reichsanwaltschaft im Laufe der Weimarer Jahre immer stärker von Verfassung und Demokratie abgewandt hat. Neben den Verfahren wegen »publizistischen Landesverrats«, ähnlich wie der Weltbühne-Prozess,[119] waren es vor allem Verfahren gegen die kommunistische Presse und gegen kommunistische Buchhändler, die wegen Vorbereitung hochverräterischer Unternehmen radikal verfolgt wurden. Wegen »Literarischen Hochverrats« wurde verfolgt, wer künstlerische oder wissenschaftliche Schriften verbreitete oder künstlerische Auftritte durchführte, um hochverräterische Ansichten zu verbreiten.[120] Die Meinungs- und Kunstfreiheit nach den Artikeln 118 und 142 der Weimarer Reichsverfassung blieb hingegen unbeachtet. Wer einer kommunistischen Einstellung anhing, galt als Hochverräter, wer hingegen dem politisch rechten Spektrum zugehörig war, der wurde als vaterlandsliebend und patriotisch angesehen und dessen Verdienste wurden bei der Abwehr kommunistischer Aufstandsversuche hervorgehoben.[121] Von der gesetzlich geforderten Objektivität war die Reichsanwaltschaft bei der Durchführung des Staatsschutzstrafrechts inzwischen meilenweit entfernt.
Die »Leipziger Prozesse«
Vor dem Hintergrund der politischen Einstellung der Reichsanwälte und der von ihnen geführten Staatsschutzprozesse scheint es eine besondere Ironie der Geschichte, dass ausgerechnet sie mit der Verfolgung der deutschen Kriegsverbrechen im Ersten Weltkrieg betraut wurden. Im Versailler Vertrag war nicht nur ein internationales Strafverfahren gegen Wilhelm II.Wilhelm II. wegen »schwerer Verletzung des internationalen Sittengesetzes und der Heiligkeit der Verträge« vorgesehen ( Art. 227 des Versailler Vertrags). Die deutsche Regierung verpflichtete sich auch, Kriegsverbrecher zur Strafverfolgung auszuliefern ( Art. 228 des Versailler Vertrags). Listen mit bis zu 900 Personen, denen Verstöße gegen die Gesetze und Gebräuche des Kriegs vorgeworfen wurden, waren von alliierter Seite der deutschen Regierung übersandt worden.[122] Man hatte aber auch aufseiten der Sieger des Ersten Weltkriegs kein Interesse an einer Eskalation, denn schließlich wäre eine Durchsetzung der Auslieferungsforderungen nur durch einen neuerlichen Krieg gegen Deutschland möglich gewesen. So willigte man schließlich in London und Paris ein, als die deutsche Regierung versprach, die beschuldigten Personen selbst strafrechtlich zu verfolgen. Am 18. Dezember 1919 verabschiedete die Nationalversammlung widerwillig das »Gesetz zur Verfolgung von Kriegsverbrechen und Kriegsvergehen«,[123] das dem Reichsgericht die Zuständigkeit für die Kriegsverbrecherprozesse zuwies und damit die Reichsanwaltschaft in die Pflicht nahm, Ermittlungen zu führen und die Anklagen zu vertreten.[124] In den Jahren 1920/21 wurden schließlich zwölf Strafverfahren eingeleitet.[125] Von insgesamt 17 Angeklagten verurteilte man acht zu milden Strafen, die aber kaum vollstreckt wurden, zumal sich einige Verurteilte auch durch Flucht der Strafe entziehen konnten.[126]