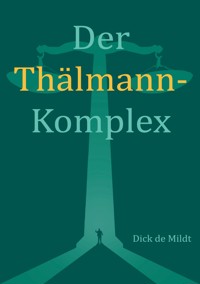
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Der Thälmann-Komplex schildert die Geschichte eines politischen Strafverfahrens im Spiegel deutsch-deutscher Verhältnisse. Dabei handelt es sich um die von Hitler angeordnete Ermordung des deutschen Kommunistenführers Ernst Thälmann im August 1944. Obwohl die Mörder von einem Augenzeugen identifiziert worden waren und die Justiz 1945 den Aufenthaltsort der meisten von ihnen kannte, dauerte es 40 Jahre, bis der einzige überlebende Mordverdächtige vor Gericht gestellt wurde. Das Buch zeigt, warum der Prozess so lange auf sich warten ließ und welche Hindernisse überwunden werden mussten, damit er überhaupt stattfinden konnte. Gleichzeitig schildert es die politische Dimension des Verfahrens im Rahmen der deutsch-deutschen Spannungsverhältnisse während der Jahre des Kalten Krieges. Und schließlich wird die Wahrheitsfindung in diesem besonderen deutschen Strafverfahren genau analysiert und gezeigt, wie sein Ausgang letztlich vor allem auch von politischen Erwägungen bestimmt wurde.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 214
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
Vorwort
Das Opfer
Der Angeklagte
Der Zeuge
Die Entlarvung des Knabenschullehrers
Die Laus im Pelz
Die unwilligen Jagdhunde der Justiz
Der Mord, der nie verjährt
Ablösung des Jägers
Die Szenographie
Der Prozess in Krefeld
Ottos Beteiligung
Wechselnde Zeugenaussagen
Die Disqualifizierung des Augenzeugen
Die Plädoyers
Das Urteil
Die Grenzen der freien Beweiswürdigung
Der Prozess in Düsseldorf
In dubio pro reo
Ein bitteres Nachspiel
Epilog: Der Thälmann-Komplex und die „Justizwende“
Anmerkungen
Literaturverzeichnis
Personenregister
Vorwort
Kurz vor Mitternacht, am 17. August 1944, erreicht eine schwarze Limousine mit Berliner Nummernschild und abgedeckten Scheinwerfern das Eingangstor des Weimarer Konzentrationslagers Buchenwald. Außer dem Fahrer befinden sich im Auto zwei Männer in Zivilkleidung sowie ein Dritter in Häftlingsuniform. Nach Meldung bei der Kommandantur folgt der Wagen dem Weg zum Krematoriumsgelände. Auf dem Hof angekommen, hält das Auto am Eingang des Gebäudes. Die beiden Zivilisten und der Häftling steigen aus und gehen auf die Eingangstür des Krematoriums zu, wobei der Letztere vorangeht. In dem Moment, in dem dieser das von einer Gruppe SS-Männer gebildete Spalier passiert und das Gebäude betreten will, werden plötzlich von hinten drei Schüsse auf ihn abgefeuert. Darauf verschwinden die SS-Männer und die Zivilisten mit ihrem verwundeten Opfer im Krematoriumsgebäude. Kurz danach ertönt noch ein vierter Schuss. Die Leiche des nun verstorbenen Häftlings wird daraufhin mit angezogener Kleidung in einen der hochgeheizten Verbrennungsöfen geschoben. Am nächsten Morgen verbleiben von ihm nur noch ein Haufen Asche und eine verbrannte Taschenuhr, die beim Reinigen des Ofens entdeckt wird.
So endete das Leben des großen deutschen Kommunistenführers Ernst Thälmann. Das heißt, wenn man der wahrscheinlichsten Darstellung seines Todes folgt, denn von Anfang an gab es mehrere von ihnen. Eine davon wurde von den Mördern absichtlich in die Welt geschickt, aber auch die anderen sind, wie wir sehen werden, mit Unstimmigkeiten durchsetzt. Doch bevor wir uns damit beschäftigen, klären wir zunächst einmal die Frage, warum wir uns mehr als 75 Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs immer noch mit ausgerechnet diesem Nazi-Mord auseinandersetzen sollten. An Wahlmöglichkeiten mangelt es schließlich nicht, und man kann sich zu Recht fragen, was gerade den Mord an Ernst Thälmann so besonders macht. Denn Thälmann mag zu seiner Zeit ein renommierter und mächtiger deutscher Politiker gewesen sein, als Opfer Hitlers aber war er doch nur einer unter Millionen. Und er gehörte bestimmt auch nicht zu den „harmlosesten“ von ihnen. Wären die Würfel des politischen Schicksals in der Weimarer Republik anders gefallen, hätte Thälmann Hitler und seine Nationalsozialisten wohl nicht weniger rücksichtslos verfolgt, als sie es mit ihm und seinen Genossen taten. Anders als die meisten von Hitlers Opfern wusste der Kommunistenführer sehr gut, warum die Nazis ihn verhafteten und einsperrten. Und er war sich auch der Möglichkeit bewusst, dass sie ihn ums Leben bringen würden. Schließlich waren Hitler und er Führer von politisch-ideologischen Machtblöcken, die einen Kampf auf Leben und Tod ausfochten, und einer von ihnen musste dabei letztendlich unterliegen. So waren die Regeln der Machtpolitik, über die sich auch der deutsche KPD-Chef keine Illusionen machte. In dieser Hinsicht war Thälmann also in der Tat kein ahnungsloses und „unschuldiges“ Opfer Hitlers. Und wenn dies tatsächlich die Betrachtungskriterien wären, dann hätte er gegen die massive Konkurrenz bestimmt den Kürzeren gezogen. Dasselbe gilt für die Art und Weise, wie er getötet wurde. Denn seine Hinrichtung mag zwar tückisch gewesen sein, aber sie war immer noch mit Abstand nicht so unvorstellbar grausam wie die Tötungsart der meisten anderen Opfer des Nationalsozialismus.
Das Besondere am Thälmannmord liegt also nicht in der Person des Opfers oder in der an ihm begangenen Straftat, sondern in dem außergewöhnlichen Nachspiel dieses Verbrechens. Ein Nachspiel, das erst 44 Jahre später mit einem Urteil des Düsseldorfer Gerichts gegen einen seiner mutmaßlichen Mörder sein endgültiges Ende finden sollte. Es ist der schleppende und in mancher Hinsicht umstrittene Verlauf der justiziellen Reaktion auf den Thälmannmord, der seine Verfahrensgeschichte so faszinierend macht. Denn sie führt hinein ins Labyrinth der juristisch-historischen Wahrheitsfindung in einem von politischen Sensibilitäten und ideologischen Gegensätzen schwer geprägten Strafverfahren, das in Ost- und Westdeutschland die Gemüter jahrzehntelang erregte. Und so ist der „Thälmann-Komplex“ weit mehr als nur die Geschichte eines bemerkenswerten strafrechtlichen Kasus. Er ist zugleich ein besonderes Kapitel in der Geschichte der mühsamen deutsch-deutschen Koexistenz und des damit verbundenen unterschiedlichen Umgangs mit der gemeinsamen NS-Vergangenheit.
1. Das Opfer
Über das Leben und Wirken des Weimarer Kommunistenführers Ernst Thälmann wurde selbstverständlich vor allem in der DDR viel geschrieben. Während des vierzigjährigen Bestehens der ostdeutschen Republik erschienen dort acht maßgebende Monografien, und daneben war er Hauptthema unzähliger Aufsätze, biografischer Skizzen, Dokumentarfilme usw.1 Paradoxerweise wird man in diesem Buch aber wenig über seine Person und seine Bedeutung als politischer Führer erfahren. Obwohl er als Opfer immer im Zentrum des beschriebenen Strafverfahrens steht, bleibt der eigentliche Thälmann hinter den historischen Kulissen. Und was seine Biografie angeht, beschränken wir uns hier vor allem auf die äußerst kurze Skizze der Richter, die sich mehr als vierzig Jahre nach seinem Tod mit seinem Fall befassten.2
Ernst Thälmann wurde am 16. April 1886 in Hamburg geboren. Als siebzehnjähriger Hafenarbeiter trat er der Sozialdemokratischen Partei (SPD) bei. Im Jahr 1918 wechselte er zur radikaleren Abspaltung, der Unabhängigen Sozialdemokratischen Partei Deutschlands (USPD), und wurde im folgenden Jahr zum Parteivorsitzenden ihrer Hamburger Abteilung sowie zum Abgeordneten der Hamburger Bürgerschaft gewählt. Kurze Zeit später schloss er sich mit dem linken Flügel der USPD den Kommunisten an und wurde 1924 Parteivorsitzender und gleichzeitig Mitglied des deutschen Reichstags. Nach dem Tod von Friedrich Ebert bewarb sich Thälmann 1925 um das Amt des Reichspräsidenten. Sein Festhalten an der von Anfang an aussichtslosen Kandidatur war einer der Hauptgründe für den Sieg Hindenburgs über den Kandidaten der Weimarer Koalition, den Zentrumspolitiker Wilhelm Marx.3 Sechs Jahre später, 1932, folgte ein zweiter Versuch; diesmal trat neben dem alten Hindenburg auch der Führer der Nationalsozialisten, Adolf Hitler, gegen ihn an. Thälmanns Wahlspruch ließ an Deutlichkeit wenig zu wünschen übrig: „Wer Hindenburg wählt, wählt Hitler, und wer Hitler wählt, wählt den Krieg!“ Doch sein prophetischer Blick nutzte ihm nichts: Im zweiten Wahlgang, am 10. April, wurde er von beiden vernichtend geschlagen.4
Nachdem sein nationalsozialistischer Gegner neun Monate später zum Reichskanzler aufgestiegen war, blieb Thälmann nur noch eine kurze Zeit in Freiheit. Bereits eine Woche nach der sogenannten Reichstagsbrandverordnung „Zur Abwehr kommunistischer staatsgefährdender Gewaltakte“ vom 28. Februar 1933 wurde er verraten und in seiner Unterkunft in der Berliner Lützowstraße 9 verhaftet.5 Er wurde in das Polizeigefängnis am Alexanderplatz überstellt und wegen Hochverrats angeklagt. Nach dem für die Nazis katastrophal verlaufenen „Reichstagsbrandprozess“ wagten sie es aber nicht mehr, den populären Kommunistenführer vor Gericht zu bringen, und nach einiger Zeit wurde der gegen ihn gerichtete Haftbefehl aufgehoben. Statt einer Freilassung folgte jedoch die „Schutzhaft“. Anders als üblich bei dieser polizeilichen Vorbeugehaft kam Thälmann aber nicht ins KZ, sondern verblieb auf Befehl Hitlers die Jahre hindurch im Gefängnis. Der Kontakt mit der Außenwelt und, über Geheimkuriere, mit der Parteiführung und mit Moskau erfolgte über Thälmanns Frau Rosa, die ihn Jahr für Jahr treu besuchte und sich unermüdlich für seine Freilassung einsetzte. Nach einiger Zeit wurde ihr jedoch klar, dass Stalin und dem KPD-Gipfel im Moskauer Exil der propagandistische Wert ihres Mannes als Gefangener Hitlers wichtiger war als sein persönliches Schicksal und die internationalen Bemühungen um seine Freilassung. Als mit dem Abkommen zwischen Hitler und Stalin im August 1939 die Chancen auf seine Freilassung stark zunahmen, schwieg es aus Moskau und auch seine führenden Parteigenossen – unter ihnen der spätere SED-Chef Walter Ulbricht – machten für ihn keinen Finger krumm.6
Und so blieb Thälmann der Willkür Hitlers ausgeliefert. Dieser war seinem ausgeschalteten Gegner übrigens lange Zeit nicht allzu böse gesinnt und zog sogar seine Freilassung in Betracht. Doch mit den schwindenden Erfolgschancen seines militärischen Abenteuers verschlechterten sich auch die Perspektiven für Thälmann, und dieser war sich dessen sehr bewusst, wie seine Äußerungen gegenüber einem Mitgefangenen Anfang 1944 zeigten:
Wird man mich so ohne weiteres aus der Kerkerverbannung wieder in die große Welt zurückkehren lassen? Nein! Freiwillig ganz bestimmt nicht. Es besteht sogar die Wahrscheinlichkeit […], dass bei einem für Deutschland gefahrvollen Vordringen der Sowjetarmeen und im Zusammenhang mit der damit verbundenen Verschlechterung der deutschen Gesamtkriegslage das nationalsozialistische Regime […] nicht davor zurückschrecken [wird], Thälmann vorzeitig beiseite zu schaffen oder aber für immer zu erledigen […]7
Das Attentat vom 20. Juli 1944 und die daraus resultierende Paranoia Hitlers sogar seinen bereits inhaftierten Opponenten gegenüber besiegelte schließlich das Schicksal des Kommunistenführers. Am 14. August meldete sich SS-Chef Heinrich Himmler in der „Wolfsschanze“ zu einem Treffen mit Hitler. Dabei machte sich der SS-Chef über die Ergebnisse einige Notizen, die erhalten geblieben sind. Unter Nummer 12 stand „Thälmann“ und dahinter in Himmlers Handschrift: „ist zu exekutieren.“ Wenige Tage später wurde Thälmann von der Gestapo in Bautzen8 aus seiner Zelle geholt, abgeführt und in Buchenwald getötet.
Wegen seines weltweiten Ruhmes und seines enormen symbolischen Wertes als Deutschlands Kommunistenführer und langjähriger Gefangener Hitlers wollten die Nazis jedoch die öffentliche Verantwortung für die Hinrichtung Thälmanns nicht übernehmen und schoben die Schuld für seinen Tod auf den Feind. Die wiederholten alliierten Luftangriffe boten ihnen die Gelegenheit dazu. Am 24. August bombardierten amerikanische Flugzeuge die Industrieanlagen in der Gegend von Buchenwald. Einige Bomben landeten auch im Lager selbst. Betroffen waren unter anderem die Unterkünfte der sogenannten prominenten Buchenwald-Häftlinge. Dazu gehörten neben dem ehemaligen sozialistischen Premierminister Frankreichs Léon Blum und dem belgischen Trotzkisten Ernest Mandel auch der SPD-Reichstagsabgeordnete Rudolf Breitscheid mit seiner Frau und die italienische Königstochter, Prinzessin Mafalda von Hessen. Breitscheid und von Hessen wurden Opfer der amerikanischen Bomben. Das NSDAP-Parteiblatt Völkischer Beobachter, das über den Bombenanschlag am 15. September berichtete, fügte ein weiteres Opfer hinzu: Ernst Thälmann. In Kreisen der illegalen Lagerorganisation – bestehend aus erfahrenen und gut informierten kommunistischen Häftlingen – wurde diese Version von Thälmanns Tod bald in das Reich der Fabeln verwiesen, aber auch unter der Lager-SS und selbst außerhalb Buchenwalds gab es solche, die die Geschichte sofort anzweifelten.9 Dennoch ordnete Kommandant Pister an, dass Thälmann als Opfer des alliierten Bombardements in das Standesamtregister von Weimar – von dem sich eine besondere Abteilung im Lager befand – eingetragen werden sollte. Das wurde vom zuständigen Standesbeamten – wie er selbst Jahrzehnte später vor Gericht angab – mit der Begründung abgelehnt, dass der Kommunistenführer nie in Buchenwald registriert worden sei und ihm nicht die vollständigen Personalien des Opfers zur Verfügung stünden. Und so verhinderten bürokratische Sensibilitäten eine formale Dokumentation.10
Dass der Mord an Ernst Thälmann nicht ungestraft bleiben durfte, stand nach der deutschen Kapitulation vor allem für die Antifaschisten in der Sowjetzone außer Frage. Drei Tage vor der Eröffnung des großen amerikanischen „Buchenwald-Prozesses“ im ehemaligen Konzentrationslager Dachau am 11. April 1947 appellierten KPD-Chef Wilhelm Pieck und SPD-Chef Otto Grotewohl im Namen der „Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands“ (SED) an das amerikanische Militärgericht, Thälmanns Mörder nicht ungeschoren davonkommen zu lassen. Unter den Mördern, die Pieck und Grotewohl auf ihrer Liste hatten, war ein gewisser SS-Oberscharführer Otto.11
2. Der Angeklagte
Wolfgang Otto, geboren am 23. August 1911 im oberschlesischen Eichenau bei Kattowitz, wollte gar nicht werden, was er schließlich doch wurde: ein Kriegsverbrecher. Wie sein 1930 verstorbener Vater erstrebte er den Beruf des Lehrers.12 Nach dem Abschluss eines humanistischen Gymnasiums schrieb er sich im März 1933 an der Hochschule für Lehrerbildung in Beuthen ein. Wegen der übermäßig großen Zahl von Anträgen wurde er aber zunächst abgelehnt. Um seine Chancen in einem zweiten Versuch zu erhöhen, riet ihm der Rektor, seine Dienstpflicht abzuleisten und sich bei der SS zu melden. Dies geschah und Wolfgang Otto wurde im November 1933 Mitglied der sogenannten Motor-SS. Die Initiative wurde in der Tat prompt belohnt: Im Mai 1934 konnte er seine Lehrerausbildung beginnen. Die Entscheidung für die motorisierte Unterabteilung der Allgemeinen SS scheint für Wolfgang übrigens vor allem eine Praktische gewesen zu sein. Einerseits verbesserten sich seine Aussichten auf Zulassung zu der von ihm gewünschten Ausbildung; andererseits war die Motor-SS seiner Meinung nach ein etwas exklusiverer Klub, dem auch einige seiner Schulkameraden angehörten und dessen Aktivitäten nicht allzu sehr seine Zeit in Anspruch nahmen. Für die Ideologie der Nazis interessierte er sich nach seinen späteren Angaben nicht. Sein Vater war immer ein Anhänger der katholischen Zentrumspartei gewesen, und er selbst hatte wenig Interesse an Politik. Er war und blieb jedoch die Jahre hindurch ein begeisterter Katholik und besuchte, wann immer möglich, die Kirche, wo er mit Vorliebe Orgel spielte. Alles in allem Leidenschaften, die innerhalb der antiklerikalen SS wenig geschätzt wurden. Anders als viele seiner Kameraden weigerte sich Otto auch, seine Kirchenmitgliedschaft aufzugeben. Dies kostete ihn – wiederum nach eigenen Angaben – den Zugang zu den Offiziersrängen. Obwohl er alle Voraussetzungen erfüllte, wurde sein Antrag auf Aufnahme in den Führerlehrgang abgelehnt.
Am 6. März 1936 schloss Otto erfolgreich die Lehrerausbildung ab und wurde im folgenden Jahr an eine Grundschule in dem kleinen Ort Bauschdorf, etwa zwanzig Kilometer unterhalb von Breslau, angenommen. Im gleichen Jahr trat er der NSDAP und auch dem Nationalsozialistischen Lehrerbund bei. Im Jahr 1938 heiratete er, und aus dieser Ehe gingen schließlich drei Kinder hervor. Neben seiner Arbeit als Lehrer war Otto einmal wöchentlich in der SS tätig, was ihm den Dienstgrad eines Rottenführers einbrachte. Kurz vor Ausbruch des Krieges wurde ihm mitgeteilt, dass er als sogenannter Reservist bei der SS einberufen werden würde. Am 1. September 1939 musste er sich in einem Sammellager in Oppeln melden. Er wurde noch am selben Tag nach Weimar versetzt, von wo er direkt in das Konzentrationslager Buchenwald geschickt wurde. Hier wurde Otto den Wachtruppen zugewiesen und – wie alle Reservisten – dienstrangmäßig auf SS-Mann zurückgestuft. Seine Tätigkeit in Buchenwald beschränkte sich zunächst auf Posten- und Wachturmdienst. Im August 1940 wurde er zum Sturmmann befördert und im November desselben Jahres hatte er bereits seinen alten Rang als Rottenführer wieder erreicht.
Es zeigte sich schnell, dass Otto wesentlich klüger war als die meisten seiner Kameraden, und es dauerte nicht lange, bis ihm die Verwaltung des Wachbataillons übertragen wurde. Im November 1941 wurde er in die Koordinierungsstelle des Konzentrationslagers, die Kommandantur, versetzt, wo er in der Verwaltungsabteilung eingesetzt wurde. Im Sommer 1943 promovierte er zum Leiter dieser Abteilung und wurde als sogenannter Spieß die administrative rechte Hand des Lagerkommandanten Hermann Pister. Damit erhielt Otto eine zentrale Verwaltungsfunktion innerhalb der Lagerleitung und war für die gesamte Verwaltung von Buchenwald sowie für die Kontakte des Lagers mit externen Stellen zuständig. Im November 1943 wurde er zum Oberscharführer befördert und mit dem Kriegsverdienstkreuz zweiter Klasse ausgezeichnet. Bis Kriegsende übte er seine Funktion als Leiter der Lagerverwaltung zur vollen Zufriedenheit des Kommandanten Pister aus.
Am 11. April 1945, kurz vor dem Eintreffen der amerikanischen Truppen, verließen Pister und seine Männer das Lager. In einer SS-Uniform ohne Rangzeichen und mit gefälschten Papieren gelang es Otto, die amerikanischen Militärkontrollpunkte ohne allzu große Mühe zu passieren und zu seiner Familie nach Weimar zurückzukehren. Da er aber keinen anderen Ausweg sah und meinte, er habe nichts zu verbergen, meldete er sich am 20. Juni im Büro des amerikanischen Militärgeheimdienstes (CIC) in Weimar. Die Amerikaner verhafteten ihn sofort und internierten ihn als mutmaßlichen Kriegsverbrecher, zunächst in Buchenwald und später im ehemaligen Konzentrationslager Dachau. Im Februar 1947 wurde er in den Arrestbunker des Internierungslagers verlegt. Dort traf er viele seiner alten Kameraden, die auf ihren Prozess warteten. Am 11. April eröffnete das amerikanische Militärtribunal in Dachau den Prozess gegen Josias Prinz zu Waldeck und dreißig Mitangeklagte, darunter auch Otto.13
Waldeck et al. wurden wegen Verbrechen angeklagt, die in Buchenwald gegen Mitglieder der alliierten Koalition „und andere nichtdeutsche Bürger“ begangen wurden.14 Der explizite Ausschluss deutscher Opfer in dieser Anklageschrift machte deutlich, dass es den Amerikanern nicht um einen umfassenden Umgang mit den in Buchenwald praktizierten Naziverbrechen ging, sondern nur um einen Teil davon: die im Lager begangenen Kriegsverbrechen. Die Verbrechen der Nazis an ihren eigenen deutschen Landsleuten gehörten nicht dazu und waren daher auch nicht Teil des amerikanischen Strafverfolgungsprogramms.15 Dennoch erhielten die am Tod des deutschen Kommunistenführers beteiligten Personen, die von Pieck und Grotewohl in ihrem Plädoyer an das Tribunal zitiert worden waren, hohe Strafen für ihre Beteiligung an einer Vielzahl von Kriegsverbrechen. Lagerkommandant Hermann Pister, sein Adjutant Hans Schmidt, Schutzhaftlagerführer Max Schobert und der Leiter des Krematoriums, Hermann Helbig, wurden alle zum Tode verurteilt. Otto selbst entkam der Todesstrafe und wurde zu zwanzig Jahren Haft verurteilt.
Alle fünf wurden vom Gericht (unter anderem) für die vom Reichssicherheitshauptamt (RSHA) in Buchenwald angeordneten Hinrichtungen verantwortlich gemacht, darunter die von Tausenden von polnischen und russischen Kriegsgefangenen. Letztere – oft sogenannte politische Kommissare der Roten Armee – wurden ab Herbst 1941 in Lagern wie Buchenwald und Sachsenhausen systematisch hingemordet. Hintergrund dieser Vernichtungsaktionen war der sogenannte Kommissarbefehl vom 6. Juni 1941. Diese „Richtlinien für die Behandlung politischer Kommissare“, wie der Befehl offiziell genannt wurde, wurden vom Oberkommando der Wehrmacht am Vorabend des Angriffs auf die Sowjetunion herausgegeben und an die verschiedenen Truppenteile gerichtet. Tatsächlich bedeuteten die Direktiven nichts weniger als ein allgemeines Todesurteil für alle sowjetischen politischen Offiziere, die in die Hände der Deutschen fielen: „Diese Kommissare werden nicht als Soldaten anerkannt“, wie es im Kommissarbefehl hieß. Und: „Der für Kriegsgefangene völkerrechtlich geltende Schutz findet auf sie keine Anwendung. Sie sind nach durchgeführter Absonderung zu erledigen.“16
In Buchenwald fand die vom RSHA orchestrierte „Sonderbehandlung“ der russischen Offiziere zunächst in einem Steinbruch auf dem SS-Industriegelände statt. Da der Umfang der Transporte mit den zu exekutierenden Offizieren bald erheblich zunahm, wurde auf einen umgebauten Pferdestall zurückgegriffen. Es gab dort einen Umkleideraum, in den die mit Lastwagen angelieferten Russen in Gruppen geführt und angewiesen wurden, sich für eine medizinische Untersuchung auszuziehen. Anschließend wurden die Russen einzeln von einem SS-Mann abgeholt und durch eine schalldichte Tür und einen Korridor in den sogenannten Untersuchungsraum gebracht, der wiederum mit einer schalldichten Eingangstür versehen war. Im hell erleuchteten Untersuchungsraum befanden sich zwei Tische mit verschiedenen medizinischen Instrumenten, während die Wände anatomische Abbildungen des menschlichen Körpers zeigten. Außerdem warteten einige SS-Leute, die mit weißen Arztkitteln verkleidet waren, um die Opfer zu täuschen. Um die Täuschung zu perfektionieren, wurde jeder hereingeführte russische Offizier einer kurzen „Untersuchung“ der Zähne, des Herzens und der Lunge unterzogen. Dann wurde er angewiesen, sich vor eine an der Wand befindliche Messlatte zu stellen. Diese befand sich in einer Nische des Untersuchungsraumes. Deren Boden bestand aus einem Metallgitter, darunter war ein Abfluss. Die Messlatte war an der Rückwand angebracht. Auf einer Höhe von einem bis zwei Metern gab es darin einen offenen Schlitz von etwa fünf bis sieben Zentimetern Breite. Dahinter befand sich ein kleiner unbeleuchteter Raum, in dem sich zwei SS-Männer aufhielten. Als das ahnungslose Opfer mit dem Rücken gegen die Messlatte stand, gab der SS-Offizier, der die „Messung“ vornahm, einen Tritt gegen die Wand als Zeichen dafür, dass alles für die Hinrichtung bereit war. Einer der SS-Männer im Raum hinter der Messlatte tötete dann das Opfer mit einem Schuss in den Nacken durch den Schlitz. Der Tote wurde darauf in großer Eile von zwei Häftlingen des Krematoriumskommandos entfernt und auf einen vor dem Gebäude wartenden Lastwagen geworfen. In der Zwischenzeit wurde der Boden des Untersuchungsraums rasch gereinigt und von allen Spuren der Hinrichtung befreit, woraufhin das nächste Opfer abgeholt wurde.
Auf diese Weise wurde bei jeder Liquidierungsaktion im Pferdestall von Buchenwald etwa alle drei Minuten ein russischer Offizier hingerichtet. Um zu verhindern, dass der Lärm der Schüsse die anderen im Umkleideraum wartenden Russen erreichte und dadurch Unruhe verursachte, wurde in diesem Raum über Lautsprecher mithilfe eines Grammophons oder Radios laute Musik gespielt. Sobald der draußen wartende Lastwagen mit Leichen gefüllt war, wurde er zum Lagerkrematorium gefahren, wo die Leichen entladen und dann in den Öfen verbrannt wurden. Ursprünglich hinterließ der Lastwagen eine auffällige Blutspur, aber nachdem man ihn mit einer Blechwanne ausgerüstet hatte, war auch dieses Tarnproblem gelöst. Die Mitglieder des Hinrichtungskommandos – nach der Nummer des Telefonanschlusses im Pferdestall auch „Kommando 99“ genannt – wurden anschließend mit Sonderrationen Brot, Wurst, Zigaretten und Alkohol belohnt und nach einiger Zeit mit dem Kriegsverdienstkreuz zweiter Klasse ausgezeichnet.
Etwa ab Jahreswende 1943/44 wurde der Pferdestall als Hinrich-tungsstätte durch den Keller des Krematoriums ersetzt. Damit änderte sich auch die Ausführungsmethode. Von nun an wurden die Opfer nicht mehr durch Genickschuss, sondern durch Strangulation getötet. Sie wurden mit hinter ihrem Rücken gefesselten Händen und einem Strick um den Hals an Haken aufgehängt, die an der Wand in einer Höhe weit über Körpergröße angebracht waren. Normalerweise dauerte es nach den Feststellungen des amerikanischen Tribunals zwischen 35 und 40 Minuten, bis der Tod bei dieser Art der Hinrichtung eintrat. Der Zeuge Ulrich Osche, der als politischer Häftling im Sektionszimmer des Krematoriums beschäftigt war, schilderte 1962 in einem Verhör vor der deutschen Justiz seine Eindrücke von dieser Hinrichtungsmethode:
Eines Nachmittags, im Sommer 1944, kam der […] Standortzahnarzt zu mir in den Sektionsraum und forderte mich auf, Zahnziehzangen aus dem Instrumentenschrank zu nehmen und mit ihm zu kommen. Er ging mit mir in den Keller des Krematoriums, in dem sich mir ein entsetzlicher Anblick bot. Rundherum an den Wänden und an den Zwischenträgern hingen und röchelten ungefähr 40 sowjetische Kriegsgefangene an in die Wand eingeschlagenen Haken. Auf dem Boden lag noch einmal ungefähr dieselbe Anzahl sowjetischer Kriegsgefangener, die meist völlig entkleidet waren. Der Zahnarzt verlangte, dass ich die Gebisse nachsehe und Goldkronen oder Brücken herausziehe. Als wir an einen Gefangenen kamen, der noch Lebenszeichen von sich gab, wurde dieser nochmals von Warnstedt und Stobbe an einem der Haken aufgehängt. Währenddessen wurden auch die an den Wänden hängenden sowjetischen Kriegsgefangenen von Müller und Rohde von den Haken abgenommen, und ich musste auch ihnen die Zähne nachsehen. Danach musste ich den Raum wieder verlassen, und kurz darauf kam der Kapo Müller zu mir und warnte mich, über das zu sprechen, was ich gesehen hätte.17
Im Hinblick auf Ottos Rolle bei diesen Hinrichtungen stellten die Amerikaner 1947 fest, dass er als Stabsscharführer für das Kommando 99 mitverantwortlich gewesen war:
Zwei Zeugen bekundeten, dass der Angeklagte als Stabsscharführer die Tätigkeit des Kommandos „99“ leitete. Ein dritter Zeuge sagte aus, dass der Angeklagte in der Zeit von 1943 bis 1945 ungefähr fünfmal als Schütze in einem Exekutionskommando Dienst tat. In seiner eigenen Aussage gab der Angeklagte zu, dass er an ungefähr 50 Exekutionen teilgenommen habe und bei der Exekution von ungefähr 200 ausländischen Häftlingen zugegen war. Er nahm an einigen Exekutionen als Protokollführer teil. Bei den Opfern kam ungefähr 1 deutscher Häftling auf 9 ausländische. Die ausländischen Häftlinge kamen meist aus östlichen Ländern. Im Jahre 1943 oder 1944 war der Angeklagte Protokollführer bei der Erhängung von 21 polnischen Häftlingen (Offiziere). Der Angeklagte Nr. 25 [= Hans Schmidt, DdM] sagte aus, dass dieser Angeklagte 1943 bei der Exekution von 20 russischen Kriegsgefangenen durch das Kommando „99“ im Pferdestall zugegen war. Der Angeklagte selbst sagte aus, dass er als Stabsscharführer der Kommandantur keine Befehlsgewalt über Häftlinge hatte. Er musste als Protokollführer bei Exekutionen dabei sein. In dieser Eigenschaft nahm er an 35-50 Exekutionen teil. Seine Aufgabe war es, diejenigen zu benachrichtigen, die daran teilnehmen mussten, und die Vorgänge zu protokollieren. Bei den exekutierten Personen handelte es sich nicht um Häftlinge aus Buchenwald. Es waren Kriminelle, die von draußen, aus dem Zivilleben kamen. Die den Opfern vorgelesenen Exekutionsanordnungen bezogen sich auf Mord, Raub (auch Notzucht) und Sabotage. Der Angeklagte tat bei verschiedenen Exekutionskommandos Dienst als Schütze. Er gab bei verschiedenen Gelegenheiten Schnaps, Zigaretten und Wurst an die Mitglieder von Exekutionskommandos aus. Der Angeklagte sagte ferner aus, dass er einmal bei einer Exekution durch das Kommando „99“ nur zugegen war, ohne dass er dort eine dienstliche Aufgabe zu erfüllen gehabt hätte.18
Das US-Tribunal verurteilte Otto am 14. August 1947 für seine Beteiligung an den Morden in Buchenwald zu zwanzig Jahren Gefängnis. Zusammen mit den anderen vierzehnhundert Verurteilten der Dachauer Prozesse wurde er in dem Gefängnis inhaftiert, in dem Adolf Hitler 23 Jahre zuvor eingesperrt gewesen war: Kriegsverbrechergefängnis Nr. 1 in Landsberg.
3. Der Zeuge
Obwohl der Mord an Ernst Thälmann im amerikanischen Buchenwald-Prozess keine Rolle spielte, blieb er den Amerikanern nicht unbekannt. Am 21. April 1947 verfasste der Pole Marian Zgoda, ehemaliger Häftling aus Buchenwald und Mitglied des Krematoriumskommandos, vor Gericht einen Augenzeugenbericht darüber. Bereits am nächsten Tag stand seine Geschichte in der Frankfurter Rundschau unter dem Titel „Ernst Thälmann wurde erschossen und verbrannt“:
Am 17. August wurde ein telefonischer Befehl gegeben, die Öfen des Krematoriums anzufeuern. Ich habe mich hinter einem Schlackenhaufen verborgen und beobachtet, wie acht SS-Unterführer, darunter der SS-Stabsscharführer Otto und der Rapportführer Hofschulte, um 24 Uhr das Krematorium betraten. Um 0 Uhr 10 Minuten kam ein großer Personenwagen, dem drei Zivilisten entstiegen, von denen zwei offensichtlich den in der Mitte Gehenden bewachten. Ich konnte vier Schüsse hören und nach etwa 25 Minuten verließen die SS-Unterführer das Krematorium. Dabei sagte Hofschulte zu Otto: „Weißt Du, wer das war?“ Otto antwortete: „Das war der Kommunistenführer Thälmann.“19
Noch während des Prozesses verfasste der amerikanische Ermittlungsbeamte Joe Kirschbaum einen schriftlichen Bericht über eine detailliertere Erklärung. Dieser wurde von Zgoda unterzeichnet und wird wegen seiner Bedeutung für das Kommende hier wörtlich wiedergegeben.
Mord an Ernst Thälmann
Heute weiss die Welt, dass Ernst Thälmann nicht, wie die Göbbels-Propaganda mitteilte, einem Luftangriff zum Opfer fiel, sondern am 17. 08. 1944 ermordet wurde.
In Dachau befinden sich noch 850 SS-Leute, die zu irgendeinem Zeitpunkt einmal in Buchenwald gewesen sind.
Aussage des Marian Zgoda, München, Melusinenplatz 1, früher Leichenträger im Krema.





























