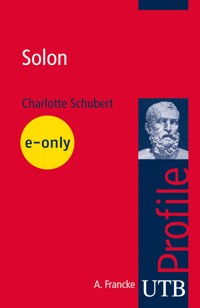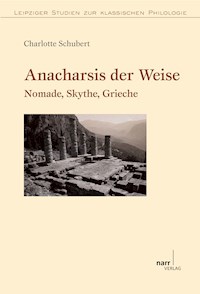24,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: C. H. Beck
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
SAKRILEG! Tiberius Gracchus – vor Übergriffen geschützt durch den heiligen Schwurbund des Volkes, der jedem seiner Tribune Unverletzlichkeit garantiert – wird im Jahr 133 v. Chr. von Senatoren und ihren Gefolgsleuten auf dem Kapitol erschlagen. Tiberius hatte es gewagt, gegen den Willen des Sensats eine Bodenreform zur Landverteilung durchzusetzen. Doch den Senatoren geht es um mehr als um ein paar Äcker – sie fürchten um ihre Macht. Dennoch wagt es zehn Jahre später der Bruder des Ermordeten, Caius Gracchus, die Politik des Tiberius aufzugreifen und voranzutreiben, und so widerfährt ihm das gleiche Schicksal. 133 v. Chr. – das hat Rom in den mehr als 600 Jahren seit seiner Gründung noch nicht erlebt: Mitglieder des ehrwürdigen Senats verwandeln sich in einen rasenden Mob und erschlagen den durch heiliges Recht unantastbaren Volkstribunen Tiberius Sempronius Gracchus. Er hat es gewagt, ein Gesetz zur Bodenreform einzubringen, das die Armen begünstigt, der römischen Elite aber nicht willkommen ist. Doch die mordlüsternen Senatoren ahnen noch größeres Unheil voraus – eine Verschiebung der politischen Kräfteverhältnisse insgesamt zu ihrem Nachteil. Zehn Jahre später wiederholt sich die Tragödie, als der jüngere der Gracchen-Brüder, Caius, ein komplexes politisches Programm ins Werk setzt, dessen Kern abermals eine Bodenreform ist. Auch er findet den Tod durch die Hand seiner senatorischen Gegner. Charlotte Schubert hat ein spannendes Buch über den Anfang vom Ende der römischen Republik geschrieben. Sie erhellt die komplexen Motive, welche die Gracchen zu ihren politisch wegweisenden Vorhaben veranlassten, und beschreibt die dramatische Wucht der darauf einsetzenden Konflikte. Die reaktionären Kreise Roms wussten sich keinen anderen Rat, als die Urheber und ihre Projekte in einem Blutbad untergehen zu lassen, anstatt für die drängenden wirtschaftlichen, sozialen und gesellschaftlichen Probleme nach alternativen Lösungen zu suchen. Dafür sollten sie Jahrzehnte später in den dunkelsten Stunden Roms einen hohen Preis zahlen, als die Republik in den Bürgerkriegen versank.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Charlotte Schubert
DER TOD DER TRIBUNE
Leben und Sterben des Tiberius und Caius Gracchus
C.H.Beck
Abbildung 1: Die Büste der Gracchen von Eugène Guillaume (1822–1905)
Zum Buch
Das hat Rom in den mehr als 600 Jahren seit seiner Gründung noch nicht erlebt: Mitglieder des ehrwürdigen Senats verwandeln sich 133 v.Chr. in einen rasenden Mob und erschlagen den durch heiliges Recht unantastbaren Volkstribunen Tiberius Sempronius Gracchus. Er hat es gewagt, ein Gesetz zur Landreform einzubringen, das die Armen begünstigt, der römischen Elite aber nicht willkommen ist. Doch die mordlüsternen Senatoren ahnen noch größeres Unheil voraus — eine Verschiebung der politischen Kräfteverhältnisse insgesamt zu ihrem Nachteil.
Zehn Jahre später wiederholt sich die Tragödie, als der jüngere der Gracchen-Brüder, Caius, ein komplexes politisches Programm ins Werk setzt, dessen Kern abermals eine Landreform ist. Auch er findet den Tod aus der Hand seiner senatorischen Gegner. Charlotte Schubert hat ein spannendes Buch über den Anfang vom Ende der römischen Republik geschrieben. Sie erhellt die komplexen Motive, welche die Gracchen zu ihren politisch wegweisenden Vorhaben veranlassten, und beschreibt die dramatische Wucht der darauf einsetzenden Konflikte. Die reaktionären Kreise Roms wussten sich keinen anderen Rat, als die Urheber und ihre Projekte in einem Blutbad untergehen zu lassen, anstatt für die drängenden wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Probleme nach alternativen Lösungen zu suchen. Dafür sollten sie Jahrzehnte später in den dunkelsten Stunden Roms einen hohen Preis zahlen, als die Republik in den Bürgerkriegen versank.
Vita
Charlotte Schubert ist Professorin em. für Alte Geschichte an der Universität Leipzig. Zu ihren Forschungsschwerpunkten gehören neben der Geschichte der Medizin und der Wissenschaft im Allgemeinen die Digital Humanities und die Landverteilung in der Antike.
INHALT
VORWORT
I: DAS ENDE
1. Tod auf dem Kapitol
2. Wie konnte es so weit kommen?
Legitimationsversuche
3. Familie und Erziehung
Der Vater Tiberius Gracchus
Die Mutter Cornelia
4. Tiberius Gracchus und Scipio Aemilianus
Vom Schützling zum Gegner
Scipio Aemilianus und Tiberius Gracchus – ein Vergleich
Die Entfremdung des Scipio Aemilianus und seines Schützlings Tiberius Gracchus
II: DIE WENDE
1. Römische Kriege in Spanien
2. Numantia
3. Streit um den Mancinus-Vertrag
III: DER ANFANG
1. Stoisch-Sozialethische Politik in Rom
Der öffentliche Nutzen und der Eigennutz
2. Stoa in Sparta
3. Blossius, der Stoiker, und der Aufstand des Aristonikos
Philosophisch-politische Hintergründe des Aristonikos-Aufstands?
IV: ERFOLG UND SCHEITERN
1. Das Programm
Grundbesitzverhältnisse in der römischen Republik
2. Bodenreform
Notleidende Bauern?
Landverteilung
3. Die Absetzung des Octavius
Geld für die Bodenreform
Eine unerwartete Finanzierungsmöglichkeit – das Erbe Attalos’ III. von Pergamon
Die Tage des Tiberius als politische Wendezeit?
4. Das Ende des Scipio Aemilianus
Das unruhige Jahr 129 v. Chr.
Scipios Tod (129 v. Chr.)
V: REFORM DER RESPUBLICA
1. Der Traum des Caius Gracchus
Die politischen Motive für das Handeln des Caius
2. Dolche aufs Forum!
3. Ein institutionelles Schutzkonzept für Bürger
4. Sozial- und Verwaltungsgesetzgebung
Brot
Land
Straßen
5. Neuordnung der Finanzen nach innen und außen
6. Richtergesetz und Spezialgerichte
7. Bürgerrecht und Wahlrecht für Latiner und Italiker
8. Erneutes Scheitern
9. Not kennt kein Gebot
VI: DANACH
1. Kampf um Erinnerung und Werk
2. Der Gründungsmythos – Cornelia und ihre Söhne
3. Frauen als politische Macht
4. Das Programm der Gracchen – eine neue Politik
5. Gewalt
VII: INTERPRETATIONEN
ANHANG
GLOSSAR
STAMMTAFEL
ZEITTAFEL
ABKÜRZUNGEN
Antike Autoren
Andere Abkürzungen
QUELLENAUTOREN
ANMERKUNGEN
I. Das Ende
1. Tod auf dem Kapitol
2. Wie konnte es so weit kommen?
3. Familie und Erziehung
4. Tiberius Gracchus und Scipio Aemilianus
II. Die Wende
1. Römische Kriege in Spanien
2. Numantia
3. Streit um den Mancinus-Vertrag
III. Der Anfang
1. Stoisch-Sozialethische Politik in Rom
2. Stoa in Sparta
3. Blossius, der Stoiker, und der Aufstand des Aristonikos
IV. Erfolg und Scheitern
1. Das Programm
2. Bodenreform
3. Die Absetzung des Octavius
4. Das Ende des Scipio Aemilianus
V. Reform der Respublica
1. Der Traum des Caius Gracchus
2. Dolche aufs Forum!
3. Ein institutionelles Schutzkonzept für Bürger
4. Sozial- und Verwaltungsgesetzgebung
5. Neuordnung der Finanzen nach innen und außen
6. Richtergesetz und Spezialgerichte
7. Bürgerrecht und Wahlrecht für Latiner und Italiker
8. Erneutes Scheitern
9. Not kennt kein Gebot
VI. Danach
1. Kampf um Erinnerung und Werk
2. Der Gründungsmythos – Cornelia und ihre Söhne
3. Frauen als politische Macht
4. Das Programm der Gracchen – eine neue Politik
5. Gewalt
VII. Interpretationen
LITERATUR
ABBILDUNGSVERZEICHNIS
BILDNACHWEIS
NAMEN- UND ORTSREGISTER
VORWORT
Das Leben des Brüderpaares Tiberius und Caius Gracchus war kurz, ihr Nachleben lang. Obwohl von Geburt, Herkommen und Erziehung für eine großartige Karriere bestimmt, fanden sie beide einen frühen und tragischen Tod. Ihr Schicksal bedeutete den Anfang vom Ende der römischen Republik. Wie ihre Politik, ihre großen Reformvorhaben und ihr früher Tod zusammenhängen, ist das Thema dieses Buches.
Da das Buch für einen breiten Leserkreis gedacht ist, sind alle griechischen und lateinischen Quellenzitate übersetzt und der Anmerkungsapparat knapp gehalten. Das Literaturverzeichnis und ein ausführliches Glossar ermöglichen weitere Informationen.
Unterstützung habe ich von verschiedenen Seiten erfahren: Sylvia Kurowsky danke ich für wertvolle Korrekturen und die Anfertigung des Registers, Susanne Muth dafür, dass sie zusammen mit ihrem Team Abbildungen eigens für das vorliegende Buch aus dem Kontext ihres Projektes zum Digitalen Forum Romanum angefertigt hat, Andrea Morgan für eine ausgezeichnete Betreuung, Cornelia Horn für eine gelungene Buchgestaltung und Stefan von der Lahr für ein Lektorat, das seinesgleichen sucht. Anregende Gespräche und Diskussionen habe ich mit Brigitte Beyer und Michael Sommer führen können, auch ihnen sei hier gedankt. Schließlich noch der Hinweis, dass selbstverständlich alle Fehler, Provokationen und Mängel in meiner Verantwortung liegen!
Leipzig, im Dezember 2023Charlotte Schubert
Abbildung 2: Italien und der Mittelmeerraum
I
DAS ENDE
1. Tod auf dem Kapitol
Etwas noch nie Dagewesenes ereignete sich:[1] Ehrwürdige Senatoren stürmten durch Rom, aufgepeitscht durch die flammende Rede eines der ihren – Untergang der Respublica, drohende Tyrannenherrschaft, Aufruhr des Volkstribunen – so schallte es durch die Reihen. «Der Konsul verrät die Stadt» und «Der Tyrann muss gestürzt werden!» schrie Scipio Nasica und wie ein wilder Mob folgten ihm seine Standesgenossen. Zwar hatte der Konsul versucht zu beruhigen, hatte in der ihm eigenen Art eines hochgebildeten Juristen erklärt, dass Gewalt keine Lösung sei, dass er gar nicht daran denken würde, gegen einen römischen Bürger ohne Anklage und Prozess vorzugehen. Selbstverständlich jedoch würde er handeln, sollte der Tribun etwas gegen das Gesetz veranlassen: Ungesetzliche Beschlüsse würde er natürlich nicht anerkennen. Doch seine Worte verhallten ungehört in dem allgemeinen Geschrei. Die aufgeputschten Senatoren stießen alles beiseite, was sich ihnen in den Weg stellte. Bänke und Stühle wurden zerschlagen, Holzstücke wurden zu Knütteln und Prügeln, Anwesende, Gaffer, Passanten, Bürger zur Seite gestoßen. Erschrocken und in Panik floh die Menge, während die wutschnaubende Elite Roms auf das Kapitol stürmte.
Das Opfer erwartete sie bereits: Der Volkstribun Tiberius Sempronius Gracchus war schon am Morgen gewarnt worden, als er zu der von ihm einberufenen Volksversammlung auf dem Kapitol aufbrach. An dem Tag wollte er seine Wiederwahl sichern. Doch ein schlechtes Omen ließ bereits heraufziehendes Unheil erahnen: Die heiligen Hühner, deren Orakel vor jeder politischen Entscheidung zu befragen war, wollten nicht fressen. Sie waren partout nicht dazu zu bewegen, sich ihren Körnern zuzuwenden! Der antike Biograph Plutarch (um 45 bis um 125 n. Chr.) beschreibt die Szene:[2] Nur ein Hühnchen zeigte sich, wollte aber auch nicht fressen, vielmehr hob es den linken Flügel, streckte ein Bein aus – und lief zurück in den Käfig. Tiberius, als Augur ein professioneller Zeichendeuter, war ratlos. Er ahnte wohl das Verhängnis, erinnerte sich sogar an Schlangen, die einmal in seinem Helm gebrütet hatten, und stieß sich prompt den Zeh an seiner Türschwelle blutig. Auf dem Weg zum Kapitol fiel ihm dann auch noch ein Stein vor die Füße, der sich beim Kampf zweier Raben von einem Dach gelöst hatte. Für einen besonnenen, gottesfürchtigen Römer sollten das eigentlich genügend Omina gewesen sein, wieder umzukehren! Doch ein Tiberius Gracchus – Sohn des Konsuls und Zensors Tiberius Gracchus, Enkel des großen Scipio Africanus und Anführer der römischen Plebs – ließ sich doch nicht von einem Raben einschüchtern! Würde er sich andernfalls nicht lächerlich machen? Oder seinen Gegnern erst recht Munition liefern? Seine Freunde und Berater überzeugten ihn, die bösen Omina zu ignorieren, und so schritt er mutig einem freudigen Empfang der begeisterten Menge auf dem Kapitol entgegen. Doch scheint ihm der Anblick seiner jubelnden Anhänger zu Kopf gestiegen zu sein und damit nahm die verhängnisvolle Volksversammlung ihren Lauf. Geplant war, dass er sich zur Wiederwahl stellen würde – es wurde seine letzte Volksversammlung. Denn den Gegnern des Tiberius schien es, als habe er, begleitet von stürmischen Anhängern, das Kapitol besetzt – jenen Hügel, der das heilige Zentrum der Stadt Rom symbolisierte.
In der aufgeregten Menge war eine ordentliche Abstimmung unmöglich, so dass der Konsul Mucius die Versammlung abbrechen musste.[3] Gegner und Anhänger des Gracchus rempelten einander an und heizten die Stimmung weiter auf. Es war bekannt, dass die Gegner schon eine bewaffnete Bande in Stellung gebracht hatten, so dass Gracchus und seine Freunde um ihr Leben fürchteten. Was aber würde im Senat passieren? Würden sich die Gegner wirklich nicht scheuen gewalttätig zu werden?
Ein menschlicher Schutzwall bildete sich um Gracchus; die Stäbe der Liktoren, Zeichen der magistratischen Amtsgewalt, wurden zerbrochen, um gegen den befürchteten Angriff wenigstens etwas in der Hand zu haben. Tiberius geriet offenbar in Panik, gestikulierend zeigte er auf seinen Kopf und wollte so seinen Anhängern die ihm drohende Gefahr für Leib und Leben bedeuten. Da tönte es von seinen Gegnern: «Jetzt hat er die Maske fallen gelassen, jetzt will er die Königskrone!» – Dass sich Tiberius Gracchus tatsächlich ein Königsdiadem aufs Haupt setzen wollte, ist indes wenig wahrscheinlich – war er doch ein urrömischer Aristokrat und Volkstribun. Zwar mag die Geste zweideutig geschienen haben. Doch die Lächerlichkeit dieses Vorwurfs scheint in der aufgeladenen, von Lärm, Geschrei und Wut angeheizten Situation niemandem – bis auf den gelassen bleibenden Konsul Mucius – bewusst geworden zu sein.
Und so nahm – wie es die Hühner angezeigt hatten – das Unheil seinen Lauf: Der senatorische Mob erschlug die Männer, die sich schützend um Tiberius Gracchus versammelt hatten. Der Volkstribun selbst versuchte zu fliehen, wurde festgehalten, verlor die Toga und floh in seiner Tunica, vorbei an all den Leichen, bis er selbst zu Boden stürzte. Nun führte den ersten Schlag – mit einem Stuhlbein, wie es bei Plutarch heißt – einer seiner Kollegen im Amt der Tribunen, ein Mann namens Publius Satureus, den zweiten ein gewisser Lucius Rufus. Man hat sich wohl eine Zeit lang solch zweifelhafter Heldentaten gerühmt, so dass uns die Namen derjenigen überliefert sind, die den sakrosankten – durch einen Schwurbund der Plebs als heilig und unverletzlich erklärten – Volkstribunen zu Tode geprügelt haben. Doch wenn nun ein Volkstribun den anderen erschlagen hätte, sollte das heißen, dass ein Unverletzlicher den anderen Unverletzlichen verletzen durfte? Der Historiker Diodor verstieg sich sogar zu der Behauptung, dass der Senator Nasica den Tiberius eigenhändig erschlagen habe![4] Mit Tiberius Gracchus starben 300 seiner Anhänger in diesem Blutbad, alle mit Knüppeln und Steinen erschlagen.[5]
Doch Wut und Hass waren mit Mord und Totschlag noch nicht Genüge getan: Als der jüngere Bruder Caius Gracchus um die Herausgabe des Leichnams des Volkstribunen bat, um ihn begraben zu dürfen, verweigerte man ihm dies. Stattdessen warf man den toten Volkstribunen und die anderen Erschlagenen in den Tiber.[6] Eine schlimmere Schändung des Toten und seiner Reputation ist kaum vorstellbar – war doch gerade das Begräbnis eines römischen Aristokraten für Familie und Klienten ein zentraler Bestandteil ihres symbolischen Kapitals. Bei diesen Gelegenheiten führten die großen Familien die historischen Verdienste ihres Geschlechts noch einmal dem ganzen versammelten römischen Volk vor Augen, indem sie die Totenmasken der bedeutendsten Vertreter ihres Hauses durch die Stadt trugen. Zwar mag Caius selbst wohl kaum solch ein öffentliches Begräbnis mit der Präsentation des Toten in einem Leichenzug, mit Reden und Zurschaustellung der Ahnenmasken im Sinn gehabt haben. Das hätte man ihm in der Situation schwerlich gestattet. Aber selbst die einfachen Bestattungsrituale wie Waschung, Salbung, Aufbahrung und Kremierung zu verweigern, bedeutete für seine Familie eine schier unerträgliche Schmach.
Es scheint, als habe damals für einen Moment in Rom der Ausnahmezustand geherrscht: Einen Volkstribunen und zahlreiche seiner Anhänger, gewiss ebenfalls römische Bürger, zu erschlagen war nicht nur ein unerhörtes Sakrileg. Dies war der größte denkbare Verstoß gegen das Recht eines jeden römischen Bürgers auf ein ordentliches Gerichtsverfahren. Darauf hatte der Konsul Mucius im Senat hingewiesen. In höchstem Maß erstaunlich ist, dass dieser Frevel in der konkreten Situation selbst und auch noch danach so völlig ohne rechtliche Konsequenzen geblieben ist. Es gibt keine plausible Erklärung dafür – außer man geht eben davon aus, dass ein zwar nicht förmlich erklärter, wohl aber kollektiv wahrgenommener Ausnahmezustand eingetreten war.
Eigentlich gab es in Rom für Ausnahmezustände feste Regeln. In solch einer Situation konnte ein Diktator mit unbeschränkten Vollmachten für sechs Monate ernannt werden. Man erwartete, dass er nach Ablauf dieser Zeit sein Amt niederlegte – ein halbes Jahr galt den Römern als ausreichend, um Krisen aller Art im Inneren wie im Äußeren bewältigen zu können. Während dieser Zeit hatte ein Diktator – und nur ein Diktator – das Recht, einen römischen Bürger ohne Gerichtsverhandlung zum Tode zu verurteilen. Doch selbst der Inhaber solch eines Ausnahmeamtes hätte keinen Volkstribunen angreifen dürfen! Übrigens hat sich der griechisch-römische Historiker Appian (etwa 90 bis um 160 n. Chr.), der uns in seiner Geschichte der römischen Bürgerkriege eine knappe Schilderung der Ereignisse überliefert, darüber gewundert, dass man seinerzeit nicht diese ultima ratio wählte und einen Diktator ernannte.[7] Dafür hätte allerdings der Konsul mitspielen müssen. Denn nur der Konsul konnte auf Vorschlag des Senates einen Diktator ernennen und das tat Mucius ganz offensichtlich nicht – gut nachvollziehbar, schließlich war Mucius einer der wichtigsten Ratgeber des Tiberius für das umstrittene Gesetz gewesen, mit dem Tiberius die Politik in Rom durcheinandergewirbelt hatte.[8] Den Dingen ihren Lauf zu lassen und sich darauf zurückzuziehen, dass der Jurist im Konsulat die richtigen Entscheidungen treffen würde, war aber auch keine Option. Wut, ja blindwütiger Hass ließen die Wellen der Empörung gegen den vermeintlichen Tyrannen Tiberius Gracchus im Senat so hochschlagen, dass jede Regelverletzung gerechtfertigt schien. Und die Ermordung eines Volkstribunen unter Verletzung des althergebrachten Provokationsrechtes, das jedem römischen Bürger zumindest einen ordentlichen Prozess vor der etwaigen Verurteilung garantierte, war eine ganz extreme Regelverletzung.
Nasica und die ihm folgenden Senatoren scheinen allerdings angenommen zu haben, dass die Umstände alles rechtfertigten. Sie fühlten sich im Recht, auch wenn es formal nicht so war. Als Nasica zum Sturm auf das Kapitol aufrief, bediente er sich der bei einer Opferhandlung üblichen Zeremonie: Er schürzte die Toga und zog sich den Saum über den Kopf, bevor er aus dem Senat stürmte.[9] Möglicherweise wollte er so, da er gleichzeitig Pontifex Maximus – der ranghöchste Priester – in Rom war, seiner Handlung den Schein religiöser Legitimation verleihen. Mit dem Akt des Verhüllens mochte er wohl den Anschein einer Consecratio erwecken – damit bedeutete er der Öffentlichkeit, dass er seinen Gegner den Göttern der Unterwelt übergab, so dass man ihn straflos töten konnte. Doch das war gegenüber einem Volkstribunen, dessen Körper sakrosankt seit alters war, trotzdem ein Frevel. Man hat das Nasica so auch nicht abgenommen. Selbst ein Pontifex Maximus wie er konnte nicht einfach die Unverletzlichkeit eines Volkstribunen aufheben. Schließlich hatte der Konsul, auch wenn man das geflissentlich ignorierte, sehr klar gesagt, was rechtens war und was nicht!
Der Furor war – wie Plutarch kommentiert – mit der Mordtat an dem Volkstribunen noch nicht an sein Ende gelangt; bewegten sich doch auch die weiteren Aktionen gegen die Anhänger des Tiberius Gracchus nicht wieder in den üblichen Bahnen. Die Glücklicheren unter den Überlebenden konnten in die Verbannung gehen, andere wurden ins Gefängnis geworfen oder sogar hingerichtet. Eine besonders schauerliche Strafe wurde einem gewissen Caius Villius zuteil: Er wurde zu Tode gefoltert in einem Käfig, in den man Nattern und Schlangen hineingeworfen hatte.
Andererseits wissen wir von Verhören, die die Konsuln des folgenden Jahres durchführen sollten, um die Umstände aufzuklären. Dies führte – zumindest in dem einen uns bekannten Fall des Blossius von Cumae (S. 39 f.), einem der wichtigsten Berater aus dem Kreis des Tiberius – zu einem Freispruch, und Blossius konnte Rom unbehelligt verlassen. Die Durchführung der Verhandlung vor dem Tribunal der Konsuln und der Freispruch des Blossius sind so zu verstehen, dass zumindest die Konsuln des Jahres 132 v. Chr. nach den Ereignissen des Vorjahres versucht haben, zu ordentlichen Verfahren zurückzukehren, und sich um eine Art Aufklärung bemühten, wer für die Exzesse verantwortlich war.[10] Eigenartigerweise war in dem Verfahren gegen Blossius der Anführer des mörderischen Mobs – Scipio Nasica – der Ankläger.[11] Blossius ließ sich nicht einschüchtern und stand nach wie vor zu Tiberius Gracchus. Plutarch berichtet, dass Blossius sich dazu bekannte, alles getan zu haben, was Tiberius ihm aufgetragen hatte. Nasica provozierte ihn sogleich mit der Frage: ‹Und wenn er dir befohlen hätte, das Kapitol anzuzünden?› ‹Das hätte Tiberius nie befohlen› – so versuchte Blossius seinen Kopf aus der Schlinge zu ziehen. Nasica und die anderen, die ihn befragten, ließen jedoch nicht locker, und schließlich soll Blossius geantwortet haben: ‹Wenn Tiberius dies befohlen hätte, wäre es meine Pflicht gewesen, dies zu tun, denn er hätte einen solchen Auftrag nie gegeben, wenn es nicht zum Wohl des römischen Volkes gewesen wäre!›[12]
Ein Angriff auf das Kapitol, das Zentrum der Respublica, den heiligsten Ort? Dann also doch Hochverrat? Aber trotz dieses Bekenntnisses zur erklärten Bereitschaft, das Schlimmste aller denkbaren Verbrechen gegen die Respublica zu begehen, ist Blossius freigesprochen worden und konnte Rom verlassen. Entweder hat diese, nicht allein bei Plutarch erhaltene,[13] Szene so nie stattgefunden und ist erst in einer späteren Phase der Gracchen-Rezeption hinzugedichtet worden, oder sie verweist darauf, dass das Bedürfnis nach Aussöhnung oder zumindest Beruhigung der aufgewühlten Stimmung in Rom stärker war als alle Aufklärungs- und Bestrafungsabsicht.
Cicero (106–43 v. Chr.) unterstellt, dass einige der Freunde und Unterstützer des Tiberius nach der Eskalation die Seiten gewechselt haben – offensichtlich, ohne dass sie irgendwelche Konsequenzen zu fürchten hatten. So nennt Cicero auch Quintus Aelius Tubero, den Neffen des Scipio Aemilianus, unter denjenigen, die mit Tiberius zusammengearbeitet haben, sich dann jedoch abwandten und ihm die Freundschaft aufkündigten. Nun stellt Cicero Tuberos Unterstützung und Distanzierung ausschließlich im Kontext von Freundschaft dar, wobei sich die Wendehälse – wenn sie eben ‹nur› Freunde gewesen waren und keine Mitstreiter – damit anscheinend rechtzeitig einer Strafverfolgung entziehen konnten.
Andere Akteure aus dem Kreis des Tiberius Gracchus wie Appius Claudius, Mucius Scaevola, Licinius Crassus Mucianus, Fulvius Flaccus und schließlich Caius Gracchus selbst (der Bruder des ermordeten Volkstribunen), die nach wie vor zu der Sache des Tribunen standen, blieben völlig unbehelligt. Tatsächlich war die gracchische Bewegung nach wie vor stark und waren ihre Protagonisten offenbar nicht angreifbar. Appius Claudius war und blieb bis zu seinem Tod 130 v. Chr. Princeps Senatus, Mucius Scaevola war und blieb 133 v. Chr. Konsul, sein Bruder Licinius Crassus Mucianus wurde 132 v. Chr. als Nachfolger des Nasica zum Pontifex Maximus gewählt und in diesem Jahr auch zum Konsul für 131 v. Chr.[14] Vielleicht gingen die Verantwortlichen für die blutigen Ausschreitungen sogar ein wenig auf die Gegner zu. Scipio Nasica wurde auf eine Mission in den Osten geschickt. Mucius scheint diese Entfernung des Nasica aus Rom und seine Entsendung nach Asien mit einer gewissen Camouflage gemildert zu haben. Zumindest sagt Cicero etwas in der Art, dass Mucius das Handeln des Nasica entschuldigt habe.[15] Es ist kaum vorstellbar, dass der Jurist, der kurz zuvor noch die Notwendigkeit der Gesetzestreue betont hatte, im Folgenden das Gegenteil vertreten hätte – wahrscheinlich kommt in diesem Zusammenhang eher Ciceros Wunschdenken in eigener Sache zum Ausdruck. Schließlich stand bei ihm stets im Hintergrund der Versuch, seine eigene Rechtsbeugung – die von ihm ohne Anklage und Gerichtsverhandlung veranlasste Hinrichtung der Catilinarier – zu legitimieren. Mit diesem Akt sollte er selbst, gute 70 Jahre später, sich in die heillose Tradition der Untaten des Scipio Nasica und einiger seiner Weggefährten stellen. Aber immerhin gibt Cicero zu, dass Mucius in den Jahren nach dem Tod des Tiberius einer der Führer der Bewegung blieb, gegen die Nasica mit seiner Lynchjustiz angetreten war.[16] Indes bleibt festzuhalten, dass die prominentesten Mitstreiter des ermordeten Volkstribunen ganz unbehelligt weiter in ihren Ämtern blieben und ihre Karrieren fortsetzen konnten.
Auch das Herzstück der gracchischen Gesetzgebung, die Bodenreformkommission, die auf der Grundlage des Gesetzes arbeitete, mit dem Tiberius Land in Italien zu verteilen beabsichtigt hatte, konnte ihre Tätigkeit fortführen. Ihre Mitglieder waren Caius Gracchus, der Bruder des Tiberius, Appius Claudius, Tiberius’ Schwiegervater, sowie Licinius Crassus Mucianus, designierter Konsul, neuer Pontifex Maximus und bald darauf auch Schwiegervater des Caius Gracchus![17] War das, was geschehen war, nur der Ausdruck eines chaotischen Ausnahmezustands, hervorgerufen durch einen irrationalen Augenblick des Furors – beispiellos und singulär? Oder war es der Beginn eines neuen Kapitels in der Geschichte der römischen Republik – der Anfang vom Ende, das mit dem Prinzipat des Augustus in die Kaiserzeit münden würde? Diese Dichotomie ist zu schlicht. Das Jahr 133 v. Chr. war nicht einfach nur ein Jahr des Aufruhrs, in dem etwas geschah, was es in dieser Art vorher noch nie in Rom gegeben hatte. War es doch vor allem ein Jahr, in dem eines der grundstürzenden Gesetze in der Geschichte der römischen Republik in Kraft trat: ein Bodenreformgesetz, das seinem Umfang nach zum damaligen Zeitpunkt seinesgleichen suchte. Auch stand dahinter nicht ein einzelner Mann mit einer Schar namenloser Anhänger, der in diesem Jahr zufällig Volkstribun war. Vielmehr war es eine Gruppe von Politikern ganz unterschiedlicher Couleur, die mit ihm zusammengearbeitet hatten. Sie bildeten freilich keinen Verbund, der es erlaubte, in ihnen so etwas wie eine Partei mit einem klar umrissenen Anliegen zu sehen. Doch immerhin ein gemeinsames Ziel hatten sie durchaus, und dieses Ziel haben sie auch nach dem Tod ihres Protagonisten weiterverfolgt. Das Bodenreformgesetz war darauf angelegt, Land in Rom und Italien neu zu verteilen; es ist allerdings nur der markanteste Ausdruck der Politik, für die viele eintraten: an der Spitze der Volkstribun Tiberius Gracchus, neben ihm der Princeps Senatus Appius Claudius, die Juristen, seine anderen Unterstützer und vor allem sein jüngerer Bruder Caius Gracchus, der zehn Jahre nach seinem älteren Bruder die politische Bühne in Rom betreten sollte. Ihnen allen ging es um eine andere Vorstellung vom Wohl der römischen Respublica. Die Werte, für die sie eintraten und die die Gesetze, die Reformen sowie die Rechtsprechung aller dieser Personen prägten,[18] waren solche eines Gemeinwohls, das den Anspruch des moralisch guten Handelns im Sinne der Allgemeinheit in den Vordergrund rückte und deren Vorkämpfer darin den Nutzen für die ganze Respublica erkannten.[19]
2. Wie konnte es so weit kommen?
Formal hatte man in Rom die Krise des Jahres 133 v. Chr. durch die Wahlen der neuen Magistrate und die gerichtlichen Anhörungen bewältigt. Der ganze Zeitablauf ist allerdings nicht genau zu rekonstruieren, da viele Einzelheiten unbekannt sind oder von späteren Anekdoten und Umformungen der Historiker bzw. durch interessengeleitete Darstellungen überlagert werden. So anschaulich die Schilderungen Plutarchs sind – und die hier präsentierte Todesszenerie beruht im Wesentlichen auf seinem Lebensbild des Tiberius Gracchus –, so bleibt dennoch vieles unklar. Wie war es zum Beispiel möglich, dass Caius die Herausgabe des Leichnams für eine Bestattung verlangen konnte, wenn er eigentlich als Militärtribun im Heer des Scipio Aemilianus vor Numantia im weit entfernten Spanien diente?[1] Natürlich gelangten die Nachrichten auch nach Spanien, aber – selbst wenn man einmal annimmt, Caius habe die Erlaubnis zur Rückkehr nach Rom erhalten – die erforderliche Reisezeit und die Aufbahrung eines Leichnams in der sommerlichen Hitze Italiens passen einfach nicht zusammen. Und wieso musste Scipio Nasica, nachdem er bei den Verhören und Anhörungen 132 v. Chr. noch das große Wort führte, sich im gleichen Jahr aus Rom absetzen und nach Asien aufbrechen? Hatte er nicht gerade die Republik gerettet? War ihm nicht eine sicher beträchtliche Zahl der Senatoren bereitwillig auf das Kapitol gefolgt und hatte sich an der Schlächterei beteiligt? Und schließlich war er Pontifex Maximus, also Oberpriester der Republik und qua Amt zur Präsenz in Rom und Italien verpflichtet. Als solcher hatte er die Aufsicht über alle sakralen Handlungen der Republik und ihren regulären Vollzug sicherzustellen; zudem kontrollierte er die Vestalinnen, amtierte in der altehrwürdigen Regia auf dem Forum und sollte seinen Einfluss auf vielfältige Weise geltend machen. So war er Herr des römischen Kalenders und hatte die Termine für sakrale und weltliche, insbesondere für die politisch bedeutenden Tage (etwa Wahltermine) zu steuern. Wieso schickte man so einen wichtigen Amtsträger weg, nahm ihn gleichsam aus der Schusslinie? Und wie konnte es sein, dass man kurze Zeit später, als Nasica im Osten den Tod gefunden hatte, mit Licinius Crassus Mucianus einen der engsten Weggefährten des ermordeten Tribunen zum Nachfolger des Nasica als Pontifex Maximus wählte?
Allen in Rom war bewusst, wie tief die Krise reichte, wie nah unter der Oberfläche der Furor noch lauerte und dass die mörderische Tat der Senatoren einen Gesetzesbruch darstellte. Selbst Cicero, der immer wieder versucht hat, die Ermordung des Tribunen als gerechtfertigt darzustellen, war sich des Sakrilegs bewusst. In einer seiner Reden gegen den korrupten sizilianischen Praetor Verres behauptet er, dass man nach der Bluttat die Sibyllinischen Bücher zurate gezogen habe, um nach einer Reinigungszeremonie zu suchen.[2] Dort habe man gefunden, dass man zur Entsühnung der Stadt die älteste Ceres in Sizilien zufriedenstellen müsse. Das ist eine reine Erfindung Ciceros, denn wie sollte eine unter Ausschluss der Öffentlichkeit im entfernten Sizilien durchgeführte Reinigungs- oder Opferzeremonie das Geschehen in Rom selbst irgendwie beeinflussen? Auch wenn sich der Senat dies als Geste dem Volk gegenüber ausgedacht hätte, wäre es reichlich sinnlos gewesen. Aber zu Zeiten Ciceros, mehr als ein halbes Jahrhundert später, nahm man es nicht mehr so genau mit dem Ablauf der Ereignisse.
In der stadtrömischen Öffentlichkeit hieß es nach dem Tod des Tiberius, Nasica sei der Tyrann gewesen, da er die dem Volk heilige Unverletzlichkeit des Volkstribunen missachtet habe. Also musste nun der Oberpriester die Stadt verlassen, vorgeblich, um an einer Kommission mitzuwirken, die die Provinz Asia neu ordnen sollte.[3] Das erzwungene Exil – und nichts anderes war es, wenn man bedenkt, dass der Oberpriester in Rom eigentlich unabkömmlich war – muss Nasica hart angekommen sein. Er starb noch im gleichen Jahr in Pergamon.[4]
Trotzdem war die Plebs in Rom nach wie vor aufgebracht, und selbst der eigentlich unantastbare Scipio Aemilianus, der Sieger über Karthago, wurde Opfer der plebeischen Agitation. Er hatte den Fehler gemacht, sich anscheinend schon während der Belagerung von Numantia im spanischen Feldzug abfällig über seinen tribunizischen Vetter Tiberius zu äußern. Er soll, als die Nachricht von den Ereignissen eintraf, Homer zitiert haben: «So verderbe ein jeder, der solche Taten verübt hat.»[5] In Rom ließen sich die Anhänger des Tiberius die Gelegenheit nicht entgehen, Scipio in die Enge zu treiben und zu demütigen. Sie stellten den erfolgreichen Feldherrn – der immerhin für seine Siege in Spanien und dafür, dass er das widerständige Numantia dem Erdboden gleichgemacht hatte, gerade einen überwältigenden Triumph gefeiert hatte – derart bloß (S. 52), dass seine Popularität drastisch sank. Wir wissen nicht, ob er verweigert hatte, sich zu den Anliegen der Plebs zu bekennen, oder ob man ihn zu einer Kritik an dem Gemetzel auf dem Kapitol herausforderte. Jedenfalls muss seine Antwort undeutlich, vielleicht auch provozierend ausgefallen sein. In der Folge stieß Scipio Aemilianus – obwohl nicht nur als Africanus, sondern gerade ebenso als Numantinus geehrt – auf Ablehnung im Volk. Wie man sich das im Detail vorzustellen hat, ist aufgrund der fragmentarischen Überlieferung schwer auszumachen. In Rom waren Schmähungen übelster Art, durchaus auch sexuell aufgeladen, Teil der täglichen Auseinandersetzungen. So etwas wie ‹peni deditos (esse)› (‹dem Schwanz ergeben sein›) gehörte zu dieser Zeit wohl nicht zu den ärgsten Beschimpfungen.[6] Aber wenn Verunglimpfungen dieser Art gegen den Sieger über Karthago und Numantia im Umlauf gewesen sein sollten, ist es nachvollziehbar, dass der stolze Mann sich vom Volk gekränkt fühlte.
Plutarch selbst urteilt vernichtend über Scipio Aemilianus: Anders als etwa der Feldherr Lucullus (117–56 v. Chr.) habe er den Moment des rechtzeitigen Rückzugs verpasst, um in Ehre und Frieden seinen Ruhm zu genießen.[7] Plutarch war sich bewusst, dass er mit einer zeitlichen Distanz von mehr als 200 Jahren über die Ereignisse berichtete – und so äußert er immer wieder, dass er viele Quellen (vermutlich zeitgenössische oder zeitnahe zum Geschehen) zurate gezogen habe; auch stellt er durchaus Vergleiche an und betont in der Regel bei Widersprüchen, dass er sich ‹den meisten› angeschlossen habe.[8] Aber immerhin berichtet auch Appian, dass Scipio das Wohlwollen des römischen Volks verloren habe, weil er sich nicht für das Bodenreformgesetz einsetzen wollte.[9]
Legitimationsversuche
Tiberius’ Gracchus jüngerer Bruder Caius hat nach dem Tod des Älteren eine Sammlung von dessen Reden herausgebracht – ein Werk, das noch bis in die Kaiserzeit verfügbar war und ganz sicher wesentlich zur Formung der Überlieferung beigetragen hat, und zwar gewiss aus der Sicht des Nachfolgers auf den verehrten Ermordeten.[10] Die reichen Werke anderer Zeitzeugen sind uns nicht erhalten.[11] Aber interessanterweise hat Lucius Calpurnius Piso Frugi, der zusammen mit Mucius Scaevola im Krisenjahr 133 v. Chr. Konsul war, ein Geschichtswerk verfasst. Ob er in Rom während der Ermordung des Tiberius zugegen war, ist nicht bekannt – vermutlich wohl eher nicht, da er einen Sklavenaufstand in Sizilien niederzuschlagen hatte. Andererseits war er Konsul in dem Jahr des Ereignisses, also viel näher am Geschehen als alle anderen unserer Gewährsmänner. Ein Jahrzehnt nach 133 v. Chr. nennt ihn Caius Gracchus seinen inimicus[12] – also seinen Feind. Piso Frugi bekämpfte die Getreidegesetze des Caius – ein ureigenstes Vorhaben des Caius zur Sicherstellung der täglichen Versorgung der Plebs –, war zu dieser Zeit also ganz sicher ein Gegner der gracchischen Politik.
Aus den spärlichen Fragmenten seines Geschichtswerks lässt sich nun eine Deutung der Ereignisse rekonstruieren, die in ihrer Rückspiegelung auf die Vergangenheit eine klare Aussage präsentiert.[13] Dionysios von Halikarnass, dem wir eine in augusteischer Zeit geschriebene Römische Geschichte verdanken, berichtet, dass Piso Frugi die legendenumrankte Ermordung des Spurius Maelius durch C. Servilius Ahala im Gegensatz zur sonstigen Überlieferung als eine Tyrannentötung ohne Prozess und Urteil beschrieben habe:[14] Spurius Maelius, ein reicher Plebeier, hatte sich durch die Ausgabe von verbilligtem Getreide während einer Notsituation im Rom des Jahres 439 v. Chr. beim Volk Beliebtheit und Anhängerschaft erworben. Er soll begierig nach der Königskrone gewesen sein, woraufhin – folgt man der communis opinio der römischen Überlieferung – der Senat einen Diktator ernannte. Dessen Magister Equitum Servilius Ahala, eine Art Reiteroberst, habe den Tyrannisaspiranten dann getötet, nachdem jener sich weigerte, einer Vorladung des Senates zu folgen. Anders hört sich die Geschichte bei Lucius Calpurnius Piso Frugi an: Weder gibt es bei ihm einen Diktator noch einen Magister Equitum, vielmehr hat sich der Senat schlicht einen kräftigen jungen Mann gesucht, der den aufrührerischen Emporkömmling beseitigen sollte, und so geschah es. Im Unterschied zu dem Tumult und dem Sturm des senatorischen Schlägertrupps 133 v. Chr. soll im 5. Jahrhundert v. Chr. der Senat wegen Spurius Maelius in aller Ruhe diskutiert haben, wie man das Provokationsrecht (das Recht jedes römischen Bürgers, bei drohender Kapitalstrafe das Volk zur Entscheidung über seine Sache anzurufen) übergehen könne; das scheint freilich kaum glaubhaft, aber immerhin ein plausibler Versuch, durch Setzung eines historischen Vorbildes, eines guten Beispiels (exemplum bonum), den Gewaltexzess im Notstand zu legitimieren. Vor allem der Aspekt der «ruhigen Beratung» ist interessant: keine Hektik, keine Aufregung, kein senatorischer Flashmob, sondern eine gemessene, würdige Szene des souveränen Senats! Auf diese Weise wird dem Leser suggeriert, dass sich der Senat von der Gefahr nicht hat irritieren lassen, sondern planvoll und zielgerichtet vorging. Das Exemplum bei Calpurnius Piso Frugi bezieht sich jedoch nicht auf einen Volkstribunen, sondern auf einen arroganten Emporkömmling ohne Amt. Mithin kann Tiberius Gracchus gar nicht als «Folie» für diesen Vergleich gedient haben. Der Verweis auf die Abgabe von verbilligtem Getreide zeigt vielmehr, dass dessen Bruder, Caius Gracchus, gemeint gewesen sein muss: Ist doch von ihm bekannt, dass er genau dies veranlasst hat – ein Gesetz zur Abgabe von verbilligtem Getreide an Bürger der Stadt Rom. Piso war ein erklärter Gegner dieses Gesetzes (S. 165). Und Caius Gracchus war zum Zeitpunkt seiner Ermordung 121 v. Chr. (wie der notorische Maelius 300 Jahre zuvor) ohne Amt. Jedoch ist auch Caius nicht durch eine geplante und zielgerichtete Aktion des ehrwürdigen Ratsgremiums zu Tode gekommen, sondern aufgrund eines Senatsbeschlusses, den der amtierende Konsul für ein blutiges Massaker in der Stadt Rom nutzte. Selbstverständlich blieb das Vorgehen des Konsuls 121 v. Chr. ein Gewaltakt – Senatsbeschluss hin oder her –, und würdevoll, ruhig oder gemessen war nichts an diesen Ereignissen. So ist die Absicht des Historikers Piso Frugi, ein unerträgliches Geschehen seiner eigenen Zeit durch eine legitimierende Tradition der Vorfahren halbwegs akzeptabel erscheinen zu lassen, unübersehbar.
Ganz anders findet sich die Geschichte von Spurius Maelius und Servilius Ahala bei Livius: Der Senat ist 439 v. Chr. eher ratlos; es heißt, man brauche einen Mann, der «frei und losgelöst von den Fesseln der Gesetze» handeln würde.[15] Dann ernennt man einen Diktator. In diesem Fall erscheint die Diktatur als Instrument, im innenpolitischen Kampf eine gewalttätige Auseinandersetzung zu führen. Tatsächlich war das aber eine Entwicklung, die erst durch den Diktator Sulla im 1. Jahrhundert v. Chr. einsetzte.
Es ist interessant zu beobachten, wie sich der Umgang mit dem Notstand in der Folge der Ereignisse von 133 und 121 v. Chr. entwickelt hat. Denn das Provokationsrecht, das einen römischen Bürger vor solchen Gewaltakten schützen sollte, galt seit dem Zwölftafelgesetz aus dem 5. Jahrhundert v. Chr. als fester Bestandteil der römischen Rechtstradition «über das Haupt eines Bürgers sollen sie keinen Vorschlag als durch die höchste Volksversammlung» beschließen – so überliefert Cicero die Bestimmung auf der neunten Tafel, die er entsprechend kommentiert: «Dann sind zwei ganz ausgezeichnete Gesetze aus den Zwölftafeln überliefert, … das andere verbietet, dass über das Haupt eines Bürgers ein Vorschlag eingebracht wird außer in der höchsten Volksversammlung.»[16] Das heißt, es war grundsätzlich in Rom nicht erlaubt, einen römischen Bürger ohne Beschluss der Volksversammlung, d.h. ohne Prozess, zu töten.
Piso hat in seiner Version der Ereignisse von 439 v. Chr. Verschiedenes zusammengemischt: Das eine Element ist die Tötung unter Verstoß gegen das Provokationsgesetz durch einen Privatmann – das ist die Geschichte von Scipio Nasica, der 133 v. Chr. den Furor entfesselt hatte, der zur Ermordung des Tiberius Gracchus geführt hat. Das andere Element ist der Auslöser der Ereignisse, und zwar die Abgabe verbilligten Getreides – das ist die Geschichte von Caius Gracchus, der als Tribun 123 v. Chr. dieses Gesetz auf den Weg gebracht hat. Als drittes Element kommt schließlich die Legitimierung der blutigen Aktionen durch einen Senatsbeschluss hinzu; diesen steuerte in Rom 121 v. Chr. gegen den Privatmann Caius Gracchus ein amtierender Konsul.
Noch ein anderer römischer Historiker, Cincius Alimentus, hatte die außergesetzliche Tötung des Spurius Maelius wohl schon behauptet;[17] er schrieb allerdings eine Generation vor Piso Frugi – mithin konnte er kaum die Ermordung des Tiberius durch die senatorische Bande des Scipio Nasica im Jahre 133 v. Chr. oder den Tod des Caius Gracchus während des Aufruhrs von 121 v. Chr. vor Augen gehabt haben.
Lucius Calpurnius Piso Frugi hat also versucht, über eine historiographische Konstruktion eine legitimierende Legende für die Aktionen des Senates im Jahr 121 v. Chr. zu stricken. Die Tötungen der Gracchen wurden in ein Vorgehen des Senates eingeordnet, das seine Legitimität aus der Tradition der römischen Geschichte beziehen sollte.
Es sollte nicht bei diesem einen Versuch bleiben. Jahrzehnte später wählte Cicero die gleiche Strategie, als er in seinem eigenen Interesse die Hinrichtung der Catilinarier zu rechtfertigen hatte, die gleichfalls ohne Prozess getötet worden waren. Sein schriftstellerisches Husarenstück gipfelt darin, dass er eine Zustimmung des Konsuls Mucius zu dem Aufruf Nasicas im Senat nicht nur implizierte, sondern sogar behauptete, der Konsul habe das Vorgehen Nasicas als optimo iure vollzogen bezeichnet![18] Damit wollte er insinuieren, dass der Anführer der Ermordung des Tiberius, Scipio Nasica, sich nicht nur auf dem Boden des Gesetzes befand, sondern sogar mit vollem, bestem Recht handelte. Das aber dürfte mit Sicherheit eine spätere Zutat gewesen sein, da der Konsul Mucius bekanntlich ein enger Mitstreiter des Tiberius Gracchus war.
Dieser Bogen von Piso Frugi bis zu Cicero und Livius – gewissermaßen von der Historiographie zur juristischen Fiktion – hat in Rom ein schönes Etikett bekommen. Nachdem sich nach dem Tribunat des jüngeren Caius Gracchus 121 v. Chr. die Ereignisse von 133 v. Chr. zu wiederholen drohten, formalisierte man im Senat den Ablauf und nannte das Verfahren Senatus Consultum Ultimum (die Verkündung des Staatsnotstands). Der Schlüsselsatz hieß von nun an:[19] ut … consul videret, ne quid res publica detrimenti caperet – dass der Konsul zusehen möge, dass die Respublica keinen Schaden nehme! Dies als Antrag im Senat gestellt, sollte die Konsuln ermächtigen, gegen Aktionen und Akteure vorzugehen, wenn ein ordentliches Verfahren unter Beachtung der Provokationsgesetze nicht möglich schien. Wie die weiteren Ereignisse zeigen sollten, war und blieb das Senatus Consultum Ultimum umstritten, gewann jedenfalls nie den Rang der angestrebten rechtlichen Legitimation (S. 190 ff.). Alle, die im Lauf der folgenden 70 Jahre unter dem Schutz eines Senatus Consultum Ultimum gegen Gegner vorgingen, mussten sich im Nachhinein einem Prozess stellen – und einige von ihnen wurden verurteilt: So wurde der Konsular Opimius 120 v. Chr. wegen Ermordung des Caius Gracchus angeklagt, allerdings freigesprochen, während Cicero wegen der Hinrichtung der Catilinarier verurteilt wurde.[20] Der Freispruch half Opimius wenig, denn kurze Zeit danach wurde er wegen Korruption verurteilt. Mindestens 14mal machte man noch bis zum Ende der Republik von dem Senatus Consultum Ultimum Gebrauch[21] – dennoch blieb es immer umstritten. Es ist seinen Vorkämpfern also nicht gelungen, damit ein wirklich tragfähiges legitimierendes Verfahren zu begründen. Vielmehr blieb es ein reines Machtinstrument der herrschenden Elite im Senat.
Doch wie hatte es überhaupt so weit kommen können? Wie wurde aus Tiberius Gracchus, Spross einer der angesehensten Familien Roms, der am Beginn einer glanzvollen Karriere stand, ein Mann, den man brutal erschlagen und dann voll Hass und Verachtung in den Tiber geworfen hat? Wie kam es, dass man wider alles Recht einen sakrosankten Volkstribunen ermordete? Und welche Verstrickungen führten dazu, dass dem jüngeren Bruder des Toten zehn Jahre später das gleiche Schicksal widerfuhr?
Nicht zuletzt stellt sich die Frage, ob die Ereignisse von 133 v. Chr., die gleichsam den Anfang vom Ende der römischen Republik markierten, Symptome oder Ursache des fatalen Prozesses waren? Waren sie Symptome, so gilt es eine größere, schon länger andauernde Entwicklung offenzulegen. Waren sie Ursache, dann hat die Eskalation dieses Jahres einen solch tiefen Riss in der Bürgerschaft verursacht, dass dieser nicht mehr geheilt oder überdeckt werden konnte. Für beide Deutungen lassen sich Argumente finden, Kontexte beschreiben und historische Plausibilisierungen herausarbeiten.
Fasst man Tiberius Gracchus ins Auge, dann zeigt sich ein Kreis von Personen, die in unterschiedlicher Intensität agierten und mit ganz unterschiedlichen Profilen aus der Überlieferung heraustreten; doch eine Gemeinsamkeit ist klar erkennbar: Sie alle waren – in je unterschiedlichem Maße und auf verschiedene Art und Weise – beeinflusst von einem durch und durch griechischen Konzept des Gemeinwohls. Welche Brisanz dieses Konzept in der römischen Republik entfaltete, offenbart sich auf den ersten Blick durch die Ereignisse, welche die Tribunatsjahre der Brüder Gracchus, 133 und 123/22 v. Chr., begleiteten, und natürlich nicht zuletzt an ihrem brutalen Ende. Es ist nicht müßig, darüber zu spekulieren, ob den Akteuren die Tragweite ihrer Absichten und Handlungen bewusst gewesen ist. Spätere – Politiker wie Cicero, Historiker wie Dionysios von Halikarnass und Livius – haben das Tribunatsjahr des Tiberius Gracchus als Einschnitt wahrgenommen. Aber schon der Zeitgenosse Calpurnius Piso Frugi hat mit seiner Version gezeigt, dass ihm die grundstürzende Bedeutung des Konfliktes sehr wohl bewusst war. Er entwirft nicht von ungefähr ein Bild, in dem er das ruhige und überlegte Handeln des Senates dem eines aufrührerischen jungen Mannes gegenüberstellt.[22] Im Ergebnis wird die Gefahr für die innere Ordnung durch die Staatsmacht beseitigt, der verdächtige Einzelne von den funktionierenden Institutionen eliminiert.[23] Die Fiktion ist sowohl eine historiographische (durch Schaffung einer historischen Tradition) wie auch eine juristisch-institutionelle (durch Schaffung des Senatsbeschlusses).[24] Zumindest seit 121 v. Chr., als erstmals der Senatsbeschluss als Senatus Consultum Ultimum gefasst wird, ist deutlich, dass man keine Ad-hoc-Reaktion beabsichtigte, sondern eine grundsätzliche und langfristige Entwicklung zur Stärkung des Senats und seiner Kompetenzen beabsichtigte. Doch der Versuch, die Rolle des Senats institutionell zu stärken, ihm das entscheidende Gewicht zu geben, blieb auf Dauer erfolglos; es fehlte die Überzeugungskraft, um in der Öffentlichkeit der Stadt Rom dieser Position ein stabiles Fundament zu legen. Ebenso wenig war der anderen Seite, ihren Protagonisten in Gestalt der Gracchen und ihren auf eine gemeinwohlorientierte Politik ausgerichteten Gesetzen dauerhafter Erfolg beschieden.
Die Respublica wurde nicht stabilisiert, sondern im Gegenteil, sie geriet ins Schlingern.
3. Familie und Erziehung
Taten und Ruhm des Vaters werden für Tiberius und seinen Bruder Caius nach traditionellen römischen Vorstellungen prägend, seine Persönlichkeit das große Vorbild gewesen sein, dem sie nachzueifern hatten. Dem Vater Tiberius Sempronius Gracchus war in der Tat eine ganz außerordentliche Karriere gelungen: erfolgreiche Feldzüge in Makedonien, Spanien und Sardinien, ein Triumph, Konsulat, Zensur und ein zweites Konsulat. Zudem führte er mehrere Gesandtschaften in den Osten in die Reiche Pergamon, Kappadokien und Syrien, in deren Verlauf er so viel an Kontakten und Klientelbeziehungen knüpfen konnte, dass er zweifellos als einer der einflussreichsten römischen Politiker gelten konnte.[1]
Wie stark dieser – in damaliger Sicht – wahrhaft global agierende Politiker praktisch in die Erziehung seiner Söhne eingebunden war, ist schwer zu sagen, zumal vor dem Hintergrund seiner Abwesenheit aus Rom über viele Jahre hinweg. Wir können folglich davon ausgehen, dass die Erziehung eher in der Hand der Mutter Cornelia lag. Für die römische Nobilität war der Wettbewerb um Ehre und Reputation, deren Ausdruck die Ämter und Positionen waren, zentral: Nicht nur die Familientradition wurde so konstituiert, sondern der gesamte politische Prozess basierte auf diesem agonalen Prinzip. Höchste Ämter waren eine begehrte Ressource für Macht und Ansehen; und so wetteiferten die Eliten um den Zugang und stritten darum, sie zu erlangen – ein Wettstreit, der bis um den Preis der Existenz geführt wurde. Diese Ressource bildete gleichzeitig das Räderwerk der Respublica, seine Ausprägung erfuhr gerade während der Karriere des Tiberius Sempronius Gracchus eine strukturelle Formalisierung. Man legte Abfolge und Hierarchie fest, wie man für die senatorischen Ämter kandidieren konnte: Seit der Lex Villia Annalis von 180 v. Chr. waren Mindestalter, Voraussetzungen wie der zehnjährige Militärdienst, ein bestimmter Abstand zwischen den Kandidaturen und vor allem die Ämtersukzession definiert.[2] Erst seit damals gab es die feste Reihenfolge von den niederen (Quaestur, Aedilität/Volkstribunat) zu den hohen Magistraturen (Praetur, Konsulat). Zugleich schloss sich damals der Kreis jener Familien, die überhaupt noch einen legitimierten Anspruch auf das Konsulat erheben konnten – legitimiert durch Herkommen und Leistung ihrer Vorfahren. Die Konkurrenz wurde dadurch jedoch nicht etwa gemildert, sondern weiter verschärft, da, von einigen Ausnahmen abgesehen, praktisch nur noch Kandidaten für das Konsulat infrage kamen, deren Vorfahren in nicht allzu ferner Vergangenheit ebenfalls schon Konsuln gewesen waren.[3]
Mag diese Entwicklung die überwiegende Mehrheit der vielversprechenden, jungen Römer aus besseren Familien ausgeschlossen haben, so galt das nicht für den jungen Tiberius Sempronius Gracchus, der 133 v. Chr. Volkstribun wurde. Sein Anspruch war ihm durch die Karriere seines Vaters in die Wiege gelegt – Reichtum, Freunde, Klientelbeziehungen inbegriffen.
Der Vater Tiberius Gracchus
Interessant für die Einschätzung dieses familiären Hintergrundes sind vor allem die Beziehungen des Vaters – im Weiteren: des älteren Tiberius Gracchus – zu den Scipionen, seine erfolgreich geführten Kriege in Spanien, seine Verbindungen nach Griechenland und in den Osten sowie die Tatsache, dass er 169 v. Chr. das Amt des Zensors innehatte. Während sein Verhältnis zu den Scipionen eine ambivalente Beziehung gewesen zu sein scheint, die in ihren Höhen und Tiefen unmittelbar näher zu betrachten sich lohnt, sollten seine Unternehmungen in Spanien, Griechenland und dem griechischen Osten im Kontext der biographischen Stationen seines Sohnes gesehen werden und daher einer späteren Betrachtung vorbehalten bleiben.
Die ersten militärischen Sporen hat sich der Vater Tiberius Sempronius Gracchus 190 v. Chr. in Makedonien verdient.[4] In beeindruckender Schnelligkeit hat er für die Scipionen die Zuverlässigkeit Philipps von Makedonien überprüft. Gleichwohl schreibt Livius anlässlich des darauf folgenden Volkstribunates des Tiberius 187 v. Chr., dass dieser sich in inimicitia – also erklärter Gegnerschaft – zu dem berühmten Scipio Africanus maior, dem Sieger von Zama und dem Bezwinger Hannibals, befunden habe. Wir wissen leider nicht, was der Grund dieser Feindschaft gewesen ist, Tiberius scheint sich ihrer aber recht schnell entledigt zu haben. Denn als im Verlauf der sogenannten Scipionenprozesse, in denen es um Betrugsvorwürfe gegen Lucius Scipio ging, sogar Scipio Africanus maior in den Strudel hineingezogen wurde, lässt Livius den Vater Gracchus eine leidenschaftliche Rede für den Africanus halten. Deren Wortlaut spiegelt die Koordinaten von Verdienst, Ehre und Ansehen im Selbstverständnis der römischen Elite – von Feindschaft ist hier nichts mehr zu spüren:
«Wird Scipio, jener Eroberer Afrikas, zu euren Füßen stehen, ihr Tribunen? Besiegte er deswegen in Spanien vier sehr berühmte Anführer der Punier und vernichtete und vertrieb vier Armeen, nahm Syphax gefangen, besiegte Hannibal, machte Karthago tributpflichtig für uns, drängte Antiochus – denn sein Bruder Lucius Scipio teilte als sein Partner die Ehre mit ihm – über die Taurushöhen zurück, um den beiden Petilliern zu unterliegen? Wollt ihr etwa den Siegeskranz von Africanus zurückfordern? Werden diese berühmten Männer aufgrund ihrer Verdienste und der ihnen erwiesenen Ehrungen jemals in ein sicheres und unantastbares Bollwerk gelangen, in dem, wenn nicht verehrenswertes, zumindest unversehrtes Alter möglich sein wird?»[5]
Damit hat der ältere Tiberius offensichtlich das Volk für den Helden eingenommen; die Versammlung wurde aufgelöst, und im Senat war man unendlich dankbar dafür, dass er Scipio Africanus vor einem demütigenden Prozess und einem möglichen Exil gerettet hatte.[6] Gleichwohl schreibt Livius, dass sich der Africanus aus Rom zurückzog und sogar bestimmte, dass er in der undankbaren Vaterstadt nicht begraben werden wollte![7] Doch nach dem Tod des Africanus wurde der Streit mit unverminderter Heftigkeit fortgesetzt, diesmal mitbefeuert von Marcus Porcius Cato, später ‹der Zensor› genannt. In den Augen des Livius war das ganz unerhört, denn für ihn war Catos Verhalten schiere Kläfferei gegenüber jedweder Großartigkeit, während die Gegner den Scipionen ein regnum – Streben nach Königsherrschaft – vorwarfen.[8] Dieser Vorwurf – selbst wenn man ihn im aufgehetzten Alltag der römischen Innenpolitik vielleicht nicht unbedingt mit Substanz verband –, war doch nicht ungefährlich und sollte später, wie wir bereits gesehen haben, für den Sohn des Tiberius Sempronius Gracchus mit dem Tod enden. Der Vater hingegen hatte sich in dieser gefährlichen Konfrontation klar positioniert und trat, so jedenfalls die bei Livius referierte Überlieferung, auch nach dem Tod des Africanus zugunsten der Scipionen auf.
In dem Prozess gegen Lucius Scipio, den Bruder des großen Africanus – der tatsächlich angeklagt wurde, vom seleukidischen König für einen milden Friedensschluss Geld genommen zu haben, und zu einer Geldbuße verurteilt wurde –, soll der ältere Tiberius als Tribun gegen das gesamte restliche Tribunenkollegium auf eine Art Kompromiss gedrungen haben. Ihm sei es zu verdanken gewesen, dass Lucius Scipio nicht ins Gefängnis abgeführt wurde und dort zwischen Räubern und Dieben sein weiteres Dasein hätte fristen müssen.[9]