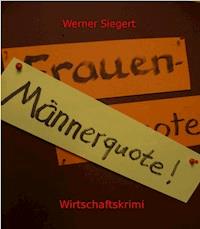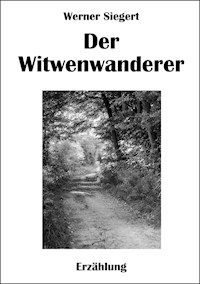Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: neobooks
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Dr. Hans Temme, Werbekaufmann, 47, leistet sich den kleinen Luxus, in einer alten Burg im Rupertiwinkel, nahe Laufen an der Salzach, ein Appartement anzumieten, als Rückzugsort, zum Malen, Meditieren, Faulenzen. Völlig überraschend besucht ihn dort eine junge Frau. Sie redet ihn vertraut mit Vornamen an. Er vermag sich nur schemenhaft zu erinnern. In seiner Verlegenheit nennt er sie Annemarie. Sie lässt sich auf das Spiel ein. Sie weiß sehr viel über ihn, er so gut wie gar nichts. Er ist mehr als ein Idol für sie. Ihn erfüllen Ängste. In seiner Verlegenheit lädt er sie zu einer Wanderung ein. Sie finden näher zu einander. "Annemarie" quartiert sich bei ihm ein. Auf ihrem Kofferanhänger steht nur "I.v.D". Als Temme am nächsten Morgen aufwacht, ist sie weg. Spurlos verschwunden. War sie eine Todesbotin? Gab es sie überhaupt? Temme beginnt an sich selbst zu zweifeln. Halluzinationen? Wochenlang versucht er, die Ereignisse in der Burg zu verdrängen. Da - anlässlich einer Reise in die Schweiz, begegnet er dieser Frau wieder, kann sie aber nicht ansprechen. Jetzt nimmt er die Suche auf, wie ein Detektiv. Er stößt auf das Touristik-Unternehmen "Thema-Reisen GmbH". Doch kaum hat er endlich Näheres erfahren, liest er in der FAZ die Todesanzeige von "Imogen von Drabenegg". Noch in der Nacht rast er über die Autobahn nach Kronberg im Taunus. Aus diskreter Entfernung wird er Zeuge des Begräbnisses, als ihn jemand von hinten antippt. Er dreht sich um: Vor ihm steht seine "Annemarie", in Wirklichkeit Madlon von Drabenegg. Die Zwillingsschwester der Verstorbenen. Temme wird überraschend zum Mittelpunkt der Trauerfamilie. Er muss sogar spontan als Reiseleiter einspringen, als Madlon bei einem Schwächeanfall stürzt. Erst als sie ihn wieder ablösen kann, in der Schweiz, finden sie endgültig zu einander, müssen aber auch erkennen, dass ihre beiden Berufe, die sie mit Leidenschaft und Profession ausüben, eine bürgerliche Ehe kaum zu lassen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 206
Veröffentlichungsjahr: 2013
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Werner Siegert
Der Tod ist keine Frau
Roman
Dieses ebook wurde erstellt bei
Inhaltsverzeichnis
Titel
Eine flüchtige Begegnung
V e r w i r r u n g e n
Irrlicht im Klostergarten
Eine heiße Spur
T o t e n t a n z
IMOGEN VON DRABBENEGG
T r a n s i t i o n
E r i n n e r u n g e n
W o r p s w e d e
Rosen auf steinernen Treppen
Die Geschichte einer Flucht
D i e R e i s e z u m D u
D i e Z u k u n f t - e i n V e r s u c h
Impressum neobooks
Eine flüchtige Begegnung
Wollte ich mich heute noch daran erinnern, wie hoch die alte Burg über dem Dorf lag, könnte ich es mir nicht genauer ins Gedächtnis zurückrufen als durch diese Beschreibung: Man konnte von oben erkennen, dass ein Mädchen unten zwischen den Häusern und Ställen hindurch lief und herauf winkte. Und dass es eine weiße Bluse anhatte. Denn dieses Bild hat sich mir tief eingeprägt.
Ein Mädchen - oder erkannte ich eine junge Frau? - kam hinter den Häusern hervor, lief einige schnelle Schritte an der alten Scheune vom Jennerbauer entlang, blickte nach oben zu mir. Ich stand ganz zufällig, um meinen Augen einen Moment der Erholung zu gönnen, am offenen Fenster. Sie winkte und nahm dann mit hastigen Sprüngen den Abkürzungspfad über den Wiesenhang.
Ich erwartete keinen Besuch. Ich erwartete keine junge Dame. Ich erwartete in dieser von Hinfälligkeit zernagten Klause überhaupt niemanden - es sei denn .... mich selbst. Und dennoch zweifelte ich nicht eine Sekunde, dass das Winken mir gegolten hatte und dieses Mädchen bald vor mir stehen würde, ein wenig keuchend - denn der Hang war steil - mit lachsroten Wangen und aufgelöstem Haar. Irgendein Zauber, eine magische Wolke (wenn es so etwas geben sollte), ein Zukunftshologramm ließ mich mit absoluter Transparenz im Voraus erkennen, was sich - vor einer Sekunde noch jeglicher Phantasie entrückt - hier gleich abspielen würde. Ich wusste, dass wir uns in die Arme schließen und ein langer, vieles erzählender Kuss eine ebenso köstliche wie geheimnisvolle Schlinge um uns ziehen würde. Ja, ich war dessen so sicher, dass ich hastig begann, dies und jenes zu ordnen, nicht um irgendetwas zu verbergen, sondern um dieser Frau ein schöneres Willkommen zu bieten.
Wenn ich von einer Burg geschrieben habe, dann mag das zu Missverständnissen Anlass geben. Hier oben wohnten damals die Ausgeflippten, die Unsteten, die Gescheiterten, die Flüchtlinge der Gesellschaft. Hier oben wohnten eigentlich die, die unten waren.
Unten im Dorf war das geregelte Leben. Waren die geordneten Vermögensverhältnisse, war das Eigentum ordentlich vermessen und im Kataster eingezeichnet. Da gab es noch Alteingesessene, Menschen, deren Haut von der Arbeit auf dem Felde gegerbt und deren Rücken vom Pflanzen, Jäten, Ernten und Tragen gekrümmt wurde. Meist waren sie nicht über die nähere Umgebung hinausgekommen. Vielleicht hatte irgendein spendabler Firmpate sie mal zu einer Reise nach Salzburg oder gar München eingeladen. Aber dort war ganz sicher für viele von ihnen die Welt zuende, und das genügte ihnen auch. Natürlich knatterten gelegentlich schon Mopeds über das Kopfsteinpflaster. Auch schwere Maschinen heulten auf, wenn die Jüngeren von der Arbeit in den umliegenden Gewerbestädtchen zurückkehrten oder - später dann - zu Disco, Kino und Imponierkorso wieder abbrausten. Alles ging tagaus, tagein seinen Lauf.
Die Burg- oder Schlossherren lebten schon längst nicht mehr. Kein Adliger trug - soweit mir bekannt war - heute noch den Namen dieses vergammelten Anwesens, das einst Herrschaftssitz, Zollstätte und Raubritterburg, später Jagdschloss und Refugium wilder oder auch verträumter Grafen war. Das Geschlecht verarmte. Mit der Ökonomie hat es offensichtlich ebenso gehapert wie mit der politischen Klugheit und der Heiratsstrategie. Irgendwann hat es sich dann endgültig auf die falsche Seite geschlagen. Ein besonders Widerspenstiger wurde eingekerkert und enthauptet, jedenfalls erzählte man sich das. Der Besitz wurde zerschlagen, verschleudert und geplündert. Später suchten wechselnde Herrschaften die restlichen Baulichkeiten zu nutzen. So dienten sie als hoheitliche Verwaltungsräume, als Hofhaltung des Gauleiters in der Nazizeit, als Fliegerleitstelle im Krieg, als Garnisonsgefechtsstelle, als Unterstellräume für Kunstgegenstände, als Flüchtlingslager, als Kommandantur der einrückenden Amerikaner, als Puff, als Umschlagplatz einer Schwarzmarktmafia mit dicken, protzigen Ami-Schlitten. Dann war einer ebenso spinnert wie eloquent, dass er die Gemeinde für den Plan zu begeistern vermochte, den Burghof für Freilichtaufführungen zu nutzen und durch jährliche Ritterfestspiele Weltruf zu erlangen. In der Tat, die Komparserie war ja schon da; denn insgesamt kann man an der Aufzählung unschwer erkennen, dass das Burgschloss stets seiner Bestimmung treu geblieben war, von jenen bewohnt zu werden, die sich auf die falsche Seite geschlagen hatten.
Daran hatte sich bis zum heutigen Tage nichts geändert. 17 Namensschilder, deren Internationalität sich nicht nur durch Schreibweise und Wortklang, sondern auch durch ihre Sorgfalt oder Unbekümmertheit verrieten, wiesen den Besucher zum Beispiel „ganz hoch, unter Dach, fünftes Türr links". Auch einige Klingeldrähte verwurstelten sich zur Gewölbedecke, als habe man bunte Spaghetti mit einer Gabel empor gezerrt. Einige stammten sicher noch von der deutschen Wehrmacht, andere aus US-Beständen. Meist war die Klingel jedoch nur Statussymbol. Der Draht endete im Nirgendwo. Die Fortsetzung diente wahrscheinlich längst im Hof als Wäscheleine. So, das mag genügen, um dem Ruch zu entkommen, diese Geschichte entspringe im Schlossherrenmilieu und die Gänsemagd schicke sich gerade an, den feschen Junker zu verliebäugeln.
Übrigens - die Miete zahlte man an die Gemeinde. Es war eher eine symbolische Handlung, denn die Summe war der Rede nicht wert. Stets in der Hoffnung, es verirre sich eines Tages ein stinkreicher Amerikaner nach T. und wolle ein echtes deutsches "castle" kaufen, es zerlegt, Stein für Stein nummeriert und verpackt nach Texas schicken oder an Ort und Stelle zu einem romantischen Hotel und Party-Place ausbauen, ließen sich die Gemeindeväter stets auch die Erklärung unterschreiben, monatliche Kündigung sei vereinbart.
Hatte ich mich auch auf die falsche Seite geschlagen? Dies zu beantworten, überlasse ich meinen späteren Leben. Diese Geschichte ließ es zunächst vermuten. Zwei der ehemaligen Prunkräume hatte ich billigst von einem Maler übernommen, der hier Zuflucht gesucht hatte, aber seines Rheumas wegen seinerseits wieder die Flucht antreten musste. Überhaupt, so glaube ich, war das Rheuma einer der strengsten Herrscher unter dem schwammsüchtigen Gebälk. Man war auf elektrische Heizungen angewiesen, hier jedoch zu niedrigen Anschlusswerten gezwungen, weil die Installation abenteuerlich genannt werden musste. Uralte Steckdosen, teils noch aus vielfach gesplittertem Porcellan (mit "c"!) und nur in meinen Rittersälen als Hinterlassenschaft der Army bereits aus hässlichem Bakelit, wiesen jeden Schukostecker von sich. Brände brachen wohl nur deshalb nicht aus, weil dafür nun wirklich alles zu feucht war.
Warum mietete man eine solche Bruchbude? Dafür gab es drei überzeugende Argumente. Eines und das wichtigste breitete sich vor dem Betrachter aus, wenn er aus den Fenstern weit in die Landschaft schaute, bei Föhn bis tief ins Gebirge. Heute, an diesem Maientag über die prangende Baumblüte, über das strotzende Frühlingsgrün bis zu den näheren Höhenzügen, von denen schlanke Barockzwiebeltürme herübergrüßten. Wer hier aus dem Fenster sah, pflegte sofort zu fragen "Ist hier noch etwas frei?" und hielt den Bewohner fortan tatsächlich für einen Schlossgrafen. Der zweite Grund, hier dem Gliederreißen zu trotzen, war die Abgeschiedenheit ohne Telefon - eine Fluchtburg für Kreativität. Und drittens war es ein herrliches Gefühl, wenn man in den Büros der nicht gar zu nahen Großstadt München saß, sich sagen zu können: Ich kann jederzeit "auf mein Schloss" fahren, und dann könnt ihr mich alle mal. Allerdings musste man der Verlockung widerstehen, irgend jemandem ein Sterbenswörtchen von diesem Paradies zu verraten oder auch nur eine Andeutung zuviel auszuplaudern.
Wie ich dennoch auf die fixe Idee kommen konnte, das Mädchen habe mir zugewunken und wolle zu mir - ich weiß es bis heute nicht. Für Bruchteile von Sekunden, für irrlichternde Gedankenblitze, brach in mir sogar die Vorstellung aus, so komme der Tod daher. Er biege plötzlich um die Ecke und winke so eindeutig, dass es gar keinen Zweck habe, sich umzusehen, ob nicht doch ein anderer gemeint sein könne, und erwische einen ganz kalt, ohne verabredet, ohne vorangemeldet zu sein, vorgelassen zu jeder Stunde. Aber der Tod ist wohl keine junge, durch Wiesengrün springende Frau - und wenn es so wäre, dann wollte ich mit ihr in einem letzten Orgasmus davon stieben.
Immerhin, schon beim ersten Gewahrwerden dieser Fee hatte sich bei mir jeder Gedanke an meine Arbeit davongestohlen. Meine Hand wurde unsicher, die Farbe anzumischen. Das Papier war schon wieder zu trocken, und mein Herz pulste zu rasch, als dass ich noch hätte ertragen können, dass dieses Mädchen zu einer der 16 anderen Wohnungen gegangen wäre.
Muss ich zu dem illustren Völkchen noch etwas sagen, das sich unter diesem windschiefen Dach zusammengefunden hatte? An einem Tag wie diesem, in dieser frühen Nachmittagsstunde, mischten sich die Schreie spielender Kinder mit dem Keifen missgünstiger Vetteln, aber gelegentlich auch mit dem ekstatischen Quieken wenig verborgener Lust-Spiele. Wozu sie verheimlichen, wenn sie in Wirklichkeit von den drallen Weibern mit unverhohlenem Stolz kundgetan wurden: Schau her, meiner oder einer treibt es noch mit mir!
Auf einmal spürte ich ganz deutlich, dass jemand näher und näher kam. Nicht dass ich durch das Brodeln des Milieus irgendeinen Stapfer hätte hören können. Auch war niemand aus meinem Fenster auszumachen, der näher als hundert Meter an die abblätternden, morbiden Mauern herangekommen war. Nein, es war einfach die Nähe dieses Menschen, diese unaufhaltsam auf mich zukommende Begegnung, die mir Herzklopfen bereitete. Mehr noch als Herzklopfen, es war eine Angst, eine eigenartige Aura, ein Magnetfeld, in das ich geraten war und aus dem es kein Entrinnen gab. Wenn so etwas möglich wäre, so musste sich wohl das Feld elektrischer Wellen, das mich umgab, innert Sekunden anders gepolt haben. Ich hätte mich nicht gewundert, wäre ein Bild von der Wand gefallen, ja, nicht einmal, wenn es sich von selber wieder aufgehängt hätte. Obwohl die Sonne durchs Fenster schien, erwartete ich einen Donnerschlag. Die Erde hätte beben können. Und dann war dieses ganz normale Klopfen.
Exakt zu dem Zeitpunkt, zu dem es kommen musste. Die Tür öffnete sich. Ich weiß nicht mehr, ob ich überhaupt "herein" gesagt hatte. Die junge Frau ging auf mich zu, schaute mich mit ihren großen Augen an, umarmte mich wortlos, und wir versanken in einem langen, schwindelhaften Kuss. Wir ließen nicht voneinander. Die Wärme ihres Körpers floss in mich über. Beide hatten wir - wie wir uns später bekannten - eine Scheu, durch irgendwelche Sätze dieses dichte Leben, diesen innigen Augenblick zu stören.
Nein, der Tod ist keine Frau, wie ich sie hier in meinen Armen hielt, eine Frau mit diesem herrlichen Duft nach Weiblichkeit. Eine solche Frau gibt Leben - und ich trank dieses Leben in mich hinein.
Als wir uns voneinander lösten, sagte sie nur "Hans, da bin ich, endlich!" Dann ging sie zum Fenster und ließ den Mai und die ganze liebliche Landschaft in sich hinein, wandte sich dann mit einer entschlossenen Kopfbewegung zu mir und sagte:
"Und hier bleibe ich jetzt! Darf ich doch? Oder?"
Ich hörte mich sagen "Wie schön! Wie schön, dass du gekommen bist!" Dabei raste es in meinem Gehirn. Ich wusste zu ein und derselben Sekunde, dass ich diese Frau nicht kannte - und dass sie mir Zeit meines Lebens vertraut war! Ich konnte sie nicht mit Namen anreden, aber es gab zwischen uns sofort eine innige Verbundenheit. Stutzig wurde ich noch mehr, als sie mich, ein paar achtlos durcheinanderliegende Aquarelle durchblätternd, nach einem ganz bestimmten Bild fragte. Und gerade dieses hatte ich noch niemandem gezeigt.
Ich wankte, ergriff die Tischplatte, krallte mich dort fest, bis ich Schmerzen spürte, weil mich doch Zweifel beschlichen, ob mich dieser Engel vielleicht schon weggeholt hatte und der Tod zwar keine Frau, aber eben doch ein Engel sei. Brücken, verlässliche Brücken zu meinem Leben suchte ich und nahm den Schmetterling dafür, der sich für wenige ruhige Flügelschläge auf dem Fensterbrett niedergelassen hatte.
"Annemarie", sagte ich plötzlich, "Annemarie, darf ich dir einen Kaffee machen, nach deiner langen Reise?"
Nie hatte ich bewusst eine Annemarie gekannt. Aber der Name kam wie selbstverständlich über die Zunge. Sie lächelte scheu, warf mir einen fragenden Blick zu und sagte ganz leise "ja". Dann trat sie wieder auf mich zu, um mich noch einmal innig zu umarmen.
"Ich bin ja so glücklich, wieder bei dir zu sein! So glücklich, dich endlich, endlich gefunden zu haben!"
Wieder ging sie zum Fenster. Mit dem Wassertopf zu hantieren, kaltes Wasser einströmen zu hören, die Kochplatte einzustöpseln, die Tassen aus dem Regal zu holen, das alles waren Tätigkeiten für mich, die mir ungeheuer wichtig wurden, bestätigten sie mir doch, noch am Leben zu sein. Und vor allem bestätigten sie mir auch, dass diese junge Frau, dieses strahlende Mädchen lebendig war, Fleisch und Blut - und nicht nur Phantasie.
"Wir müssen meine Tasche nachher noch vom Brückenwirt holen. Ich dachte, du zeigst mir die Gegend, und wir machen einen Spaziergang. Auf dem Rückweg holen wir die Sachen ab."
Immer wieder schaute ich sie an. Eine schöne, vitale, junge Frau. Ihr langes, dunkel glänzendes Haar war vom Wind strähnig verweht. Sie war barfuss in ihren Sandaletten. Aber wer war sie? Wer?
Immer, wenn ich ansetzte zu fragen, verschlossen sich meine Lippen. Als ob ich, wie in einem Märchen, zum Schweigen verdammt wäre.
Glaubte ich an ein Leben nach dem Tode? An eine Wiederkehr? Ich hatte viele Bücher darüber gelesen und war immer skeptischer geworden. Die Autoren hatten sich, so meinte ich es zu spüren, mit irgendwelchen Floskeln als Wichtigtuer und Scharlatane verraten.
Um ihr aus einer schweren Depression herauszuhelfen, hatte ich mich einmal mit einer Frau verabredet, für den Fall, dass wir noch einmal leben würden, wollte ich sie mit ihren Lieblingsblumen, einem Strauß von zartrosa Rosen und weißen Freesien an einem Denkmal auf dem Rossmarkt in Frankfurt wiedertreffen. Sie war kurz darauf so schmerzhaft jung an Krebs gestorben. Sie hieß Michaela. Nicht Annemarie.
In einer meiner Novellen, die ich schreibend durchlitten hatte, war Barbara plötzlich verschwunden. Zur Konditorei gegangen und nicht mehr wiedergekommen. Auch eine Lelia kreuzte so meinen literarischen Weg und verschwand in ein hoffentlich schönes Leben.
Häufig war es mir passiert, dass ich in der S-Bahn oder auf der Straße plötzlich in ein Frauengesicht schaute, das mir ungeheuer vertraut schien - im doppelten Sinne dieses Adverbs: ungeheuer war mir dabei. Auch dann raste mein Herz - aber nie so wie heute. Übrigens: Nie war mir das bisher bei einem Mann passiert.
Gut, ich versuchte, diesem Phänomen mit psychologischen Erklärungen auf die Spur zu kommen, und es gab viele, teils wenig schmeichelhafte Deutungen, zu denen sich ein Mann gar nicht leicht bekennt. Und jetzt - Annemarie?
Ich deckte ihr einen Platz am Fenster. Stellte den Wiesenstrauß dazu, den ich morgens vom Jogging mitgebracht hatte. In der alten Kaffeedose hatte ich noch ein paar Kekse.
"Und du?" fragte sie.
"Ich? Ich kann vor Aufregung gar nichts essen oder trinken. Ich muss dich einfach immer wieder anschauen. Und anfassen. Ganz einfach anfassen muss ich dich!" Dabei strich ich immer wieder über ihr Haar, ließ es durch meine Hände fließen und küsste sie ganz sanft in den Nacken. Sie wehrte es nicht. Das "Du" floss mir ohne jedes Zögern von den Lippen.
"Freust du dich?" fragte sie mich. Und nie habe ich ehrlicher "ja" gesagt.
So sehr mir dieses "Ja" aus dem tiefsten Herzen kam, so fühlbar war die Anspannung in mir. Denn in dieser Begegnung gab es so gar keine Belanglosigkeiten. Jede Geste, jeder Blick, jedes Wort wog für mich bedeutungsschwer, während meine Besucherin ganz im Gegensatz dazu einen überaus entspannten, sehr fröhlichen, fast ausgelassenen Eindruck machte. Immer wieder wurde mir unbehaglich, wenn sie mich sehr präzise nach meiner Arbeit fragte, Details nannte, die nur jemand wissen konnte, der mir jahrelang über die Schulter geschaut hat. Wieder und wieder formten sich auf meinen Lippen Sätze wie "Annemarie, woher weißt du das alles?" oder "Wer, zum Teufel, bist du denn?". Aber so, wie man in Todesangst kein Wort herausbringt, pressten sich meine Lippen zusammen, wann immer ich diesem Rätsel auf die Spur kommen wollte.
Schließlich, bei einer ganz und gar menschlichen und weiblichen Situation glaubte ich für einen Moment, dieses Geheimnis geradezu lachhaft einfach entschlüsselt zu haben: Annemarie war mit sicheren Schritten zu meiner Mini-Toilette gegangen. Dazu musste sie immerhin mein Schreib- und Schlafzimmer durchqueren. Ich hatte aus sehr praktischen Gründen Schreiben und Malen getrennt. Hier lagen die vielen gescheiterten Versuche, etwas in Farben auszudrücken, drüben war der Boden rings um den kleinen Erker mit Manuskriptblättern übersät. Mein Bett war unordentlich aufgeschlagen. Es zu machen, schien mir hier überflüssig, denn Schlafenszeit durfte mich hier jederzeit überfallen. Vor allem bei Regen und Nebel schlief ich häufig tagsüber und fieberte dafür nachts über diesen und jenen Papieren. Fast in der Mitte der großen Außenwand verdankte ich dem Sanitärwahn der US-Army eine Nasszelle, einen von außen überaus hässlichen, funktionalen Anbau, der jedem Denkmalsschutz Hohn sprach. In Backstein bis zur Dachkante hochgezogen, nicht verputzt und eindeutig in seinem Zweck erkennbar: kein Bergfried, sondern ein Donnerturm mit Wasserspielen, um wenigstens verbal einigermaßen romantisch zu bleiben.
Hierhin war Annemarie, oder wie meine himmlische Besucherin hieß, mit schlafwandlerischer Sicherheit entschwunden. Keine der üblichen Fragen "Wo ist, bitteschön ...." oder "Darf ich mal ....?" die Nase pudern. Nein, sie setzte die Schritte, als könne sie den Weg auch im Dunkeln finden.
Und da durchschoss mich der schalkhafte Gedanke, ob sie vielleicht eine Freundin des Malers sei, der vor mir war. Ob sie vielleicht hoffnungslos kurzsichtig und ebenso eitel war, so dass sie keine Brille trug. Dass sie mich mit Martinicz, meinem Vorgänger, verwechselte, den das Rheuma vertrieben hatte? Vielleicht hieß er auch Hans? Denn so hatte sie mich zumindest einmal angeredet. Welch' eine Desillusionierung!!! Welch' lachhaftes Komödienspiel, reif für eine Posse der bisher gescheiterten Burgfestspiele. Das Mittelalter hätte sich an einem solchen Stoff in Opern ergötzt!
Aber hatte sie mich nicht nach meinen Arbeiten gefragt? Und nach jenem Bild, das ich bis heute in die hinterste Ecke verbannt hatte, weil es mich immer wieder aufs äußerste beunruhigte? Diese Auseinandersetzung mit Dingen zwischen Himmel und Erde, von denen sich meine Schulweisheit nichts träumen ließ und auch nichts träumen lassen wollte, brachte mich noch - so fühlte ich es jedenfalls - an den Rand des Irrsinns. Ich nahm meine Zuflucht zu Erklärungen derart, dass ich ja auch schon oft durch Landschaften und Städte gefahren bin, ja, mich in Gebäuden aufgehalten habe, in denen ich mich so zuhause gefühlt habe, als sei ich dort geboren oder aufgewachsen, obwohl ich tatsächlich nie vorher in meinem Leben dort gewesen sein konnte. Auch hatte ich schon fremde Wohnungen betreten, in denen mir die Räume, ja, die Schränke und Bilder äußerst vertraut vorgekommen waren. "Déjà-vu" nannte man das wohl.
Warum sollte es Annemarie nicht ebenso ergehen? Vielleicht hatte sie in einem ihrer früheren Leben als Burgfräulein hier gelebt? War sie eine verwunschene Prinzessin? Ein gar liebliches Burggespenst? Für eine Kolportage ein trefflicher Entwurf!
Bald schlenderten wir Hand in Hand, wie frisch Verliebte, den romantischen Bachsteg hinunter. Das plätschernde Wasser hatte früher den Burggraben gefüllt und so den Zugang von der Bergseite erschwert. Jetzt rauschte der Bach in kleinen Kaskaden zu Tale. Leider von den grässlichen Spuren der Plastikgesellschaft gesäumt, über die das junge Maigrün nur einen schütteren Schleier zu legen vermochte.
Lange Zeit liefen wir schweigend nebeneinander her. Längst waren wir vom eigentlichen Ziel, die Koffer zu holen, abgekommen. Auf steinigen Feldwegen folgten wir den üppig grünenden Wiesen und Rainen. Eine "sentimental journey" dachte ich, in Erinnerung an einen Erfolgsschlager meiner Pennälerzeit. Aber war dies wirklich sentimental? Beim Anblick der vielen Millionen Pusteblumen zurückzukehren in jene frühen Jahre, in denen eine Pusteblume für mich noch eine Pusteblume und kein abgeblühter Löwenzahn war? In denen Glockenblumen noch von Elfen bewohnt wurden, wie ich sie auf einem meiner Lieblingskinderbücher abgebildet fand? Woher kamen diese Erinnerungen ausgerechnet in der Begleitung dieser jungen Frau? War das nicht zu wenig männlich?
"Ich möchte sehen lernen, wie du siehst!" sagte sie unvermittelt, als habe sie versucht, in meinen Gedanken zu lesen. "Ich will die Dinge wahrnehmen, wie du sie wahrnimmst."
"Aber warum?" fragte ich. "Warum willst du, als Frau, mit meinen Augen sehen? Wo doch das Weibliche in dir nicht nur die Augen viel weiter öffnet, sondern deine Sinne insgesamt. Während ich als Mann ständig an meine Grenzen stoße."
Und dann floss ganz spontan ein Satz aus meinem Mund, den ich nie bewusst erdacht hatte und der mich selbst aufs äußerste berührte:
"Für mich sind meine künstlerischen Versuche allesamt eine einzige erotische Begegnung mit dem Weiblichen, indem ich mich fast verzweifelt bemühe, die Welt so zu erahnen, wie eine Frau sie sehen könnte. Das, was mir von meiner Natur lebenslang verschlossen bleibt, will ich durch Striche, Farben, Konturen, durch Wörter und Sätze wenigstens in Schemen darzustellen versuchen ...."
".... und bist dabei so tief in mein Inneres vorgedrungen, dass ich mich zutiefst beunruhigt fand. Du hast übersetzt, was ich selbst von mir nur ahnte, aber bei dir in aller Klarheit wiederzuerkennen vermochte! Das war es ja, was mich nicht ruhen ließ, den Weg zu dir zu suchen."
"Und wie hast du ihn gefunden?"
"Für jemanden, der so intensiv mitzuschwingen beginnt, war die Spur unverkennbar, die du selbst gelegt hast. Sei ehrlich, dein Rückzug hier in diese Einsamkeit war doch zugleich ein Schrei nach Menschen, die dich verstehen. Natürlich verborgen in einer Art Code, den zu entschlüsseln nur jemand vermag, der auf derselben Wellenlänge Botschaften zu empfangen in der Lage ist."
"Nach e i n e m Menschen!" korrigierte ich. "Und deshalb wusste ich, als ich dich zwischen Scheune und Haus auftauchen sah, dass du dieser Mensch sein musstest und dass du zu mir kommen würdest!" Ich wusste nicht einmal, ob das gelogen war.
"Aber du kennst mich nicht?!"
"Nicht deinen Namen!"
"Du weißt also, dass ich nicht Annemarie heiße ...."
"Ich nannte dich so ...."
".... und ich finde den Namen gut. Er engt mich nicht ein. Verpflichtet nicht. Ist kein Programm."
"Wer bist du dann?"
Verschmitzt lächelte sie mich an: "Wenn du lieb bist, sage ich es dir in der zweiten Hälfte der Nacht!"
"Wozu dieses Spiel?"
"Wieso, ist der Name so wichtig? Irgendwann wirst du mich erkennen!"
Erkennen? Im biblischen Sinne?
Ich versuchte, aus ihrem Dialekt, ihrer Sprache Schlüsse zu ziehen. Der Klang war dunkel und warm. Eher süddeutsch, ohne dass man auf Bayern hätte tippen können. Österreich? Dann meinte ich wieder, andere Akzente, weichere Konsonanten herauszuhören.
"Verschwende die Zeit nicht, um zu grübeln, wer ich bin. Ich bin einfach da. Ich habe dich gesucht, wochenlang, jahrelang, und ich habe dich endlich gefunden ...."
".... aber ich selbst suche mich seit Jahren und habe mich noch nicht gefunden!"
"Weil es ein Irrtum ist zu glauben, man fände sich selbst, wenn man sich mit sich und zu sich selbst zurückzieht. Du beginnst nur zu gründeln, und je mehr du den Grund aufwühlst, desto mehr Schlamm wirbelst du auf, und dein Blick wird trüber mit jedem Tag. Irgendwo habe ich mal gelesen 'Beim Fallenlassen in deine eigenen Abgründe erkennst du vielleicht dich selbst', doch meine Abgründe offenbarten mir nur eine grässliche Fratze ....“
„.... das ist es ja gerade: Ich bin nicht nur gekommen, um ich zu finden, sondern dabei auch mich."
Annemarie ließ Gräser durch ihre Finger schlüpfen und erfreute sich an den kleinen Grannensträußen.
"Ich habe keine Botschaften ausgesandt!" nahm ich den Faden wieder auf.
"Oh ja! Du hast Kurzgeschichten geschrieben. Geschichten mit einer irren Sehnsucht nach Zärtlichkeit, wie sie vielleicht nur einer Frau auffällt. Ich habe Aquarelle von dir gesehen, und die sagen eigentlich dasselbe ...."
"Das wäre eine magere Botschaft!"
"Wie man's nimmt. Nicht in dieser Zeit. Nein - es sprach aber noch mehr daraus: Achtung auch vor gescheiterten, vor strauchelnden Menschen, Versuch der Verständigung zwischen Gegensätzen, die Fähigkeit, in einer unermesslichen Spannweite zu leben und zu erleben. Und, jetzt, wo ich darüber spreche, wird es mir erst richtig bewusst: Du suchst Begegnungen und nimmst ihren Zauber, ihre Bereicherung so dankbar in dich auf. Ja, das ist es. Deshalb möchte man dir begegnen, immer und immer wieder!"