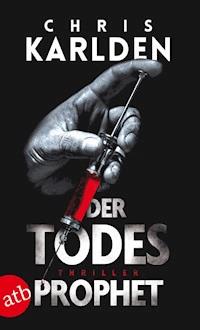4,49 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: via tolino media
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Über zwei Jahre ist es her, dass Lucy, die Tochter von Hauptkommissar Adrian Speer, entführt wurde. Unverhofft finden sich im Zuge der Aufklärung einer Mordserie erstmals Hinweise auf ihren Verbleib. Ein ominöser Unbekannter mit dem Decknamen Sammler hat Lucy zusammen mit zwei weiteren Mädchen in seiner Gewalt. Mit Hilfe seines Partners Hauptkommissar Robert Bogner stürzt Speer sich in eine atemlose Suche. Gleichzeitig zieht ein eiskalter Mörder eine blutige Spur durch die Stadt. Als die beiden Ermittler einen Zusammenhang mit Lucys Entführung herstellen können, geraten plötzlich auch Speer und seine Familie ins Visier des Killers. Schon bald können Speer und Bogner nur noch wenigen Menschen trauen, während sich die Ereignisse gnadenlos zuspitzen und der Sammler das Schicksal der Mädchen besiegeln will.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
DER TOTENSÄER
THRILLER
CHRIS KARLDEN
INHALT
Über den Autor
Prolog
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Kapitel 26
Kapitel 27
Kapitel 28
Kapitel 29
Kapitel 30
Kapitel 31
Kapitel 32
Kapitel 33
Kapitel 34
Kapitel 35
Kapitel 36
Kapitel 37
Kapitel 38
Kapitel 39
Kapitel 40
Kapitel 41
Kapitel 42
Kapitel 43
Kapitel 44
Kapitel 45
Kapitel 46
Kapitel 47
Kapitel 48
Kapitel 49
Kapitel 50
Kapitel 51
Kapitel 52
Kapitel 53
Kapitel 54
Kapitel 55
56. Zwei Wochen später
Nachwort
Was bisher geschah
Weitere Bücher
ÜBER DAS BUCH
Über zwei Jahre ist es her, dass Lucy, die Tochter von Hauptkommissar Adrian Speer, entführt wurde. Unverhofft finden sich im Zuge der Aufklärung einer Mordserie erstmals Hinweise auf ihren Verbleib. Ein ominöser Unbekannter mit dem Decknamen Sammler hat Lucy zusammen mit zwei weiteren Mädchen in seiner Gewalt. Mithilfe seines Partners Hauptkommissar Robert Bogner stürzt Speer sich in eine atemlose Suche. Gleichzeitig zieht ein eiskalter Mörder eine blutige Spur durch die Stadt. Als die beiden Ermittler einen Zusammenhang mit Lucys Entführung herstellen können, geraten plötzlich auch Speer und seine Familie ins Visier des Killers. Schon bald können Speer und Bogner nur noch wenigen Menschen trauen, während sich die Ereignisse gnadenlos zuspitzen und der Sammler das Schicksal der Mädchen besiegeln will.
ÜBER DEN AUTOR
Chris Karlden, Jahrgang 1971, studierte Rechtswissenschaften und arbeitet als Jurist in der Gesundheitsbranche. Sein erster Psychothriller »Monströs« wurde zum E-Book-Bestseller bei Amazon. Seitdem sind von ihm mehrere erfolgreiche Spannungsromane erschienen. Mit dem Psychothriller »Das Medikament«, veröffentlicht 2018, gelang ihm ein Nr.-1-Bestseller. Der Autor lebt mit seiner Familie grenznah zu Frankreich und Luxemburg im Südwesten Deutschlands. Mehr Informationen unter https://chriskarlden.de
Der Totensäer: Thriller
Copyright © 2019 by Chris Karlden
Alle Rechte vorbehalten
Umschlaggestaltung und Bildnachweise: www.buerosued.de
Lektorat: Philip Anton
Korrektorat: Manuela Tiller, www.textwerk-koeln.de
Das Werk ist urheberrechtlich geschützt. Jedwede Verwendung des Werkes darf nur mit schriftlicher Genehmigung des Autors erfolgen. Dies betrifft insbesondere die Vervielfältigung, Verbreitung und Übersetzung.
Dies ist ein fiktiver Roman. Die Figuren und Ereignisse darin sind frei erfunden. Jede Ähnlichkeit mit echten Personen, lebend oder tot, wäre zufällig und nicht beabsichtigt.
BLURBS
»Der Totensäer« ist der zweite Band der Thrillerreihe rund um die Kommissare Speer und Bogner. Die Figuren entwickeln sich von Buch zu Buch weiter und sie persönlich betreffende Handlungsstränge werden fortgeführt. Für Quereinsteiger steht ein »Was bisher geschah« bereit, das am Ende des Buches zu finden ist. Die Kriminalfälle des Ermittlerteams sind aber je Band in sich abgeschlossen und können unabhängig voneinander gelesen werden.
PROLOG
Der Mann, der heute Nacht auf seiner Liste stand, betrat die spärlich beleuchtete, etwa hundert Meter lange Fußgängerunterführung. Das Vorspiel, das im Beobachten und Verfolgen seines Opfers bestand, neigte sich nun dem Ende zu. Er zog seine Pistole aus dem Schulterholster und schraubte den Schalldämpfer auf, ohne dabei seine Zielperson aus den Augen zu lassen.
Die Wahl hatte er entgegen seiner sonst üblichen Praxis nicht dem Zufall überlassen. Der stämmige Mann war ein Auftrag. Nach dessen Judotraining hatte er ihn verfolgt und verborgen im Schutz einer dunklen Hinterhofgasse beobachtet, wie der Kerl mit einem Vereinskollegen in eine Kneipe gegangen war. Das Lokal war innen hell erleuchtet gewesen und das Licht durch ein breites gardinenloses Fenster auf den Gehweg gefallen. Die beiden Männer hatten Bier bestellt und nach einem kurzen Gespräch am Tresen begonnen, Dartpfeile auf eine elektronische Zielscheibe zu werfen. In den Pranken desjenigen, der heute Nacht sterben würde, hatten die Pfeile wie Nadeln gewirkt.
Mit schnellen, lautlosen Schritten verkürzte er den Abstand zu seinem Opfer, das bereits ein Drittel der Unterführung hinter sich gelassen hatte. Er versicherte sich, dass niemand hinter ihm in den Tunnel getreten war. Dann beschleunigte er weiter. Er wollte den Kerl, der die Statur eines dicken Baumstumpfes hatte, mit einem einzigen Schuss ins Jenseits befördern.
Nicht das Leiden der Beute, sondern die Effizienz und die fehlerlose Ausführung seiner Kunst waren sein Anspruch. Wie so oft musste er bei dem Gedanken grinsen, dass sein umfassendes Werk, sollte es je bekannt werden, die Opferzahl der offiziellen Mordstatistik signifikant in die Höhe treiben würde. Die Schatzkarte jedoch, auf der verzeichnet war, wo er all die Toten vergraben hatte, existierte nur in seinem Kopf.
Jetzt war der Mann nur noch etwa zehn Meter von ihm entfernt. Er fragte sich, wann dieser endlich bemerken würde, dass ihn jemand im Visier hatte. Wieder wurde er darin bestätigt, dass dem Menschen das Gespür für Todesnähe abging.
Er begann, in Gedanken von fünf abwärts zu zählen. Falls sein Opfer sich nicht bei null umgedreht hätte, würde er ihn von hinten erschießen. Fünf, vier, drei, zwei, eins. Im letzten Moment wandte der Mann sich doch noch abrupt um, erstarrte und ließ die abgenutzte Sporttasche, deren Griff seine Hand umklammert hatte, zu Boden fallen. Seltsamerweise blieben seine Gesichtszüge trotz der auf ihn gerichteten Pistole ausdruckslos. Sie standen sich mit nur zwei Metern Abstand gegenüber. Der Dicke setzte dazu an, die Arme nach ihm auszustrecken und einen Schritt auf ihn zuzumachen.
Er drückte ab. Mit einem leisen Puffen schoss die Kugel aus der Mündung. Für einen kurzen Moment sah der Mann ihn ungläubig an, während sich auf seiner hellen Jacke ein kreisrunder dunkler Fleck ausbreitete. Dann wurden seine Augen leer und er sackte leblos zu Boden.
Zufrieden betrachtete er sein Werk, schraubte den Schalldämpfer ab und steckte die Waffe zurück ins Holster. Den Schalldämpfer verstaute er in seinem Rucksack und holte dann eine dunkle Wolldecke daraus hervor. Diese stopfte er unter den Toten, zog damit den Leichnam bis an den nahen rechten Rand der Unterführung und rollte ihn mit dem Gesicht zur Wand. Dann nahm er das Handy, den Schlüsselbund und den Geldbeutel des Toten an sich und bedeckte ihn mit der Wolldecke, sodass nur noch die kurz geschorenen Haare hervorschauten. Schließlich stellte er noch die Sporttasche ans Kopfende.
Als er den Tunnel auf der anderen Seite verließ, stellte sich das bekannte Rauschgefühl ein. Wie ein Vampir, der nach Blut gierte, dürstete es ihn nach dem Akt des Tötens. Und sein Durst war noch lange nicht gestillt.
1
Wie in Trance steckte Adrian Speer das Handy zurück in seine Jackentasche. Seine Tochter Lucy war vor zwei Jahren kurz vor ihrem elften Geburtstag entführt worden und soeben hatte er zum ersten Mal wieder ihre Stimme gehört.
Trotz der Kälte vor dem Jagdhaus glühte sein Körper von innerer Hitze, und auf seiner Stirn hatten sich Schweißperlen gebildet. Die Wunde von dem Streifschuss, der ihn nahe der Schulter am rechten Oberarm erwischt hatte, spürte er kaum. Er war wie betäubt von Lucys Worten, die in seinem Kopf widerhallten.
In flachen unregelmäßigen Zügen atmete er die feuchte Waldluft ein und wieder aus, während der Dienstwagen der Leiterin des Morddezernats, Fernanda Gomez, und der Van der Spurensicherung mit knirschenden Reifen auf dem geschotterten Platz vor der Veranda hielten.
Kurz registriere er, dass die Kriminalrätin und die Kollegen von der KTU ausstiegen. Dann schweifte sein Blick an ihnen vorbei zu den Nadelbäumen am Ende der Lichtung, die sich dunkel vor dem Himmel abzeichneten.
Erst vor achtundvierzig Stunden hatte ihn der Mörder Sebastian Grabitz, der jetzt tot im Keller des Jagdhauses lag, auf ein Foto aufmerksam gemacht, das sich auf dem Smartphone seines zweiten Mordopfers, eines Rechtsanwalts, befand. Es zeigte drei Mädchen, die zusammen in einem Kellerraum auf einer Couch saßen.
Eines von ihnen war Lucy, und das Bild war offenbar vor etwas mehr als zwei Wochen an ihrem dreizehnten Geburtstag aufgenommen worden. Es war das erste Lebenszeichen seit ihrer Entführung gewesen.
Grabitz hatte von seinem zweiten Opfer, dem Anwalt Wölfling, Organisator der Entführung, erfahren, wohin Lucy verschleppt worden war. Doch er hatte sein Versprechen, Lucys Aufenthaltsort preiszugeben, nicht mehr einlösen können. Vor wenigen Minuten hatte Hauptkommissar Emil Sanddorn den Mörder bei einem Festnahmeversuch im Keller des Jagdhauses erschossen und der Schuss, der sich dabei aus Grabitz` Waffe gelöst hatte, hatte Speers Schulter gestreift.
Kurz nachdem Speer auf die Veranda getreten war, hatte dann Lucys Smartphone, das er immer bei sich trug, geklingelt. Es war Lucy selbst gewesen, und es hatte ihm den Boden unter den Füßen weggezogen.
»Ich habe euch lieb und ich vermisse euch, sag das Mama und Jona«, hatte sie gesagt und dass es ihr gut gehe und sie sich nicht mehr so viele Sorgen um sie machen sollten. Das war alles gewesen. Es gab neue Ansätze, die ihn zu ihr führen konnten. Aber im Moment wirbelten diese wie lose Fäden in seinem Kopf herum.
Das Geräusch der ins Schloss fallenden Schiebetür des Vans drang wie ein dumpfer Schuss zu ihm durch und riss ihn aus seinen Gedanken.
Er rieb sich die Feuchte aus den Augen und stand von der Verandabank auf. Gomez kam die Treppe herauf und blieb vor ihm stehen. Schweigend wartete sie ab, bis die Spurensicherer an ihnen vorbei im Haus verschwunden waren. Währenddessen musterte sie ihn mit kritischem Blick.
Sie hatte ihn wegen persönlicher Betroffenheit von den Mordermittlungen abgezogen. Jetzt musste sie feststellen, dass er auf eigene Faust weitergemacht und den Mörder gestellt hatte.
»Sie haben gegen meine dienstliche Anweisung verstoßen, rechnen Sie also mit entsprechenden Konsequenzen«, sagte sie in neutralem Ton. Sie drehte sich zur Eingangstür, hielt inne und wandte sich wieder ihm zu. Sie atmete tief durch. Der Ausdruck in ihrem Gesicht verlor an Strenge, ihr Blick wurde sanfter und sie verzog die Mundwinkel zu einem verkniffenen schiefen Lächeln, wodurch sich tiefe Falten in ihre Wangen kerbten. »Sie werden das nie wieder von mir hören, Speer. Aber meine persönliche Meinung ist, dass Sie einen guten Job gemacht haben.«
Fernanda Gomez setzte wieder ihre gewohnte und keinerlei Emotionen verratende Miene auf und verschwand in dem Jagdhaus.
Kurz darauf kamen die Kollegen, die im Keller dabei gewesen waren, mit Maximilian Heimer, dessen Hände auf dem Rücken mit Handschellen gefesselt waren, aus dem Haus und führten ihn nach unten zum Streifenwagen.
Heimer war bei ihren Mordermittlungen der leitendende Staatsanwalt gewesen. Wie sich jetzt herausgestellt hatte, war er zudem der Komplize von Sebastian Grabitz gewesen und hatte ihn mit Informationen aus erster Hand versorgt.
Robert Bogner kam zu Speer und sah ihn bedauernd an.
Erst vor wenigen Wochen war die achte Berliner Mordkommission mit Spezialzuständigkeit für ungelöste Fälle und besonders grausame Verbrechen gegründet und Bogner zum Leiter ernannt worden. Speer war sein Stellvertreter.
Charakterlich waren sie grundverschieden und in den ersten Tagen im gemeinsamen Büro waren sie trotz der Tatsache, dass Robert Bogner offen und redselig war, noch nicht warm miteinander geworden.
Speer wusste, dass es an ihm selbst gelegen hatte. Seit Lucys Entführung war er noch in sich gekehrter und behielt seine Emotionen und was er dachte lieber für sich. Doch die nervenaufreibenden Ermittlungen der letzten Tage hatten sie nun schneller zusammengeschweißt, als er es für möglich gehalten hätte.
»Unser toter Mörder hatte seinen Ausweis im Geldbeutel«, sagte Bogner. »Sebastian Grabitz ist der Sohn des Polizeipräsidenten. Ich kann das kaum glauben.«
Staatsanwalt Maximilian Heimer wurde auf den Rücksitz eines Streifenwagens bugsiert und sah durch das Seitenfenster zu Speer nach oben. Kurz trafen sich ihre Blicke. Als der Wagen anfuhr, wandte Heimer sich ab.
»Wir finden Lucy auch ohne Grabitz«, sagte Bogner.
Der Streifschuss verursachte einen plötzlichen stechenden Schmerz. Speer fasste mit der linken Hand reflexartig an die Wunde, die unter seiner zerfetzten Lederjacke blutig hervorklaffte.
Bogner zog die Augenbrauen zusammen. »Du musst ins Krankenhaus.«
»Nein, es geht schon«, sagte Speer, »ein einfacher Verband tut´s auch.«
Gemeinsam gingen sie nach unten und warteten vor den offen stehenden Türen des Rettungswagens, bis die Sanitäter die Richterin, die ebenfalls auf Grabitz̔ Racheliste gestanden hatte, auf der Trage aus dem Jagdhaus brachten und in das Fahrzeug hievten.
»Wird sie es schaffen?«, fragte Bogner, als der Notarzt zu Speer kam und ihm half, die Jacke auszuziehen.
»Sie hat viel Blut verloren. Aber ich denke schon.«
Dann widmete sich der Arzt Speers Verletzung, desinfizierte sie und legte ihm einen Verband um.
»Da haben Sie Glück gehabt, dass es eine reine Fleischwunde ist. Sehnen und Knochen sind unverletzt geblieben. Dennoch würde ich mir das gern im Krankenhaus noch genauer ansehen.«
»Danke, verzichte«, erwiderte Speer.
Der Arzt sah ihm skeptisch in die Augen.
»Wie Sie wollen, aber schonen Sie sich in nächster Zeit wenigstens etwas. Sie sehen aus, als könnten Sie eine Auszeit brauchen.«
Speer nickte, legte die Jacke über den gesunden linken Arm, drehte sich um und marschierte los zu dem im Schutz der Bäume und Sträucher am Rand der Lichtung geparkten Wagen. Nach wenigen Metern war Robert Bogner neben ihm.
»Und was wird das jetzt?«
Speer schwieg.
»Hey, was hast du vor?«
»Ich muss mit der Adoptivmutter von Sebastian Grabitz sprechen.«
Sie hatten die Lichtung halb überquert. Die Sonne war wieder hinter dicken grauen Wolken verschwunden. Links von ihnen huschten zwei Hasen in das Unterholz.
»Die Frau hat gerade ihren Sohn verloren. Einen Sohn, der sich als Serienmörder entpuppt hat. Lass die Kollegen ihr erst mal diese Nachrichten überbringen und sie das verdauen.«
Speer seufzte. Aber Bogner war noch nicht fertig. »Du siehst kaputt aus, und ehrlich gesagt duftest du auch nicht sonderlich gut. Bevor du also weitermachst, würde ich dir zumindest empfehlen, zu duschen, ein wenig auszuruhen und ein paar frische Klamotten anzuziehen.«
Sie kamen zu Bogners Wagen. Speer hatte ihn sich geliehen.
»Scheiße«, sagte Bogner und betrachtete den Wagen. Die vielen Schlaglöcher und Zusammenstöße mit Baumstämmen und Ästen auf dem Weg hierher waren nicht ohne Folgen geblieben. Er steckte sich einen Kaugummi in den Mund und deutete ein Kopfschütteln an.
Als Speer den Schlüssel aus seiner Jacke zog, nahm Bogner ihm diesen aus der Hand. »Der Arzt hat gesagt, du sollst dich schonen. Und davon abgesehen bist du gestern zum letzten Mal mit meinem Auto gefahren.«
Während Bogner den Wagen über den Waldweg auf die Straße bugsierte, schwiegen sie. Speer dachte an seine Schwester Marlene. Sebastian Grabitz war ihr neuer Freund gewesen, der auch noch bei ihr eingezogen war. Nun musste er ihr beibringen, dass es sich um einen Serienmörder handelte.
Grabitz hatte aus Rache diejenigen getötet, die er für das Leid, das ihm und seiner Familie zugefügt worden war, verantwortlich machte. Darunter waren auch zwei Männer gewesen, die in Lucys Entführung verstrickt waren.
Grabitz hatte deshalb in ihm einen Verbündeten gesehen und sich vor seinen Taten in Marlenes Leben geschlichen, um ihm, ihrem Bruder, unbemerkt nahezukommen.
Je länger Speer im Wagen saß, desto stärker wurden die Müdigkeit und das Gefühl, völlig ausgelaugt zu sein. Bogner hatte recht. Er hatte seit zweiundsiebzig Stunden so gut wie gar nicht geschlafen und würde sich ausruhen müssen, bevor er seine Suche nach Lucy fortsetzen konnte.
»Wir brauchen dich später auf dem Revier für deinen Bericht«, brach Bogner das Schweigen.
»Schon klar«, sagte Speer. Er hatte zwar in der vergangenen Nacht mit Tina Jeschke, dem dritten Mitglied ihrer neu gegründeten Mordkommission, in ständigem Kontakt gestanden. Doch alle Einzelheiten des Puzzles und wie es sich zusammensetzte, kannte auch sie noch nicht.
»Ich hätte es fast getan«, sagte Speer.
»Von was redest du?«
Speer hatte, während er durch die Windschutzscheibe auf den unter dem Wagen dahinhuschenden Straßenasphalt starrte, ohne es zu merken, seinen Gedanken laut ausgesprochen.
»Grabitz wollte, dass ich der Richterin die Zunge herausschneide. Dann erst wollte er mir verraten, wo Lucy ist.«
»Mein Gott«, entfuhr es Bogner.
»Er hat euch über eine Außenkamera anrücken sehen. Er wollte es mir nur sagen, wenn ich es tun würde, bevor ihr in den Keller kommt.«
»Du hast richtig gehandelt. Die Richterin hätte es nicht überlebt. Und woher willst du wissen, dass Grabitz nicht geblufft hat? Er war einfach verrückt.«
Bogner hielt auf dem Seitenstreifen vor dem Mietshaus in der Brunnenstraße, in der sich Speers Wohnung befand. »Ich muss mir für die nächste Zeit ein billiges Hotelzimmer suchen. Laura hat mich vor die Tür gesetzt.«
»Wegen einer Frauengeschichte?«
Bogner nickte.
»Du bist ein Idiot.«
»Ich weiß«, sagte Bogner reumütig.
Speer öffnete die Beifahrertür, machte Anstalten auszusteigen, hielt dann aber inne und zog die Tür wieder zu, sodass sie nur noch einen Spalt weit offen stand.
»Als ich allein draußen auf der Veranda vor dem Jagdhaus gesessen habe, hat Lucy mich auf ihrem Handy angerufen.«
Bogner wandte sich ihm ruckartig zu. »Und das sagst du erst jetzt? Was hat sie gesagt.«
»Nicht viel.« Speer fasste kurz das Gespräch zusammen.
»Aber warum dieser Anruf und warum ausgerechnet jetzt?«
»Sie hat gesagt, es gehe ihr gut. Vielleicht wollten sie mich mit dem Anruf ruhigstellen.«
»Möglich«, entgegnete Bogner.
»Wir sind den Drahtziehern näher gekommen. Vielleicht werden sie nervös.«
»Deine Tochter lebt. Das ist das Wichtigste. Möglicherweise kommt sie bald von selbst frei.«
Speer schüttelte den Kopf. »Das wird nicht passieren.«
Nach Lucys Entführung hatten sie ihm die Nachricht zukommen lassen, dass er seine Ermittlungen, damals noch als Drogenfahnder, für zwei Wochen ruhen lassen solle. Anschließend käme Lucy wieder frei. Er hatte seinen Teil erfüllt. Doch sie hatten ihr Versprechen nicht gehalten. Freiwillig würden sie Lucy auch in Zukunft nicht gehen lassen.
2
Lucys Entschluss stand fest. Sie musste diesen Horror, bei dem sie an keinem Tag wusste, ob sie ihn unbeschadet überstehen würde, endlich beenden. Sie musste von hier weg. Irgendwie musste sie es schaffen zu fliehen.
Am Morgen gegen acht Uhr hatte er die Kammertür geöffnet und sie zu sich zitiert. Normalerweise war er eine halbe Stunde früher dran und sie mussten gemeinsam mit ihm nach oben kommen. Diesmal aber hatte er Tanja und Paulina angewiesen, in der Kammer zu bleiben, und nur sie mitgenommen. Aus Angst, er würde sie bestrafen, folgte sie ihm mit pochendem Herzen die Betonstufen nach oben. Die Tür am Ende der Kellertreppe führte ins Wohnzimmer. Von dort dirigierte er sie in sein Arbeitszimmer, wo er ihnen manchmal wie ein Schuldirektor ihre Verfehlungen und Unzulänglichkeiten vorhielt und ihnen zur Bestrafung mit einem dünnen Stock auf die Finger schlug. Lucy fürchtete diese Prozedur. Heute geschah jedoch etwas Unerwartetes.
Er schloss die Tür hinter sich, setzte sich an seinen Schreibtisch und erklärte ihr, dass sie gleich ihren Vater anrufen dürfe. Tiefe Freude überkam sie. Ein Gefühl, das ihr fremd geworden war. Im gleichen Atemzug gab er vor, was sie sagen sollte. Er notierte die Worte auf einem Blatt Papier und drohte an, ihr schrecklich wehzutun, falls sie davon abweichen würde. Bevor es so weit war, musste sie warten und sich auf den Stuhl vor seinem Schreibtisch setzen.
Durch das Fenster hinter ihm sah sie es langsam heller werden und wie sich die schwarzen Umrisse hinter dem Zaun in Bäume verwandelten. Irgendwann klingelte das Mobiltelefon. Es war ein klobiges Gerät mit einer Antenne. Er nahm das Gespräch an, hörte kurz zu und schaltete es wieder aus. Dann kam er zu ihr, tippte die Nummer ihres Handys in das Tastenfeld und gab ihr das Telefon. Sie hatte sich so sehr zusammenreißen müssen, um nicht aus der Fassung zu geraten, als sie Papas Stimme hörte. Ihr Klang riss in ihrem Herzen die Wunden jener Nacht auf, in der sie entführt und hierhergebracht worden war. Aber in erster Linie steigerte seine Stimme auf einen Schlag ihre Sehnsucht nach ihrer Familie ins Unermessliche.
Als er ihr das Mobiltelefon aus der Hand nahm und das Gespräch beendete, liefen Lucy Tränen die Wangen hinunter und ihre Unterlippe bebte.
»Los, in die Küche mit dir«, blaffte er sie an. »Das Frühstück macht sich nicht von allein.« Seine Augen funkelten bedrohlich. Er konnte Jammern nicht ausstehen und bei lautem Weinen, Schluchzen und Wimmern wurde er schnell wütend und brutal. Sie wischte sich mit beiden Händen die Tränen aus dem Gesicht und verließ mit weichen Knien das Zimmer. Er folgte ihr dichtauf, schloss die Tür und stampfte die Kellertreppe nach unten, um die beiden anderen Mädchen zu holen.
Paulina war achtzehn, Tanja sechzehn. Sie stammten aus Polen und waren beide auf dem Schulweg gekidnappt worden. Paulina und Tanja nannten ihn insgeheim Monster. Lucy benutzte lieber das Wort Wärter. Wenn sie mit ihm zusammen waren, mussten sie ihn jedoch mit seinem Vornamen ansprechen. Paulina war seit vier Jahren bei ihm. Bis Lucy dazukam, war Paulina alleine mit ihm gewesen. Sie tat Lucy deshalb leid. Paulina war sehr in sich gekehrt und redete kaum. Es schien, als sei sie mit ihren Gedanken ständig woanders. Vielleicht hatte sie sich in ihrer Fantasie eine schönere Welt geschaffen und lebte mehr dort als in der Realität ihrer Gefangenschaft.
Tanja hingegen war kämpferisch und zuweilen sogar etwas keck, wusste sich aber zu verstellen, wenn sie in seiner Nähe waren. Dann spielte sie die ergebene Untertänige. In ihren Augen konnte Lucy noch Hoffnung erkennen. Vielleicht lag es daran, dass Tanja erst vor einem Jahr hergebracht worden war und aus unerfindlichen Gründen einmal pro Woche kurz mit ihrem Vater telefonieren durfte.
Einmal hatte der Wärter ihnen beim Abendessen erzählt, dass vorher schon andere Mädchen bei ihm gewesen waren. Sie hatten sich gefragt, wo diese Mädchen jetzt waren und was mit ihnen geschehen war, aber keine von ihnen hatte sich getraut, ihre Ängste auszusprechen.
Noch benommen von dem Telefonat bewegte sich Lucy in Richtung der offenen Küche. Unter ihren nackten Füßen fühlten sich die Dielenbretter kalt und klamm an.
Sie musste unbedingt weg von hier. Aber wie? Bisher hatte sie diesen Gedanken verdrängt, weil ein Weglaufen ihr als unmöglich erschien. Auch hatte der Wärter mehrmals verkündet, er werde sie umbringen und in einem Erdloch verscharren, wenn sie es wagen sollte. Aber nun wollte dieser eine Gedanke sie nicht mehr loslassen.
Zu lange hatte sie darauf vertraut, dass ihr Papa oder die Polizei sie finden würden. Das Grundstück war von einem hohen Drahtzaun umgeben. Sie hatte Videokameras entdeckt, mit denen das Anwesen kontrolliert wurde, und neben dem Wärter, der sie behandelte, als wären sie sein Eigentum, gab es immer mindestens zwei weitere Männer, die auf dem Grundstück patrouillierten. Es waren düstere Männer, sie hatten lange Bärte und sie trugen Pistolen an ihren Gürteln.
In den ersten Monaten nach ihrer Ankunft bekam sie Herzrasen, der Schweiß brach ihr aus und es verschlug ihr den Atem vor panischer Angst, wenn sie die nahenden Schritte des Wärters auf der Kellertreppe hörte.
Erst als er sie mit den anderen im Frühling ins Freie vor die Hütte ließ und sie nach Monaten zum ersten Mal wieder frische Luft atmete und ans Tageslicht kam, war es ihr ein wenig besser gegangen. Obwohl Lucy hier gefangen war, hatte sie sich nach und nach mit der Situation einigermaßen arrangiert. Er schlug sie bisweilen, aber er hatte sich keiner von ihnen je unsittlich genähert.
Als die Hoffnung auf Rettung der Gewissheit wich, dass ihr Vater sie nicht finden und befreien würde, entstand in ihr der Drang, sich umzubringen. So tief saß die Traurigkeit, dass sie keinen Sinn mehr im Leben sah. Doch irgendwann kam ihr der Gedanke, dass dann die Ungerechtigkeit gesiegt hätte, und ihre Mutter hatte immer gesagt, dass sie ein starkes Mädchen sei. Sich das Leben zu nehmen, hätte bedeutet aufzugeben, und starke Mädchen gaben nicht auf. Also hatte sie ihre Sichtweise geändert. Sie hatte sich immer wieder eingeredet, dass der Wärter krank war und er deshalb nichts für das konnte, was er ihnen antat. Mit der Zeit gelang es ihr, ihm jede seiner Handlungen zu verzeihen.
Eine plötzlich einsetzende Atemnot und ein Hustenanfall rissen Lucy aus ihren Überlegungen, in die sie vollkommen versunken gewesen war, zurück in das Holzblockhaus. Ihr wurde bewusst, dass sie eine Zeit lang untätig vor der Arbeitsplatte neben der Spüle gestanden hatte. Im Kaminofen loderte das Feuer und die Holzscheite knisterten. Doch noch immer war es in der Hütte kalt von der Nacht. Der Duft von Kaffee überlagerte den beißenden Rauchgeruch, der erst kürzlich beim Schüren und Holznachlegen in den Raum gezogen sein musste. Fröstelnd griff Lucy nach dem Asthmaspray in der Tasche ihrer Strickweste, die sie, wenn es morgens kalt war, über ihrem Nachthemd tragen durfte. Gierig sog sie das befreiende Medikament ein. Langsam ebbte das Engegefühl in ihrer Brust ab und der Hustenreiz ließ nach.
Auf einmal musste Lucy an die Küchenmesser in der Schublade vor ihr denken. Es war auch ein sehr langes und scharfes dabei. Sie sah sich es herausnehmen und ihm in den Bauch rammen. Dann hörte sie ihn die Treppe wieder heraufkommen und schreckte vor ihrer eigenen Fantasie zurück. Sie konnte ihn nicht erstechen. Dazu wäre sie nicht imstande. Und selbst wenn sie es fertigbrächte: Gegen die Wachen draußen, mit ihren Pistolen und Gewehren, wäre sie machtlos.
Sie öffnete den Hängeschrank und nahm hastig vier Müslischüsseln heraus. Aus der Schublade griff sie schnell nach Löffeln. Dann eilte sie zu dem runden Tisch und deckte die Plätze ein.
Im nächsten Moment trat er aus dem dunklen Treppenhaus durch die offen stehende Tür ins Wohnzimmer. Hinter ihm tauchten Tanja und Paulina auf. Wie Lucy waren sie barfuß und steckten noch in ihren verblichenen dünnen Nachthemden. Das war eine seiner verrückten Regeln. Sie durften sich erst nach dem Frühstück waschen und anziehen.
Lucy holte die Milch aus dem Kühlschrank und die Packung Früchtemüsli aus dem Vorratsregal und stellte beides auf den Tisch.
»Paulina, mach uns Rührei und Würstchen!«, befahl er.