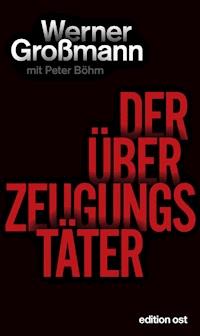
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Das Neue Berlin
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Man wird nicht als Soldat geboren, hieß ein Roman über die Schlacht von Stalingrad, und Autor Simonow schildert darin, dass keiner der Soldaten freiwillig und begeistert ins Gefecht gezogen ist. Die misslichen Umstände zwangen sie dazu. Werner Großmann zog auch nicht freiwillig in den Kalten Krieg. Die Umstände sorgten dafür, dass der gelernte Maurer Geheimdienstler wurde, landläufig Spion genannt. 1986 übernahm er von Markus Wolf den Auslandsnachrichtendienst der DDR. In einem Gespräch mit Peter Böhm macht der inzwischen 88-Jährige reinen Tisch. Er berichtet über sein schwieriges Verhältnis zu Mielke, Honecker und zum Parteiapparat. Probleme ganz anderer Art bekam er mit Hansjoachim Tiedge, als der Spionageabwehrchef der Bundesrepublik in die DDR überlief ...
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 208
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Alle Rechte der Verbreitung vorbehalten. Ohne ausdrückliche Genehmigung des Verlages ist nicht gestattet, dieses Werk oder Teile daraus auf fotomechanischem Weg zu vervielfältigen oder in Datenbanken aufzunehmen.
Die Fotos stammen aus den Archiven Werner Großmann, edition ost und Robert Allertz
ISBN E-Book 978-3-360-51042-6
ISBN Buch 978-3-360-01880-9
© 2017 edition ost im Verlag Das Neue Berlin, Berlin
Umschlaggestaltung: Buchgut, Berlin
Die Bücher der edition ost und des Verlags Das Neue Berlin erscheinen in der Eulenspiegel Verlagsgruppe.
www.eulenspiegel.com
Das Buch
Er war der letzte Chef des Auslandsnachrichtendienstes der DDR, dem er während der ganzen Zeit seiner Existenz angehörte. Großmann brachte es bis zum Generaloberst und kennt wie kaum ein Zweiter das Innenleben des Apparats und dessen Wirken im Ausland. In einem Gespräch berichtet er über sich, sein Leben und seine Aufgaben in der Aufklärung, über die er bislang geschwiegen, aber stets mit Überzeugung erfüllt hatte.
Der Autor
Werner Großmann, geboren 1929 bei Pirna, lernte Maurer, machte Abitur, studierte an der TH Dresden und war dort einige Zeit FDJ-Funktionär. 1952 wurde er Mitarbeiter des MfS. Nach dem Besuch der Schule des Außenpolitischen Nachrichtendienstes (APN), aus dem die Hauptverwaltung Aufklärung (HVA) hervorging, absolvierte er die Parteihochschule in Moskau (1966/67) und die Juristische Hochschule in Potsdam-Golm (1972). 1986 wurde er in der Nachfolge von Markus Wolf Chef des Auslandsnachrichtendienstes der DDR und stellvertretender Minister für Staatsicherheit.
Peter Böhm, geboren 1950, Journalist, war im Internationalen Pressezentrum in Berlin tätig und recherchiert seit Jahren zum Thema Geheimdienste. Zuletzt schrieb er über die Spione Hans-Joachim Bamler, Hans Voelkner und Horst Hesse.
Für Brigitte, ohne die ich nie der geworden wäre, der ich war und bin.
Inhalt
Vorwort
Fahnenflüchtig bei den Nazis
Vom Jungzugführer zum FDJ-Vorsitzenden
Vom Bau zur Hochschule
»Wir wussten nicht, wo wir uns befanden«
Revolutionäre Wachsamkeit allenthalben
In der Militärspionage
»An seinen Händen klebte kein Blut«
Außenpolitik und Auslandsaufklärung
Genossen und Freunde
Die Grenzen der Wirtschaftsspionage
Bockwurst mit Kartoffelsalat
»Hast du das ernst gemeint?«
Deutschstunde
Über Ross und Reiter
Hochgerüstete Unsicherheit
Selbststeller und Verräter
»Du kommst mir nich rin«
Internationales
Titelfindung
Vorwort
Ihn kannte die Öffentlichkeit so wenig wie seinen Vorgänger. Dieser wurde erst publik, als er publizierte. Da jedoch war Markus Wolf schon aus dem Dienst ausgeschieden und sein langjähriger Stellvertreter Werner Großmann hatte seine Funktionen übernommen: Er wurde Mitte 1986 Leiter der Hauptverwaltung Aufklärung und Stellvertretender Minister für Staatssicherheit der DDR. Das ist normal: Ein Geheimdienst wäre kein Geheimdienst, wenn seine Mitarbeiter – ob nun führend oder nur im Glied stehend – täglich in der Zeitung oder im Fernsehen zu besichtigen wären.
Das vermutlich erste Foto von Großmann in einer Westzeitung erschien im Oktober 1990, als es angeblich nicht mehr Ost oder West gab, denn am 2. Oktober hatte die DDR, der Großmann Zeit seines Berufslebens treu und mit Überzeugung diente, aufgehört zu existieren, und am 3. Oktober wurde er verhaftet. Großmann wurde fotografiert – oder, wie das jetzt in der Fachsprache des Boulevard hieß, »abgeschossen«, als er in Karlsruhe aus dem Hubschrauber stieg, damit ihm im dort amtierenden Bundesgerichtshof der Haftbefehl persönlich verkündet werden konnte.
An jenem 3. Oktober 1990 lagen sich die Offiziellen in den Armen, weil doch nun die Bundesrepublik über Nacht um 108000 Quadratkilometer und rund 16 Millionen Steuerzahler reicher geworden war, während der arbeitslose Großmann spazieren ging. Als der 61-Jährige mit seiner Familie zurückkehrte, passte sein Schlüssel nicht mehr in der Haustür. Er klingelte kühn an seiner eigenen Pforte – und schon ward ihm aufgetan: von Beamten des Bundeskriminalamtes, die gerade dabei waren, die Wohnung der Großmanns zu durchstöbern. Um dabei nicht gestört zu werden, hatten sie vorsichtshalber die Schlösser ausgewechselt. Weil, so erklärten sie ihm, die Fahnder davon ausgegangen seien, dass der Gesuchte sich abgesetzt habe. Umso erfreuter schienen sie, Großmann nun festnehmen und dem Generalbundesanwalt in Karlsruhe zuführen zu können. Der ehemals ranghöchste »Ostspion« war der erste DDR-Offizielle, der am Tag 1 der neuen BRD verhaftet wurde. Es war ihm eine Ehre.
Großmanns Anwalt beantragte Haftverschonung, die der Ermittlungsrichter mit Auflagen auch gewährte, indem er den Haftbefehl außer Vollzug setzte. Die Begründung ist insofern interessant, als sie ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts von 1995 vorwegnahm. Werner Großmann, so der Ermittlungsrichter Klaus Detter, habe »glaubhaft dargetan, dass er sich dem Verfahren stellen wird. Dabei hat er besonders darauf hingewiesen, dass er sich als früherer Leiter der HVA auch in Verantwortung gegenüber seinen bisherigen Mitarbeitern sieht. Er will erreichen, dass der Öffentlichkeit bewusst wird, dass er bis zur Wiedervereinigung für seinen Staat eine legitime Tätigkeit ausgeübt hat. Von besonderer Bedeutung ist für ihn dabei, dass es sich um eine Tätigkeit gehandelt hat, der in allen Staaten durch Sicherheitsorgane nachgegangen wird. Die Haltung des Beschuldigten spricht dafür, dass er sich dem weiteren Verfahren mit allen seinen Schwierigkeiten stellen will«, so Detter in seiner Begründung.
Zum Verfahren kam es nicht. Nach fast fünf Jahren, am 15. Mai 1995, nahm der Generalbundesanwalt die Klage gegen Großmann zurück und stellte das Verfahren ein. Am selben Tage nämlich hatte das Bundesverfassungsgericht erklärt: »Die Angehörigen der Geheimdienste der DDR haben – wie die Geheimdienste aller Staaten der Welt – eine nach dem Recht ihres Staates erlaubte und von ihm sogar verlangte Tätigkeit ausgeübt.«
Mit dieser Feststellung hatte sich die Jagd auf Mitarbeiter des MfS jedoch keineswegs erledigt. Die Propagandamühlen mahlen seither unentwegt die gleiche Kleie, noch nach einem Vierteljahrhundert rauscht der Blätterwald, wenn bei einem auch nur schwach bekannten Manne das Kürzel »MfS« im Lebenslauf auftaucht, egal, ob er am Ende der DDR noch Windeln trug oder schon General war.
Werner Großmann erlangte dadurch ungewollt eine Bekanntheit, die ihm zu DDR-Zeiten aus den genannten Gründen nicht zuteil werden konnte. Er hätte gern auf diese Art Prominenz verzichtet. Denn anders als andere, Kollegen nicht ausgenommen, drängte er nie ins Rampenlicht. Er ist der Typ des anständigen und verlässlichen Hintergrundarbeiters, eines Kanalarbeiters in jenem Sinne, wie Egon Bahr ihn verstand, wenn er von »back channels« sprach: den verschlungenen, verborgenen, den konspirativen Wegen, auf denen vertrauliche Nachrichten und Botschaften durch den Eisernen Vorhang hin- und herbefördert wurden. Großmann war, im guten Sinne, Kanalarbeiter und Amtsleiter. Nie redselig, loyal gegenüber seiner Obrigkeit wie gegenüber seinen Unterstellten, darum nur in Maßen ehrgeizig und frei von jenem Eifer, der in hierarchischen Strukturen als Bazillus umgeht und vor allem jene infiziert, die um jeden Preis nach oben wollen. Auch ohne dass dem durchaus feinsinnigen für einen Uniformträger ungewöhnlich sensiblen Großmann die Erkenntnis eingebläut worden war, handelte er nach ihr: Wenn man hinaufsteigt, muss man eines Tages auch wieder hinabsteigen und trifft dann jene Personen erneut, an denen man einst vorbeigezogen war. Und so, wie man sie damals behandelte, werden sie einem dann auch begegnen. Generaloberst a.D. Großmann und also »Zwangs- und Strafrentner« wie seinesgleichen (oder, um im Bild der Militärs zu bleiben, wie der »Schütze Arsch im letzten Glied«) wurde von niemandem geschnitten oder musste keinem aus dem Wege gehen: in seinem Keller lagen keine Leichen.
Werner Großmann marschiert, wenngleich mit Stock, auf die 90 zu. In diesen Regionen wird es zunehmend einsamer, Freunde gehen, ehemalige Kollegen und Kampfgefährten, auch seine Frau Brigitte hat ihn unlängst verlassen. Diese Reihenfolge war nicht erwartet worden, schon gar nicht von ihm. Vielleicht haben die Umstände ihn veranlasst, meiner Bitte nach einem abschließenden Gespräch über sein Leben als Überzeugungstäter nachzukommen. Vielleicht aber lag es auch daran, dass Werner Großmann ein freundlicher, hilfsbereiter und aufgeschlossener Mensch ist, der mit klarem Verstand die Zeichen der Zeit zu deuten weiß.
Peter Böhm,
Berlin, im Januar 2017
Fahnenflüchtig bei den Nazis
In den einschlägigen Nachschlagewerken der Neuzeit findet man zwei Auskünfte, die nicht interpretiert werden: »Werner Großmann kam am 9. März 1929 zur Welt.« Und: »Der Geburtsort heißt Oberebenheit und liegt bei Pirna in Sachsen.« Was für ein merkwürdiger Name.
Oberebenheit liegt auf einer Ebene oberhalb der Elbe, und seit ich den Ort kenne, hat er sich nicht verändert: Er besteht aus drei Gehöften. Meine Eltern, beide noch sehr jung, heirateten erst 1934, und so kam ich als uneheliches Kind zur Welt. Allerdings wurde ich in eine funktionierende Familie hineingeboren. Meine Mutter Martha Großmann fand Rückhalt bei ihren Eltern, somit verbrachte ich die ersten Jahre bei meinen Großeltern in Oberebenheit. Mein Vater Arno war Zimmermann und – wie damals üblich – auf der Walz, um in der Fremde Geld zu verdienen. Als ich geboren wurde, war er kurz zu Haus; dann zog er wieder los, schweren Herzens.
Man lebte dort einfach. Die Höfe wurden von kleinen Bauern geführt, die sechs bis acht Kühe besaßen, zwei, drei Pferde und ein paar Schweine. Dazu Enten, Gänse, Hühner und einen Wachhund. Dann gab es noch die Scheune mit der Tenne, wo das Getreide gedroschen wurde, einen Heuboden und ein Getreidelager. Die Bauern beschäftigten in der Regel eine Magd und einen Knecht. Sie wohnten in kleinen Zimmern über dem Pferdestall und unterhalb des Getreidebodens. Weder dort noch in der Küche des Bauern gab es fließendes Wasser, Bad und WC kannte man nicht. Das Klo befand sich in einem Verschlag auf dem Hof. Im Winter war das Brett mit dem Loch vereist, im Sommer kreisten die Fliegen. Alles nicht sehr angenehm. Aber da man nichts anderes kannte, nahm keiner daran Anstoß. Man kann nur vermissen, was man kennt.
Brannte denn wenigstens eine Glühbirne an der Decke? In den 30er Jahren probierte man in Berlin bereits das Fernsehen.
Die Wohnung hatte kein elektrisches Licht, und wir besaßen folglich auch kein Radio. Musik machten wir mit einem Grammophon, dessen Feder mit einer Kurbel aufgezogen werden musste. Licht spendeten Petroleumlampen. Elektrischen Strom gab es nur dort, wo er Arbeit verrichtete: im Stall, in welchem abends die Kühe gemolken wurden, und auf der Tenne, wo er die Dreschmaschine antrieb.
Drei Höfe. Wo war die Schule?
In Ebenheit, dem Hauptdorf mit vielleich 200 Seelen. Dorthin führte keine Straße, sondern nur ein Weg, den allenfalls Fuhrwerke befahren konnten. Zum Unterricht und zum Einkaufen – dort gab es einen Tante-Emma-Laden – lief man zu Fuß.
Was hatten Ihre Eltern gelernt? Ihr Vater, sagten Sie, war Zimmermann. Und Ihre Mutter?
Sie besuchte die Volksschule und ging danach »in Stellung«, wie das damals hieß. Sie musste Geld verdienen. In Pirna arbeitete sie als Haushaltshilfe bei einem Fleischer. Das brachte etwas Bares und, ganz wichtig, Naturalien in Form von Wurst und Fleisch.
Vater arbeitete, nachdem er das Leben als wandernder Zimmermann aufgeben konnte, in Cunnersdorf. Das lag wenige Kilometer von Ebenheit entfernt und näher an der Stadt Pirna. Arno Großmann stammte aus einer Bauarbeiterfamilie. Sein Vater arbeitete auf dem Bau, und dessen Geschwister taten es auch. Großmanns hatten vier Söhne und eine Tochter. Arno war der Älteste. Die Söhne gingen auch alle auf den Bau, als Maurer oder als Zimmerleute.
Unter dem Dach war also ein ganzer Bautrupp versammelt, weshalb eines Tages auch ein Haus errichtet wurde. Wie mein Großvater zum Hausbesitzer geworden war, blieb mir lange Zeit unerklärlich. Zwar konnten meine Onkel und der Vater Gebäude errichten, aber neben der Arbeitskraft, die es unentgeltlich gab, kostete vor allem das Baumaterial. Später erst merkte ich, wie groß der angehäufte Schuldenberg war.
Die Großeltern besaßen ein größeres Grundstück an der Dorfstraße in Cunnersdorf. Das Haus, das sie darauf setzten, verfügte über sechs Wohnungen, in jeder Etage zwei.
Das zweite Haus bauten sie 1934 für meine Eltern und mich. Erheblich kleiner. Es wurde auf einer Wiese an Rand eines Waldes, der ins Elbtal hinabging, errichtet und bestand aus Wohnküche, Schlafzimmer und einem kleinen Toilettenraum. Es war aber voll unterkellert, jedoch ohne Dachboden, an der Seite gab es noch einen kleinen Schuppen. Das Haus war außen mit Holz verkleidet, weshalb es »das Holzhäuschen« hieß. Dort zogen wir 1934 ein.
Häusle-Bauer, aber kein Geld zum Heiraten. Das verstehe ich nicht.
Sie haben ja geheiratet, als ich fünf war. Da ging es ihnen finanziell ein wenig besser. Und dadurch, dass Vater als Zimmermann damals in Deutschland und Österreich auf der Walz war, wollte man sich wohl auch nicht binden. Ich kann nur spekulieren, denn darüber habe ich nie mit ihnen gesprochen. Sie heirateten erst, als er sesshaft geworden war.
In der Stadt Pirna gab es zwei Baufirmen, bei der einen hat Vater bis zu seinem frühen Tod 1947 gearbeitet. Aber die Zimmermanns-Tätigkeit befriedigte meinen Vater nicht. Er wollte sich entwickeln, lernen, weiterkommen. Und so qualifizierte er sich im Selbststudium zum Polier, eine Art Baustellenleiter.
Gab es in Cunnersdorf eine Schule?
Nein, wir mussten nach Ebenheit. Wir waren so sechs bis acht Kinder, die täglich und bei jedem Wetter die etwa drei Kilometer zu Fuß zurücklegten. Über Kuhweiden, Stock und Stein, wie man so sagt. Als wir größer waren, fuhren wir mit dem Rad über die Feldwege. Dies alles stärkte unser Gemeinschafts- und Zusammengehörigkeitsgefühl. Es existierte in allen Generationen. Man war aufeinander angewiesen, brauchte sich gegenseitig, half einander, wenn es nottat. Die Väter trafen sich reihum zum Doppelkopf – dieses Kartenspiel beherrscht heute kaum noch jemand. In meiner Kindheit war es sehr populär. Jede Woche traf sich die Doppelkopfrunde bei einem anderen.
Natürlich gab es auch eine freiwillige Feuerwehr, was für die Bauernhöfe sehr wichtig war, denn schnell fing ein Getreidefeld oder eine Scheune Feuer. Sobald man einen Schlauch tragen konnte, schloss man sich der Dorffeuerwehr an. Ich auch. Zweimal im Monat fand eine Übung statt. Und man brauchte Kraft, denn die Pumpe wurde mit Muskelkraft bewegt.
Ihr Wohnort lag unweit von Schloss Sonnenstein, einer Mordstätte der Nazis. Dort wurden, wie man heute weiß, an die 14000 Menschen mit geistigen und körperlichen Behinderungen im Rahmen der T4-Aktion ermordet. Haben Sie etwas davon bemerkt?
Ja und nein. Dass sich während des Krieges dort eine Mordstätte der Nazis befand, erfuhr ich erst viel später, nach dem Krieg. Dass auf der Festung im Pirnaer Stadtteil Sonnenstein geistig und körperlich Kranke stationär untergebracht waren, wusste jeder. Es war eine Heilanstalt seit weit über hundert Jahren, in der geistig Kranke, die als heilbar galten, behandelt wurden. Sie arbeiteten, das war Teil der Therapie, auf einem Gut, einer staatlichen Meierei. Die Patienten wurden am Morgen zur Arbeit geführt und zum Feierabend wieder in das Schloss gebracht. Wir sahen sie gelegentlich, hatten aber keinen Kontakt. 1940/41 fuhren auffällig viele Busse mit zugehängten Fenstern hinauf zur Festung – wie wir heute wissen, saßen darin geistig kranke Menschen, von den Nazis zynisch als »unwertes Leben« bezeichnet. Sie wurden auf Schloss Sonnenstein mit Gas getötet und Opfer der »Euthanasie«-Morde. Nach 1941 wurde das Schloss als Lazarett genutzt, und eine Reichsverwaltungsschule wurde ebenfalls dort untergebracht.
Welche Rolle spielte die Kirche im Ort? Waren Ihre Eltern konfessionell gebunden, wurden Sie getauft?
Meine Eltern waren evangelisch-lutherisch getauft wie fast jeder, ich natürlich auch. Aber die Religion spielte bei uns kaum eine Rolle. Sie zahlten wohl Kirchensteuer, aber in die Kirche gingen sie nie, ich kann mich jedenfalls nicht daran erinnern. Zu meiner Konfirmation mussten wir extra nach Pirna pilgern, weil es in Cunnersdorf zwar einen Gasthof, aber kein Gotteshaus gab. Ich trat später, was nur logisch und konsequent war, aus der Kirche aus.
Nun ist es eine Binsenweisheit, dass die entscheidenden Prägungen während der Kindheit und Jugend erfolgen. Als den Nazis 1933 die Macht übertragen wurde, waren Sie vier, und sechzehn, als das Nazi-Reich durch die militärischen Schläge der Antihitlerkoalition zerbrach. Hinterließ die braune Diktatur Spuren bei Ihnen?
Mittel- und langfristig ganz gewiss nicht. Mit der Nazi-Ideologie kam ich erstmals in der Schule in Ebenheit in Berührung. Das war eine Zwergschule, bestehend aus zwei Unterrichtsräumen. In der einen lernten die Klassenstufen eins bis vier, in der anderen die von fünf bis acht. Es gab zwei Lehrer, aber dass sie ausgemachte Nazis gewesen wären, könnte ich nicht sagen. Außerdem wechselte ich mit der 5. Klasse nach Pirna, weil ich Abitur machen wollte oder sollte.
Aber bei den sogenannten Pimpfen, der Hitlerjugend, waren Sie schon? Oder?
Wie alle Jungs, wenn sie das 10. Lebensjahr erreicht hatten. Ende der 30er Jahre war eine »Jugenddienstpflicht« gesetzlich vorgeschrieben: An zwei Tagen in der Woche hatte man irgendwelche unsinnigen Verrichtungen und Schulungen zu absolvieren.
Meine Eltern waren keine Mitläufer oder gar Anhänger des Nazi-Systems, allerdings auch keine Widerstandskämpfer. Ihre Grundeinstellung war eher ablehnend denn zustimmend, im weitesten Sinne wohl antifaschistisch. Ich erinnere mich, dass meine Mutter nach dem Überfall auf die Sowjetunion im Juni ’41 lakonisch feststellte, dass dies nun wohl Hitlers Ende sein würde. Ich hatte nicht den Eindruck, dass diese Einsicht sie sonderlich traurig gestimmt hätte.
Vater zog man zur Wehrmacht ein, er war an der Ostfront. Ich entsinne mich, dass er im Urlaub von Dingen sprach, die er nicht in Ordnung fand. Ob er dafür das Wort »Verbrechen« benutzte, was sie ja waren – verübt von seinesgleichen, von Wehrmachtsoldaten, SS und SD –, weiß ich nicht. Erkennbar jedoch war, dass er verurteilte, was er erlebt oder gesehen hatte.
Sie kamen 1940 ans Gymnasium in Pirna. Ein wenig ungewöhnlich für einen wie Sie, mit diesem familiären Hintergrund.
Ja, ab der fünften Klasse besuchte ich die Staatliche Oberschule für Jungen. Ich war von meinem Lehrer aufgrund meiner schulischen Leistungen empfohlen worden. Ich meine, kein besonders guter Schüler gewesen zu sein. Meinen Eltern sahen das wohl ähnlich und verhielten sich reserviert, der Lehrer führte mehrere Gespräche mit ihnen, ehe sie zustimmten. Ich glaube, dass ihnen die Zusage, kein Schulgeld zahlen zu müssen, die Entscheidung erleichterte. Ich habe später nie darüber mit meinem Vater geredet, doch ich bin mir sicher, dass ihm die Perspektive Abitur gefiel, denn das entsprach seiner Lebenshaltung: lernen, lernen und nochmals lernen!
Für mich kam dieser Schulwechsel nicht nur überraschend, er stellte auch einen Bruch mit Gewohntem dar. In Cunnersdorf war ich einer unter Gleichen, in Pirna einer vom Dorf. Obgleich meine Eltern in Pirna arbeiteten, war ich anfangs völlig verunsichert. Hinzu kam dann die stete Entfremdung von meinen Freunden im Dorf. Im Wortsinne trennten sich unsere Wege. Ich hielt es nun mit den »Bessergestellten« in der Stadt, wie sie meinten, war also in ihren Augen auch »was Besseres«, ein »Verräter« gar.
Ich empfand alles als zweifache Bedrückung: den Verlust des Vertrauten und das Fremde, das mich nun umgab. Das waren alles Kinder aus der Mittelschicht, ich als Sohn eines Zimmermanns war Proletarierkind. Deren Eltern besaßen alle Bücherschränke zu Hause, sie hatten einen Vorrat an Wissen und Bildung mitbekommen, den ich nicht besaß. Mein Banknachbar zum Beispiel war der Sohn eines höheren Bahnangestellten. Seine Familie lebte in einer großen Dienstwohnung im Bahnhof von Pirna. Er hatte ständig Geld in der Tasche, bekam also regelmäßig Taschengeld, was mir meine Eltern natürlich nicht bieten konnten.
Haben die Mitschüler Sie spüren lassen, dass Sie nicht einer der ihren waren?
Einige schon, aber die meisten nicht. Im Großen und Ganzen haben wir uns verstanden. Aber ich blieb trotzdem ein Außenseiter, weil ich bei vielem nicht mithalten konnte. Das begann mit der Kleidung und endete nicht bei den Freizeitmöglichkeiten. Wenn alle in die Italienische Eisdiele in Pirna gingen, hielt ich mich fern: Mir fehlte schlicht das Geld. So haben mich weniger meine Mitschüler, sondern mehr die Umstände spüren lassen, dass ich eigentlich nicht dazu gehörte.
War damit das Scheitern an der Schule vorprogrammiert?
Dass mir der Unterricht schwerfiel, heißt ja nicht, dass ich scheiterte. Es fiel mir das meiste schwer. Soweit ich mich entsinnen kann, lagen mir Deutsch und Englisch. Bei den Naturwissenschaften und der Mathematik gab es Probleme. Latein hingegen war ein Graus. Ich verstand einfach nicht, warum man eine Sprache erlernen sollte, die kein Mensch mehr sprach. Da fehlte mir einfach die Motivation, und so schleppte ich mich von Schuljahr zu Schuljahr.
Ganz profan: Wie kamen Sie täglich zur Schule? Mit dem Bus, dem Rad?
Zu Fuß natürlich, eine halbe Stunde morgens, eine halbe mittags retour. Am Morgen ging es bergab ins Elbtal in die Stadt, nachmittags wieder bergauf über den Sonnenstein auf die Hochebene. Es war ein schöner Schulweg, denn am Morgen sah ich von oben auf die Dächer und die Türme der Stadt. Und die Elbe glitzerte im Sonnenlicht. Es war ein wunderbares Bild, das ich in mir aufnahm. Die Regentage, oder wenn winters der Wind kalt über das Plateau fegte, habe ich vergessen. Es schien nicht an jedem Tag die Sonne.
In der Natur fühlten Sie sich frei, nicht in der Stadt, wie Sie einmal sagten. Bekanntlich heißt es doch: »Stadtluft macht frei!«
Das galt nicht für mich. Deshalb liebte ich ja auch den Sport. Wegen meiner Größe war ich beim Feldhandball gefragt. Damals spielte man draußen, nicht in der Halle. Ich gewann dadurch alsbald Anerkennung bei meinen Mitschülern. Plötzlich besaß ich Freunde. Ich genoss ein gewisses Ansehen, was meinem schwachen Selbstbewusstsein guttat.
Die Kehrseite der Medaille: Man machte mich in der HJ zum Jungzugführer. Bei Geländespielen, die mir durchaus Spaß bereiteten, hörten 20 bis 25 Jungen auf mein Kommando. Ich war nicht mehr der Außenseiter, der sich zurechtfinden musste. Ich hatte was zu sagen und war nicht mehr nur der Junge vom Dorf. Bei mir funktionierte genau das, was die Nazis für unsere Generation geplant hatten: Gib ihnen Aufgaben, Funktionen, Herausforderungen, begeistere sie mit Abenteuer und Kampfsport – und mache sie reif für den Krieg. Flink wie Windhunde, zäh wie Leder, hart wie Kruppstahl …
Kunst und Literatur kamen dabei nicht vor?
Nein. Nicht einmal im Unterricht spielte klassische Literatur eine Rolle. Ich kann mich nur an Nazi-Poeten erinnern.
Wie waren die Lehrer?
Ich habe nur schwache Erinnerungen. Ich erinnere mich an meinen Klassenlehrer, der sich sehr um mich bemühte und mich einige Male zu sich nach Hause einlud. Doch obgleich er immer schützend seine Hände über mich breitete, mich positiv beeinflusste und durchaus beeindruckte, ist auch sein Name aus meinem Gedächtnis entschwunden. Aber wenn Sie damit in Erfahrung bringen wollten, ob an der Schule überzeugte Nazis unterrichteten, muss ich auch die Auskunft schuldig bleiben. Da man alles damals als »normal« empfand, werden wohl auch solche dabei gewesen sein.
Pirna liegt unweit von Dresden. Mitte Februar 1945 legten britische und amerikanische Bomber die Stadt in Schutt und Asche. Der Angriff war militärisch unnötig, wie die meisten Historiker sagen, es war eine Machtdemonstration. Nicht gegenüber dem Gegner, sondern gegenüber dem östlichen Verbündeten. Haben Sie etwas von diesem Bombardement mitbekommen?
Aber natürlich. Bei jedem angekündigten Fliegerangriff flüchteten wir in den Keller meiner Großeltern, weil der unter unserem Holzhaus wenig Schutz bot. Ich hingegen verspürte selten Lust, mich feige in den Keller zu verdrücken, und bezog Posten auf dem Dachboden. Doch der Angriff vom 13. Februar 1945 war derart heftig, dass ich es mit der Angst bekam und gegen meine sonstige Gewohnheit in den Keller flüchtete.
Sie waren 15, als die Schule für Sie endete?
1944 wurde der Jahrgang 1929 in Wehrertüchtigungslager gesteckt. Die Schule in Pirna wurde einfach geschlossen. Wir kamen nach Altenberg im Osterzgebirge, das Lager befand sich in rund 750 Metern Höhe. Marschieren, Exerzieren, Waffenkunde, Geländeausbildung: das kleine Einmaleins des Krieges eben. Unsere Ausbilder waren Fußballer des Dresdner SC, die spielten in der Gauliga Sachsen, weshalb wir am Wochenende vor ihnen Ruhe hatten. Aber besonders militant waren sie nicht. Als die Alliierten näher rückten – die Rote Armee aus dem Osten, die US Army aus dem Westen –, beriet die Lagerleitung, was zu tun sei. Da die vorhandenen Waffen nicht ausreichten, entschied man, sie nur an Freiwillige auszugeben und die anderen nach Hause zu schicken.
Einer von unseren Leuten, der Wache vor den Baracken schob, bekam die Diskussion und die Entscheidung mit, worüber er uns anschließend informierte. Beim Appell am nächsten Morgen, als es hieß »Freiwillige vor!«, blieb ich natürlich stehen – und wurde nach Hause geschickt.
Meine Mutter war sehr froh, als ich unerwartet vor der Tür stand. Doch die Freude über die Freiheit währte nicht lange. Schon am nächsten Morgen stand der Ortsgruppenführer der NSDAP vor der Tür und erteilte mir den Befehl, mich beim Volkssturm in Pirna-Neuendorf zu melden. So landete ich in einer Kaserne als Volkssturmmann, um »den Russen« zu stoppen. Mir und anderen drückte man Gewehre in die Hand und schickte uns an den Stadtrand von Pirna und in benachbarte Orte, um dort Schützengräben auszuheben. Wir bekamen keine Angreifer zu sehen. Stattdessen feuerte die sowjetische Artillerie. Eine Granate riss meinem Freund, der direkt neben mir stand, beide Beine weg. Er verblutete … Das war ein grausiges Schlüsselerlebnis für uns alle. Wir flüchteten zurück in die Kaserne.
Zwei Tage später hoben wir erneut Schützengräben aus. Uns beaufsichtigte ein Unteroffizier. Der wohnte nicht weit von Dresden entfernt und teilte uns unvermittelt mit, dass er jetzt nach Hause gehe. Er warf seine Ausrüstung weg und überließ uns vier, fünf Jungen unserem Schicksal. Wir beschlossen, seinem Beispiel zu folgen. Ich warf mein Gewehr in die Gottleuba, einen kleinen Fluss, der in Pirna in die Elbe fließt, und eilte zu meiner Mutter. Die schickte mich zu den Großeltern nach Oberebenheit, damit mich der Ortsgruppenführer, der mich zum Volkssturm beordert hatte, nicht erneut finden würde. Die drei Bauernhöfe in Oberebenheit waren jedoch bereits von SS-Einheiten besetzt, um hier »den Iwan« aufzuhalten.
Ich schnappte mein Fahrrad und fuhr nach Cunnersdorf zu einem Freund, der mit mir auch beim Volkssturm gewesen war. Wir hatten uns gegenseitig versprochen, dass jeder beim anderen unterkriechen könne, wenn es die Umstände erforderten. Dort, im Haus seiner Eltern, erlebte ich das Ende des Krieges.
Die riskierten eigentlich ihr Leben, indem sie Fahnenflüchtige versteckten.





























