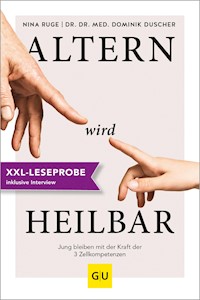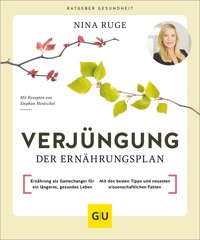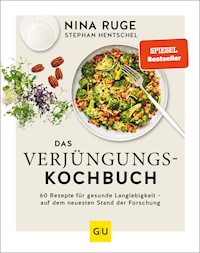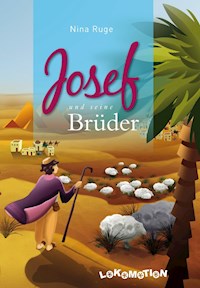5,99 €
Mehr erfahren.
Nina Ruge, wie keiner sie kennt
Nina Ruge hat sich ihr Leben lang immer wieder neu erfunden und Herausforderungen gestellt. Doch es waren nicht die äußeren Erfolge, die sie stärkten, sondern eine verblüffende Entdeckung: In jedem von uns verbirgt sich ein Ort, an dem wir ganz wir selbst und in Kontakt mit unserer größten Kraft sein können. In diesem Buch stellt Nina Ruge ihre Methode vor, mit deren Hilfe wir mitten im stressigsten Alltag innehalten und Glück erfahren können. Auch im tiefsten Winter wohnt ein unbesiegbarer Sommer – und die Tür steht immer offen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 301
Veröffentlichungsjahr: 2013
Ähnliche
Nina Ruge
Der unbesiegbare Sommer in uns
Ein Wegweiser zu unserem ureigenen Kraftort
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen. Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen. Verlagsgruppe Random House
1. Auflage
Originalausgabe
© 2013 Kailash Verlag
in der Verlagsgruppe Random House GmbH,Neumarkter Str. 28, 81673 München.
Lektorat: Anne Nordmann
Umschlaggestaltung: ki Editorial Design, Sabine Krohberger, unter Verwendung eines Fotos von ©Frank P. Wartenberg/glampool (Portrait Nina Ruge) und eines Fotos von ©plainpicture/Andreas Baum
Satz: EDV-Fotosatz Huber/Verlagsservice G. Pfeifer, Germering
ISBN 978-3-641-10676-8V002
www.kailash-verlag.de
Inhaltsverzeichnis
Vorwort
1 Wo die Angst ist, geht es lang
Die Geschichte meiner eigenen Reise
2 Und auf einmal steht es neben dir, an dich angelehnt. Was? Das, was du so lang ersehnt.
Meine erste Satori-Erfahrung
3 Die Tyrannei des Denkens
Nur wer sich bewegt, spürt seine Fesseln
4 Entspanne dich. Lass das Steuer los. Trudele durch die Welt. Sie ist so schön.
Üben, das Denken abzustellen. Und was kommt danach?
5 Die wichtigste Stunde ist immer die Gegenwart
1000 Gelegenheiten fürs Innehalten, mittendrin und täglich
6 Das gibt’s doch nicht! Doch, das gibt’s.
Widerstand kostet Leben
7 Die Kraft der Gegenwart
Ach, Augenblick, verweile doch!
8 Man sieht nur mit dem Herzen gut. Das Wesentliche ist für die Augen unsichtbar.
Der unbesiegbare Sommer in mir
9 Auf welches Instrument sind wir gespannt?
Das Ego-System als Dornröschenhecke
10 Lebenskunst beginnt bei der Absichtslosigkeit
Doch: Nur tote Fische schwimmen mit dem Strom
11 Das Wasser, das du in den Wein gossest, kannst du nie wieder herausschütten
Widerstand gegen das, was ist, raubt Leben
12 Im Herbst des Lebens verkriecht sich die Schönheit nach innen
… und der unbesiegbare Sommer welkt?
13 Was ist Liebe – und wenn ja, wie viele?
Ihr seid das Licht für die Welt
14 Auf den Hund gekommen
Tiere als Türöffner zum Sein
15 Der letzte Ernst der Dinge ist heiter
Humor ist lernbar
16 Die Freiheit, die ich meine
Kein Mensch muss müssen
17 Einfachheit ist die höchste Stufe der Vollendung
Über das Suchen und Leben von Werten
18 Vergiss die Zeit
Es ist alles schon da
Mitten im Winter erkannte ich …
… dass in mir ein unbesiegbarer Sommer wohnt
Ein magischer Satz. Albert Camus spricht uns aus der Seele. Ein paar Worte nur, und wir halten inne. Sie tun unendlich gut. Sie verströmen die Wärme einer scheinbar längst verlorenen Zeit. Sie bringen eine Gewissheit zurück, von der wir spüren, dass sie irgendwann einmal die ureigene war. Ein Satz, der tief unter die Haut geht, denn wir wissen intuitiv: Das ist kein Werbeclaim. Da spielt niemand mit unseren Gefühlen. Dieser Satz ist wahr.
Wahrheit weckt die Sehnsucht nach mehr, umhüllt uns mit Melancholie. Der unbesiegbare Sommer in mir – wie tief ist er vergraben, wie wenig von seiner Kraft und Heiterkeit trägt mich im Alltag. Da ist ein Quell der Kraft in mir verborgen, doch finde ich den Weg zu ihm nicht mehr, die Tür ist zu, der Schlüssel achtlos im Nirgendwo.
Dieses Buch soll ein innerer Wegweiser sein. Doch: An den Scheidewegen des Lebens stehen keine Hinweisschilder. Die Loipe nach innen muss jeder für sich selber bahnen. Deshalb kann das Buch nur Initiator, Anreger und Begleiter sein. Und das Buch bin natürlich ich.
Es enthält den Extrakt meiner lebenslangen Suche, die glücklicherweise noch längst nicht abgeschlossen ist. Dennoch hat sie mich schon oft in meinen inneren Sommer geführt. Sie hat mich bislang einiges über den Weg dorthin gelehrt. Vor allem, dass dieser Weg keineswegs über »Wissen« führt. Sondern über Erkenntnis, die nicht mit Worten zu definieren ist. Zum Beispiel über die Erkenntnis, dass mein Denken den Weg wie ein Hinkelstein blockiert. Über die Erkenntnis, wie sehr meine Denk- und Verhaltensmuster mein Ego prägen und wie Pattex meine Wahrnehmung verkleben. Über die Erkenntnis, dass die Gitterstäbe meines Gedanken-Gefängnisses nur langsam schmelzen. Und schließlich, dass das Lösungsmittel für antrainierte Muster eine Mixtur ist aus Geduld, Konzentration und Entschlossenheit. Wenn wir einwilligen, dass wir lange und regelmäßig üben müssen, um Altes abzulegen und Neues zu erfahren, dann öffnet sich der Weg.
Wenn du gesprungen bist, hast du den Ort der Landung längst geträumt. Das ist das Wunderbare, das uns die mühsame Reise ins Innere der Liebe so reizvoll macht. Gott verspricht eine sichere Landung, aber keine ruhige Reise. Also, los!
Über das Träumen, Reisen und Landen an einen Ort, den nur einer kennt: du selbst.
1
Wo die Angst ist, geht es lang
Die Geschichte meiner eigenen Reise
Mitten im Winter erkannte ich … dass ich dabei war zu erfrieren. Der Winter war ein kühler Tag im April und die Konfirmation der jüngeren Schwester meines damaligen Freundes. Die Familie saß hübsch gemacht in einer evangelischen Kirche in Kassel. Ich war 19, saß daneben und sah das Ganze als spaßfreies Pflichtprogramm an. Ich war zwar evangelisch getauft, doch zu jener Zeit alles andere als empfänglich für kirchliche Botschaften.
Und nun fing auch noch der Jugendchor an zu singen. Ausgerechnet ein Jugendchor! Ich selbst hatte eine fünfjährige Chor-Biografie zu verzeichnen. Oh Gott, wie war das brav und spießig gewesen! Die Lust am Singen poppte höchstens in der Disco noch mal in mir auf.
Alles in mir war also auf Abwehr programmiert. Ein Konfirmations-Kirchenchor – forget it! Doch als die ach-so-piefigen Jungs und Mädels zu singen anhoben, erwischten sie mich eiskalt. Denn sie bedienten sich exakt des Soundtracks, für den meine Magengrube den idealen Resonanzboden bot, der ein verheißungsvolles Morgen versprach: Sie rockten Deep Purple, David Bowie, Uriah Heep.
Dem Pfarrer gelang etwas Unerhörtes: eine Konfirmation in der Gefühlssprache von uns, den Unter-Zwanzigjährigen. Ein Gottesdienst als Lebensschule, als Freiheitsschule vielleicht sogar. Erwachsene herzlich eingeladen.
Gesungen wurde zwar in der verachtenswerten Sprache der Oberlehrer und Sittenwächter, auf Deutsch, heaven!, doch ich kam erst gar nicht dazu, die inneren Schotten dicht zu machen. Gleich die erste Liedzeile setzte mich schachmatt: »Meinen Kopf in einen warmen Schoß zu legen, und meine Sorgen in einen großen Schrank.« Ein schlichter, um nicht zu sagen, ein höchst kitschverdächtiger Satz. Roy Black hätte seine Freude daran gehabt. Doch bevor ich begriff, wie mir geschah, begann ich – auch zum Erstaunen meiner kirchlichen Nebensitzer – hemmungslos zu weinen. Mein Gott, war das peinlich! Es schüttelte mich, und es hörte nicht auf. Im Gegenteil.
Noch schlimmer wurde es, als der Pastor vom Weg in die innere Wärme sprach, der der wichtigste Weg in unserem Leben sei, und den so viele verpassen würden. Er sprach von Menschen, die die Liebe vergäßen. Die gierig darauf bedacht seien, von wem sie welche Dosis Anerkennung, Zuwendung, Bestätigung erhielten, aber nie lernten, dass Liebe die wertvollste Währung sei. Am wertvollsten, wenn man sie verschenke.
Wer sie achtlos zumülle, die unerschöpfliche Liebesquelle in sich selbst, der begänne unweigerlich zu frieren, so der Pastor. Es gäbe zwar viele Methoden, den inneren Schüttelfrost kurzzeitig zu betäuben, doch wer sich dem nicht stelle, nicht anschaue, weshalb es ihn so friere, der verlöre über kurz oder lang sein Leben. Genauer gesagt: Er verlöre seine Lebendigkeit.
Es heulte mich. Mit Macht brach aus mir heraus, was ich nicht wahrhaben wollte. Denn ich war doch zutiefst davon überzeugt: Ich lebte die große Freiheit Nummer sieben! Gemeinsam mit meinem Freund in einer flippigen WG, im Studium lief auch alles rund … Einzig das Geld war wahnsinnig knapp, weil meine Eltern mir nur den gesetzlich vorgeschriebenen Mindestbetrag gaben, 300 Mark pro Monat. Aus Disziplinierungsgründen. Aber selbst das war irgendwie cool. Geld? Das war doch das Magengeschwür der Kapitalisten.
Und hier, auf dieser beinharten Kirchenbank, wurde mir schlagartig klar: Ich fror, und wie! Trotz I Ging, trotz Habermas und Horst Eberhard Richter, trotz allen Gegenentwürfen zum etablierten Spießerleben hatte ich aufgehört zu suchen. In mir vibrierte es nicht mehr. Die Welt war von einem Grauschleier überzogen. Das tiefe Glücksgefühl zu leben – kaum geahnt, schon verpufft. Mein Gott, eine Lebenskrise mit 19? Verdammt früh!
Aber kein Wunder eigentlich. Hatte ich doch schon früh einen sensiblen Geigerzähler entwickelt für Phasen, in denen das Leben seinen Glanz verliert. Weil ich von klein auf gespürt hatte, wie es ist, sich außen geborgen und innen verloren zu fühlen. Ich klammerte mich an den Rockzipfel meiner Mutter, weil ich kleines, dürres Mädchen innen total verängstigt war. Ein Vertrauen der Sorte »von guten Mächten wunderbar geborgen« war noch nicht erwacht. So erinnere ich mich an meine Kindheit mit dem Gefühl von Behütetsein – und Schüttelfrost.
Ich komme aus einer klassischen Akademikerfamilie. Mein Vater war Professor für Maschinenbau in Braunschweig, meine Mutter hatte das Medizinstudium mit der Geburt meiner älteren Schwester abgebrochen. Carl-Orff-Schulwerk, Klavierunterricht, Ballett, Tennis, Reiten, Jugendchor, Bildungsreisen. Meine Eltern wollten das Beste für uns. Sie organisierten nach bestem Wissen und Gewissen und mit größtem Kraftaufwand die optimale Förderung für uns. Ihr Prinzip: eine strenge, liebevolle Erziehung.
Ich war ein merkwürdiges Kind, extrem schüchtern, ja scheu. Ich traute mich weder aufs Fahrrad noch allein zum Kaufmann an die Ecke. In der Schule war ich war supergut, zu Hause wollte ich am liebsten zu Mama und Papa auf den Schoß. Der Rockzipfel als verlängerte Nabelschnur.
Irgendwann begann ich zu spüren, dass es bei uns zu Hause irgendwie anders war als bei meinen Freundinnen. Alles ein bisschen schwerer, ernster, tiefer, weniger spontan. Es war, als verstecke sich zwischen uns vieren ein graues Geheimnis. Ein Geheimnis, das wie ein schuppiges Tier hinter dem Vorhang saß und sich von Lebensfreude nährte.
Erst zehn Jahre später, ich war gerade 18, begann ich zu begreifen: Es gab einen Zusammenhang zwischen meiner Schüchternheit und dem schuppigen Tier. Mein Vater erzählte uns von dem, was er und meine Mutter mit sich trugen. Und das war beileibe tonnenschwer. Meinem Vater war als »Halbjude« zunächst das Abitur verwehrt worden, später wurde er nach Frankreich in ein Lager deportiert. Dort musste er »den Westwall schippen« und erkrankte schwer. Er hat das Lager und den Nazi-Terror nur mit sehr viel Intelligenz und noch mehr Glück überlebt.
Bei meiner Mutter wurde ein schwarzes Melanom diagnostiziert, als sie im vierten Monat mit mir schwanger war. Als angehende Ärztin wusste sie, was das bedeutet. In einer sofortigen Operation sah sie keine Chance mehr, also trug sie mich aus. Kurz nach der Geburt kam ich ins Säuglingsheim und sie ins Krebsforschungszentrum Heidelberg. Man fand Metastasen im ganzen Bauchraum. Trotzdem wurde sie operiert, acht Stunden lang. Anschließend bereitete der Professor meinen Vater auf ein Leben als Witwer vor.
Doch dann das Wunder: Meine Mutter wurde massiv bestrahlt – und überlebte. Der Krebs war weg. Was blieb, war die Angst. Immer wieder musste sie zu Kontrolluntersuchungen, immer wieder hatte sie veränderte Lymphknoten, die entfernt werden mussten. Eine einzige aggressive Metastase hätte genügt …
Und von alldem hatten uns unsere Eltern unsere ganze Kindheit und Jugend hindurch nichts erzählt. Sie wollten uns nicht belasten. Und sie wollten unsere Mutter schützen. Niemand sollte über sie und ihr Schicksal tuscheln.
Heute weiß ich, wie das schuppige Tier heißt, das die Lebensfreude in unserer Familie so hinterhältig aufzehrte. Sein Vorname: Angst. Sein Nachname: Verdrängung. Ich meine zu ahnen, was für ein unglaublicher mentaler Kraftakt es gewesen sein muss, mit all dem Erlebten fertig zu werden. Ich spreche bewusst nicht von »Verarbeiten«. Dazu wäre es vielleicht nötig gewesen, professionelle Hilfe zu suchen, sich Unterstützung durch einen Psychotherapeuten zu holen. Doch in den Fünfziger-, Sechzigerjahren? Da wurde verdrängt. Man war ja schon mit ganz anderem »fertig geworden«. Der Krieg war schließlich vorbei. Haltung war alles. Gefühle zulassen war keine Option.
Meine Eltern stammten aus Berlin. In Braunschweig suchten sie sich keine Freunde. Wie zwei Mammutbäume stehen sie da, in meiner Erinnerung. Stumm (er)trugen sie die Last ihres Schicksals und schnitten Gefühle, die sie irritierten, einfach ab.
Zwischen diesen Mammutbäumen tapste nun also Klein-Nina herum, ständig um Aufmerksamkeit und Liebe bettelnd. Meine Eltern gaben mir alles, was sie konnten. Unsicher und verloren blieb ich trotzdem. Denn ich spürte ja: Irgendetwas war anders. Irgendetwas stimmte nicht.
Und so begann ich zu suchen. Nach etwas, das mich stark macht, das mich hält. Zunächst war das der Erfolg in der Schule. Freundinnen fühlten sich leicht überfordert von mir. So viel Nähe, so viel Ausschließlichkeit wie ich brauchten sie nicht.
Als ich dann zwölf wurde, wuchs das nagende Gefühl, dass gute Noten nicht reichten, um den Grauschleier zu durchstoßen. Er lag über allem, was ich erlebte. Aus ihm war auch meine Schüchternheit gewebt. An die Lerneinheit: »Einfach mal leben« traute ich mich nicht mal aus der Ferne heran. Ich hatte so wenig festen Boden unter den Füßen, wie sollte ich da Experimente wagen? Nein, nur hinter dem Wohnzimmersessel fühlte ich mich einigermaßen sicher.
Dennoch ahnte ich bereits damals, dass die Farben des Lebens in Wirklichkeit viel satter waren, als ich sie wahrnehmen konnte. Und ich ahnte, dass ich Rockzipfel und Wohnzimmersessel verlassen musste, um den Grauschleier zu zerreißen. Ich hatte nur noch keine Ahnung, wie.
Eines Nachmittags nahm dieses Wie Form an. Buchstabenform. Ich war zwölf und saß mit meiner besten Freundin auf dem Bett in meinem »Jugendzimmer«. Wir philosophierten. Das taten wir täglich. In uns beiden blubberte die einsetzende Veränderung. Unsere Eltern nervten, und die blöden Jungs waren plötzlich gar nicht mehr so blöd. Haare zu Rattenschwänzen binden und freundlich den Müll runtertragen – sollte es das gewesen sein? Fing das Leben nicht eben erst an? Aber wie? Nur eins war uns klar: das »richtige« Leben, das pulsierte nur dort, wo keine Eltern den Takt vorgaben … Wir sehnten uns danach, selbstbewusster zu sein. Freier. Heiterer. Was also tun? Wie denken? Wohin wollen? Darüber also philosophierten wir. Und dann, an diesem Nachmittag, stand er da, an uns gelehnt, ein schlichter Satz: »Wo die Angst ist, geht es lang.« Woher wir ihn hatten – ich erinnere mich nicht mehr. Doch er war für mich ein pubertärer Erkenntnisblitz. Ja, es war Angst! Mein Handeln und Fühlen, das steuerte nicht ich, von wegen! Das war fremdgesteuert. Von etwas anderem, von diesem merkwürdigen Tier in mir, vor dem ich mich fürchtete und das ich verabscheute.
»Wo die Angst ist, geht es lang.«
Mein Gott, tat das gut. Tu das, wovor du Angst hast, und die Angst schwindet. Und das mir! Dem Mädchen im Käfig aus Angst.
Nur wer sich bewegt, spürt seine Fesseln. Wir wollten stark sein und frei. Ich wollte lernen, wie Leben geht. Ich wollte Farben sehen.
Irgendwann später, in einer meiner vielen Selbstentwicklungsphasen, entdeckte ich Hermann Hesse und mit ihm das geniale sprachliche Bild aus seinem Roman Demian: »Der Vogel kämpft sich aus dem Ei. Das Ei ist die Welt. Wer geboren werden will, muss eine Welt zerstören. Der Vogel fliegt zu Gott.« Genauso war es. Das war ich! Endlich fühlte ich mich verstanden. Den letzten Satz ließ ich allerdings erst mal weg. Gott war für mich das Konstrukt der Etablierten, der interessierte mich nicht. Was den Vogel allerdings nicht davon abhielt, zu Gott zu fliegen. Aber das verstand ich erst deutlich später.
Zunächst kümmerte ich mich mal darum, meine Welt zu zerstören. Der klassische Widerspruch der Pubertät: Erkennen, dass Halt und Orientierung aus einem selbst kommen müssen. Die beiden Mammutbäume, die sollten mir nicht mehr das Sonnenlicht nehmen. Doch es war so geschützt und gemütlich nah an ihrem starken Wurzelgeflecht und unter ihrer weit entfernten Krone. Oh weh! Wurzel und Krone! Hatte ich das selber schon? Na, eins war klar: Wachsen konnte ich nur, wenn ich mich groß fühlte. Zugeben, dass ich unsicher war, ging also gar nicht. Immer die Selbstsichere mimen! Für meine Eltern muss diese Zeit grauenhaft gewesen sein. Denn granatenschnell wurde ich das, was man als »frühreif« etikettierte. Mit 14 tummelte ich mich in der Braunschweiger Drogenszene, mit 15 wechselte ich die Freunde im Wochentakt, mit 16 war ich Parteimitglied des KBW (Kommunistischer Bund Westdeutschland), also links außen in der kommunistischen Studentenszene, und mit 17 hatte ich Abitur. Mathematik und Physik waren meine Schwerpunktfächer gewesen.
Einen Tag nach dem Abi zog ich zu meinem Freund und mit Studienbeginn in eine WG. Und siehe da: Je mehr ich von dem zertrat, was meine Eltern für mich vorgesehen hatten, desto farbiger wurde mein Leben. Ich hatte null Geld, und das engte mich furchtbar ein, aber ich genoss mein freies, unkontrolliertes Leben.
Das war typisch für meine Generation. Die Achtundsechziger hatten die Mauern niedergerissen, und nun testeten wir aus, was sich hinter den Fassaden der starren gesellschaftlichen Vorgaben befand. Besonders wir Frauen stießen hier auf vermeintliches Niemandsland. Keine Generation vor uns hatte jemals die Chance auf ein derart selbstbestimmtes Leben gehabt.
Da ich so früh begonnen hatte, im Außen alles wegzureißen, was ich als einengend empfand, begann ich auch früh, mich dem Innen zuzuwenden. Ich suchte nach dem, was mich erden könnte. Auch in dieser Hinsicht war ich sicherlich typisch für meine Generation. Bhagwan, Yoga, biodynamische Ernährung, Selbsterfahrungsgruppen, Sufi-Tanz und Psychokurse … ich ließ nichts aus. Genau definieren konnte ich mein inneres Ziel allerdings nie. Ich suchte Ruhe, Gelassenheit, Selbstbewusstsein, Glücksfähigkeit. So in etwa.
Ja, und dann, nach einigen Semestern, begann der Zauber des Ausprobierens und des Entdeckens unmerklich seinen Glanz zu verlieren. Routine schlich sich ein. Schon seit zwei Jahren war derselbe Mann an meiner Seite, im Studium war die Belastung konstant hoch, und so verlor ich Stück für Stück den roten Faden meiner Suche, den Zugang zur Sehnsucht, das Gespür für das große schwarze Loch in mir.
Das Sollen-Wollen-Müssen eines anspruchsvollen Studiums fuhr gedanklich Karussell mit mir. Phasen des Müßiggangs, in denen die Seele die Navigation eines Tages, einiger Stunden übernahm, gab es nicht mehr. Ich überließ mich, mein Leben, meine Gefühle, dem Diktat meiner flirrenden Gedankenwelt. Yoga verkam zur körperlichen Ertüchtigung. Ich funktionierte gut in der kompetitiven Massenuniversität. Ich schaffte sämtliche Aufnahmeprüfungen, auch die in organischer Chemie.
Und so verpuffte der Zauber des Aufbruchs mit den Knallgasreaktionen der chemischen Seminare. Die lila Latzhose als Signal meiner Verweigerung aller bürgerlichen Klammern und Werte war plötzlich out. Ich begann zu nähen und zu stricken. Nicht weil ich Rückfälle in die Häuslichkeit erlitten hätte, sondern weil ich modisch auffallen wollte. Ich fing sogar an mich zu schminken, was zu Beginn der Siebziger noch total out gewesen war. Auch vorher war ich ja alles andere als eine graue Maus gewesen, doch was nun begann, war die Suche – vielleicht auch die Sucht – nach Anerkennung von außen. »Glück ist, wenn sie dich toll finden«, davon war ich jetzt überzeugt. Am besten natürlich die Männer, und von denen möglichst viele. Das hatte ja schon fünf Jahre zuvor bestens funktioniert, doch damals war es noch so etwas wie ein spielerisches Austesten gewesen. Jetzt wurde es zum Prinzip.
Ich war also voll in der Hand meiner hauseigenen Gedankenpolizei. Die aufregenden Pfade nach innen hatte ich gekappt und das aufkeimende Mangelgefühl, den Mangel an Tiefe und Glück, einfach zugeklebt. Mit den Alltagsdrogen, die wir alle lieben: Erfolg, Anerkennung, Bewunderung. Ich war anders als all die anderen. Besser, hübscher, einfach toll.
Natürlich glaubte ich das – tief in mir drinnen – nicht. Und so tat ich alles dafür, damit es nach außen so aussah. Wohlgemerkt: Ich finde erfolgreiche, schöne und engagierte Menschen noch immer großartig. Doch heute ist entscheidend für mich, ob sie für die Sache brennen – oder für ihr Ego.
Zurück zum April 1976. Wir fuhren also in unserem klapprigen VW zur Konfirmation nach Kassel, wo sich die Sehnsucht, die ich so elegant weggesperrt hatte, plötzlich als Heulkrampf zurückmeldete.
Damit endete der erste Zyklus von Suchen und Verlieren in meinem Leben. Der erste von vielen. Es war die Suche nach dem tiefen Quell von Wärme, Liebe und Geborgenheit in mir selbst. Und ein Verlust war es, weil ich mir von meiner Gedankenpolizei immer wieder hatte einreden lassen, dass anderes noch viel lustvoller und schöner sei. Jedes Mal aber, wenn ich zurückfand in die Lust der Suche, spürte ich, dass ich schon längst fündig gewesen war. Und jedes Mal mehr. Dem Wandernden wird sich der Weg unter die Füße schieben.
Heute endlich, nach so viel Suchen und Verlieren, ist der zehrende Schmerz verschwunden, das schwarze Loch auf die Größe eines Stecknadelkopfes geschrumpft. Und das Bewusstsein für das, wonach ich suche, verlässt mich nicht mehr. Längst habe ich auch Worte dafür gefunden: Licht und die Liebe. Und heute weiß ich auch, wo ich beides finde: Mitten im Winter erkannte ich, dass in mir ein unbesiegbarer Sommer wohnt.
2
Und auf einmal steht es neben dir, an dich angelehnt. Was? Das, was du so lang ersehnt.
Meine erste Satori-Erfahrung
Es war am letzten Tag meines ersten Urlaubs in totaler Freiheit.
Ich war 17, hatte das Abitur in der Tasche, war in die Studentenbude meines Freundes gezogen und hatte mein erstes eigenes Geld verdient, bei Horten in der Herrenabteilung. 350 D-Mark waren dabei rausgesprungen, die mussten nun reichen für einen sechswöchigen Urlaub in Südfrankreich.
Heute schaudert’s mich, wenn ich daran denke – und auch damals fühlte ich mich weit entfernt von Happy-Go-Lucky. Wenig Geld kann ja ein Wegweiser fürs Wesentliche sein, doch sehr wenig Geld nervt einfach nur.
Geliehenes Zweimann-Zelt, wildes Campen, Plumpsklo und Kakerlaken-Dusche – so sah unser Urlaub aus. Zu essen gab es importierte Aldi-Dosen, dazu Weißbrot, Tomaten und Käse. Solche Knappheit beschränkt und macht die Seele eng. Glückshormone brauchen andere Quellen zum Sprudeln.
Doch natürlich gab es auch eine andere Seite der Medaille: unendlich viel Zeit. Lesen, Wandern, Zweisamkeit, die Wildheit der Pyrenäen entdecken. Der kleine Terrorist in meinem Hinterkopf paukte seine Parolen immer mehr ins Leere: Müssen! Sollen! Wollen! Seine Munition war weich geworden, sie löste sich auf.
Zeit raste nicht mehr, sie floss dahin. Gerüche wurden stärker, Farben auch.
Ich spürte, wie meine Seele es sich wohnlich machte in meinem Körper. Mein Atem wurde weicher, meine Gesichtszüge entspannten sich. Sechs Wochen … Zeit genug, um bei sich selbst anzukommen.
Schließlich kam die Rückfahrt. Der klapprige VW hielt durch. Lauer Wind beim Tankstellen-Stopp, die letzten Francs wurden verflüssigt. Kein Widerstand gegen gar nichts. Alles war, wie es war. Die Landstraßen zogen sich hin, weil die Autobahnmaut zu teuer war. Na und? Im Radio: A Long and Winding Road.
Und dann geschah es, auf Neudeutsch ein »Flash«. Doch solch eine Vokabel verpackt dieses faszinierende Erlebnis zu sehr in Stanniolpapier, als dass sie dessen Kern zeigen könnte, seine Tiefe, ja: seine Urgewalt.
Wir hatten unser Zelt für die letzte Nacht in einem Wäldchen an einem kleinen See in der Schweiz aufgeschlagen. Es war schon dunkel gewesen, als wir den Platz gefunden hatten, in der totalen Abgeschiedenheit.
Am Morgen danach wachte ich sehr früh auf. Um uns herum herrschte eine große, friedvolle Stille. Ich rollte mich ins Freie und ging ein Stück zum See hinunter. Die Sonne hing noch tief zwischen den Bäumen, und über dem Wasser lag ein feiner Dunst. Der Himmel war von durchsichtigem Blau. Alles hielt den Atem an. Bis heute rieche ich die moosige Erde und spüre jeden einzelnen Baum. Ein Vogel begann zu singen. Und plötzlich geschah etwas mit mir, etwas Überwältigendes, völlig Neues, das sich trotzdem seltsam vertraut anfühlte. Ich tat gar nichts. Ich stand nur da, wie angewurzelt, ein ganzes Stück noch vom Ufer entfernt, und es war, als sähe ich das spiegelnde Wasser, die Ufergräser, die Zweige und den Himmel zum ersten Mal. Alles, was mich umgab, umfing mich mit einer Kraft und Klarheit, die mich erschaudern ließ. Die Wucht des Gefühls, das in mir hochstieg, die Dimension des Glücks, die Sprachlosigkeit zugleich, all das zu erfassen – ich fühlte mich wie aus der Zeit gefallen.
Keine Ahnung, wie lange ich dort stand und staunte. Es war, als hätte die Natur mir gnädig ein Portal geöffnet, durch das ich gehen und eins sein durfte mit ihr. Wo ich herkam, wer oder was ich war, wohin ich wollte, mit mir, mit meinem Leben – nichts war von Bedeutung; kein Gedanke an gestern, heute, morgen.
Kein Gedanke! Das war es. Während ich da stand und von diesem pulsierenden Gefühl unendlicher Lebendigkeit übermannt wurde, spürte ich intuitiv: Wenn ich jetzt anfange nachzudenken, über das, was hier mit mir geschieht; wenn ich es analysiere und in Worte kastele, dann zieht es sich zurück. Diese enorme Energie will mit anderen Sensoren begriffen werden. Denn sie ist … heilig.
Mit Heiligkeit hatte ich damals eigentlich überhaupt nichts am Hut. Das war für mich eine Vokabel, die die Kirche zwecks geistiger Vernebelung der Gläubigen gepachtet hatte. Heiligkeit, pfui Teufel. Und dennoch – anders war diese Woge nicht zu beschreiben! Es war, als würde ich eine tiefe Wahrheit schauen, eine tiefe kollektive Wahrheit.
Und exakt in dem Augenblick, als ich das dachte, begann sich dieser wunderbare Zustand aufzulösen. Sakra! Nicht denken! Keine Worte! Auch nicht das Wort »Heiligkeit«! Intuitiv hatte ich den Schlüssel gefunden zu diesem Portal, das mir eine so überwältigende Welterfahrung eröffnet hatte. Nicht benennen, sondern Worte verbannen! Einfach nur sein. Bewusst sein.
Den Schlüssel sah ich also vor mir, doch es gelang mir nicht, ihn zu benutzen. Sosehr ich mich dagegen wehrte, ich rutschte in meinen banalen Normalzustand zurück. Wie ein Holzwurm bohrten sich wieder Gedanken in meinen Kopf und meine Seele. Wie viele Stunden würden wir noch bis Braunschweig brauchen? Wie kalt war wohl das Seewasser? (Es gab ja keine Dusche.) Himmel, da war ich gerade irgendwie erleuchtet gewesen, und jetzt dachte es mich so ein banales Zeug!
Ich ging wie auf Watte zum Zelt zurück und fühlte mich euphorisch und verwirrt zugleich. Von einer kristallklaren Erfahrung überwältigt, von Energie durchflutet und seltsam melancholisch. Ich hatte keine Ahnung, was da mit mir geschehen war, ich wusste nur eines: Dieses Unmittelbare, dieses Voll-da-Sein, dieses wahnsinnig intensive Pulsieren des Lebens – das wollte ich wiederhaben. Möglichst oft. Eigentlich immer. Es schien mir, als gäbe es nichts Schöneres, nichts Wertvolleres, nichts Faszinierenderes als dieses merkwürdige Im-Wald-Stehen-und-auf-den-See-Starren. Und noch etwas wusste ich: Diesen Zustand, den ich da gerade nur kurz erlebt hatte, den würde ich von nun an zeitlebens suchen. Mir war, als hätte ich ihn unbewusst, fast träumerisch, schon immer erahnt.
Gab es einen Weg, um solchen Erlebnissen künftig den Boden zu bereiten? Vielleicht könnte ich sie ja sogar bewusst herbeiführen?
Als Erstes beschloss ich, meditieren zu lernen. Ich ging davon aus, dass dies der Weg sein musste, um mich solch einem Zustand in Zukunft zu nähern. Es sollte eine ganze Weile dauern, bis ich begriff, dass diese Technik auch nur ein Hilfsmittel unter vielen anderen ist und nicht für jeden auf die gleiche Weise wirkt. Wie eine Brille für die Seele. Eine Brille muss ja ebenfalls sehr genau angepasst sein: Dioptrienzahl, Astigmatismus … jedes Auge ist anders. Dann muss man sie auch immer aufsetzen, wenn es nötig ist. Und schließlich gibt es Kontaktlinsen, die funktionieren noch mal ganz anders. Jedem das Seine, das gilt auch für Versenkungstechniken wie die Meditation. Aber davon später.
Noch etwas änderte sich in meinem Leben nach diesem magischen Morgen am See: Ich entwickelte eine Kopfmenschen-Allergie. Dabei war ich ja selbst ein Kopfmensch zu jener Zeit. Und was für einer! Marx-Lenin-Mao-Tse-Tung. Ich hatte mich quer durch die ultralinke Studentenszene ideologisiert. Doch das alles ekelte mich plötzlich an. Dieses Besserwissen, sich und die kommunistischen Zirkel als den intellektuellen Heilsbringer feiern, dieser Dünkel, der vermessene Glaube, die gesellschaftliche Erlösungsweisheit mit Löffeln gefressen zu haben … Mit dieser Arroganz der bornierten Linken war von einem Tag auf den anderen Schluss. Morgenstund hat Gold im Mund.
Weshalb beschreibe ich es nun aber so ausführlich, das Gold der Morgenstund? Warum erzähle ich Ihnen von dieser für einen Außenstehenden vielleicht eher weniger aufregenden Erfahrung am See so detailgenau?
Weil ich der Überzeugung bin, dass derartig wegweisende Schlüsselerlebnisse jeder schon gemacht, deren unendlichen Wert aber bislang vielleicht übersehen hat. In anderen Zeitaltern mag es religiöse Zeremonien und kollektive Kulte gegeben haben, die genau darauf abzielten, diese Erfahrung gemeinschaftsfähig und für alle elementar zu machen. Sicherlich hat auch unsere christliche Kirche dieses Potential. Und tiefgläubige Menschen erleben Gotteserfahrungen vermutlich auch heutzutage. Aber wer ist heute denn noch tief gläubig? Also liegt die Gotteserfahrung größtenteils brach. Und ich haderte sowieso mit der Etikettierung meines – ja, mystischen? – Erlebnisses: Kann das Wort »Gotteserfahrung« das treffende sein? Eigentlich mag ich nicht von Gott sprechen, weil die Vokabel zu verquer aufgeladen ist. Auf der Suche nach einem Wort, das diese Erfahrung passend umschreibt, habe ich einen Begriff aus dem Zen-Buddhismus entdeckt, der mich faszinierte. In ihm finden sich fast alle Facetten einer solchen heiligen Erfahrung. Er lautet: Satori.
Strenggläubigen Zen-Buddhisten wird mein Vokabelklau sicherlich nicht gefallen. Ich möchte sie deshalb in aller Form um Verzeihung bitten – und darum, genau hinzuschauen! Kann ein Satori nicht auch bei uns, im enorm verkopften Westen … ein Satori sein?
Der Zen-Buddhismus versteht unter Satori eine blitzartige und unerwartet auftretende Bewusstseinserweiterung – eine Art befristete Erleuchtung. Sie tritt unabhängig von intellektuellen Denkprozessen auf und wird als eine Befreiung vom Ich und vom Diktat der Zeit empfunden, heißt es. Ein Satori ist meist ein vorübergehender Zustand, der mit »unbedingten Glückserfahrungen« einhergeht.
Also ganz mein Morgen am See!
Und ich füge hinzu: Ein Satori ist von unschätzbarem Wert. Denn es macht uns nicht nur fast schockartig bewusst, wonach die Menschheit (um es ein wenig pathetisch zu sagen) ewig sucht, sondern es liefert zugleich das Gesuchte. Es ist Erfüllung, Ruhe, Frieden, Angekommensein – alles in einem. Das tiefe Glücksgefühl einer kraftvollen Lebendigkeit. Es nimmt die Angst und befähigt zu Liebe.
Ein Satori kann zum Leitstern Ihres Lebens werden, eben weil es exakt aus alldem besteht, wonach wir uns im tiefsten Innern sehnen.
Weshalb also diesen Glücksstern achtlos im Haufen unserer Erinnerungen verstauben lassen? Hängen wir ihn auf. Nutzen wir ihn. Machen wir ihn zu unserem GPS als tägliche innere Orientierung.
Dazu müssen Sie Ihr Satori aber erst mal finden! Wie gesagt, ich bin sicher, Sie hatten schon mal eins. Vielleicht fällt es Ihnen auf Anhieb ein. Sonst machen Sie sich auf die Suche, scannen Sie Ihre Erinnerung. Nehmen Sie sich Zeit dafür. Segeln Sie gedanklich durch Ihr Leben, und warten Sie ab, ob sich ein Bild zeigt, eine Erinnerung hochkommt, die einzigartig aufgeladen ist:
Ein Satori tritt wie gesagt blitzartig auf. Sie erfahren es immer nur ganz allein; es lässt sich nicht teilen. Es kommt zu Ihnen fast immer in der Natur. Allerdings nicht in Stressphasen. Stress ist so abschreckend für Satoris wie ein Elektrozaun. Ein Satori ist ein überwältigendes Gefühl, das weit über das hinausgeht, was ein toller Sonnenuntergang an Wow-Effekt bewirken kann. Es ist ein kurzes Eintauchen in … ja, was? Worte gibt es dafür keine. Sagen wir: Es ist ein Eintauchen in die Kraft des Seins. Farben leuchten, Atem fließt, Zeit steht still.
Ein Satori brennt sich in die Seele ein. Trotzdem wird es in den meisten Fällen sehr schnell verschüttet von der allgegenwärtigen Flut der Alltagsgedanken. Graben Sie es aus! Legen Sie es frei! Vertiefen Sie sich in innere Bilder, und locken Sie das großartige Gefühl wieder herauf, das diese Bilder trägt. Sie können auch mit vertrauten Menschen gemeinsam auf die Suche gehen, indem Sie ihnen von Erinnerungen mit starker Leuchtkraft berichten. Nahe Menschen können Ihnen ein Satori spiegeln.
Wenn Sie dann eines entdeckt haben: Spüren Sie ihm nach. Konzentrieren Sie sich auf Details, die aus Ihrer Erinnerung aufsteigen, und achten Sie besonders auf die damit verbundenen Gefühle und Empfindungen. Baden Sie in Ihrem Satori. Wiederbeleben Sie es! Irgendwann gehört es ganz zu Ihnen und wird zu einem kostbaren Schatz.
Die Frage ist nur: Wo wollen Sie ihn aufbewahren? Wo ist es sicher verwahrt und sorgsam geschützt?
Legen Sie Ihr Satori in einem Winkel Ihres Inneren ab, den Sie jederzeit erreichen. Machen Sie sich bewusst, wo es liegt, und erinnern Sie sich selbst immer wieder sehr bewusst daran. Ich hege und pflege drei Satoris, die ganz gemütlich in meinem dritten Auge liegen, also mittig zwischen den Augenbrauen, etwa ein Zentimeter Richtung Stirn.
So, spätestens an dieser Stelle dürfte der eine oder andere von Ihnen beginnen, an meiner Zurechnungsfähigkeit zu zweifeln, ich weiß. Aber probieren Sie es einfach aus. Schließen Sie die Augen, vergegenwärtigen Sie sich Ihr Satori und finden Sie einen Ort in Ihrem Körper, wo es gut aufgehoben und abrufbar ist.
Ich hüte meine Satoris sehr sorgfältig. Wenn man sie schludrig behandelt, nur mal schnell, husch, husch, einen inneren Blick darauf wirft, unkonzentriert und dem besonderen Wert dieser Seins-Erfahrung nicht würdig, nutzen sie sich ab. Daher bringe ich ihnen stets großen Respekt und besondere Sorgfalt entgegen. Ich bin mir ihrer möglichst oft bewusst, habe sie sozusagen als zweite Erinnerungsebene im Hintergrund. Immer dann, wenn sie mir im Alltagsgewusel zu entgleiten drohen, hole ich sie mir zurück. Praktisch als eine permanente Erinnerung an den unschätzbaren Wert des Lebens.
Sind meine Sinne mal wieder ordentlich vernebelt von all dem Stress und den vielen Eindrücken, die jeden Tag auf mich einströmen, dann suche ich mir einen stillen Moment, atme tief ein, und beim Ausatmen rolle ich die Erinnerung an mein Satori aus. Nein, das unbeschreibliche Glücksgefühl von damals stellt sich nicht »on demand« ein. Doch seine Strahlkraft genügt, um mein inneres Hamsterrad zu stoppen, dem zwanghaften Kreisen der Gedanken den Stecker zu ziehen. Wenn mir das Satori-Entfalten sehr konzentriert gelingt, entspannt sich mein Körper, und meine Sinne nehmen wieder mit ganzer Kraft ihre Arbeit auf: Farbensehen, Hören, Atmen, Fühlen – die Welt wird reich. Eine große Ruhe steigt auf. Woher?
Davon später.
Jetzt freunden Sie sich zunächst mit Ihrem Satori an. Machen Sie sich bewusst: Es ist Ihr ureigener, auf Sie und Ihre Seele maßgeschneiderter Schlüssel zu dem unbesiegbaren Sommer, der in Ihnen wohnt. Nur Sie selbst können ihn für sich entdecken, und nur Sie allein können ihn sorgsam bewahren: Nur von Ihnen hängt es ab, ob seine Kraft, seine Botschaft, seine Heiligkeit auf Dauer wirken kann. Und wenn Sie sensibel geworden sind, bereit für den Zustand dieser kleinen, hoch energetischen, so überraschenden wie beglückenden Erleuchtung … dann könnte es sein, dass Sie Satoris mehrfach erleben – und zwar mit steigender Frequenz. Welche wollen Sie als Ihre sehr persönlichen Orientierungsmarken bewusst aufbewahren? Gibt es andere, die Sie eher ungenutzt deponieren? Nicht wichtig. Hauptsache, Sie wählen bewusst aus. Hauptsache, Sie entscheiden sich für das eine oder für mehrere, die Sie mit dem Gefühl von Wahrheit und Authentizität als Leitstern für Ihre innere Ausrichtung nutzen möchten. Meiner Erfahrung nach bleiben Satoris stärker präsent, wenn ich sie mir notiere. Obwohl ich mit so einem Werkzeug des Intellekts in genau diesem Zusammenhang auch fremdele. Doch wenn ich unter dem unmittelbaren Eindruck einer Satori-Erfahrung schreibe, dann gelingt es mir, tatsächlich Worte für das nicht wirklich Beschreibbare zu finden. Zumindest ich selbst bin dann später in der Lage, zum Wort das Bewusstsein aufleben zu lassen, das wahr war.
Es wird seine Zeit brauchen, bis Sie gelernt haben, Kraft aus Ihrem Satori zu schöpfen. Je intensiver Sie es nutzen, desto stärker wird seine Signalstärke.
Wenn Sie es ihm erlauben, wird es immer mehr einfach da sein in Ihrem Leben. Es wird Sie erinnern, bei allem, was Sie auch tun, dass es da etwas gibt, das unendlich viel größer ist als Sie, als Ihr Ego, als unsere kollektive Existenz. Es wird Ihnen Frieden schenken, Stabilität und Gelassenheit. Und irgendwann wird es Ihnen helfen, das Portal nach innen zu öffnen, zu dem unbesiegbaren Sommer … aber das erwähnte ich ja bereits.
3
Die Tyrannei des Denkens
Nur wer sich bewegt, spürt seine Fesseln
Mein faszinierendstes Satori hatte ich vor einigen Jahren an einem sehr speziellen Ort, nämlich im Sinai. Dort liegt mitten in der Wüste eines der ältesten Klöster der Christenheit: das Katharinenkloster, das heute griechisch-orthodox ist. Man erreicht es nach stundenlanger Busfahrt von Sharm-el-Sheik aus.
Ich war innerlich überhaupt nicht vorbereitet auf eine so elementare Begegnung jenseits meiner eingefahrenen Wahrnehmungsmuster. Obwohl – im Nachhinein betrachtet – die Voraussetzungen dafür stimmten. Ich befand mich mit meiner Schwester fernab vom Alltagstrubel auf einer Kreuzfahrt von Bombay nach Athen. Zwar war ich an Bord nicht als Passagier, sondern gehörte zur Besatzung, doch trotzdem hatte ich das Privileg, dieselben Annehmlichkeiten wie die Gäste genießen zu dürfen. Mein Job bestand darin, das nachmittägliche Bordfernsehen und die Abendveranstaltungen zu moderieren. Das bedeutete durchaus viel Arbeit, denn ich bereite mich auf jeden Auftritt ordentlich vor.