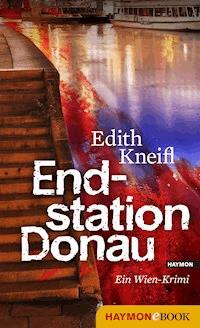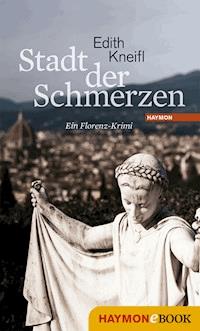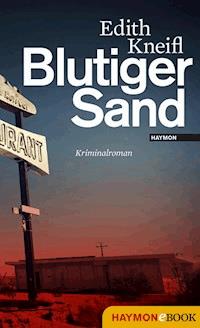13,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Haymon Verlag
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
Wenn behagliche Schummrigkeit auf die dunkelsten Seiten der Wiener Seele trifft, ermittelt Psychoanalytiker Arthur Lang Herzschmerz vergeht … solange er dich nur im metaphorischen Sinne trifft Arthur, Psychoanalytiker mit Vaterproblemen, ist nach dem Abtritt des Verursachers derselbigen wieder in der Spur. Die gerade in Fahrt gekommene Beziehung mit seiner angehimmelten Maya endete in intensiver Freud-Lektüre – alleine, nicht im Sinne eines ungewöhnlichen Dates. Maya wollte ihren Toni nicht verlassen – Wiens Gastroszenenmogul und ihr um einiges älterer Chef, der ihr weit mehr bietet als nur pünktliche Gehaltszahlungen. Ungeachtet des romantischen Interessenskonflikts trifft es Arthur, als Toni in seiner Bar, in der Arthur noch immer mehr Zeit verbringt, als angemessen wäre, getötet wird. Im Fokus der Verdächtigungen ist nicht nur dessen Gattin (ja, eheliche Treue ist in diesen Kreisen ein interpretationsoffenes Konzept) sondern auch Maya. Wer gehört dringender auf die Couch? Der Patient oder doch der Psychoanalytiker? Das Daily Business nimmt auf dieses Drama allerdings keine Rücksicht, und Arthur versucht, inmitten der Probleme seiner Patient*innen und den eigenen Problemen, den Kopf nicht zu verlieren. Das ist gar nicht so einfach, vor allem dann, wenn man nicht Geister, sondern immer wieder einen Wolf um die Ecke huschen sieht. Bei Geistern könnte sich Arthur zumindest sicher sein, dass mittlerweile nicht nur seine Patient*innen halluzinieren. Halt sucht Arthur bei seiner neuen Flamme Katja. Nicht nur Halt, sondern auch die Heilung der von der Beziehung mit Maya davongetragenen emotionalen Blessuren. Jetzt müsste nur noch das klappen, wogegen er in seinem Beruf eigentlich ankämpft: Das ungute Gefühl, das sich anschleicht, soll sich bitte ins Unterbewusstsein verdrücken. Der Tod ist ein Wiener. So wie Edith Kneifl, die ihm literarisch unter die Arme greift Edith Kneifl, das ist doch die mit den netten, atmosphärischen Wien Krimis? Jein. Atmosphärisch sind sie auf alle Fälle: schummrige Bars, die beweisen, dass gemütlich-abgeranzt und nachlässig-abgeranzt zwei Paar Schuhe sind, Wiens Prachtbauten, daneben der Donaukanal in der Dämmerung … Nett geht es in den Kneifel’schen Krimis allerdings nicht immer zu. Zielsicher lockt Edith Kneifl ihre Protagonist*innen in den Schatten und bringt sie dort in brenzlige Situationen. Dabei lässt sie uns in ihre Köpfe blicken, zu denen sie die Schlüssel als ausgebildete Psychoanalytikerin natürlich parat hat. Dass wir darin Charaktere voller Widersprüche erkennen, lässt uns umso mehr mitfiebern, ob sie dem Schatten entkommen können.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Edith Kneifl
DerunheimlichePatient
Ein Wien-Krimi
Inhalt
Cover
Titel
Widmung
Motto
Teil I
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
Teil II
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
Teil III
45.
46.
47.
48.
49.
50.
Die Autorin
Impressum
für Ernestine
„Es sind nicht alle Menschen liebenswert.“
Dr. Sigmund Freud
TEIL I
Der Mann auf der Herrentoilette wusste, dass er nur mehr ein paar Sekunden zu leben hatte.
Nach ihm hatte eine schlanke, dunkel gekleidete Gestalt die Toilette betreten. Er drehte sich nicht um, erschrak erst, als er im Spiegel über dem Waschbecken, das sich knapp neben dem Pissoir befand, sah, dass die Person eine Strumpfmaske über dem Kopf trug, in einer Hand ein Messer hielt und in der anderen ein seltsames Gerät, das einem Rasierapparat ähnelte.
Ehe er reagieren konnte, spürte er etwas Heißes an seinem Hals. Er heulte auf vor Wut und Schmerz.
Eine glänzende Klinge fuhr in einem Bogen auf ihn zu. Traf ihn im Rücken. Ein Schwall von Blut schoss hervor, verspritzte verschiedene Rottöne auf die Wand und das Pissoir.
Obwohl er den Stich, der seine Lunge verletzte, kaum spürte, ging er zu Boden.
Die unheimliche Gestalt zog das Messer aus der Wunde, holte zum zweiten Stich aus und stieß ihm die Klinge bis zum Anschlag neben dem Brustbein zwischen die Rippen hindurch ins Herz.
Hilflos starrte der Mann, der auf dem gefliesten Boden lag, auf den roten Fleck an seinem weißen Hemd. Sein Blick wanderte ein Stück weiter nach unten.
Mit offener Hose zu sterben, war entwürdigend. Vergeblich versuchte er, den Reißverschluss seiner Jeans zu schließen. Er besaß keine Kraft mehr, war nicht mehr fähig, sich zu bewegen.
Das Rauschen in seinem Kopf übertönte alle anderen Geräusche.
Sein Stöhnen ging in leises Röcheln über. Ein letztes Aufbäumen des schweren Körpers. Seine glasigen Augen verdrehten sich. Aus seinem Mund sickerte Blut. Dann war alles vorbei. Toni Fontana war tot.
1.
Wien im August. Mörderische Hitze. Selbst des Nachts kühlte es nicht ab.
Mein Laken war durchgeschwitzt. Meine Haare klebten am Nacken. Ich nahm mir vor, sie demnächst millimeterkurz zu schneiden. Oder sollte ich mir eine Klimaanlage zulegen? Das monotone Geräusch des Ventilators strapazierte meine Nerven. Solche und ähnlich banale Überlegungen hielten mich wach.
Gegen drei Uhr morgens schlief ich endlich ein. Doch mir war kein ruhiger Schlaf vergönnt. Nach kurzer Zeit schreckte ich auf.
Unheimliches Geheule hatte mich geweckt. Leicht benommen starrte ich auf ein rötlich-gelbes Licht.
Ein einäugiger Wolf?
Ich hatte lange keine optischen Halluzinationen mehr gehabt. Früher, vor allem kurz nach dem Tod meines Vaters, träumte ich öfter von Wölfen und sah sogar welche. Eigenartig, dass mir das jetzt wieder in den Sinn kam.
Ich tastete nach meiner Brille am Nachtkästchen. Sie lag nicht dort. Mit zusammengekniffenen Augen schaute ich mich um.
Die unwirklich klingenden Laute kamen von draußen. Offensichtlich wehte ein starker Wind. Meine Balkontür stand offen. Der dünne Vorhang bauschte sich auf, formte ein seltsames Gebilde.
Das rot-gelbe Auge des Wolfes entpuppte sich als Standby-Licht meiner neuen, sündhaft teuren Stereoanlage.
Kaum war ich wieder weggedöst, klingelte mein Handy. Der digitale Wecker auf meinem Nachtkästchen zeigte zehn nach fünf an.
Um diese frühe Stunde kommen nie gute Nachrichten. Höfliche Menschen rufen zu zivileren Zeiten an.
Ich hob nicht ab.
Das Handy begann erneut zu klingeln.
Ich meldete mich mit: „Doktor Lang“, in der Annahme, dass es nur ein sehr verzweifelter Patient wagen würde, mich zu dieser unchristlichen Stunde aus dem Bett zu holen.
„Ich bin’s“, flüsterte eine jugendliche Stimme. „Du musst herkommen.“
„Jonas?“
„Es ist wichtig. Wir brauchen deine Hilfe.“
„Was ist passiert?“
„Er ist tot. Jemand hat ihn erstochen.“
„Wie bitte? Wer wurde erstochen?“
„Toni.“
„Oh, mein Gott!“
Mein Herz setzte einen Schlag lang aus.
„Was genau ist geschehen?“
„Nicht am Telefon.“
„Wo bist du?“
„In der Bar …“
Er hatte „wir“ gesagt. War Maya bei ihm?
Bevor ich ihn fragen konnte, legte er auf.
Jonas war der neunzehnjährige Sohn von Maya Marin. Sie war die Geschäftsführerin der etwas heruntergekommenen Blauen Bar in der Wiener Innenstadt. Nicht zu verwechseln mit der schicken Blauen Bar im Hotel Sacher.
Ach, Maya! Dieser wundervollen Frau verdankte ich viele schlaflose Nächte. Ich hatte sie seit drei Monaten nicht gesehen. Unsere leidenschaftliche Affäre hatte nicht lange gedauert. Sie war nicht bereit gewesen, ihr langjähriges Verhältnis mit ihrem Chef Toni Fontana zu beenden. Und ich war wiederum, aufgrund meiner Lebensgeschichte, nicht imstande gewesen, eine Dreiecksbeziehung einzugehen. Daher zog ich einen radikalen Schlussstrich und brach den Kontakt zu ihr ab. Anders hätte ich es nicht geschafft, von ihr loszukommen.
Schmerzhaft erinnerte ich mich an ihre Worte bei unserem letzten Treffen: „Ich bin nicht auf der Suche nach emotionalen Komplikationen. Und ich brauche keinen Mann, um mich komplett zu fühlen. Ich komme gut allein zurecht.“
Damals war ich sehr wütend auf sie. Denn sie machte sich selbst etwas vor. Meiner Meinung nach war sie nicht nur finanziell, sondern auch emotional von Toni abhängig gewesen.
Rasch verdrängte ich diese Erinnerungen. Ich liebte Maya, wie ich keine andere Frau je geliebt hatte. Obwohl ich kurz nach der Trennung meine jetzige Partnerin kennenlernte, sehnte ich mich immer noch nach ihr, träumte von ihren schönen grünen Augen, ihrem geheimnisvollen Lächeln, ihren roten Haaren, die in der Sonne glänzten wie Goldfäden, von ihren wundervollen Brüsten und ihren zarten Händen, die kräftig zupacken konnten. Oft stellte ich mir vor, wie ich mein Gesicht in ihrem dichten, lockigen Haar vergrub, meine Hände zärtlich ihre Brüste streichelten.
Ich träumte nicht nur fast jede Nacht von ihr, meine Gedanken waren auch tagsüber ständig bei ihr. Ich hörte ihre erotische Stimme, ihr Lachen und verwechselte auf der Straße jede rothaarige Frau mit ihr. Ich wünschte mir, sie zu küssen, mit ihr zu schlafen …
Erotische Fantasien waren momentan nicht angebracht. Die Realität holte mich zurück aus meinen Träumen. Mayas Sohn benötigte meine Hilfe. Ich sollte mich besser beeilen.
Ohne mich zu duschen oder wenigstens zu rasieren, schlüpfte ich in die Jeans, die ich gestern getragen hatte, und zog ein frisches T-Shirt an.
Beim Zähneputzen ließ sich ein Blick in den Spiegel nicht vermeiden.
Ich fand, dass ich entsetzlich aussah, nicht nur, weil ich unrasiert war. Mein schmales, melancholisches Gesicht war leicht sonnenverbrannt. Meine Wangen waren eingefallen und die dunklen Ringe unter meinen Augen würde meine neue Brille kaum verbergen.
Meine alte Nachbarin Caroline Čećnik hatte gelacht, als sie mich zum ersten Mal mit dieser Nickelbrille sah. Sie meinte, ich würde aussehen wie John Lennon, wenn er mein Alter erreicht hätte.
Mein Fünfziger stand im Herbst bevor. In meinem schwarzen Haar zeigten sich erste graue Strähnchen. Auch die vielen Falten um Augen und Mund ließen sich nicht mehr übersehen. Da ich mit meinem Aussehen noch nie zufrieden gewesen war, schenkte ich all den Anzeichen des nahenden Alters keine besondere Beachtung.
Das Wiedersehen mit Maya nach so vielen Monaten löste eine leichte Nervosität bei mir aus, Zeit für einen Kaffee musste aber sein. Während ich mir einen doppelten Espresso herunterließ, dachte ich an Jonas’ Worte.
Toni Fontana, der große Zampano, dem vier Lokale in der Wiener Innenstadt gehörten, war ermordet worden. Das bedeutete: Ich war meinen Rivalen endgültig los.
Schämst du dich nicht, Arthur?
Erschrocken fuhr ich zusammen. Früher hatte ich öfters die Stimme meines verstorbenen Vaters gehört. Seit der Exhumierung und Obduktion seiner Leiche, bei der sich herausstellte, dass er höchstwahrscheinlich eines natürlichen Todes gestorben war, hatte er mich jedoch in Ruhe gelassen.
Meine fixe Idee, dass seine zweite Frau ihn getötet hatte, konnten die Gerichtsmediziner nicht bestätigen. Die Spuren, die ich an seinem Körper erwartete, wurden nicht gefunden. Ein Rest von Zweifel war mir trotzdem geblieben.
Die Exhumierung war eine komplizierte Angelegenheit gewesen. Zahlreiche Genehmigungen mussten besorgt werden. Ein Bestatter und das Einverständnis der Kirche waren vonnöten. Jemand vom Gesundheitsamt musste dabei sein. Sichtschutzwände und Beleuchtung wurden herangeschafft, da der ganze Zirkus nachts vor sich ging, um die Friedhofsbesucher nicht zu sehr zu irritieren.
Zuerst eine Wolf-Halluzination und jetzt die Stimme meines Vaters. Ging der Wahnsinn erneut los?
Im November vorigen Jahres war ich anlässlich des Begräbnisses meines Vaters nach Wien zurückgekehrt. 25 Jahre lang hatte ich keinen Fuß in meine Heimatstadt gesetzt, stattdessen in Berlin gelebt und gearbeitet. Den Kontakt zu meinem tyrannischen und gewalttätigen Vater hatte ich komplett abgebrochen, da ich ihn, ein Jahr nach dem Selbstmord meiner Mutter, an dem ich ihm die Schuld gab, mit meiner Freundin Nadine beim Vögeln erwischt hatte.
Ich hasste es, seinen Namen zu tragen. Ich hasste die Frau, die meine erste große Liebe war, mich betrog und später dann meinen Vater heiratete. Ich hasste es, dieselbe Luft einzuatmen wie die beiden, und übersiedelte in einer Nacht- und Nebelaktion nach Berlin.
Dass Nadine es mit der Treue nicht sehr ernst nahm, spürte nach den Honeymoon-Jahren auch mein Vater, denn Nadine betrog auch ihn, mimte nach seinem unerwarteten Dahinscheiden dann aber die trauernde Witwe.
***
Viertel vor sechs. Ich bestellte ein Taxi. Wer weiß, ob ich an einem Sonntagmorgen unterwegs so schnell eines finden würde. In fünf Minuten sollte es vor meiner Haustüre stehen.
Rasch trank ich meinen Kaffee aus und begab mich auf die Suche nach meiner Geldbörse.
Bevor ich losging, riss ich alle Fenster und die Balkontür auf. Die Luft war abgestanden. Außerdem roch es in der Wohnung nach Marihuana. Meine 85-jährige Nachbarin Caroline hatte mich gestern – wie beinahe jeden Abend – besucht und mit ihren Joints eingenebelt.
Ich hatte die 220 Quadratmeter große Altbauwohnung meiner Eltern in einem der weniger attraktiven Ringstraßenpalais geerbt. Die in die Wohnung integrierte, wenn auch abgetrennte orthopädische Privatordination meines Vaters ließ ich zu einer psychoanalytischen Praxis umgestalten.
Meine Psychoanalyse-Patienten behandelte ich in 45-minütigen Sitzungen, mehrmals wöchentlich. Genau genommen war ich Psychiater, der sich zum Psychoanalytiker weitergebildet hatte. Das bedeutete, ich empfing in meiner Rolle als Psychiater psychisch Erkrankte, die ich medikamentös einstellte. Im Grunde interessierte mich aber nur meine Arbeit als Psychoanalytiker, denn Medikamente zu verordnen war nicht mein Ding.
Manchmal hatte ich es satt, meine durch ihre Neurosen beschränkt einsatzfähigen Patienten zum Funktionieren zu bringen. Ihre Produktivität zu steigern – könnte man aus der Perspektive der Leistungsgesellschaft auch sagen. In solchen Momenten träumte ich von einer Karriere als Barpianist, obwohl mir bewusst war, dass dieser Job kein Honiglecken war. Wahrscheinlich würde es mir auf Dauer fehlen, die Seelen kranker Menschen zu ergründen und dafür zu sorgen, dass sie wieder arbeits- und beziehungsfähig wurden. Auch wenn man als Barpianist vielleicht ebenfalls eine spezielle Form von Kummerkasten war.
Aber heute war Sonntag, die Praxis war geschlossen, und ich hatte ein anderes, dringlicheres Problem.
Als die Wohnungstür hinter mir ins Schloss fiel, bemerkte ich, dass ich den Schlüssel drinnen vergessen hatte. Fluchend lief ich die Treppe hinunter.
2.
Der Erste, den ich sah, als ich vor der Blauen Bar aus dem Taxi stieg, war der versoffene alte Privatdetektiv Dieter Klein, der mich seit unserer gemeinsamen Verwicklung in eine Reihe von Mordfällen seinen Freund nannte.
Mittlerweile waren wir tatsächlich befreundet. Ich war eigentlich ein Einzelgänger, aber diesen mürrischen, verlässlich angetrunkenen Expolizisten mochte ich komischerweise.
Dieter trug eine rot-weiß gestreifte Pyjamahose und darüber einen Regenmantel, der sich über seinem Bauch nicht mehr schließen ließ.
Er klopfte mir mit seinen kräftigen Pranken auf die Schulter und zischte mir ins Ohr: „Ich hab dich lieber heraußen abgepasst. Wir müssen kurz reden. Die zwei da drinnen sind komplett durch den Wind. Ich hab kein vernünftiges Wort aus ihnen rausgekriegt.“ Sein Atem stank nach Bier und sein nackter Oberkörper verströmte einen unangenehmen Schweißgeruch.
Mir war leicht übel. Ich machte einen Schritt zurück.
Er rückte nach und flüsterte: „Angeblich hat Mayas kleiner Liebling den Toten entdeckt. Maya war nach der Sperrstunde allein mit ihm, mit Toni, meine ich, in der Bar. Sie haben fürchterlich gestritten.“
Ich hatte Schwierigkeiten, seinem Gebrabbel zu folgen.
„Willst ihn sehen?“
Ich nickte.
„Hast du schon gefrühstückt? Ist eine Mordssauerei. Man braucht einen starken Magen, wenn man so eine übel zugerichtete Leiche untersuchen will.“
„Keine Angst, ich bin nicht Psychoanalytiker geworden, weil ich kein Blut sehen kann.“
„Das sagt man doch, oder?“
„Ich weiß. Ist ein alter Medizinerwitz.“
„Der Jonas ist umgekippt, als er ihn entdeckt hat.“
„Weil er eine Blutphobie hat, was in seinem Fall, denk an seinen drogenabhängigen Vater und seine eigenen zwielichtigen Geschäfte, ein glücklicher Umstand ist. Denn mit Hämatophobie, so heißt die Blutphobie offiziell, geht oft die Angst vor Spritzen und Kanülen einher. Die Gefahr, dass er sich irgendwas von dem Zeug, das er verscherbelt, selber spritzt, ist also minimal.“
Dieter blickte mich skeptisch an.
„Komm, lass uns reingehen.“
Ich fürchtete mich vor dem Wiedersehen mit Maya. Wir hatten uns, wie gesagt, in den vergangenen drei Monaten nie mehr getroffen. Jonas bin ich öfter über den Weg gelaufen. Vor allem dann, wenn er meiner Nachbarin Caroline Nachschub brachte. Er machte gute Geschäfte mit Haschisch und Gras. Caroline bevorzugte Letzteres.
Maya lehnte hinter der Theke und starrte durch mich hindurch, als ich die Blaue Bar betrat.
Ich hatte so viele Tage, Wochen, ja Monate damit zugebracht, an sie zu denken, von ihr zu träumen, dass mich ihre Gegenwart überwältigte. Es durchlief mich heiß und kalt bei ihrem Anblick. Ich blieb in der Tür stehen und schaute sie entsetzt an.
Sie schien sich von dem Schock noch nicht erholt zu haben. Ihr schönes Gesicht war angespannt und schmaler, als ich es in Erinnerung hatte. Der Knoten in ihrem Nacken, der ihre lange rote Lockenpracht bändigte, war in Auflösung begriffen. Während sie mit gleichförmigen Bewegungen die ohnehin saubere Theke abwischte, versuchte sie, sich die Haare aus dem Gesicht zu streichen, was ihr mit den gelben Gummihandschuhen, die sie trug, nicht gelang. Ihre Augen wirkten verweint. Reste ihrer Wimperntusche klebten auf ihren leicht geröteten Wangen. Heute sah man ihr die 39 Jahre ausnahmsweise an.
Mein erster Impuls war, sie in die Arme zu nehmen und fest an mich zu drücken. Ich gab dieser Regung nicht nach, sondern grüßte sie, ohne ihr die Hand zu reichen.
Ich hatte mir unser Wiedersehen nach all den Monaten ganz anders vorgestellt. In vielen Tagträumen hatte ich mir ausgemalt, wie wir einander umarmen und leidenschaftlich küssen würden.
„Er ist tot, und außer uns war niemand …“ Der Rest des Satzes wurde von einem Schluchzer abgewürgt. Sie schlug beide Hände vors Gesicht.
Ich bemerkte die Gänsehaut auf ihren nackten Unterarmen.
Mit meiner Zurückhaltung war es zu Ende. Ich beugte mich über die Theke, löste die Hände von ihrem Gesicht und sagte mit belegter Stimme: „Hab keine Angst. Es wird sich alles aufklären.“
Sie schniefte, sah mich noch immer nicht an, sondern griff nach einer Serviette und putzte sich die Nase.
„Es fällt mir schwer, darüber zu sprechen“, flüsterte sie.
Ich schwieg, ließ ihr Zeit.
„Was soll ich bloß machen? Mein Leben ist ein einziger Scherbenhaufen. Ich kann nicht so tun, als wäre ich in Toni verliebt gewesen. Aber er war mein Freund, mein Geliebt…“ Sie brach ab, als ihr bewusst wurde, mit wem sie sprach.
Auch ich war ihr Geliebter gewesen. Doch es war nicht der richtige Zeitpunkt, um die alte Geschichte aufzuwärmen.
„Wo ist Jonas?“, fragte ich.
„In der Küche“, sagte sie leise und rieb sich die vom Weinen verquollenen Augen.
„Wäscht er sich noch immer die Hände?“, fragte Dieter. „Hat er das nicht schon vor einer halben Stunde erledigt?“
„Ihm graust so entsetzlich“, sagte sie.
„Es ist nicht nur das Blut. Ich hab … hab noch nie im Leben einen Toten gesehen“, vernahm ich Jonas’ Stimme aus der Küche.
Dieter, der wegen seines kaputten Knies nicht imstande war, lange zu stehen, setzte sich an einen Vierertisch.
„Hockt euch her. Du auch, Jonas! Wir haben einiges zu besprechen“, sagte er in harschem Ton.
Maya schien zu bemerken, dass ich auf die blitzblanke Kaffeemaschine schielte.
„Kaffee?“, fragte sie und ging hinter die Theke, ohne meine Antwort abzuwarten.
Jonas blickte weder Dieter noch mich an, als er sich widerwillig zu uns setzte.
Der rothaarige Junge sah aus wie ein ausgemergelter Junkie. Seine Jeans hingen ihm tief über den Hintern. Er war barfuß und sein Oberkörper war nackt.
Wenn die Situation nicht so ernst gewesen wäre, hätte ich garantiert zu lachen begonnen. Da saß ich nun in den frühen Morgenstunden zwischen zwei halb nackten Männern am Tisch, ließ mir von einer völlig aufgelösten Frau Kaffee servieren und ein paar Meter weiter lag eine Leiche.
Die Stimmung war angespannt.
Jonas war kreidebleich. Seine Hände zitterten.
„Und du hast den Toten gefunden?“, bemühte ich mich, ein Gespräch in Gang zu bringen.
Er nickte.
„Wann hast du ihn entdeckt?“
„Um vier. Ein Unwetter hat sich zusammengebraut. Ich wollte mich in der Blauen Bar unterstellen. War gerade in der Nähe.“
„Hat dir Toni nicht unlängst Lokalverbot erteilt?“, mischte sich Dieter ein.
„Ja, aber ich wusste nicht, wohin. Um diese Uhrzeit hat alles zu. Zu mir nach Hause konnte ich nicht.“
„Die albanische Mafia ist hinter ihm her. Wegen der Scheißdrogen.“ Mayas Stimme klang heiser. Ihre Worte waren kaum zu verstehen.
„Es geht nicht um mich. Mein Erzeuger ist den Albanern Geld für die letzte Lieferung schuldig geblieben. Charlie ist untergetaucht. Jetzt verlangen sie, dass ich für den Alten bleche.“
„Wenn dich dieses Arschloch nicht endlich in Frieden lässt, bringe ich ihn um“, stieß Maya wütend hervor.
„Na, na, ein Toter am Tag reicht“, nuschelte Dieter.
„Könntet ihr bitte aufhören. Lasst Jonas endlich erzählen“, sprach ich ein Machtwort.
Jonas schnäuzte sich lautstark, schilderte uns dann aber relativ gefasst, was passiert war. „Ich war patschnass, als ich die Bar erreicht hab. Sie war schon zu. Durch das Fenster habe ich drinnen Licht gesehen. Mama hat auf mein Klopfen nicht reagiert. Sie hört beim Putzen meistens Musik und hat ihre Kopfhörer aufgehabt. Also bin ich durch die offen stehende Toreinfahrt und habe es beim Hintereingang, der zu den Toiletten der Bar führt, probiert. Er war zu, aber unverschlossen. Gleich am Gang vor den Klos ist mir der Geruch von Blut und Urin in die Nase gestiegen. Da habe ich sofort gewusst, dass ich in Schwierigkeiten steckte. Die Tür der Herrentoilette war nur angelehnt. Ich hab sie mit dem Fuß aufgestoßen und das Licht angemacht. Und da ist er gelegen. Überall war Blut. Auf seinem Hemd, seiner Hose, an der Wand und am Pissoir …“ Er schüttelte sich vor Ekel. „Ab dann weiß ich nichts mehr. Vielleicht habe ich geschrien oder auch nicht. Vor meinen Augen ist alles verschwommen und ich bin umgekippt.“
„Jonas kann kein Blut sehen“, sagte Maya.
„Ich weiß. Lass ihn weitererzählen“, bat ich sie.
„Als ich wieder zu mir gekommen bin, lag ich auf dem Bauch des Toten und hab ein Messer in der Hand gehalten“, seufzte er.
„Ja, so habe ich ihn gefunden“, sagte Maya. „Wahrscheinlich hat er sich am Messergriff festhalten wollen, als er in Ohnmacht gefallen ist. Seine Finger waren mit Blut beschmiert und auch auf seinem T-Shirt waren Blutflecken.“
„Hör auf, sonst wird mir gleich wieder schlecht“, stöhnte Jonas.
„Ich habe ihm das Messer abgenommen und sein T-Shirt sofort verbrannt.“
„Weil du geglaubt hast, ich hätte ihn erstochen“, sagte er in vorwurfsvollem Ton.
„Nein, um Gottes willen! Ich stand unter Schock, ich wusste nicht, was ich tat …“ Sie begann zu weinen.
Ihren Tränen gegenüber war ich machtlos. Ich quälte sie nicht weiter mit Fragen. Doch sie begann von selbst zu erzählen. „Er ist mit einem von meinen Fleischmessern getötet worden. Aus dem Messerblock fehlen zwei. Ich habe vorhin nachgesehen. Aber die kann jeder genommen haben. Während der Arbeit liegen sie manchmal irgendwo in der Küche herum …“ Sie hielt inne, schaute mich verzweifelt an.
Der Eingang zur Küche befand sich hinter der Theke. Sie hätte es bemerken müssen, wenn jemand an ihr vorbeigeschlichen wäre.
„Habt ihr deswegen nicht sofort die Polizei verständigt, sondern zuerst Dieter und mich?“
„Mama wollte dich nicht belästigen, sondern eh gleich die Polizei anrufen“, verteidigte Jonas seine Mutter. „Aber ich war dagegen. Wir haben doch beide kein Alibi.“
Maya senkte den Kopf und flüsterte kaum hörbar: „Ich war’s nicht.“
„Ich sehe mir Toni mal an“, sagte ich mit belegter Stimme.
„Wozu?“, fragte Jonas.
„Hast du vergessen, dass er Arzt ist?“, sagte Dieter. „Ich bleib da. Mit Toten hab ich’s nicht so. Außerdem hab ich schon einen schnellen Blick auf ihn geworfen. Rühr ihn nicht an, Doktor, oder borg dir Gummihandschuhe von Maya aus. Sonst finden sie deine Fingerabdrücke auf ihm. Sein Gewand hab ich bereits durchsucht. Sein Portemonnaie ist weg, ebenso sein protziger Siegelring und seine Uhr. Ich tippe deswegen auf Raubmord. Es war allgemein bekannt, dass Toni oft eine größere Menge Bargeld bei sich trug. Höchstwahrscheinlich war’s ein Junkie.“ Er sah Jonas an. Dieters normalerweise sanft entrückter Blick konnte von einer Sekunde auf die andere sehr scharf werden.
„Klar, wer sonst?“, schnauzte der Junge ihn an.
Die beiden standen nicht auf dem besten Fuß miteinander. Die Abneigung des Exbullen gegen Drogensüchtige und vor allem gegen Dealer saß tief.
Dieter hatte jahrelang bei der Drogenfahndung gearbeitet und von einem flüchtenden Dealer einen Schuss ins Knie abbekommen. Daraufhin musste er den Dienst quittieren. Er gründete dann gemeinsam mit einem Freund eine Privatdetektei. Nachdem dieser Freund unfreiwillig das Zeitliche gesegnet hatte, kamen kaum mehr Aufträge herein. Mit 58 fand er nicht so leicht einen neuen Job.
„Und du hast wirklich nichts gehört?“, fragte ich Maya, bevor Jonas und der Alte sich ernsthaft in die Haare kriegten.
Sie schüttelte den Kopf.
„Mama hat ihre Kopfhörer aufgehabt. Sie hat auch mein Klopfen nicht gehört“, antwortete Jonas statt ihr.
„Die Hintertür war offen, oder?“, fragte Dieter.
„Ja, das habe ich dir vorhin schon gesagt“, murmelte Jonas.
Ich erinnerte mich, dass Maya die Hintertür immer erst zusperrte, nachdem sie einen Rundgang gemacht hatte, also kurz bevor sie die Bar verließ.
„Ich bringe es am besten gleich hinter mich.“ Ich stand auf.
„Vergiss nicht die Gummihandschuhe, falls du doch was anfasst“, rief Dieter mir nach.
3.
Nichts kann einen auf einen derartigen Anblick vorbereiten, auf das Entsetzen, die Verwirrung, die Wut, die einen in so einem Moment überkommt.
Toni war ein großer, kräftiger Mann, nicht dick, besaß aber einen schweren Körperbau.
Als ich ihn in der Blutlache erblickte, drehte sich mir der Magen um. Ich konnte gut verstehen, dass Jonas umgekippt war. Der Anblick war auch für Menschen ohne Angst vor Blut schwer zu ertragen.
Was für ein Gemetzel! Toni war übel zugerichtet worden. Sein Mörder hatte mehrmals zugestochen. Diese sinnlose Brutalität schien mir eine pathologische Machtdemonstration zu sein.
Ein letztes Mal betrachtete ich das Gesicht meines Rivalen, das einschüchternd wirkte, wenn man es aus der Nähe sah: hohe Stirn, breite Nase, sinnlicher Mund, energisches Kinn.
Jemand hatte ihm die Augen geschlossen. Ich nahm an, es war Maya.
Aus der Damentoilette drang leichter Brandgeruch herüber. Hatte Maya das T-Shirt ihres Sohnes dort verbrannt?
Ich holte tief Luft, beugte mich über die Leiche, zog den Gummihandschuh aus und berührte Tonis linkes Handgelenk. Die Haut war nicht vollständig erkaltet. Obwohl ich von Pathologie nur wenig Ahnung hatte, war mir klar, dass er noch nicht lange tot war.
Ich sah mir die Stichwunden genauer an.
Der Lungenstich dürfte nicht tödlich gewesen sein. Gewiss hatte er ihn kaum gespürt. Ein Stich nahe am Brustbein, genau an der richtigen Stelle, dürfte ausschlaggebend gewesen sein. Der Täter hatte direkt ins Herz getroffen. Dies setzte anatomische Kenntnisse voraus. Außerdem waren da noch drei Bauchstiche. Ob ihm die danach zugefügt worden waren, konnte ich nicht einschätzen. Allerdings war ich mir sicher, dass er innerhalb von Minuten innerlich verblutet sein musste.
Normalerweise wiesen mehrfache Stichwunden auf einen Mord aus Leidenschaft hin.
Ich dachte wieder an Maya. Hatte sie die Abhängigkeit von Toni nicht länger ertragen? War aus Liebe Hass geworden?
Nein, das hielt ich für ausgeschlossen. Dennoch könnte es sich um eine Täterin handeln. Toni war zwar ein starker Mann, mit dem eine Frau nicht so leicht fertiggeworden wäre, aber die merkwürdige Verletzung an seinem Hals stammte womöglich von einem Taser.
Ich hatte in Berlin, als ich vorwiegend Drogensüchtige und Alkoholkranke behandelte, bereits einige Wunden zu Gesicht bekommen, die Elektroschocker der Polizei hinterlassen hatten. Tonis Verbrennungsmal erinnerte mich daran. Wahrscheinlich hatte ihn die Person zuerst außer Gefecht gesetzt und danach auf ihn eingestochen.
Aus dem Augenwinkel registrierte ich das Messer mit der blutverschmierten Klinge, das neben der Leiche lag. Mich schauderte.
Ich zwang mich dazu, mir das Messer genauer anzusehen. Ein scharfes Küchenmesser mit einer etwa 21 Zentimeter langen Klinge, an der Blut klebte, während der Griff sauber war.
***
Leicht verunsichert kehrte ich zu den anderen zurück und teilte ihnen meine Mutmaßungen mit.
Keiner reagierte. Jonas und Maya starrten in ihre Kaffeetassen. Dieter stürzte ein Seidl hinunter. Um seinen Spiegel aufrechtzuerhalten, vermutete ich.
„Ist es nicht ungewöhnlich, dass ein Mörder die Tatwaffe nicht verschwinden lässt?“, fragte ich den alten Privatdetektiv.
„Soll schon vorgekommen sein.“
„Ihr habt beide das Messer angefasst“, wandte er sich an Maya und Jonas.
„I… Ich hab es an… anscheinend rausgezogen, als ich auf ihn gefallen bin“, stammelte Jonas. „Mama hat meine Fingerabdrücke aber eh abgewischt.“
„Was Blöderes ist euch nicht eingefallen“, fauchte Dieter sie an.
„Lass ihn in Ruhe. Jonas hat Toni nicht ermordet“, fauchte Maya zurück. „Und jetzt hört mir mal zu. Toni ist kurz nach der Sperrstunde aufgekreuzt. Er hat sofort zu meckern begonnen, weil noch einige Gäste da waren. Er drohte, sie eigenhändig hinauszuwerfen. Es hat eine Rangelei gegeben. Ich hab mich nicht eingemischt, hab den Müll rausgetragen. Als ich zurückgekommen bin, waren alle weg. Ich hoffte, auch Toni wäre abgehauen, aber er war noch da und hat seinen Frust an mir ausgelassen.“
„Worum ging es?“
„Um das Übliche. Er plante, die Blaue Bar zu verscherbeln, weil er bis zum Hals in Schulden steckte. Toni hat sich mit der schicken Tageslounge, die er voriges Jahr eröffnet hat, übernommen. Sie läuft nicht. Und seine anderen beiden Restaurants gehören sowieso bereits zur Hälfte den Mafiosi …“ Sie schauderte und begann zu schluchzen.
„Beruhig dich! Bist du dir sicher, dass außer dir und Toni keiner in der Bar war?“, fragte Dieter.
„Wir waren allein. Er ist erst nach drei Uhr hier aufgekreuzt. Nachdem er alle rausgeschmissen hatte, haben wir etwa eine Viertelstunde miteinander debattiert. Irgendwann habe ich ihn einfach stehen gelassen und begonnen, in der Küche sauber zu machen. Ich habe nicht bemerkt, dass er auf die Toilette ist, ich dachte, er wär endlich gegangen.“
„Du hast also kein Alibi.“
Ungeduldig schüttelte sie den Kopf.
„Und du natürlich auch nicht“, sagte er zu Jonas.
„Mama könnte sagen, dass ich bei ihr in der Küche war und beim Aufräumen geholfen habe.“
„Das kaufen sie euch nie ab“, wandte ich ein.
„Manchmal ist es besser, kein Alibi zu haben als ein zu perfektes. Viel verdächtiger ist es, wenn man genau weiß, wo man wann war.“
„Alibi hin oder her“, unterbrach ich den Detektiv, der nach seinem zweiten Seidl in Schwafellaune war. „Wir sollten uns beeilen. Wenn noch mehr Zeit vergeht, bis ihr die Polizei anruft, werden die Bullen eher das verdächtig finden.“
„Sollen wir ihn nicht einfach fortschaffen?“, fragte Jonas. „Wir könnten ihn zu einer Baustelle bringen. Bei uns im Zweiten hab ich gestern zugeschaut, wie sie frischen Zement in eine Baugrube gegossen haben.“
„Alte Mafiamethode. Nicht schlecht. Jedenfalls besitzt du kriminelle Fantasie“, spottete Dieter und fuhr in scherzhaftem Ton fort. „Ich hätte einen einfacheren Vorschlag. Wir binden ihm einen Stein um die Füße und werfen ihn in den Donaukanal.“
„Es reicht! Bitte hört auf“, sagte Maya nun leise. Sie war während des Geplänkels zwischen Dieter und Jonas apathisch und mit hängendem Kopf dagesessen und hatte geschwiegen.
Jonas war zu überdreht, um auf seine Mutter zu hören. Er schlug vor, Tonis Leiche in der Kühltruhe zu verstecken, bis uns etwas Besseres einfiel.
Ich versuchte, das schwachsinnige Gespräch zu beenden, indem ich Dieter empfahl, der Polizei zu sagen, dass Jonas die Leiche um fünf Uhr früh gefunden hätte. Inzwischen war es halb sechs.
„Ihr könntet sagen, dass ihr unter Schock wart, was ja der Wahrheit entspricht. Ihr wolltet zuerst Dieter um Rat fragen, da ihr wisst, dass er gute Kontakte zur Kripo hat. Bis ihr ihn endlich wachgekriegt habt, hat es ein paar Minuten gedauert …“
„Deine kriminelle Energie ist ebenfalls nicht ohne, Doktor“, sagte Dieter grinsend.
Jetzt reichte es auch mir. „Ruf endlich die Polizei an“, forderte ich ihn auf.
Maya legte ihre rechte Hand auf meine. Ein paar Sekunden lang fühlte ich mich wie elektrisiert. „Danke“, flüsterte sie.
„Wofür? Ich war euch keine große Hilfe.“
„Schluss mit dem Süßholzgeraspel. Du solltest lieber abzischen, Doktor, bevor die Polizei anrückt“, sagte Dieter. „Du verkomplizierst nur alles, warst bereits in zu viele Mordfälle verwickelt.“
Ich musste ihm recht geben, obwohl es mich ärgerte, dass er mich ausgerechnet jetzt an die beiden Mordfälle erinnerte, in die ich involviert gewesen war.
Fast zwei Stunden, nachdem Jonas die Leiche entdeckt hatte, griff Dieter zu seinem Handy und rief die Kripo an.
Ich zögerte nach wie vor, Maya und Jonas im Stich zu lassen. „Ihr werdet einen Anwalt benötigen“, sagte ich zu ihr. „Ich könnte euch einen guten Strafverteidiger besorgen und dir, falls nötig, Geld … borgen.“
Ich wusste, dass sie von mir kein Geld annehmen würde.
Sie schluckte, sagte nichts. Ich spürte ihren Schmerz beinahe körperlich. Hatte sie Toni geliebt, obwohl sie das Gegenteil behauptete?
„Wir brauchen keinen Anwalt. Wir haben ihn nicht umgebracht“, sagte Jonas trotzig.
„Sei still. Du hast keine Ahnung“, brachte Dieter ihn zum Schweigen. Mit der anderen Hand machte er eine eindeutige Bewegung in meine Richtung. „Verzieh dich“, sagte er, bevor er der Beamtin am Telefon die Lage schilderte.
„Meinen Kaffee darf ich aber schon noch austrinken“, versuchte ich, meinen Abgang hinauszuzögern.
Maya stand auf, beugte sich zu mir herunter und flüsterte mir ins Ohr: „Geh bitte, Arthur.“
Zwar fühlte ich mich wieder einmal ausgeschlossen, doch ich protestierte nur halbherzig. Im Grunde war ich froh, nicht weiter in diese Katastrophe hineingezogen zu werden.
„Ruf mich an, wenn sie weg sind“, sagte ich zu Maya, als sie mich zur Tür brachte.
Beim Abschied legte sie ihre Hände auf meine Wangen und küsste mich auf den Mund.
Ich hielt sie fest, erwiderte ihren Kuss. Erst als ich in der Ferne die Sirene eines Polizeiwagens vernahm, ließ ich sie los.
An der nächsten Straßenecke blieb ich stehen und wartete.
Nach wenigen Minuten hielten mehrere Wagen vor der Bar. Ich sah zu, wie Beamte der Spurensicherung Gerätschaften hineintrugen. Kameras, Scheinwerfer, Absperrbänder …
Als ich die unsympathische Visage von Oberinspektor Wanneck erblickte, machte ich mich aus dem Staub.
4.
Nicht nur Tonis Ermordung, sondern vor allem Mayas Abschiedskuss hatte mich sehr aufgewühlt.
Ich hatte immer versucht, herauszufinden, was vor drei Monaten schiefgegangen war, was ich übersehen hatte, wie es gelaufen wäre, wenn ich im richtigen Moment das Richtige gesagt oder getan hätte.
Maya Marin war bei ihrer Großmutter in der Gumpendorfer Straße aufgewachsen. Sie war das Resultat eines One-Night-Stands. Ihre Mutter lebte seit vielen Jahren in einem indischen Ashram. Ihr Vater, ein Rumäne, wohnte in New York und betrieb dort ein Deli. Sie stand mit beiden kaum in Kontakt.
Als Maya mit neunzehn schwanger wurde, heiratete sie aus Verzweiflung ihren damaligen Freund, einen vermeintlich coolen Rockmusiker. Bald kam sie dahinter, dass er weder als Ehemann noch als Vater etwas taugte, und setzte ihn vor die Tür. Toni Fontana, für den sie vor ihrer Heirat als Kellnerin gearbeitet hatte, stand ihr nach der Scheidung bei. Dafür war sie ihm bis heute dankbar. Als er sie Jahre später zur Geschäftsführerin seiner Blauen Bar machte, fühlte sie sich ihm erst recht verpflichtet.
Ich wusste, dass ihr Toni vor vielen Jahren einen Heiratsantrag gemacht hatte, den sie ablehnte. Sie sei keine Wiederholungstäterin, hatte sie zu mir gesagt. Allerdings schlief sie noch immer mit dem um zwanzig Jahre älteren Mann. Sie nannte es ihr schlampertes Verhältnis. Und genau damit war ich nicht in der Lage gewesen umzugehen.
Seit ich mich nicht mehr mit Maya traf, war auch der Kontakt zu Jonas loser geworden. Ich gestand mir ein, dass ich von dem Burschen enttäuscht war. Er hatte zwei Monate in Berlin verbracht. Ich hatte ihm dort eine Wohnung vermittelt und ein paar Kontakte, da ich ja selbst 25 Jahre lang in Berlin gelebt hatte. Er trieb sich in der jungen Kunstszene herum und jobbte als Kellner in einem Café. Nach seiner Rückkehr nach Wien fiel ihm nichts Besseres ein, als wieder mit dem Dealen anzufangen. Laut Dieter arbeitete er wenigstens nicht mehr mit seinem ständig zugedröhnten Vater Charlie zusammen.
Ich vermisste die Abende in der Blauen Bar, blieb aber konsequent und war bis zum heutigen Tag nicht mehr dort gewesen.
Tonis Gesicht tauchte vor meinem inneren Auge auf. Seine erstarrte Miene, der verzerrte Mund. Das Grinsen des Todes, nannte man das.
Sein gewaltsamer Tod erschütterte mich mehr, als ich erwartet hatte. Ich spürte einen bitteren Geschmack auf der Zunge und mein Magen krampfte sich zusammen.
Verzweifelt versuchte ich, mich daran zu erinnern, wie er war, als er lebte. Und plötzlich sah ich ihn vor mir.
Sein schwarzer Humor, seine kumpelhafte Art, seine Hilfsbereitschaft … Ich hatte ihn gemocht. Wenn nicht die Sache mit Maya gewesen wäre, hätten wir Freunde werden können.
Tonis Vorfahren stammten aus Kalabrien. Sein Vater war einer der ersten italienischen Gastarbeiter in Wien gewesen. Er hatte als Kellner in einem Wiener Beisl angefangen, die Wirtstochter geheiratet, aus dem Gasthaus eine Pizzeria gemacht und seinem Sohn zwei italienische Restaurants in der Innenstadt übergeben. Toni kaufte später die Blaue Bar dazu und eröffnete zuletzt noch die Tageslounge Antonella, benannt nach seiner an Drogen verstorbenen Tochter. Die Lounge lief nicht besonders gut. Die beiden Restaurants befanden sich ebenfalls seit einiger Zeit in den roten Zahlen. Laut Maya gehörten sie zum Teil der Gastromafia.
Toni hatte, so wie fast alle Wirte, die Preise nach der Pandemie gewaltig erhöht. Gezwungenermaßen wegen der horrenden Energiekosten, wie er behauptete. Einheimische ließen sich daraufhin kaum mehr bei ihm blicken. Allein von dem Geschäft mit den vorwiegend italienischen Touristen, die bei ihm verkehrten, war es nicht möglich zu überleben.
Mir ging Mayas verzweifelter Gesichtsausdruck nicht aus dem Kopf. Je länger ich über diese Katastrophe nachdachte, desto klarer wurde mir, dass sie und Jonas in ernsthaften Schwierigkeiten steckten. Der Polizei würde gar nichts anderes übrig bleiben, als einen von beiden oder sogar beide wegen Mordverdachts festzunehmen.
Wie konnte ich bloß nach Hause gehen und mich seelenruhig ins Bett legen?
Drückeberger, hörte ich meinen Vater höhnen.
Obwohl mir bewusst war, dass ich mich wie ein trotziges Kind benahm, beschloss ich nun erst recht heimzugehen.
Ich warf einen Blick auf meine Armbanduhr.
Es war viel zu früh, um Caroline, die einen Zweitschlüssel für meine Wohnung besaß, herauszuläuten. Da sie nie vor drei, vier Uhr morgens ins Bett ging, schlief sie üblicherweise bis Mittag.
Ich war fast am Michaelerplatz angelangt, als ich kehrtmachte und zurück zur Blauen Bar eilte.
Dort sah es beinahe aus wie in einem Operationssaal. Grelles Scheinwerferlicht beleuchtete den ganzen Raum. Die Kriminaltechniker hatten auf der Theke ihr Werkzeug ausgebreitet: Skalpelle, Pinsel, Pinzetten, Beweismittelbeutel, Abstrichtupfer und Material zum Sichern von Fingerabdrücken.
Die Polizei war ebenfalls noch vor Ort. Oberinspektor Wanneck entdeckte mich sofort.
„Was haben Sie hier zu suchen?“, herrschte er mich an.
Die Antipathie war gegenseitig. Der Mann besaß die gleiche Habichtsnase wie mein Vater und ebenso eiskalte Augen. Widerwillig gestand ich mir ein, dass er mich einschüchterte.
Dieter, der mit Maya und Jonas hinter der Theke stand und gerade von Wanneck einvernommen wurde, erklärte ihm, dass er mich angerufen und gebeten hatte herzukommen.
Eine Notlüge. Sie schien den Oberinspektor jedoch zu besänftigen.
„Bleiben Sie, wo Sie sind. Sie können mir auch gleich ein paar Fragen beantworten“, sagte er in freundlicherem Ton zu mir.
Als er mir seinen Rücken zukehrte, kam ich einen Schritt näher und spitzte die Ohren.
Wannecks lautes Organ schallte durch die Bar. Maya und Jonas sprachen leiser. Sie verwickelten sich in Widersprüche.
Umso mehr sie sich in ihre Lügengeschichten verstrickten, desto nervöser wurde ich. Waren sie sich der Konsequenzen einer Falschaussage nicht bewusst?
Meistens durchschaute ich rasch, wenn mich jemand anlog. Ich hatte eine gewisse Routine darin, Lügen zu entlarven. Ausreden und Vorwände bekam ich bei meiner Arbeit als Psychoanalytiker genug zu hören.
Mir kam ein Gedanke, den ich am liebsten ignoriert hätte. Maya war eine temperamentvolle Frau. Hat sie etwa doch? Nein, hat sie nicht! Ich verwarf diese haarsträubende Vorstellung schnell wieder.
Als sie bei der Befragung plötzlich die Beherrschung verlor, fühlte ich mich erleichtert. Denn Verdächtige, die sich nicht aus der Ruhe bringen ließen, hatten sich ihre Antworten lange vorher zurechtgelegt, das wusste auch Oberinspektor Wanneck.
Als er sich endlich mich vorknöpfte, hatte ich mir bereits einige Antworten auf mögliche Fragen ausgedacht.
Ohne mit der Wimper zu zucken, tischte ich ihm meine Falschaussagen auf. Dass ich im Morgengrauen in der Bar war, verschwieg ich ihm. Und ich erwähnte auch nicht, dass ich mir Tonis Leiche genauer angesehen hatte.
Im Nachhinein war ich Dieter dankbar für den Tipp, Gummihandschuhe anzuziehen. Ich hatte die Handschuhe nachher in einen Mistkübel am Graben geworfen.
Zwar würden sie in der Bar Fingerabdrücke von mir finden, doch das war weiter nicht ungewöhnlich, hatte ich doch früher zu den Stammgästen gehört.
Wanneck forderte mich auf, demnächst auf dem Kommissariat vorbeizuschauen und das Protokoll meiner Aussage zu unterschreiben. Dann durfte, oder besser gesagt, musste ich gehen.
Ich warf Maya einen Blick zu und entfernte mich betont langsam.
Als ich bei der Tür angelangt war, hörte ich Wanneck folgende fatale Sätze zu Maya sagen: „Sie sind im Zusammenhang mit dem Mord an Toni Fontana wegen dringenden Tatverdachts vorläufig festgenommen. Sie haben das Recht, die Aussage zu verweigern … Alles, was Sie sagen, kann vor Gericht gegen Sie verwendet werden …“
5.
Das durfte alles nicht wahr sein. Maya war keine Mörderin. Was auch immer sie zur Polizei gesagt hatte, es hatte ihr zweifellos einen Platz ganz oben auf der Liste der Verdächtigen eingebracht.
Ich spürte, wie meine Kehle sich zuschnürte.
Ich war ein gebranntes Kind. Denn es war mir bereits einmal passiert, dass ich einer mir nahestehenden Person keinen Mord zugetraut hatte, die Hand für sie ins Feuer gelegt hätte und mich massiv getäuscht hatte.
Ich vermied es, so gut ich konnte, über die grauenvollen Ereignisse im Frühjahr nachzudenken. Das klappte nicht immer. Vor allem nachts quälten mich surreale Bilder von dem toten Mann, der von einem Wolf ausgebuddelt worden war und den Dieter und ich zusammen entdeckt hatten. Der alte Expolizist gestand mir einmal, dass auch er bis heute unter Alpträumen litt.
Mein Haus an der Alten Donau, wo sich besagter Mord ereignet hatte, vermietete ich an UNO-Beamte aus Taiwan, die nicht ahnten, was hier vorgefallen war. In ein paar Jahren, wenn die böse Geschichte vergessen war, wollte ich das Haus verkaufen. Immer wieder dachte ich auch an meine Patientin, die in dieser Zeit durch eine Überdosis Schlafmittel gestorben war. Auch an ihrem Tod war ein Bekannter von mir nicht ganz unschuldig. Was wäre gewesen, wenn ich die Protagonisten von damals eher durchschaut hätte? Wenn ich schneller reagiert hätte? Was wäre gewesen, wenn ich meiner Patientin geglaubt hätte, anstatt sie nur als pathologische Lügnerin zu sehen. Wäre, hätte, sollte … die Vergangenheit kann niemand ändern.
Maya hatte mir in dieser aus mehreren Gründen schweren Zeit geholfen, indem sie mir zuhörte. Sie war mindestens eine gleich gute Zuhörerin wie ich, folgte meinen Hasstiraden gegen meinen verstorbenen Vater ebenso geduldig wie meinen Schwierigkeiten, mich in Wien einzugewöhnen, und ertrug auch meine Verzweiflung darüber, dass ich mich in meinen mörderischen Bekannten so getäuscht hatte.
Ja, mein Herz gehörte nach wie vor Maya. Aber es war eine Tatsache, dass ich jetzt mit Katja zusammen war.
Katja Radek und ich hatten uns bei dem Mordprozess kennengelernt. Kurz nach Ende des Prozesses wurden wir ein Paar.
Die 38-jährige deutsche Journalistin war eine toughe Frau. Resolut, klug, ehrgeizig. Sie stammte aus dem Osten Berlins. Als Kleinkind war sie noch in den Genuss einer kommunistischen Erziehung gekommen. Entsprechend forsch und entschlossen trat sie bis heute auf. Der Schein trog, wie so oft.
Katja war aus einer toxischen Beziehung nach Wien geflüchtet. Nach allem, was sie mir über ihren früheren, langjährigen Freund erzählt hatte, hielt ich diesen Typ für einen Psychopathen. Er hatte sogar ihr Auto angezündet, als sie ihm drohte, sich von ihm zu trennen, wenn er nicht bereit war, seine Familie zu verlassen. Er hatte das zwar jahrelang versprochen, aber nicht im Traum daran gedacht, seinen Vorsatz je in die Realität umzusetzen.
Ich fragte mich, wie sich so eine starke, selbstbewusste Frau in so einen Mann verlieben konnte. Als ich sie besser kennenlernte, begriff ich, dass ihre vermeintliche Selbstsicherheit nur vorgespielt war. Im Grunde war sie ein unsicherer Mensch.
Katja hatte es in Wien von Anfang an nicht leicht gehabt. Viele Wiener verhielten sich eher abweisend gegenüber Ausländern. Und Deutsche waren schon gar nicht beliebt. Sie fand keine Freunde, dafür war sie in ihrem Job mit vielen Rivalinnen konfrontiert. In den ersten Monaten fühlte sie sich besonders einsam. Möglicherweise war das mit ein Grund gewesen, warum sie sich so intensiv um mich bemühte.
Ich hatte nichts von einer Beziehung wissen wollen, hatte nur mit ihr geschlafen, um wenigstens für ein paar Stunden Maya zu vergessen. Katja war hartnäckig geblieben. Sie wollte mich um jeden Preis. Und sie bekam immer, was sie wollte. Das hatte sie mir später verraten.
***
Montagmorgen begann ich gleich nach dem Frühstück herumzutelefonieren. Ich hatte Glück. Einer meiner Kollegen war mit einer bekannten Strafverteidigerin befreundet und legte mir eine Rutsche zu ihr. Eine knappe Stunde später suchte ich sie in ihrer Kanzlei auf. Sie schien sich ernsthaft für den Fall zu interessieren. Als ich ihr sagte, dass ich bereit war, eine Kaution für Maya zu stellen, machte sie mir Hoffnung, Maya morgen freizukriegen.
Am frühen Nachmittag erschien mein erster Patient.
Ich fühlte mich erschöpft, sehnte mich nach einem Mittagsschläfchen. Das konnte ja eine heitere Sitzung werden.
Jede Sitzung mit Sascha Käfer begann ähnlich wie die vorherige. „Haben Sie gut geschlafen? Quälen Sie wieder Alpträume? Wie steht’s mit wahllosen Gedanken, Flashbacks, Panikattacken?“
Manchmal beantwortete er meine Fragen einsilbig. Meistens ließ er sie schweigend über sich ergehen.
Zu Beginn seiner Psychoanalyse hatte er mir ständig von seinen Computerspielen erzählt. Er sprach über die Figuren, als wären sie reale Personen. Anfangs dachte ich, er rede von seinen Freunden oder Verwandten.
Obwohl ich kaum Erfahrung mit kleinen Kindern besaß, wusste ich, dass viele von ihnen, vor allem im Vorschulalter, ebenfalls völlig in dieser Fantasiewelt aufgingen.