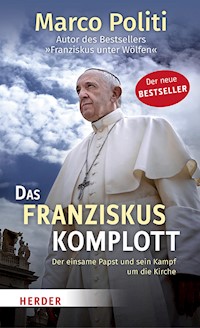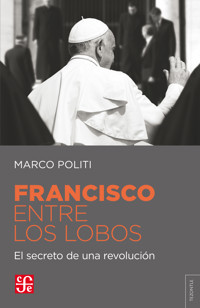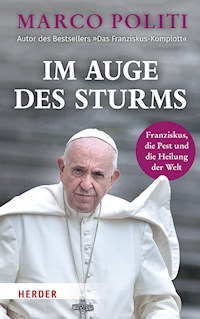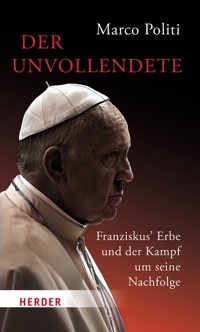
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Verlag Herder
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Sprache: Deutsch
Seit über zehn Jahren herrscht Bürgerkrieg im Vatikan. Papst Franziskus hat in seinem Pontifikat den Kurs der »Synodalität« eingeschlagen – ein Reformweg, der die Kirche in eine ungewisse Zukunft führt. Die Reaktionen darauf sind eine Mischung aus Zustimmung, Unbehagen, Enttäuschung, Vertrauen, sogar Hass. Viele Gläubige und Prälaten hatten sich das Pontifikat anders vorgestellt. Marco Politi beleuchtet diese kritische Übergangszeit mit gewohnt herausragender Expertise. Mit exklusiven Einblicken hinter die Kulissen der Kurie zeigt er nicht nur die spannenden Wirrnisse und abgründigen Schattenseiten auf, sondern stellt sich den drängenden Fragen: Wohin steuert die Kirche? Und welchen Papst suchen die Kardinäle mit Blick auf das nächste Konklave?
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 322
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Buchvorderseite
Titelseite
Marco Politi
Der Unvollendete
Franziskus’ Erbe und der Kampf um seine Nachfolge
Aus dem Italienischen von Gabriele Stein
Impressum
© Verlag Herder GmbH, Freiburg im Breisgau 2025Hermann-Herder-Str. 4, 79104 FreiburgAlle Rechte vorbehaltenwww.herder.de
Bei Fragen zur Produktsicherheit wenden Sie sich an [email protected]
Umschlaggestaltung: geviert.comUmschlagmotiv: © Stefano Spaziani
E-Book-Konvertierung: Daniel Förster
ISBN Print 978-3-451-39745-5ISBN E-Book (EPUB) 978-3-451-83688-6
fürMaia
Inhalt
Kapitel I.Wirre Zeiten
Verunsicherung prägt den Herbst des Pontifikats von Jorge Mario Bergoglio. Es herrscht ein Klima der Anspannung und Ungewissheit. »Zurzeit ist alles in der Schwebe«, gesteht ein Veteran der Kurienwelt. »Franziskus ist müde … Die Erwartung eines Wechsels breitet sich aus … Wollen wir hoffen, dass er zumindest seine zentralen Ideen verankern kann.«
Abends brennt kein Licht in dem Appartement im dritten Stock des Apostolischen Palasts. Franziskus hat sich zu Beginn seiner Amtszeit dagegen entschieden und es vorgezogen, in Santa Marta, dem Gästehaus des Vatikans, zu wohnen. Manche hoffen, dass die Lichter in der päpstlichen Wohnung wieder angehen und ein traditionellerer Papst wieder in die Räumlichkeiten seiner Vorgänger einzieht. Andere jedoch ‒ wie Christopher Coyne, Erzbischof von Hartford in den USA ‒ sind der Meinung, der Vatikan solle Rom den Rücken kehren und sich einen anderen Standort suchen, weil der kuriale Stil an den Ufern des Tiber allzu verknöchert und selbstbezüglich sei.1
Dieser Seitenhieb eines vom Papst selbst ausgewählten Bischofs zeigt, dass die alten Bezugspunkte nicht mehr so unverrückbar feststehen wie einst. Alles ist in Bewegung. Auch die respektvolle Ehrerbietung der Gläubigen, denen Zutritt zum Apostolischen Palast gewährt wird, scheint zu schwinden. Bei der Gratulationscour zu Ehren der 21 neuen, vom Pontifex im September 2023 kreierten Kardinäle erschien eine buntgemischte Besucherschar, die eher auf ein Kreuzfahrtschiff als in den Apostolischen Palast gepasst hätte. Damen und Herren in Schwarz neben Gruppen in legerer Kleidung, Kaugummi kauende Frauen in Spitzenkleidern, High Heels und Turnschuhe, Krawatten und offene Hemdkragen. Und jede Menge Selfies mit den neuen Purpurträgern.
In den Abendstunden, wenn das Gewimmel der Pilger und Touristen zur Ruhe kommt, wird die Szenerie wieder von den massigen Umrissen des Petersdoms beherrscht. Fassade und Kolonnaden sind geschickt illuminiert. Auf dem nunmehr menschenleeren Platz fallen die großen Fernsehbildschirme ins Auge, die bei den Zeremonien zum Einsatz kommen. Unter Berninis mächtigen Säulen schlagen Gruppen von Obdachlosen ihre Zelte auf. Aus einem Taschenradio klingt Musik.
Ein Hauch von Ewigkeit liegt in der Luft. Doch der Schein trügt.
Nach über zehnjähriger Amtszeit sind Franziskus’ Pflichten nicht weniger geworden. Er ist noch immer viel auf Reisen. Er war in der Demokratischen Republik Kongo, im Südsudan, auf dem Weltjugendtag in Portugal, in der Mongolei und auf dem Treffen der Bischöfe des Mittelmeerraums in Marseille. 2024 hat er Luxemburg und Belgien besucht und eine extrem anstrengende Reise in den Fernen Osten ‒ nach Indonesien, Papua-Neuguinea, Osttimor und Singapur ‒ unternommen.
Er hat 30 Nobelpreisträger aus aller Welt in den Vatikan eingeladen, um für eine Wirtschaft einzutreten, die der »Sehnsucht aller Völker nach Gerechtigkeit« Rechnung trägt, und um zu einem weltweiten Waffenstillstand aufzurufen. Er hat bei beiden Versammlungen der Weltsynode der Bischöfe den Vorsitz geführt, seinen Gesandten zu Friedensbemühungen nach Kiew, Moskau, Washington und Peking geschickt, die Veröffentlichung von Dokumenten über den päpstlichen Primat und über die übernatürlichen Phänomene und die Geschichte von Međugorje angeregt und das Apostolische Schreiben Laudate Deum verfasst, in dem er die Staaten dazu aufruft, sich der Verantwortungslosigkeit ihres Handelns bewusst zu werden und ernsthaft gegen die Klimakrise anzugehen.
Franziskus’ religiös-sozialer Elan hat keineswegs nachgelassen. Er ist davon überzeugt, dass die Zukunft der Menschheit auf dem Spiel steht. »Das enorme technologische Wachstum«, so schreibt er, »ging nicht mit einer Entwicklung des Menschen in Verantwortlichkeit, Werten und Gewissen einher«.2 Dieses Missverhältnis werde durch das Aufkommen der künstlichen Intelligenz noch verschärft.
Sein verständnisvoller und fester Blick, seine sanfte Stimme und seine spontanen Gesten sind faszinierend wie eh und je. Und doch weht ihm ein heftiger Wind entgegen. Seine Botschaft der menschlichen Solidarität, mit der er sich vom Petersplatz aus dem Wüten der Covid-Pest entgegenstemmte, ist mit den beinharten Interessen der wirtschaftlichen und politischen Potentaten zusammengestoßen. »Wir sitzen alle im selben Boot. Entweder sind wir alle Brüder und Schwestern, oder es bricht alles zusammen«, hatte Franziskus in jenen dramatischen Monaten des Jahres 2020 ausgerufen, als die Welt in Angst und Trauer zu versinken drohte. Der Chefredakteur einer großen italienischen Tageszeitung wird dieser Aussage später eine etwas andere Pointe geben: »Wir fahren alle über dasselbe Meer ‒ aber die Boote sind unterschiedlich!«
Seit dem Ende der Pandemie ist nämlich nicht nur der Vorschlag einer kostenlosen Vergabe von Lizenzen für Corona-Impfstoffe vom Tisch: Auch von einer größeren Aufmerksamkeit des Wirtschaftssystems für die sozialen Bedürfnisse ist keine Rede mehr. Stattdessen zeigt sich ein stürmisches Wachstum der Ungleichheiten. In den zwei Jahren der Pandemie hat das reichste Prozent der Weltbevölkerung 63 Prozent der gesamten globalen Nettovermögenszuwächse kassiert: 26 von insgesamt 42 Billionen Dollar.3 Laut Schätzungen der Forschungsgesellschaft Wealth-X besitzt dasselbe eine Prozent zurzeit 59 Prozent aller Wertpapiere weltweit.4 Zum ersten Mal seit 25 Jahren haben Hunger und absolute Armut auf unserem Planeten wieder zugenommen. 2023 verzeichneten die UN-Agenturen 733 Millionen Menschen, die von Hunger betroffen sind. »Das Überleben der Reichsten« lautet sarkastisch der Titel des Oxfam-Berichts für 2023. Im Jahr 2024 ist die Situation noch dramatischer.
Das Schicksal der Migranten hat sich verschlechtert. Finnland hat seine Übergänge an der Grenze zu Russland geschlossen, wo selbst im Winter Gruppen von verzweifelten Migranten aus Asien über verschneite Straßenmit dem Fahrrad eintrafen. In Polen wird geprüft, wie man das Asylrecht aussetzen kann. In Großbritannien hatte die konservative Regierung Asylsuchende nach Ruanda abschieben wollen, doch diese Pläne wurden gestoppt, als die Labour Party an die Regierung kam ‒ die nun allerdings ihrerseits die Rückführungen forcieren will. In Deutschland und Frankreich sind strengere Einwanderungsgesetze beschlossen worden. Italien ist auf die Idee verfallen, Migranten, die in internationalen Gewässern gerettet wurden, für eine erste Überprüfung in ein eigens zu diesem Zweck errichtetes Zentrum in Albanien zu bringen. Unterdessen wird die Seenotrettung der freiwilligen Helfer auf vielfältige Weise behindert. Die Europäische Union ist hinsichtlich der automatischen Umverteilung der Asylsuchenden auf alle Mitgliedsstaaten noch immer nicht zu einer Einigung gelangt. Und in den Vereinigten Staaten hat der Sieger der Präsidentschaftswahlen, Donald Trump, versprochen, eine Million illegaler Einwanderer zu deportieren.
Franziskus’ Worte scheinen auf unfruchtbaren Boden zu fallen. Über zehn Jahre ist es her, dass er nach Lampedusa gereist ist, um die »Globalisierung der Gleichgültigkeit« gegenüber diesen verzweifelten Menschen anzuprangern, die gezwungen sind, sich weit entfernt von ihrem Heimatland eine Zukunft zu suchen. Seither hat sich fast nichts verändert. Wieder und wieder erinnert der argentinische Papst daran, dass die Integration der Migranten mühsam, aber weitsichtig ist. »Im Hinblick auf die schreckliche Geißel der Ausbeutung von Menschen besteht die Lösung nicht in der Ablehnung«, erklärt Franziskus im September 2023 in Marseille vor den versammelten Bischöfen des Mittelmeerraums und Präsident Emmanuel Macron. Die richtige Antwort sei vielmehr, »dank einer ausgewogenen Aufnahme in Europa« im Rahmen der jeweiligen Möglichkeiten eine »Vielzahl von legalen und regulären Einreisemöglichkeiten« zu gewährleisten.5
Im selben Jahr empfängt er im Vatikan den kamerunischen Auswanderer Mbengue Nyimbilo Crepin, dessen Frau Matyla und dessen sechsjährige Tochter Marie in der Wüste im Grenzgebiet zwischen Tunesien und Libyen verhungert und verdurstet sind. Franziskus nimmt sich eine Stunde Zeit für ihn. Danach sagt er: »Das ist der leidende Christus […] unser Christus ist in unserer Nähe, wir müssen nicht weit gehen, um ihn zu finden.«6
Es ist eine Zeit, in der die Kluft zwischen den Sichtweisen der katholischen Kirche einerseits und der neuen italienischen Regierung von Ministerpräsidentin Giorgia Meloni andererseits in aller Schärfe zutage tritt. Meloni steht an der Spitze einer Partei mit neofaschistischen Wurzeln, die im Oktober 2022 an die Macht gekommen ist. Für die italienische Kirche und das Papsttum ist dies eine völlig neue Situation. Zum ersten Mal seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs liegt die Macht in Rom in den Händen einer Regierungschefin, deren ideologische Positionen in krassem Gegensatz zu den Überzeugungen des amtierenden Papstes stehen. Die Koalition aus Melonis Fratelli d’Italia, Matteo Salvinis Lega und der Forza Italia des verstorbenen Silvio Berlusconi träumt davon, die Boote der Migranten zurück aufs Meer zu schicken, hat sich die schnelle Ausweisung der illegal Eingewanderten auf die Fahnen geschrieben und beschwört sogar das Gespenst eines ethnischen Austauschs herauf.
Als in der Nacht vom 25. auf den 26. Februar 2023 bei stürmischer See an der kalabrischen Küste vor Cutro ein Flüchtlingsboot aus der Türkei Schiffbruch erleidet und 94 Menschen, darunter 35 Kinder, ums Leben kommen, brechen in Italien heftige Kontroversen aus. Viele glauben, dass das Unglück hätte verhindert werden können, wenn die zuständigen Behörden die Lage nicht unter dem Einfluss des politischen Klimas falsch eingeschätzt, sondern umgehende Rettungsmaßnahmen in die Wege geleitet hätten. Ministerpräsidentin Meloni, die wenig später zu einer außerordentlichen Sitzung des Ministerrats nach Cutro kommt ‒ bei dieser Gelegenheit soll ein härteres Vorgehen gegen die illegale Einwanderung beschlossen werden ‒, nimmt sich nicht einmal die Zeit für eine Geste der Pietät im nahegelegenen Crotone, wo man die 66 Särge der bis dato geborgenen Opfer in der Mehrzweckhalle aufgestellt hat. Anders als eine Woche zuvor der Präsident der italienischen Republik Sergio Mattarella, ein Katholik. In einer Pressekonferenz verkündet Meloni ‒ rechtspopulistische Parolen reinsten Wassers ‒, dass sie die Schlepperbanden »auf dem gesamten Erdball« jagen werde ‒ ohne dass in den darauffolgenden Monaten irgendetwas geschieht.7
Italien ist für Franziskus ein schwieriges Terrain geworden. Die neue Regierung schafft das Grundeinkommen ab (eine Zuwendung für arme Menschen, Langzeitarbeitslose und Arbeitssuchende), weigert sich, den in 21 europäischen Ländern bereits geltenden Mindestlohn einzuführen, beschließt Richtlinien, die die Zahl der prekären Beschäftigungsverhältnisse steigen lassen, und plant eine differenziert verstärkte Autonomie der Regionen, die den italienischen Bischöfen Sorge bereitet, weil sie das Land in reiche und benachteiligte Regionen zu spalten droht.
Die Ministerpräsidentin, die in ihrer Zeit als Oppositionsführerin regelmäßig auf den Treffen der Trump-Anhänger zu finden war, ist stolz auf ihr Profil: »Ich bin Giorgia, ich bin eine Frau, ich bin eine Mutter, ich bin Italienerin, ich bin Christin«, hat sie in Madrid auf einer Kundgebung der spanischen rechtsextremen Partei Vox gerufen.8 In ihrer vor den Wahlen von 2022 erschienenen Autobiographie singt sie ein leidenschaftliches Loblied auf Karol Wojtyła: »[…] ein großer Mann, ein Heiliger […] der größte Papst der Moderne und der größte Staatsmann des ganzen 20. Jahrhunderts […]« Über den argentinischen Papst äußert sie sich eher distanziert: »Ich muss zugeben, dass ich Papst Franziskus nicht immer verstehe.«9
Als sie an die Macht kommt, werden die Beziehungen formell und respektvoll. Nach ihrer Privataudienz beim Pontifex bezeichnet sie die Begegnung auf Twitter als eine »Ehre und ein sehr emotionales Erlebnis« und beschreibt Bergoglio als scharfen Beobachter des politischen Geschehens in Italien. Dann macht sie sich den italienischen G7-Vorsitz zunutze und lädt Franziskus ‒ ein Paukenschlag ‒ zum Treffen nach Apulien ein, wo der Papst eine Rede über die Notwendigkeit hält, die künstliche Intelligenz durch einen verbindlichen internationalen Vertrag zu regulieren.
Dennoch bleibt die Tatsache, dass die kulturelle Kluft zwischen einem amtierenden Papst und einem regierenden Ministerpräsidenten in der gesamten Geschichte der italienischen Republik noch nie so tief gewesen ist. Das macht es dem Papst auf internationaler Ebene nicht eben leicht. In früheren Jahrzehnten waren die Strategien des Vatikans oft von Rom unterstützt worden. Der Ukrainekrieg, der am 24. Februar 2022 mit dem Einmarsch der russischen Truppen begann, hat Franziskus hart getroffen. Die Staats- und Regierungschefs der Nato-Länder begegnen ihm mit frostiger Gleichgültigkeit, weil er sich nicht offen auf die Seite der Ukraine stellt und Wladimir Putin nicht ausdrücklich verurteilt. Der Papst weigert sich, in den Chor derer einzustimmen, die Kiews ›Sieg‹ verlangen, und mahnt immer und immer wieder zu Friedensverhandlungen ‒ selbst wenn das bedeutet, dass man die weiße Fahne schwenken muss. Mit jedem weiteren Jahr des Konflikts wird die diplomatische Isolation des Pontifex in der westlichen Welt deutlicher greifbar.
Auch von jüdischer Seite hagelt es Kritik, als der Papst sowohl den barbarischen Angriff, den die Hamas am 7. Oktober 2023 auf Israel verübte, als auch das brutale Flächenbombardement im Gazastreifen, das im Lauf der Monate über 45 000 zivile Opfer fordern wird, als »Terrorismus« bezeichnet. Die Versammlung der italienischen Rabbiner wirft ihm »eisige Gleichmacherei« vor und stellt den Wert des jahrzehntelangen jüdisch-christlichen Dialogs in Frage. Franziskus antwortet mit einem »Schreiben an die jüdischen Brüder und Schwestern in Israel«, in dem er betont, dass die Kirche jedwede Form von Antijudaismus und Antisemitismus ablehnt und »die Äußerungen des Hasses gegen die Juden und das Judentum« unmissverständlich verurteilt. Gleichzeitig erinnert er daran, dass das Heilige Land sowohl von Israelis als auch von Palästinensern bewohnt wird und die Spirale von Hass und Gewalt daher nur durch das Wort »Bruder« aufgebrochen werden kann.10
Erzbischof Paul Gallagher, der Außenminister des Vatikans, weist darauf hin, dass die Lösung des Nahostkonflikts die Anerkennung des Staates Palästina »auf der Basis der internationalen Verträge und der UN-Resolutionen zu den betreffenden Gebieten« voraussetzt.11 Als Israel beginnt, Beirut zu bombardieren, um die bewaffnete Partei Hisbollah zu vernichten, mahnt Papst Franziskus, dass die Verteidigung immer in einem angemessenen Verhältnis zum Angriff stehen müsse: »Wenn etwas unverhältnismäßig ist, zeigt es eine Neigung zur Dominanz, die jenseits der Sittlichkeit liegt«, und dann kommt es zu »unmoralische[n] Handlungen.«12
Unterdessen setzt sich, durch die Säkularisierung befeuert, die große Krise der katholischen Kirche weiter fort. Die Jugendlichen laufen davon, die Frauen laufen davon, die Priesteramtsanwärter laufen davon. Die Gläubigen gehen nicht mehr zu den Sakramenten. Die Beteiligung an Messe und Eucharistiefeier geht dramatisch zurück, kaum jemand interessiert sich noch für die Beichte. Weder dem polnischen noch dem deutschen noch dem argentinischen Papst ist es gelungen, diesen Trend umzukehren. Um die vatikanischen Finanzen ist es ebenfalls schlecht bestellt. 2023 lag das operative Defizit bei 83 Millionen Euro. An der Schwelle des Heiligen Jahres hat der Papst in einem Schreiben an das Kardinalskollegium eine drastische Reduzierung der Kosten gefordert. Jeder Sektor ist aufgerufen, möglichst auch externe Mittel zu beschaffen. Ein »Nulldefizit« ist das Gebot der Stunde. Der Ton des Schreibens verrät eine gewisse Getriebenheit.
Auch der Bürgerkrieg, der den Katholizismus zerreißt, tobt nach all den Jahren weiter. Er war ausgebrochen, als Franziskus auf den beiden Familiensynoden 2014 und 2015 das Verbot, wiederverheirateten Geschiedenen die Kommunion zu spenden, zu den Akten legte: ein Verbot, an dem Johannes Paul II. und Benedikt XVI. hartnäckig festgehalten hatten. Jahr um Jahr feuert die konservative Front ihre Kanonen auf den Pontifex ab, der »vom anderen Ende der Welt« gekommen ist. Die katholische Schriftstellerin Lucetta Scaraffia, die Ratzinger nahestand und unter Papst Benedikt XVI. mit Erfolg die Beilage des Osservatore Romano »Frauen Kirche Welt« gegründet und herausgegeben hat, erklärt unumwunden: »Franziskus ist eine Katastrophe für die Kirche in Europa und in der Welt […] Die Kirche spielt überhaupt keine Rolle, sie interessiert niemanden mehr«. Politisch gesehen sei Franziskus »antiwestlich und vor allem antiamerikanisch«. Und, schlimmer noch, ein Papst, der »sich viel mehr um die Umwelt als um den Antisemitismus kümmert«.13
Auch aus seiner Heimat, vom argentinischen Präsidentschaftskandidaten Javier Milei, muss sich Franziskus im Jahr 2023 wüste Beschimpfungen anhören. Auf Wahlkampfveranstaltungen nennt der anarchisch-kapitalistische Politiker den Pontifex einen »Vertreter des Bösen im Haus Gottes«, einen »Dummkopf« und einen »Jesuiten, der den Kommunismus und eine kirchliche Scheißpolitik« fördere. Eine unerhörte verbale Aggression. 71 Pfarrer aus den Elendsvierteln von Buenos Aires und der Generalvikar der Diözese unterzeichnen einen Brief der Solidarität an Franziskus und feiern zur Sühne für diese Beleidigungen eine Messe, an der auch Friedensnobelpreisträger Adolfo Pérez Esquivel teilnimmt. Die Pfarrer werfen dem Präsidentschaftskandidaten vor, dass er den Markt vergöttliche und gegen den Sozialstaat zu Felde ziehe.
Milei gewinnt die Wahl. Der Papst greift ungerührt zum Telefon, um ihm zu gratulieren, und wird vom frischgebackenen Präsidenten mit »Eure Heiligkeit« angesprochen und nach Argentinien eingeladen. Schon im Vorfeld der Stichwahl am 19. November 2023 hatte Milei eine politische Kehrtwende vollzogen und beteuert, dass er Franziskus als Oberhaupt der katholischen Kirche und Staatsoberhaupt respektiere. Als Milei im Februar 2024 zur Kanonisierung der ersten argentinischen Heiligen, »Mama Antula«, nach Rom kommt, fasst er den im Rollstuhl sitzenden Papst überraschend bei den Schultern und umarmt ihn. Bergoglio ist peinlich berührt ‒ das zeigt sich daran, wie er den Kopf des Präsidenten mit der rechten Hand festhält, um dessen zur Schau getragenes Ungestüm zu bremsen. Die Reise nach Argentinien bleibt in der Schwebe.
Regieren zermürbt. Irgendwann macht sich in der vatikanischen Bürokratie ‒ und in Teilen der katholischen Welt ‒ der Eindruck breit, dass das Pontifikat in Dauerschleife läuft. Täglich im Blickpunkt der Öffentlichkeit zu stehen, birgt Risiken. Päpste halten zu viele Ansprachen, treffen zu viele Menschen. Ein Mechanismus, aus dem auch Franziskus nicht ausbrechen kann. Er empfängt katholische Medienvertreter, Studentenseelsorger, Erdbebenopfer, Hals-Nasen-Ohren-Ärzte, den Verein europäischer Eltern, die Spieler des Celtic Football Club aus Schottland, Zirkusclowns und -jongleure, Rektoren von Wallfahrtsorten und Ordensleute aus sämtlichen Kongregationen. Eine endlose Liste. Und bei jeder dieser Gelegenheiten ist Platz für ein Bibelzitat, eine moralische Ermahnung oder eine kurze geistliche Betrachtung. Von den institutionellen Treffen mit kirchlichen Würdenträgern oder Staats- und Regierungschefs gar nicht zu reden.
Es droht ein Abgleiten in die Gleichgültigkeit.
Allmählich schwindet das Interesse der Massenmedien an den Wortmeldungen des Papstes. Auch wichtige Zeugnisse seines Denkens wie das Dokument Laudate Deum oder die Botschaften zum Weltfriedenstag und zum Welttag der Migranten werden stillschweigend übergangen. Nach und nach greift unter den Angehörigen der vatikanischen Kurie ein gewisser Überdruss um sich. Das sieht man an den Mienen der Priester und Bischöfe im Verlauf der zahllosen Feiern. Auf der anderen Seite ist eine Flut an Büchern zu verzeichnen, auf deren Cover der Name des Papstes prangt und die seine Gedanken überall verbreiten. Papst Franziskus: Ich wünsche dir ein Lächeln …Du bist wundervoll … Macht Euer Herz stark … Gott ist jung. Franziskus gönnt sich sogar so etwas wie eine Autobiographie, Leben. Meine Geschichte in der Geschichte, die in mehreren Sprachen gleichzeitig erscheint, und lässt in dem Band El sucesor seine Beziehungen zum emeritierten Papst Ratzinger Revue passieren. Und das ist nur ein Bruchteil von dem, was die Regale der Buchhandlungen füllt.
Der Herbst des Pontifikats ist eine kritische Übergangszeit. Franziskus’ gesundheitliche Probleme sind zunehmend beunruhigend. Am 4. Juli 2021 unterzieht er sich einer Dickdarmoperation. »Ich lebe noch«, ruft er danach lachend. Ein Pfleger vom vatikanischen Gesundheitsdienst hatte ihn zu dem Eingriff überredet. »Er hat mir das Leben gerettet«, wird der Papst später verraten. Allerdings gab es Probleme mit der Anästhesie. Seither scheut Franziskus vor einer Vollnarkose zurück. Und hat den Krankenpfleger, Massimiliano Strappetti, zum Berater seines Vertrauens gemacht. Es ist schon das zweite Mal, dass eine Pflegekraft ihn vor dem Äußersten bewahrt. Das erste Mal war in Argentinien: Der 21-jährige Bergoglio war mit Wasser in den Lungen ins Krankenhaus eingeliefert worden. Der Arzt hatte eine hohe Dosis Penicillin und Streptomycin verordnet, doch die diensthabende Krankenpflegerin, Schwester Cornelia aus Italien, beschloss heimlich, die Dosis zu verdoppeln, »denn sonst …«14 Den Jesuiten in der Slowakei wird der Pontifex später erzählen, dass man ihn in Kurienkreisen schon aufgegeben hatte: »Ich weiß, dass es sogar Treffen unter Prälaten gegeben hat, die meinten, der Zustand des Papstes sei ernster, als gesagt wurde […] Sie haben schon das Konklave vorbereitet. Geduld! Gott sei Dank geht es mir gut.«15
Zwei Jahre später, im März 2023, erkrankt Franziskus an einer Atemwegsinfektion. Wieder bringt man ihn in den zehnten Stock der Gemelli-Klinik, den »Vatikan Nummer drei«, wie Johannes Paul II. diesen Flügel nannte, als er noch für ihn reserviert war. Er wird im Ambulanzwagen dorthin gefahren, weil er nach der Generalaudienz über heftige Schmerzen in der Brust und über Atemprobleme geklagt hatte. Das vatikanische Presseamt lässt zunächst verbreiten, Anlass der Einlieferung sei eine »zuvor geplante Untersuchung« gewesen. Später wird bekannt, dass der Pontifex sich eine Bronchitis zugezogen hatte, die mit Antibiotika behandelt wurde.
Franziskus verbringt drei Nächte im Krankenhaus. »Ich hatte keine Angst«, sagt der Papst zu den umstehenden Journalisten.16 Dann aber erinnert er sich an ein Erlebnis in Argentinien: »Ein alter Mann, älter als ich, hat in so einer Situation einmal zu mir gesagt: Padre, den Tod selbst habe ich nicht gesehen, aber ich habe ihn kommen sehen … und er ist hässlich, oh ja!« Am Ausgang des Klinikums küsst und umarmt er eine weinende Frau. Sie und ihr Mann haben sich gerade von ihrer kleinen Tochter verabschieden müssen, die an einer Erbkrankheit gestorben ist. Es ist die Karwoche. Wegen der Kälte muss der Papst auf die Teilnahme am Kreuzweg im Kolosseum verzichten. Die liturgischen Feiern im Petersdom finden allesamt unter dem »Vorsitz« des Pontifex statt, doch die Zelebration am Altar überlässt er einem Kardinal. Zwei Monate später wird der Papst erneut ins Gemelli-Krankenhaus eingeliefert und einer Laparotomie, einer Bauchoperation, unterzogen. Die Rekonvaleszenz dauert wenig mehr als eine Woche. Der Papst verlässt die Klinik mit der inzwischen obligatorischen Bemerkung: »Ich lebe noch.«
Doch die Gesundheit lässt ihm in diesem besonderen Jahr 2023 keine Ruhe. Es ist der 25. November. Am darauffolgenden Freitag soll der Papst eigentlich nach Dubai fliegen, um auf der UN-Klimakonferenz COP 28 einen Vortrag zu halten. Das Programm ist soeben veröffentlicht worden. Am selben Tag jedoch lässt der Vatikan lakonisch verlauten, dass »die für heute Morgen vorgesehenen Audienzen des Heiligen Vaters wegen eines leichten grippalen Infekts abgesagt werden«. Tags darauf erscheint Papst Franziskus im Fernsehen mit einem auffälligen Pflaster auf dem rechten Handrücken, wo die Infusionskanüle für das Antibiotikum gelegen hat. »Heute kann ich mich [zum Angelusgebet] nicht am Fenster zeigen, weil ich dieses Problem mit der Lungenentzündung habe«,17 erklärt er überraschend mit müder Stimme und dunklen Ringen unter den Augen. Seine sonntägliche Betrachtung wird von einem seiner Mitarbeiter vorgelesen. Am Montag gibt der Vatikan bekannt, dass eine Lungenentzündung ausgeschlossen werden konnte. Am Dienstag, dem 28. November, heißt es in einem Kommuniqué, dass der grippale Infekt und die Entzündung der Atemwege sich gebessert, die Ärzte den Papst jedoch gebeten hätten, nicht zu reisen. Der Flug nach Dubai wird gecancelt. Die Zickzack-Kommunikation über die Gesundheit des Pontifex sorgt für ständige Unruhe.
Inzwischen hat der Rollstuhl wieder Einzug im Vatikan gehalten. Erneut ist ein römischer Pontifex gezwungen, vor aller Augen den Thron seiner Schwäche zu besteigen. Für Wojtyła war er das Zeichen des unerbittlich fortschreitenden Verfalls gewesen, dem er sich mit seiner eisernen Entschlossenheit, »nicht vom Kreuz herabzusteigen«, entgegengestemmt hatte. Und so wurde der Rollstuhl schon bald zum Symbol seines Martyriums. Im Herbst des Bergoglio-Pontifikats sind der Stock, auf den er sich stützt, wenn er mühsam auf seinen eigenen Beinen geht, und der Rollstuhl Zeichen seiner Gebrechlichkeit, die der zähe und hartnäckige argentinische Papst nun einkalkulieren muss. Anfangs, hat er zugegeben, habe er sich geschämt, auf den Rollstuhl angewiesen zu sein. Doch irgendwann nahm er die Sache mit Humor: »Früher haben die Päpste die Sedia gestatoria benutzt. Heute sind wir fortschrittlicher!«18
Die Gläubigen und vor allem die Prälaten im Vatikan achten ängstlich auf seinen zuweilen keuchenden Atem und auf sein Gesicht, das an manchen Tagen aufgedunsen wirkt und an anderen wieder die gewohnten Züge trägt. Erschöpfung und Elan scheinen sich bei Franziskus ständig abzuwechseln.
Doch auch im Rollstuhl ist sein Drang, zu kommandieren und sich zu äußern, ungebrochen. Seine kritischen Worte auf der Klimakonferenz COP 28, die Kardinal Pietro Parolin in Dubai verlas, sind von großer religiöser und politischer Tragweite. Franziskus wettert gegen die Negationisten, die die menschlichen Ursachen des Klimawandels leugnen; er prangert die Länder und Konzerne an, die nach wie vor nur dem eigenen Profit nachjagen; er kritisiert diejenigen, die den Armen ihren Kinderreichtum vorwerfen; er weist darauf hin, dass fast die Hälfte ‒ die ärmere Hälfte! ‒ der Weltbevölkerung für gerade einmal zehn Prozent der Schadstoffemissionen verantwortlich ist; und er erinnert an die enorme Ressourcenverschwendung durch Kriege und Wettrüsten. »Es ist Aufgabe dieser Generation, […] die Grundlagen für einen neuen Multilateralismus zu schaffen«, erklärt er.19 Damit nicht zufrieden, verschickt er außerdem eine Videobotschaft anlässlich der Einweihung des Glaubenspavillons in Dubai.
2023 markiert einen Wendepunkt in Franziskus’ Pontifikat. Joseph Ratzinger stirbt, der erste Papst der Neuzeit, der von seinem Amt zurückgetreten ist. Drei Tage lang wird sein Leichnam im Petersdom aufgebahrt. Am 5. Januar, einem Donnerstag, leitet Papst Franziskus die feierlichen Exequien auf dem Petersplatz. Über 400 Bischöfe und 4000 Priester konzelebrieren, wie das Opus Dei bekannt gibt. Die päpstliche Homilie ist ungewöhnlich kurz. Ein knappes Wort über den Wunsch, in die Fußstapfen seines Vorgängers zu treten, ein Hauch von Poesie bei der Beschreibung seiner »Weisheit, seines Feingefühls und seiner Hingabe«, und der abschließende Ausruf: »Benedikt, du treuer Freund des Bräutigams (Christus),möge deine Freude vollkommen sein, wenn du seine Stimme endgültig und für immer hörst!« ‒ und schon ist die Gedenkpredigt zu Ende.20 Ein deutscher Bischof merkt an: »Es war, als wollte er sagen: Lieber Benedikt, bleib im Himmel und komm nicht zurück.«
Für den argentinischen Papst ist Ratzingers Ableben das Ende einer permanenten Ambivalenz, die sein Pontifikat Monat um Monat und Jahr um Jahr begleitete. Zwei Päpste im Vatikan ‒ das hatte es noch nie gegeben. Die beiden weißen Gewänder und auch die Wahl des Titels, »emeritierter Papst«, hatten zu Situationen geführt, die schwer auszuhalten waren. Beide Seiten mussten äußerst diplomatisch vorgehen und einander mit Wertschätzung, ja Zuneigung begegnen. Und doch war es eine pausenlose Anstrengung, die durch den Ausbruch des Bürgerkriegs innerhalb der katholischen Kirche ‒ die ständige Suggestion der Konservativen, dass Joseph Ratzinger der einzige Papst sei, der die wahre Tradition verkörpere ‒ noch erschwert wurde.
Tatsächlich hatte der abgedankte Papst nicht damit gerechnet, dass er nach seinem Rücktritt noch zehn Jahre leben würde. Als er seine Entscheidung traf, war er völlig erschöpft gewesen. Doch das Schicksal oder die Vorsehung hatten anders entschieden. Das Gleichgewicht zwischen den beiden Päpsten bestand über Jahre hinweg und wurde auf Franziskus’ Seite durch etliche Gesten der Ehrerbietung unterstützt. Etwa, dass er sich die Enzyklika Lumen fidei, die Benedikt XVI. noch vor seinem Rücktritt praktisch fertiggestellt hatte, zu eigen machte und promulgierte. Oder dass er Ratzinger im Dezember 2015 in die Eröffnung der Heiligen Pforte zu Beginn des Barmherzigkeitsjahres einbezog. Oder dass er ihm in dem kleinen Kloster im Herzen des Vatikans, in das sich der deutsche Ex-Papst zurückgezogen hatte, regelmäßig die neuen Kardinäle vorstellte. Dann aber war es zum Bruch gekommen. Im Januar 2020, als Franziskus entscheiden musste, ob in Notsituationen ‒ wie von der überwältigenden Mehrheit der Bischöfe auf der Amazoniensynode gefordert ‒ der Einsatz verheirateter Priester zulässig sein sollte, hatte Ratzinger gemeinsam mit Kurienkardinal Robert Sarah ein Buch über die unauflösliche Verbindung zwischen Priestertum und Zölibat veröffentlicht.
Noch heute, viele Jahre später, ist der Riss tief, den dieser Schritt im Innern der katholischen Kirche verursacht hat. Aussagen wie die gemeinsam mit Kardinal Sarah getroffene, wonach man nicht vor dem Zölibat »zurückschrecken« müsse, oder auch die allein vom emeritierten Papst verantwortete, wonach das priesterliche Leben »in der Berührung mit dem göttlichen Geheimnis« stehe und daher »eine Ausschließlichkeit für Gott« verlange, »die eine andere, das ganze Leben umgreifende Bindung wie die Ehe neben sich ausschließt«, kamen einer Kriegserklärung an Bergoglios Reformkurs gleich21 ‒ einer Art Traditionalisten-Eid, der die ultrakonservativen Stoßtrupps im Schoß des Katholizismus und die moderateren Gruppen, die Veränderungen scheuen, bis heute beseelt.
Niemand im Vatikan hat den theatralischen Titel des Buchs Aus der Tiefe des Herzens und vor allem das Cover der ersten französischen Auflage vergessen, auf dem ‒ eine Provokation ‒ sowohl Benedikt XVI. als auch Kardinal Robert Sarah als Verfasser firmierten. Und darunter, gut sichtbar, die Fotos der beiden, insbesondere das von Ratzinger in weißem Papstgewand und mit der Kordel des Brustkreuzes um den Hals. Der abrupte Kurswechsel, den die Jesuitenzeitschrift La Civiltà cattolica ‒ der Chefredakteur, Pater Antonio Spadaro, ist einer der engsten Vertrauten des Papstes ‒ damals vollzog, zeigt, wie sehr die Affäre Franziskus verunsichert hat. Gleich nach dem Ende der Amazonas-Synode signalisiert die Zeitschrift Offenheit gegenüber möglichen Veränderungen. Die Frage der sogenannten Viri probati (ordinierte verheiratete Männer), schreibt Spadaro im November 2019, »gründet mitnichten auf einer Infragestellung des Zölibats, sondern auf der dramatischen Wahrnehmung, dass die Sakramente im alltäglichen Leben vieler Gläubiger fehlen«. Deshalb müsse sie »in eine umfassende und reife, von jedwedem Klerikalismus freie Sicht auf die Kirche hineingestellt werden«, zumal die Laien de facto schon in vielen kirchlichen Gemeinden Leitungsaufgaben wahrnehmen.22
Wenige Monate später, als es der Pontifex bereits vermieden hat, in seinem nachsynodalen Schreiben Querida Amazonia positiv auf das Anliegen der Amazonasbischöfe zu antworten, ändert die Jesuitenzeitschrift ihren Ton. Die Frage, so heißt es nun, sei Teil eines »Reifungsprozesses, der sich entwickeln wird«.23
Die Invasion des Ratzinger-Lagers war ein schwerwiegender Vertrauensbruch vonseiten jenes Mannes, der, als er vom Papstthron herabgestiegen war, seinem Nachfolger »bedingungslose Ehrerbietung [und] bedingungslosen Gehorsam« versprochen hatte.24
Den Preis bezahlte Benedikts persönlicher Sekretär Erzbischof Georg Gänswein, der am 15. Januar 2020 umgehend von seinen Verpflichtungen als Präfekt des päpstlichen Hauses ‒ eine Art vatikanischer Protokollchef ‒ entbunden wurde. »Sie bleiben von jetzt an zu Hause. Sie begleiten Benedikt, der Sie braucht, und schirmen ihn ab«, erklärt ihm Franziskus kurz und bündig.25 Der emeritierte Papst begriff sofort: »Es scheint, dass Papst Franziskus mir nicht mehr traut und möchte, dass Sie den Aufpasser spielen!«, sagt er zu seinem Sekretär.26 Aus Sicht des argentinischen Papstes ist es seine Schuld, dass er Ratzingers Einmischung nicht verhindert hat. Aus Gänsweins Sicht war es eine Sünde der Loyalität.
Am 28. Februar 2023, nach dem Tod Benedikts XVI., wurde Ratzingers Ex-Sekretär und Testamentsvollstrecker stillschweigend entlassen und auf Anweisung Bergoglios in seine Heimatdiözese Freiburg im Breisgau zurückgeschickt. Als fände sich in keiner der zahllosen kirchlichen Einrichtungen weltweit eine Aufgabe für ihn. »Es ist eine Demütigung vor aller Welt«, sagt Gänswein dem Pontifex während der letzten Audienz.27 Bei seiner Ankunft in Freiburg wird ihm lediglich mitgeteilt, dass er regelmäßig eine Sonntagsmesse im Münster zelebrieren soll.
Es ist eine exemplarische Strafe. Der Papst kann ihm nicht verzeihen, dass er in einem gleich nach dem Tod Benedikts XVI. erschienenen Buch die Meinungsverschiedenheiten offengelegt und in einem Interview mit der deutschen katholischen Wochenzeitschrift Die Tagespost erklärt hatte, Franziskus’ Entscheidung, die lateinische Messe drastisch einzuschränken, habe Benedikt das Herz gebrochen.
Gänsweins Exil endet im Juni 2024, als bekannt wird, dass der Papst ihn zum Nuntius für Litauen, Estland und Lettland ernannt hat. In dem kleinen Kloster in den vatikanischen Gärten, wo der emeritierte Papst gelebt hatte, ist inzwischen eine neue Gruppe von Ordensfrauen eingezogen: argentinische Benediktinerinnen aus Buenos Aires. Ihre Aufgabe wird, wie von Johannes Paul II. gewollt, darin bestehen, den amtierenden Papst mit ihren Gebeten zu unterstützen. Ein weiteres Signal, das auf symbolische Weise die Vergangenheit löscht.
Die gleichzeitige Anwesenheit zweier Päpste im Vatikan ‒ der eine im Amt, der andere im Ruhestand ‒ hatte die Regierungsmaschinerie des Pontifikats in den ersten zehn Jahren schwergängig gemacht. Jahrelang hatte Franziskus ‒ im Rahmen einer klaren Strategie der guten Beziehungen zu Ratzinger ‒ Kardinäle auf ihren Kurienposten belassen, die er nicht selbst ausgewählt hatte, die gedanklich nicht auf seiner Linie waren oder, wie Kardinal Gerhard Ludwig Müller, sich ihm sogar offen widersetzten.
Nun, da er endlich frei ist, kann Franziskus 2023 zwei Männer auf Schlüsselpositionen berufen, die sein absolutes Vertrauen genießen: den Amerikaner Robert Francis Prevost an die Spitze des Dikasteriums für die Bischöfe und den argentinischen Theologen Víctor Manuel Fernández an die Spitze des Dikasteriums für die Glaubenslehre. Kardinal Burke, einen systematischen Kritiker des argentinischen Papstes, ereilt die Strafe noch im Jahr 2023, nach Benedikts Beerdigung. Nach dem Ende seiner Amtszeit als Kardinalpatron des Malteserordens am 29. Juni werden ihm Gehalt und Dienstwohnung gestrichen. Zuvor hatte Franziskus während einer Versammlung, die am 20. November im apostolischen Palast stattfand, erklärt, dass der amerikanische Purpurträger »gegen die Kirche und gegen das Papsttum arbeite«, um die Gemeinschaft der Gläubigen zu spalten.28
Nie wieder wird es im Vatikan zwei Päpste geben. Franziskus hat angekündigt, dass ein bestimmtes Zeremoniell für die Beisetzung ehemaliger Kirchenoberhäupter ausgearbeitet werden wird. Vor allem aber arbeiten sie im Vatikan seit geraumer Zeit an einem Protokoll für Päpste, die sich zum Rücktritt entschließen. Sie sollen künftig als »emeritierte Bischöfe von Rom« betrachtet werden. Weder der Papsttitel noch das weiße Gewand wird jemals mehr Verwirrung stiften. Ab sofort wird immer nur ein einziger Mensch Papst sein ‒ und er allein.
Rollstuhl hin oder her, Franziskus geht weiter. Zurücktreten? »Das ist mir nie durch den Kopf gegangen. Im Moment nicht, im Moment nicht«, erklärt er, als man ihn zum x-ten Mal fragt, ob er bereit sei, sein Amt aufzugeben.29 Es knirscht im Gebälk der Welt. Der Dritte Weltkrieg »in Stücken«, von dem der argentinische Papst zu Beginn seines Pontifikats gesprochen hat, bricht sich in unerwarteten und beängstigenden Katastrophen wie den blutigen Konflikten in der Ukraine und im Nahen Osten Bahn. »Heute ist der Dritte Weltkrieg in einer globalisierten Welt im Gange«, warnt er in besorgtem Ton.30
Auch im Gebälk der katholischen Kirche knirscht es. Der innere Konflikt hat sich verhärtet. In der letzten Phase seines Pontifikats versucht Franziskus, die Kirche dazu zu bringen, dass sie sich aus einer autokratischen hierarchischen Struktur in eine Gemeinschaft verwandelt, in der das ganze »Volk Gottes«, wie das Zweite Vatikanische Konzil es genannt hat, zur Teilhabe an der Evangelisierungsmission und insbesondere die Frauen zur Mitentscheidung aufgerufen sind. Das ist es, was er unter »Synodalität« versteht. Ein Ziel, das seiner Meinung nach nur verwirklicht werden kann, wenn man »Türen und Fenster öffnet, Mauern einreißt, Ketten sprengt und Grenzen aufhebt.«31 Und nötigenfalls auch bereit ist, die Richtung zu ändern.
Im Vatikan vermag und wagt keiner vorherzusagen, was der argentinische Papst noch erreichen wird.
Unmittelbar nach seiner Wahl tauchte ein Graffito von Franziskus im Superman-Kostüm auf. Jetzt zeigt ihn der Karikaturist Mauro Biani in la Repubblica im Rollstuhl auf der Spitze einer Felsnadel. Ringsherum klaffen Abgründe.
Kapitel II.Sturz eines Mächtigen
»Becciu, Giovanni Angelo, wird zu einer Freiheitsstrafe von fünf Jahren und sechs Monaten verurteilt […] sowie einem lebenslangen Verbot, öffentliche Ämter zu bekleiden.«1 Es ist der 16. Dezember 2023. In einem schmucklosen Saal ohne den ehrwürdigen Nimbus der vatikanischen Paläste verliest der vorsitzende Richter Giuseppe Pignatone ‒ in schwarzer Robe mit einem senkrechten blutroten Streifen auf der Brust ‒ das Urteil. An der Wand hinter ihm hängt ein Kruzifix, etwas weiter weg an der Seite ein Foto von Papst Franziskus. Die Ausstattung des Saales wirkt provisorisch, improvisiert. Das Richterpult und die Tische der Anwälte sind, wie bei einer Theatervorführung, mit bräunlichen Stoffbahnen bedeckt. Die ganze Szenerie wird diskret von zwei Videokameras überwacht. Tatsächlich ist dieser Ort gar kein Gerichtssaal, sondern ein Multifunktionsraum in den Vatikanischen Museen.
Es ist das erste Mal in der neueren Geschichte, dass ein Kardinal der Heiligen Römischen Kirche wegen Missmanagements verurteilt wird. »Amtsunterschlagung« lautet der juristische Fachbegriff. Historisch Interessierte glauben, dass man, um einen ähnlich gelagerten Fall zu finden, etwa fünf Jahrhunderte zurückgehen muss. Das Gericht verurteilt Becciu und die anderen Beschuldigten zu einer Entschädigungssumme von insgesamt mehr als 186 Millionen Euro. Und noch etwas ist neu und versetzt die alten Kuriengenerationen in Aufruhr: Der ehemalige Purpurträger, der seinen Status als Erzbischof gleichwohl behält, ist von einem Gericht verurteilt worden, das aus Laienrichtern besteht.
Es ist das Ende des großen Schweigens, mit dem der Vatikan in früheren Zeiten die heikelsten und anrüchigsten Affären zu überdecken pflegte. Zwei Prozesse prägen die Ära des Jorge Mario Bergoglio. Der erste zu Beginn seines Pontifikats gegen den Nuntius in der Dominikanischen Republik, Erzbischof Józef Wesołowski, der des Missbrauchs an Minderjährigen überführt und deshalb vor ein Kirchengericht gestellt worden war, endete 2014 mit dem Ausschluss des Angeklagten aus dem klerikalen Stand. Auf Anweisung des Papstes wurde auch ein Strafverfahren nach vatikanischem Recht eingeleitet. Die erste Anhörung fand am 11. Juli 2015 statt und dauerte gerade lange genug, um die Anklagepunkte zu verlesen. Wesołowski hatte am Nachmittag zuvor über Unwohlsein geklagt und war ins Krankenhaus eingeliefert worden. Am 27. des darauffolgenden Monats erlitt er einen Infarkt. Man fand ihn tot in seinem Fernsehsessel.
Der zweite exemplarische Prozess ist ‒ nicht zuletzt wegen der Kontroverse, die er auslösen wird ‒ der Fall Becciu. Giovanni Angelo Becciu ist eine Persönlichkeit, die bis in die höchsten Ebenen der vatikanischen Regierung aufgestiegen ist. Von 2011 bis 2018 bekleidete er das Amt des Substituten, war also so etwas wie ein stellvertretender Innenminister. Ein Mann der Macht, der seine Zuständigkeitsbereiche im vatikanischen Apparat wie ein echter Boss handhabte und ein weit gespanntes Netz aus Beziehungen pflegte. Er machte als Diplomat Karriere und war Nuntius auf Kuba. Danach ernannte ihn Benedikt XVI. zum Substituten. Kardinalstaatssekretär war damals Tarcisio Bertone. Auch unter Franziskus verläuft seine Karriere zunächst reibungslos. Der argentinische Papst versteht sich sehr gut mit dem Prälaten, der aus Sardinien stammt, sie haben einen persönlichen Draht zueinander. 2018 ernennt ihn Franziskus zum Kardinal und Präfekten der Kongregation für die Selig- und Heiligsprechungsprozesse. Beccius Bewunderer halten ihn sogar für papabile.
Dann aber gerät er auf seinem Weg nach oben ins Stolpern und stürzt. Schuld sind Fehlinvestitionen in dreistelliger Millionenhöhe. Zwischen 2013 und 2014 entscheidet Becciu, damals noch nicht Kardinal, im Rahmen seiner Befugnisse als Substitut, Anteile am Hedgefonds Athena Capital Commodities im Wert von 200 500 000 Dollar zu zeichnen. Die Investition beinhaltet den Kauf eines Gebäudes in der Londoner Sloane Avenue Nr. 60: einer ehemaligen Harrods-Lagerhalle im Nobelviertel Chelsea, die zu Luxusappartments umgebaut werden soll. Eingefädelt wird die Operation von dem Finanzier Raffaele Mincione. Der Vatikan erhält 45 Prozent der Anteile an dem Gebäude, aber keinerlei Handlungsbefugnis.
Eigentlich sollte das Ganze üppige Gewinne abwerfen, doch die Dinge laufen alles andere als gut. Auf Drängen des Börsenmaklers Gianluigi Torzi beschließt man, auch die restlichen 55 Prozent der Anteile zu kaufen.
Der Vatikan ist gezwungen, weitere 40 Millionen britische Pfund auszugeben. In der Zwischenzeit hat im Staatssekretariat ein neuer Substitut sein Amt angetreten: der venezolanische Erzbischof Edgar Peña Parra. Und das ist noch nicht alles. Es stellt sich heraus, dass der Vermittler Torzi 1000 Aktien mit Stimmrecht und damit die Handlungsmacht zurückgehalten hat. Also muss der Vatikan Torzi für diese Anteile weitere 15 Millionen Euro bezahlen. (Der vatikanische Gerichtshof wird Torzi später wegen schweren Betrugs und Erpressung verurteilen.)
Insgesamt ‒ Honorare, Provisionen und andere unvorhergesehene Kosten mit eingerechnet ‒ werden so im Ofen der Sloane Avenue über 300 Millionen Euro verbrannt. Ein Riesenskandal. Ein finanzielles und mediales Desaster. Die Gelder, die Becciu für die erste Investition verwandt hat, stammen aus dem Sondervermögen des Staatssekretariats, das sich unter anderem aus dem Peterspfennig, das heißt aus Spenden von Gläubigen in aller Welt, speist. Als der Vatikan letzten Endes beschließt, das Gebäude in der Sloane Avenue wieder zu verkaufen, wird ein Preis von nur 186 Millionen Pfund Sterling erzielt: für die vatikanischen Finanzen ein Verlust von insgesamt 140 Millionen Euro. In einem 2022 unter dem Pseudonym Demos veröffentlichten Memorandum schätzt der australische Kardinal Pell, der von 2014 bis 2019 als Präfekt des Wirtschaftssekretariats fungierte, den Verlust deutlich höher, nämlich auf 217 Millionen Euro.