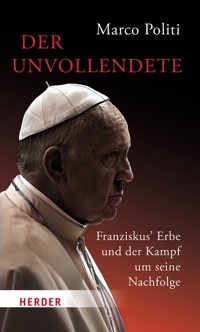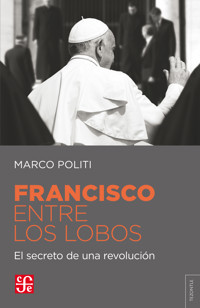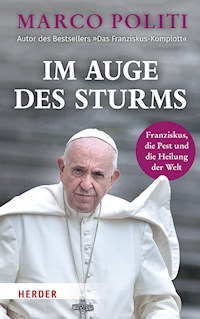
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Verlag Herder
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Sprache: Deutsch
In 2000 Jahren Kirchengeschichte hat es das nie gegeben: Eine Virus-Pandemie zwingt die Kirche, ihre Gotteshäuser zu schließen, die Feier der Sakramente einzustellen. Alte und Kranke sind isoliert, sterben alleine. Kritik regt sich, die Kirche lasse ihre Gläubigen im Stich, ziehe sich zurück. Mit seiner außergewöhnlichen Geste füllt Franziskus diese Lücke. Die eindrücklichen Bilder des einsamen Gottesdienstes am 27. März 2020 gingen um die Welt: Der Papst steht alleine auf dem verregneten Petersplatz, ein weißer Fleck in der Dunkelheit. Sein Weckruf: Schlimmer als die gegenwärtige Krise wäre nur, die Chance, die sie birgt, ungenutzt verstreichen zu lassen. Und er denkt vor allem an die Zeit nach der Pandemie: Franziskus fordert eine Gesellschaft für alle, eine Wirtschaft im Dienste des Gemeinwohls, eine Politik, die den Schwächsten eine Stimme gibt.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 170
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Marco Politi
Im Auge des Sturms
Franziskus, die Pest und die Heilung der Welt
Aus dem Italienischen von Gabriele Stein
Titel der Originalausgabe:
Francesco: La peste, la rinascita
Copyright © 2020, Gius. Laterza & Figli, All rights reserved
Deutsche Erstausgabe
© Verlag Herder GmbH, Freiburg in Breisgau 2021
Alle Rechte vorbehalten
www.herder.de
Umschlaggestaltung: Verlag Herder
Umschlagmotiv: ©Stefano Spaziani 2019
E-Book-Konvertierung: Daniel Förster, Belgern
ISBN Print 978-3-451-39109-5
ISBN E-Book (Epub) 978-3-451-82488-3
ISBN E-Book (PDF) 978-3-451-82489-0
Nach einer solchen Krise ist man nicht mehr wie vorher.Wenn man herauskommt, ist man besser oder schlechter.
Franziskus
Inhalt
Ein Papst im Sturm
»Blicken wir auf die Massengräber«
Die Gefahr des Populismus
Ein Virus in der Kirche
Auferstehung und Erneuerung
Über den Autor
Ein Papst im Sturm
Der Platz liegt verlassen da, regennass, in fahles Licht getaucht. Die Arme der Kolonnaden greifen ins Leere. Hinter dem Obelisken, hinter der Via della Conciliazione wirkt Rom wie ausgestorben. Verschlossen im Lockdown, den die Epidemie der Stadt aufgezwungen hat. Ganz Italien ist leer und verschlossen, geduckt und verschreckt.
Die Pest geht durch die Straßen, ein Gespenst aus der Vergangenheit. Der Schwarze Tod des 14. Jahrhunderts … die Pest, von der Manzoni in den Verlobten erzählt und die in ganz Europa wütete: von London bis Prag, von Mailand bis Apulien … die Spanische Grippe, an der Anfang des 20. Jahrhunderts 500 Millionen Menschen erkrankten, ein Viertel der damaligen Weltbevölkerung.
Die Pest ist wieder da. Im November oder Dezember 2019 ist sie in China ausgebrochen, möglicherweise in der Stadt Wuhan. Eine Zeit lang hielten die Behörden sie noch geheim, doch dann griff sie explosionsartig um sich und verbreitete sich von Fernost aus bis nach Europa, Amerika und Afrika. Woche um Woche infizieren sich Zehntausende Männer und Frauen, der Tod schreitet unerbittlich voran. Die Pandemie sät Angst, Beklemmung und Einsamkeit.
Am 27. März 2020 betritt Jorge Mario Bergoglio allein den verwaisten Vorplatz der Petersbasilika. Hinkend bewegt sich der greise Pontifex vorwärts, den Zucchetto auf dem zerdrückten Haar. Ein weißer Fleck, unwirklich unter dem schwärzlichen Himmel.
Seit beinahe drei Wochen, so scheint es, hat die Kirche aufgehört zu existieren. Die Gotteshäuser sind praktisch geschlossen, die Gläubigen verschwunden. Es werden keine Messen mehr gefeiert, keine Kinder mehr getauft, es finden keine Trauungen und keine Beerdigungen statt. Den letzten Sterbesegen überlassen die Bischöfe dem Pflegepersonal und den Ärzten, deren Arm die Kranken leise berühren, ehe sie ins Nichts stürzen. Kolonnen von Militärlastwagen transportieren die Särge zu den Friedhöfen. Angehörige sind nicht zugelassen, sie müssen zu Hause bleiben.
Die religiösen Autoritäten haben sich dem Lockdown gefügt, den die Regierung am 9. des Monats verhängt hat. Am 27. März sind weltweit annähernd 600 000 Menschen mit dem Coronavirus infiziert und beinahe 27 000 verstorben. In Italien zählt man über 66 000 gemeldete Infektionen und 9134 Todesfälle. Allein in den vergangenen 24 Stunden sind dort über 900 Menschen gestorben. Zahlen, die schwindelerregende Höhen erreichen werden. Auch im Vatikan werden zwei Infektionen gemeldet. Schon bald werden es zwölf sein, einer von ihnen aus der unmittelbaren Umgebung des Pontifex. Franziskus hat sich testen lassen, er ist negativ. Doch er hat begonnen, seine Generalaudienzen online zu halten.
Auf die Proteste von Pfarrern und Gläubigen hin hat der Papst entschieden, dass die Pfarrkirchen wenigstens für das individuelle Gebet offen bleiben sollen. Doch das Schweigen der Kirche in der Stunde der Katastrophe wird für Millionen von Katholiken unerträglich und unbegreiflich. Auch viele Agnostiker und Nicht-Glaubende, die das Bergoglio-Pontifikat bislang mit Interesse verfolgt haben, registrieren dieses plötzliche Verschwinden der Kirche von der öffentlichen Bühne.
Die Kirche hat dem Tod schon immer die Stirn geboten. Es gibt keine Auferstehung ohne Grab, das Geheimnis von Tod und Auferstehung fällt seit Jahrhunderten in ihre besondere Zuständigkeit Verstört blicken Italien und Europa auf die unaufhaltsam wachsende Masse der Toten und Infizierten – doch von den Kanzeln kein Wort. Seit Jahrzehnten hatte man den Tod symbolisch eliminiert. Er betraf immer nur »die anderen«. Kriege, Massaker und Anschläge hatten auf den Fernsehbildschirmen einen cineastischen Charakter bekommen: etwas, das man sieht, aber auf Knopfdruck verschwinden lassen kann. Auch der Tod von Verwandten war längst kein Ereignis mehr, das man als Familie gemeinsam durchlebte. Wer sterben musste, wurde aussortiert und in Krankenhäuser und Senioreneinrichtungen verbannt. Der Tod sollte die Zeitgenossen nicht verstören. Jetzt aber ist der schaurige Sensenmann zurückgekehrt. Es kann jeden treffen – und es ist auch erschütternd, plötzlich feststellen zu müssen, dass man sich von einem Sterbenden nicht mehr verabschieden oder einem Toten keine Blume ins Grab werfen kann.
Jorge Mario Bergoglio, 266. römischer Pontifex, weiß aus der Geschichte seiner piemontesischen Familie, wie es ist, wenn man – aus Zufall oder weil die Vorsehung es so will – mit knapper Not dem Tod entronnen ist. Das Schiff, das seine Großeltern väterlicherseits und seinen Vater von Genua nach Argentinien bringen sollte, sank im Atlantik. Hunderte ertranken. Die Bergoglios wurden gerettet, weil sie die Reise verschoben und ihre Karten für die Überfahrt nach Argentinien mit dem Dampfer »Principessa Mafalda« im letzten Moment umgetauscht hatten. So kam es, dass sie nicht unter den Schiffbrüchigen waren. Jorges Vater Mario Bergoglio ging zwei Jahre später, 1929, gemeinsam mit seinen Eltern in Buenos Aires an Land.
Jorge Mario selbst wäre mit 21 Jahren beinahe an einer schweren Lungenentzündung gestorben; damals musste ihm der obere Teil des rechten Lungenflügels entfernt werden. Ein Detail, das die Gegner seiner Kandidatur beim Konklave 2013 auszunutzen versuchten. Kardinal Óscar Rodríguez Maradiaga musste beim Mittagessen der wahlberechtigten Kardinäle von Tisch zu Tisch gehen, um die Gerüchte von einer schweren gesundheitlichen Beeinträchtigung zu dementieren, die Bergoglios Wahl im Wege gestanden hätte.
In Buenos Aires hat Franziskus als Jesuit und Erzbischof mitangesehen, wie in den Armenvierteln gelebt, gestorben und gemordet wird. Und nachdem er Papst geworden war, befand er sich jahrelang im Fadenkreuz des ISIS, der Bilder vom Obelisken auf dem Petersplatz ins Netz stellte, über dem drohend die schwarze Flagge des islamistischen Kalifats wehte.
Die Stille auf dem Petersplatz ist erdrückend. Unter einem weißen Baldachin spricht Franziskus ins Leere. Das Lächeln, das die Welt seit sieben Jahren kennt, ist verschwunden. »Tiefe Finsternis hat sich auf unsere Plätze, Straßen und Städte gelegt; sie hat sich unseres Lebens bemächtigt und alles mit einer ohrenbetäubenden Stille und einer trostlosen Leere erfüllt«, ruft Franziskus aus, und sein Gesicht ist von Melancholie und tiefem Ernst gezeichnet. Er spricht von der Leere, die alles lähmt. »Es liegt in der Luft, man bemerkt es an den Gesten, die Blicke sagen es.« Wir alle, so fährt er fort, sind verängstigt und verloren wie die Jünger Jesu auf dem Boot inmitten des Sturms.1 Franziskus’ Gebet bringt die Decke des Schweigens, die über der Stadt und dem Erdkreis liegt, zum Bersten.
Jahrhundertelang war die Kirche in Zeiten der Epidemie immer die große Hauptdarstellerin. Sie hat die Stadt der Menschen, sie hat ihre Bilderwelt beherrscht. Das bezeugen die Fresken, die noch heute von den Wänden der religiösen und weltlichen mittelalterlichen Bauten zu uns sprechen. Der Tod ist der große Gleichmacher. Das Kreuz ist die Arche des Heils. Auf dem Triumph des Todes in Palermo, dem bekannten Fresko aus dem 15. Jahrhundert, liegen die Leichen von Päpsten und Kaisern wild durcheinander auf einem Haufen: Zeichen einer unparteiischen göttlichen Gerechtigkeit, die den von der Feudalgesellschaft unterdrückten Männern und Frauen Genugtuung verschafft. Der skelettartige Tod reitet auf einem knochigen grauen Pferd und schießt erbarmungslos seine vergifteten Pfeile ab. Gottes Zorn schlägt unerbittlich zu und trifft Fürsten, Damen und Ritter, die schwere Schuld auf sich geladen haben. Vor der Krankheit gibt es kein Entrinnen.
Auf dem Camposanto Monumentale in Pisa treffen Lebende und Tote in einer unerwarteten Begegnung aufeinander. Der unerträgliche Leichengestank macht die Pferde scheu und lässt ihre Nüstern beben. Die Adligen halten sich Taschentücher vors Gesicht. Aus den Leibern der Toten kriechen abscheuliche Schlangen. Bilder des Totentanzes ziehen sich durch ganz Europa.
In der großen Katastrophe war die Kirche immer das Sinnbild einer unerschütterlichen transzendenten Macht, die einzige Mittlerin und Zuflucht, Zeichen des Heils, um den göttlichen Richtspruch abzumildern. Die Krankenhäuser waren kirchliche Einrichtungen. In den verlassenen Straßen ging der Priester unter Schellengeläut von Tür zu Tür, um den Sterbenden Trost zu spenden. Er hörte schreckerfüllte Beichten und drängte Männer und Frauen, die im Schatten des Altares Zuflucht suchten, Buße zu tun. Er, der Priester oder Ordensmann, war es, der die Lebenden und Sterbenden tröstete, die Bettreihen in den Lazaretten abschritt und die Prozessionen der psalmodierenden Gläubigen anführte, die um Erbarmen flehten, während das Volk gelobte, Votivsäulen zu errichten, wenn die Geißel vorüber war.
Im Jahr des Herrn 2020 ist diese alles durchdringende Präsenz mit einem Mal wie ausgelöscht. Die Säkularisierung hatte die zentrale Bedeutung der religiösen Institution schon vorher gebrochen. Die »christliche Gesellschaft« gehörte, wie der katholische Historiker Pietro Scoppola erklärte, endgültig der Vergangenheit an. Selbst Ratzinger, Papst Benedikt XVI., war zu dem Schluss gekommen, dass das Christentum zu einer Minderheit geworden war.
Bei Ausbruch der Epidemie und in der Zeit der Massenquarantäne – bei den Franzosen Confinement, Arrest, und in der angelsächsischen Welt Lockdown genannt: Wörter, bei denen man förmlich zu hören meint, wie die Gefängnistür ins Schloss fällt – wird deutlich, dass die Religion vollkommen von der Bühne verschwunden ist. Zum ersten Mal seit dem Mittelalter grassiert ein großes, todbringendes Phänomen und beherrscht den öffentlichen Raum, ohne dass religiöse Symbole sichtbar werden. Eine Nichtpräsenz, die in unserem Medienzeitalter zum Himmel schreit. Die Religion tritt in den Hintergrund, die Wissenschaft ist die unangefochtene Herrin. Die im Rampenlicht stehen, tragen Kittel und keine Stola. Es riecht nicht nach Weihrauch, sondern nach Desinfektionsgel. Helden und Märtyrer sind die Ärzte und Pflegerinnen, die Verkündung des Wortes obliegt der Politik: dem Premierminister, den Bürgermeistern, den Landesregierungen. Die einzige Liturgie ist die abendliche Pressekonferenz, bei der die Zahlen der Toten, der Infizierten und der Genesenen sowie die Empfehlungen verlesen werden, denen es zu folgen gilt. Dass es kein Priester ist, der den Sterbenden das letzte Kreuz auf die Stirn zeichnet, lässt sein Ausgeschlossensein grausam deutlich werden. Doch es ist unvermeidlich. Der einzige Weg, die Krankheit zu bekämpfen, ist der, den die Wissenschaft vorgibt. Zusammen zu sein ist ansteckend. Zusammen zu sein ist tödlich. Wer als Botschafter Gottes ins Krankenhaus geht, läuft Gefahr, die Seuche zu verbreiten.
Die Verfinsterung betrifft die beiden großen monotheistischen Weltreligionen: Christentum und Islam. Beide gründen sich auf die Gottesanbetung in großen gemeinschaftlichen Räumen. Nicht nur der Petersplatz ist verwaist: Auch der Platz vor der Kaaba in Mekka – das berichtet die missionarische Nachrichtenagentur Asia News – ist menschenleer. In Jerusalem ist die Grabeskirche genauso geschlossen wie die al-Aqsa-Moschee. Und die Feierlichkeiten zum muslimischen Fastenmonat Ramadan werden in den darauffolgenden Monaten in verschiedenen Teilen der Welt strengen Beschränkungen unterliegen.
Die Schnelligkeit, mit der sich COVID-19 ausbreitet, ist unvorstellbar. Ein Jahr nach seinem ersten Auftreten beläuft sich die Zahl der Infizierten auf über 100 Millionen und die der Opfer auf zweieinhalb Millionen. 2021 wird das Virus seinen gnadenlosen Lauf fortsetzen und die Menschen weiter dahinraffen.
Das Virus befällt auch die menschlichen Beziehungen. Es lässt Kontakte abreißen und bringt das Sozialleben zum Erliegen. Es verurteilt Singles zur Einsamkeit und hält alte und alleinstehende Menschen unerbittlich gefangen. Es lässt Konflikte aufbrechen, Hass, Spannungen zwischen Lebenspartnern. Das Virus verhindert den physischen Kontakt: Umarmungen, Zärtlichkeiten, Küsse, einen Händedruck.
Für die Kirche ist es ein Schock, wie sie ihn nicht einmal in Kriegszeiten, nach Überschwemmungen oder Erdbeben je zuvor erlebt hat. Das Wesen des Christentums besteht nicht im Studium heiliger Texte oder in der individuellen Betrachtung des Göttlichen, sondern in der Beziehung zum Leib des Volkes Gottes. Das Wort Pfarrei leitet sich vom Griechischen Paroikia ab, das den nachbarschaftlichen Verbund von Haushalten bezeichnet, der unter einem Priester zusammenkommt. Durch die gemeinschaftlich gefeierte Trauung erhält der Pfarrer Zugang zur lebendigen Beziehung zwischen den Geschlechtern. Und durch die persönliche Beichte, die, wie auf dem Konzil von Trient festgelegt, mindestens einmal im Jahr abgelegt werden muss, erhält er Zugang zu den Gewissen.
Der Priester nimmt bei der Taufe das Neugeborene auf den Arm und spendet den Jugendlichen die Erstkommunion. Bei der Krankensalbung berührt er einen Menschen in den letzten Augenblicken seines Lebens. Die Kirche ist Andachtsraum, Wallfahrt, Gebetsgemeinschaft, Prozession. Die Messe ist das Gedenken an ein gemeinsames Mahl, die Kommunion ist Seelenspeise, die durch den Körper geht. Die Predigt ist Blickkontakt, der Friedensgruß ist ein Händedruck, Singen und Beten sind kollektive Akte. Der Glaube wird mit Herz und Verstand als Beziehung in Fleisch und Blut erlebt.
Und dann wird dieses seit Jahrhunderten, ja seit Jahrtausenden pulsierende Gewebe mit einem Mal von der COVID-19-Seuche zerrissen. Papst Franziskus nimmt die Erschütterung wahr. Er mahnt, sich an die Logik der Wissenschaft zu halten, aber er begreift, dass die Kirche nicht untätig bleiben kann.
Sechs Tage nach Ausrufung des landesweiten Lockdowns stattet der Pontifex der Basilika Santa Maria Maggiore einen Blitzbesuch ab, um vor der Marienikone »Salus Populi Romani« zu beten, und geht anschließend einige Dutzend Meter zu Fuß über eine der Hauptstraßen Roms, den Corso. Sein Ziel ist die Kirche San Marcello. Er will dort vor dem Kruzifix beten, das der Überlieferung nach als Prozessionskreuz durch die Stadt getragen wurde, um der »großen Pest« des Jahres 1522 Einhalt zu gebieten.
Im Jargon der PR-Experten nennt man so etwas Photo Opportunity, ein Bild, das eine Botschaft ausdrückt, das Aufmerksamkeit erregt. Doch damit nicht genug. Zehn Tage später, am 25. März, lädt der Papst die Christen sämtlicher Konfessionen zu einem weltumspannenden Vaterunser ein. Der Ökumenische Patriarch Bartholomaios I., der anglikanische Primas Justin Welby und der Weltkirchenrat schließen sich an. Doch auch das reicht noch nicht. Franziskus spürt, dass er wieder zur Welt sprechen muss. Zu den 1,3 Milliarden Katholiken, zu den Millionen Christen aus anderen Konfessionen, die erwartungsvoll auf den Bischof von Rom blicken, zu denjenigen unter den Gläubigen anderer Religionen und unter den Nicht-Glaubenden, die seit Jahren auf seine Botschaft achtgeben.
Die katholische Kirche war in den vergangenen Jahrzehnten keineswegs immun gegen die heftigen und bitteren Anschuldigungen im Zusammenhang mit den Missbrauchsverbrechen und ihrer schändlichen Vertuschung bis in die höchsten Kreise hinein; sie hat wegen trüber Finanzskandale auf der Anklagebank gesessen; und als Vatileaks Wellen schlug, hat sie das unschöne Gesicht interner Grabenkämpfe entblößt. Und doch kommt zyklisch immer wieder der Moment, da ein Papst die Größe findet, als die Stimme der Welt zu sprechen. Ob er nun Johannes Paul II. oder Paul VI. heißt, Johannes XXIII. oder Franziskus.
Unter dem weißen, regendurchweichten Baldachin auf dem verwaisten Petersplatz verwandelt Franziskus am 27. März die Leere in einen Raum der Begegnung für eine Menge, die nach Nähe und Vertrauen dürstet. Vor der Basilika, die einer Felswand ähnelt, sammelt Franziskus wie in einem Brennglas die Spannung der nahen und fernen Erwartungen. Er bringt ein Wort der Hoffnung und Solidarität, des Glaubens und des Muts. Das Boot, sagt er, befindet sich in einem Sturm, und in diesem Boot sitzen wir alle. »Alle sind wir dazu aufgerufen, gemeinsam zu rudern, alle müssen wir uns gegenseitig beistehen.«2
Weil das Virus den herrschenden darwinistischen Mythos platzen lässt, die Besessenheit der Sieger, die in beständigem Wettkampf liegen. Franziskus meißelt Worte in die Stille, die für jedermann klar verständlich sind. Die Menschen hätten erkannt, »dass wir nicht jeder für sich, sondern nur gemeinsam vorankommen«. Der Sturm entlarvt die Verwundbarkeit der Welt, erschüttert die falschen Sicherheiten, reißt die Klischees herunter, hinter denen sich das Ego der krankhaft um ihr Image besorgten Zeitgenossen versteckt hatte.
Im Laufschritt war man vorangestürmt, hatte sich stark gefühlt, sich alles zugetraut, nach Profit gegiert. »Wir haben uns von Kriegen und weltweiter Ungerechtigkeit nicht aufrütteln lassen«, fährt Franziskus fort, »wir haben nicht auf den Schrei der Armen und unseres schwer kranken Planeten gehört. Wir haben unerschrocken weitergemacht in der Meinung, dass wir in einer kranken Welt immer gesund bleiben würden.« Jetzt, inmitten des Sturms, erinnert Franziskus an den uralten Schrei der vom Entsetzen gepackten Jünger, die im See Gennesaret zu ertrinken fürchten, während Jesus auf dem Boot immer noch tief und fest schläft: »Wach auf, Herr!«
Die Scheinwerfer an den vatikanischen Palästen tauchen die Gestalt des greisen Pontifex, der mit leiser Stimme spricht, in ein schwaches Licht. 17 Millionen Zuschauer verfolgen die Andacht im italienischen Fernsehen, mehrere Hunderttausend außerdem über das Streaming-Angebot und die Liveschaltungen der diözesanen Radio- und Fernsehstationen. Weitere Millionen in aller Welt werden sich den Auftritt des Papstes auf den digitalen Kanälen ansehen. Bergoglio ist 83 Jahre alt. Er hat nicht die majestätische Erscheinung und physische Präsenz des ehemaligen Schauspielers Karol Wojtyła. Er ähnelt eher einem Pfarrer, doch seine menschliche Ausstrahlung hat die Menge vom ersten Augenblick an in ihren Bann gezogen: seit er sich nach dem Konklave am Abend des 13. März 2013 auf der Loggia der vatikanischen Basilika gezeigt hat.
Er ist ein Papst, der den Geruch des Lebens kennt. Er hat gearbeitet, er hat als Rausschmeißer in einer Diskothek gejobbt, er hatte eine Freundin, er hat die Barbarei der Diktatur und die Niedertracht einiger seiner Mitbrüder im Bischofsamt kennengelernt, er weiß um die geringschätzige Achtlosigkeit der Reichen und Wohlmeinenden für die Existenzen, die nur wenige Kilometer von ihnen entfernt Schiffbruch erleiden, er weiß um die Korruption und die stillschweigende – aber allen bekannte – Allianz, die in vielen Ländern Teile der institutionellen mit Teilen der kriminellen Welt verbindet. Die Heuchelei der scheinbar Gottesfürchtigen gefällt ihm nicht: Dann sei man besser Atheist, erklärt er. Franziskus kennt den Geruch der Verzweiflung. Er kennt die Knoten der Geschichte – deshalb fühlt er sich so sehr zur bayerischen »Maria Knotenlöserin« hingezogen – und die Windungen des menschlichen Geistes. Auch seines eigenen. In den 1980er-Jahren hat er sich nach einem wenig glücklichen Intermezzo als Jesuitenprovinzial einer Psychoanalyse unterzogen.
Dort, auf dem Petersplatz, spricht er über die Aussichten der Jünger auf einem Boot, das zu sinken droht. Seine Ansprache ist religiös, aber nicht abstrakt. Sie trifft den Kern des historischen Augenblicks. Christus ist nicht fern, Christus »kümmern« alle, ruft er aus. Der Sturm offenbart allenfalls, wie schwach der Glaube der Christen ist und wie schwer es ihnen fällt, zu verstehen, dass sie das Heil Gottes brauchen.
Bergoglios Theologie dringt vor in die Schatten des regnerischen Abends, und seine Stimme trägt weit. Im Kreuz Christi, so sagt er, »sind wir geheilt und umarmt worden«, aber das bringt eine Verantwortung mit sich. Franziskus mag es nicht, wenn Christen träge sind. Das Kreuz zu umarmen, erklärt er, bedeutet, dass man den Mut findet, die Widrigkeiten der Gegenwart zu akzeptieren und einen Moment lang nicht nach Besitz und Allmacht zu lechzen. Es bedeutet, sich den anderen zuzuwenden und »diesen Stunden, in denen alles unterzugehen scheint, Festigkeit, Halt und Sinn [zu] geben«.
Der argentinische Papst will an die erinnern, Männer und Frauen, die in den entscheidenden Augenblicken die Notwendigkeit verkörpern, gemeinsam zu rudern. Er spricht nicht ex cathedra, sondern versetzt sich auf die Flure der Kliniken, in die Zimmer der Häuser, wo Menschen in Armut leben, in die Winkel des Alltäglichen hinein. Mit einem Gefühl der Nähe zählt Bergoglio sie alle auf, nennt Ärzte, Krankenschwestern und Pfleger, Supermarktangestellte, Reinigungspersonal, Ärzte, Betreuerinnen, Personenbeförderer, Ordnungskräfte, Ehrenamtliche, Priester, Ordensleute und »viele, ja viele andere, die verstanden haben, dass niemand sich allein rettet«. Sie sind diejenigen, die im Kampf gegen die Krankheit das entscheidende Kapitel schreiben.
Papst Franziskus hat gerade erst Anweisung gegeben, die päpstliche Titulatur auszudünnen: Im Annuario pontificio von 2020 werden Titel wie »Stellvertreter Jesu Christi«, »Nachfolger des Fürsten der Apostel«, »Pontifex maximus der universalen Kirche«, »Souverän des Staates der Vatikanstadt« usw. als historisch bezeichnet und in eine Fußnote verbannt. Franziskus genügt es, Bischof von Rom zu sein. Der Pomp vergangener Zeiten – so seine Überzeugung – dient zu nichts, im Gegenteil, er ist nur hinderlich, wenn man mit den Männern und Frauen des 21. Jahrhunderts ins Gespräch kommen will, die aufgrund denkbar unterschiedlicher persönlicher Erfahrungen gläubig oder nicht gläubig sind.
Was Franziskus interessiert, ist ein aktiver, nach dem Maßstab der Nächstenliebe gedachter und gelebter Glaube: ein konkretes Glaubenshandeln in der konkreten historischen Situation des Jahres 2020, während die Pest sich unaufhaltsam ausbreitet. Und mit dem Ziel, dass die Welt »danach« nicht mehr so krank sein soll wie zuvor. Christus die eigenen Ängste anzuvertrauen, setzt voraus, dass jeder sich als Teil einer einzigen Menschheitsfamilie fühlt. Das ist der religiöse Humanismus von Papst Franziskus, und dieser Humanismus ist bereit, sich an anderen Humanismen messen zu lassen. Entweder man ist Bruder und Schwester oder man ist verloren. Aus dieser Geisteshaltung heraus weist der Papst die alte Vorstellung von der Pest als göttlicher Strafe (wie sie schon von Homer besungen wurde) zurück. Für Bergoglio ist Gott immer Vater, und Aufgabe der Kinder ist es, den Sinn eines Erbes zu erkennen, das der argentinische Pontifex von Anfang an in zwei Begriffe gefasst hat: Liebe und Barmherzigkeit. Womit er sich den Zorn der Gesetzeslehrer in seiner eigenen Kirche eingehandelt hat.