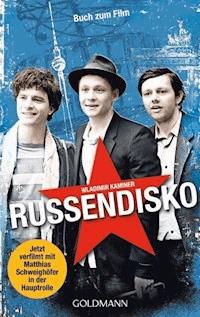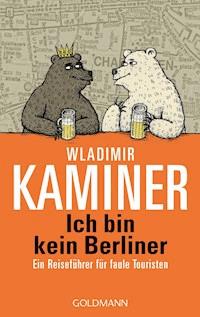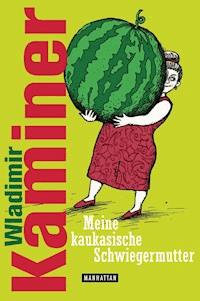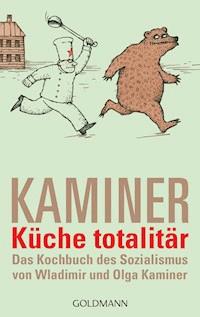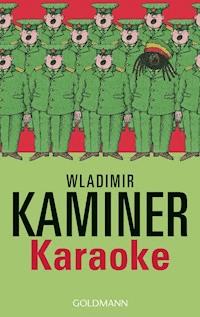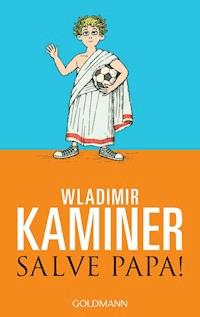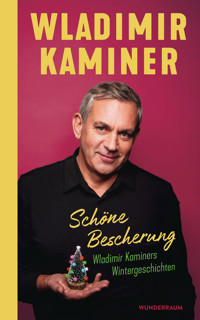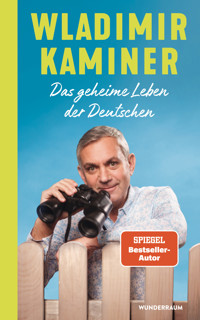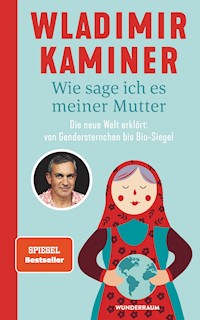3,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 12,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 12,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Goldmann Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Das neue Buch des SPIEGEL-Bestsellerautors.
Mit unerschütterlichem Humor blickt Wladimir Kaminer auf die Monate, die unser Leben veränderten.
Frühjahr 2020. Die Menschen erwachten aus dem Winterschlaf, blinzelten in die Sonne und ahnten nicht, was auf sie zukam. Im fernen China hatte angeblich ein erkältetes Gürteltier auf eine kranke Fledermaus geniest – ein Virus war geboren, das die Welt lahmlegte. Doch es konnte weder der Neugier noch dem Humor von Wladimir Kaminer etwas anhaben. Trotz Lockdown, Mundschutz und Fassbier-Verbot fand er überall Geschichten, die bewiesen: Das Leben ging weiter! Wenn auch jeden Tag ein bisschen anders als zuvor. Mit Witz und Herz beobachtete er den Alltag von uns Coronauten und die allmähliche Veränderung unserer Realität …
Wladimir Kaminer und sein Blick auf die Corona-Welt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Buch
Frühjahr 2020. Die Menschen erwachten aus dem Winterschlaf, blinzelten in die Sonne und ahnten nicht, was auf sie zukam. Im fernen China hatte angeblich ein erkältetes Gürteltier auf eine kranke Fledermaus geniest – ein Virus war geboren, das die Welt lahmlegte. Doch es konnte weder der Neugier noch dem Humor von Wladimir Kaminer etwas anhaben. Trotz Lockdown, Mundschutz und Fassbier-Verbot fand er überall Geschichten, die bewiesen: Das Leben ging weiter! Wenn auch jeden Tag ein bisschen anders als zuvor. Mit Witz und Herz beobachtete er den Alltag von uns Coronauten und die allmähliche Veränderung unserer Realität …
Autor
Wladimir Kaminer wurde 1967 in Moskau geboren und lebt seit 1990 in Berlin. Er selbst sieht sich als Weltbürger und sagt, er sei privat Russe, beruflich deutscher Schriftsteller. Mit seiner Erzählsammlung »Russendisko« sowie zahlreichen weiteren Bestsellern avancierte er zu einem der beliebtesten und gefragtesten Autoren Deutschlands. Alle Bücher von Wladimir Kaminer gibt es auch als Hörbuch, von ihm selbst gelesen.
Weitere Informationen zu lieferbaren Titeln des Autors
finden Sie am Ende des Buches sowie unter
www.wladimirkaminer.de.
Wladimir Kaminer
Der verlorene
Sommer
Deutschland raucht auf dem Balkon
Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Originalausgabe April 2021
Copyright © 2021 by Wladimir Kaminer
Copyright © dieser Ausgabe 2021
by Wilhelm Goldmann Verlag, München,
in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH,
Neumarkter Str. 28, 81673 München
Umschlaggestaltung: UNO Werbeagentur, München
Umschlagfotografie: © Urban Zintel
AB • Herstellung: ik
Satz: KompetenzCenter, Mönchengladbach
ISBN: 978-3-641-27360-6V001
www.goldmann-verlag.de
Besuchen Sie den Goldmann Verlag im Netz
Inhalt
1. Freitag, der 13.
2. Mama
3. Kids 1: Nicole
4. Kids 2: Sebastian
5. Das stille Leben in Brandenburg
6. Russland
7. Riverboat
8. Demos in Berlin
9. Der Tag der Solidarität
10. Die Reise zum weißen Pferd
11. Restaurants
12. Katzen in Zeiten der Pandemie
13. Colosseum
14. Der verlorene Sommer
15. Die völlige Ignoranz der Fische
16. Glattes Eis
17. Wir richten uns nach dem Pfeil
Kapitel 1
Freitag, der 13.
»Bus und der Busfahrer sind desinfiziert. Bitte halten Sie den Sicherheitsabstand ein, und steigen Sie durch die hintere Tür in den Bus ein.« Mit diesem großen roten Zettel war die Busfahrertür von außen versiegelt, der Fahrersitz war mit rot-weiß gestreiften Absperrbändern gesichert. Ich stieg durch die hintere Tür ein und wollte den Busfahrer nach einer Fahrkarte fragen. »Nach hinten gehen, dü hascht nich gelese!«, pöbelte er mich an. Man konnte zum Glück nicht wirklich verstehen, welche Wünsche er in seine Atemschutzmaske spuckte. Ich nickte, wünschte ihm in Gedanken ebenfalls einen schönen Coronadurchfallstrahl zu Ostern und setzte mich nach hinten.
Es war also kein Witz. Auch hier in Baden-Baden hatte die Panik zumindest die Verkehrsbetriebe erreicht. Aufgrund der Corona-Pandemie waren schon mehrere meiner Veranstaltungen ausgefallen, denn die Bundesregierung und das ganze Land hatten nur noch eins im Sinn: die Infektionsketten unterbrechen. Mit meinen Lesungen und der Russendisko war ich zweifelsohne Teil dieser Kette und musste dringend unterbrochen werden. Eine Woche zuvor waren bereits Großveranstaltungen ab tausend Teilnehmern untersagt worden, am Montag darauf hieß es, auch Veranstaltungen ab hundert Teilnehmern seien eine große Gefahr für die Menschen. Es gehe um Leben und Tod jedes Einzelnen von uns, hatte der Finanzminister gesagt und alle Bürgerinnen und Bürger aufgefordert, ihre Wohnungen nicht mehr zu verlassen.
Alle Kultur- und Kunstorte wurden als mögliche Beschleuniger der Seuchenverbreitung eingestuft und geschlossen. Den ganzen Vormittag riefen mich die Verantwortlichen von Theatern, Clubs und Volkshochschulen an, wo demnächst eine Lesung oder eine Disko geplant war, und baten um Ersatztermine für den Herbst. Zwischen September und Januar wollten sie das Programm wieder aufnehmen. Bis dahin wäre die Sache mit dem Virus vorbei, so war die allgemeine Stimmung.
Auf einmal war ich arbeitslos, denn nur die wenigsten Veranstalter hielten an ihrem Programm fest. Die Sparkasse in Annaberg-Buchholz wollte allerdings trotz schlechter Nachrichten unbedingt den Internationalen Frauentag für ihre weiblichen Kunden nachfeiern, und auch das Casino Baden-Baden zeigte sich nicht bereit, auf meinen Auftritt zu verzichten.
»Sie sind unser letzter Gast«, erklärte mir eine Öffentlichkeitsbeauftragte des Casinos, Frau Hase. »Danach möchten auch wir eine Pause machen. Als Casino müssen wir ganz besonders auf unser Image achten. Es geht ja nicht, dass alle Festspielhäuser und Konzerthallen schließen, das Casino aber weitermacht, als wäre nichts passiert. Wir wollen nicht als einzige Quelle der Seuche in der Öffentlichkeit dastehen und schließen deswegen morgen. Heute aber freuen wir uns sehr auf Ihre Lesung!«
Ich freute mich auch auf den Abend, obwohl der lange Weg von Annaberg-Buchholz nach Baden-Baden durch ein verängstigtes und verseuchtes Deutschland mir die letzte Kraft raubte. Dazu kam dann noch der pöbelnde Busfahrer mit Atemmaske. Im Bus saßen drei Menschen und ich mit größtmöglichem Abstand voneinander entfernt. Dummerweise war ich erkältet und konnte meinen Husten nicht verbergen. Jedes Mal, wenn ich hustete, blickten die anderen Passagiere in meine Richtung wie gejagte, in die Ecke getriebene und vom Tod bedrohte Tiere.
Der Tod war derzeit überall. Er lauerte an jeder Ecke, unsichtbar, tückisch, allgegenwärtig. Das Virus konnte ersten Berichten zufolge ohne menschlichen Wirt bis zu drei Tage auf allen Oberflächen überleben. Es konnte auf jeder Türklinke, jedem Sitz, jeder Klobrille sein Unwesen treiben und innerhalb einer Sekunde der Entspannung, wenn du auf der Toilette gerade deinen Schutzanzug heruntergelassen hast, in dich eindringen.
Je schärfer die Passagiere mich anschauten, umso mehr musste ich husten. Ich glaube, es handelt sich hier um ein psychisches Phänomen. Jedenfalls hustete und hustete ich, bis ich ausstieg. Vor dem Hotel traf ich den Casino-Direktor mit seiner schönen russischen Frau Natascha. Er hustete auch, das beruhigte mich etwas.
»Wir werden wahrscheinlich ab Montag keine weiteren Veranstaltungen abhalten können, aber das heute Abend ziehen wir durch«, lächelte mich der Direktor an. Er selbst könne allerdings nicht kommen. Er sei leider verschnupft, meinte seine Frau. Sie wären gerade beim Arzt gewesen, und der Direktor habe sich krankschreiben lassen. In diesen Zeiten der allgemeinen Verunsicherung wollte er seinen Mitarbeitern nicht zumuten, einen kränkelnden, hustenden Direktor vor Augen zu haben. Sie wünschten mir viel Erfolg.
Im Hotel versuchte ich, mich mental auf den Abend vorzubereiten. Eine Stunde vor Beginn kam dann die Nachricht: Das Casino schloss mit sofortiger Wirkung den gesamten Spielbetrieb, inklusive Bars und Restaurants.
»Das ist leider nicht zu ändern, Wladimir«, meinte Frau Hase. Sie wollte am Abend jedem einzelnen der 200 Gäste sein Geld persönlich zurückgeben und sich entschuldigen. »Das wird kein Spaß«, meinte sie am Telefon, »aber lass uns trotzdem danach ins Rizzi essen gehen.«
Wir verabredeten uns für halb zehn. Zum Glück waren die Restaurants noch nicht geschlossen, aber keiner wusste wie lange noch. Abends saßen wir wie jedes Jahr mit der Buchhändlerin Marion, der Öffentlichkeitsbeauftragten Frau Hase und Arnold, dem Chef der sozialpädagogischen Abteilung, zusammen. Wieso hatte ein Spielcasino überhaupt eine sozialpädagogische Abteilung? Es ging dabei um die Gesundheit der Spieler – psychisch und physisch. Spieler sind wie die Katzen. Sie verdrängen oft ihr Leiden, tun so, als seien sie fit und munter, und offenbaren sich erst, wenn es für Hilfe bereits zu spät ist. Die sozialpädagogische Abteilung baue auf Vorsorge und Prävention, auf gut Deutsch: Verhütung.
In der Regel sieht ein Casinobesucher adrett und gesund aus. Er ist ordentlich gekämmt, sauber rasiert und angezogen, grüßt das Personal, spielt meistens an einem Tisch, schaut konzentriert aufs Roulette und freut sich, wenn jemand in seiner Nähe gewinnt. Manchmal aber kommt ein Spieler ungekämmt und unrasiert herein. Er zappelt, schimpft, grüßt die Angestellten nicht und springt wie ein wilder Ziegenbock von Spieltisch zu Spieltisch. In diesem Fall macht der Leiter der sozialpädagogischen Abteilung ein Kreuz auf seiner Liste und wartet auf den Anruf von Familienangehörigen. In der Regel kommt dieser Anruf innerhalb von 24 Stunden. Sohn, Tochter oder Ehefrau des Betroffenen klagen, ihr Vater oder Ehemann sei in letzter Zeit kaum wiederzuerkennen. Er sei verzweifelt, habe Selbstmordfantasien, laufe Amok und sei anscheinend fest entschlossen, sein ganzes Vermögen nicht seinen Angehörigen, sondern dem Casino zu überlassen. Dabei hätten die Ehefrau und die Kinder fest mit dem Geld gerechnet, um damit ihr Leben als reiche Schmarotzer abzusichern. Sie bitten daher die sozialpädagogische Abteilung, dem Spieler mindestens vorübergehend Casino-Verbot zu erteilen, damit er ein wenig Zeit habe, wieder zu sich zu kommen.
Es sind oft komplizierte, nervenaufreibende Schlichtungen, die Arnold zu managen hat. Wahrscheinlich ist er durch seine Arbeit ein so ruhiger, ausgeglichener Mensch geworden. Doch an diesem Tag war er völlig außer sich.
»In den ganzen dreißig Jahren ist es mir noch nie passiert, dass ich die Tresore der Spielbank bereits um 20.00 Uhr schließen musste. Wir sind heute leer ausgegangen! Wir sind leer! Das Virus hat unser Geld gefressen. Und das ist nur der Anfang!«
Arnold wusste anscheinend mehr als wir alle über die Pandemie. Seit Februar hatte er jeden Abend und jeden Morgen die Live-Ticker zur Corona-Ausbreitung verfolgt und sich dabei sogar ein wenig in den Virologen Christian Drosten verliebt, der jeden Tag in allen wichtigen Nachrichtensendungen auftrat und Tipps gab, wie man in einer virenverseuchten Welt am besten überlebte.
»Er hat ein solches Charisma! Dieser Blick, diese leise, aber gleichzeitig selbstbewusste Stimme!«, schwärmte Arnold. In der Tat hatte man Menschen wie Drosten früher nicht so oft im Fernsehen gesehen, aber auf einmal waren sie zu den wichtigsten Orakeln der Nation aufgestiegen. Kein Nachrichtenprogramm kam ohne einen Fachmann in medizinischer Forschung aus. Es waren die Helden der neuen Zeit, allesamt Männer, schlank, lässig angezogen, manche mit Dreitagebart: Virologen, Epidemiologen, Professoren für Tropenmedizin, Amphibienforscher. Die meisten versuchten, der Bevölkerung komplizierte wissenschaftliche Vorgänge in möglichst einfacher Sprache zu vermitteln, um den Menschen die Angst vor der Erkrankung zu nehmen. Das funktionierte nicht wirklich. Denn was für Virologen normal war, versetzte die unvorbereiteten Zuhörer in Panik. Natürlich würde das Virus mutieren und jedes Jahr in immer neuen Formen wiederkommen, prophezeiten sie. Möglicherweise hätten wir im Sommer eine Verschnaufpause, und es ginge erst im Herbst wieder los. Vielleicht aber hätte sich das Virus auch der warmen Jahreszeit angepasst und freute sich wie wir alle auf den Sommer, sagten die Virologen. Und was konnten wir dagegen tun? Nichts. Außer alle zwanzig Sekunden gründlich die Hände waschen und nach Möglichkeit in den Ellenbogen niesen.
Der charismatische Virologe Christian Drosten ging allerdings noch weiter. Er gab wichtige Überlebenstipps für das alltägliche Leben. Er würde niemals Bier vom Fass trinken, nur aus der Flasche, offenbarte der Wissenschaftler. Man wisse nämlich nie, wie gründlich die Gläser abgespült würden, wie viel Spülmittel dabei eingespart werde und wer noch vor fünf Minuten aus demselben Glas getrunken habe.
Am nächsten Tag konnte man in jeder Zeitung als wichtigste aktuelle Empfehlung lesen: »Virologe Drosten rät von gezapftem Bier ab, trinkt nur aus der Flasche!«
Die Empfehlung konnte den Berliner Kneipen kaum noch schaden, denn bereits wenige Tage später mussten sie auf Anordnung der Stadtverwaltung schließen. Polizeipatrouillen fuhren durch die Stadt und kontrollierten, ob die Kneipenbesitzer sich an das Verbot hielten. Sie waren positiv überrascht. Die Wirte wussten alle Bescheid und mussten nicht erst durch die Polizei zum Zusperren aufgefordert werden. Die anderen Empfehlungen der Virologen kamen bei der verunsicherten Bevölkerung ebenfalls gut an: niemandem die Hand schütteln, keine Elternbesuche mehr, keine unnötige Kommunikation mit anderen Menschen.
In den Augen der Virologen schienen Menschen reine Virentransporteure zu sein, die man auf jeden Fall zum Stehen bringen musste. Sonst würden Menschen und Viren sterben und nur noch Virologen den Planeten bevölkern, weil sie niemals Bier vom Fass getrunken hatten. Es gehe um Leben und Tod, um den Erhalt unserer Population, sagte der Finanzminister im Fernsehen. Deswegen dürfe Geld jetzt keine Rolle spielen, Hauptsache wir überlebten.
Für Virologen und Politiker war eine goldene Zeit ausgebrochen. Jahrzehntelang hatten die Bürgerinnen und Bürger sich beklagt über die Unfähigkeit des politischen Personals, Entscheidungen zu treffen, und über die europäische Bürokratie, die jede gesellschaftliche Initiative durch endlose Abstimmungen erdrosselte. Angesichts der großen Herausforderungen des Klimawandels, der Flüchtlingsströme, der Kriege und des unverantwortlichen Egokapitalismus machte sich die europäische Politik in die Hose. Sie hatte Angst vor Großkonzernen, Angst vor Umweltverschmutzern und Klimawandelleugnern, Angst vor Putin und Trump. Die großen bürgerlichen Parteien verloren immer mehr Zustimmungs-Prozente, und die Menschen begannen sich ernsthaft zu fragen, ob sie vielleicht ganz ohne Regierung besser dran wären und dabei auch noch jede Menge Geld sparen würden. Nun hatte sich das Blatt gewendet. Im Virus hatten die Politiker einen Gegner erkannt, vor dem sie keine Angst haben mussten. Es konnte den meisten von ihnen nichts antun – außer einem Schnupfen. Sie aber bekamen durch die Pandemie die Gelegenheit, mit aller Macht zu zeigen, wozu Ordnungshüter da waren. Sie konnten schnelle Entscheidungen treffen, die bürgerlichen Rechte einschränken und natürlich schließen und sperren, schließen und sperren, um das Land und das Volk zu retten.
Die Politiker versuchten sich mit Rechtfertigungen zu überbieten. »Wir sind im Krieg«, erklärte der französische Präsident. Die Bundeskanzlerin ging noch weiter und nannte die Corona-Welle »die größte Herausforderung seit dem Zweiten Weltkrieg«. »Es geht um die Existenz unseres Planeten, wir Amerikaner müssen als Volk überleben«, sagte der amerikanische Präsident, im festen Glauben, unserem Planeten würden ausgerechnet die Amerikaner besonders fehlen.
Als Experten holten sich die Politiker jede Menge Virologen und Epidemiologen – Leute, die durch ihre beruflichen Präferenzen in allen Menschen wandelnde Virensäcke sehen. Sie gaben Tipps zur Eindämmung des Virus. Man sollte sich beispielsweise in seine Wohnung verkriechen und sich nicht mit anderen treffen. Auf diese Weise würden wir nicht alle auf einmal erkranken, sondern geordnet der Reihe nach und so unser Gesundheitssystem vor dem Kollaps bewahren. Sie empfahlen eine weltweite Quarantäne und konnten nicht sagen für wie lange. Je gruseliger ihre Prognosen, umso beliebter wurden die Virologen. Es ist oft so, dass Menschen gerade diejenigen besonders stark ins Herz schließen, die ihnen am meisten Angst machen. Man kennt das auch als Stockholm-Syndrom.
Kneipen wurden geschlossen, während Restaurants zunächst noch bis 18.00 Uhr geöffnet sein durften, später aber nur noch Speisen zum Mitnehmen anbieten konnten. Aber an diesem ersten Tag des Schreckens, am Freitag, dem 13. März, in Baden-Baden galt das Kneipenverbot noch nicht. Also ging ich noch in die Bar des schönen neuen Russenhotels mit dem Swimmingpool auf dem Dach, angeblich frisch von reichen Russen erbaut, wie mir Arnold erzählt hatte. Die Russen lieben Baden-Baden. Sie fangen permanent an, hier etwas zu bauen. Aber dann geht ihnen auf halber Strecke das Geld aus, weil sie nach Feierabend zu oft ins Casino gehen. Die Baustelle wird fürs Erste eingefroren, doch nach einer Weile kommen neue Russen mit frischem Geld, zahlen die alten Russen aus und bauen weiter. Irgendwann gehen allerdings auch die neuen zu häufig ins Casino. Wobei sie das nur tun, um ihren großen Schriftsteller Dostojewski zu ehren, der hier seine ganzen Honorare verspielte. Dostojewski legte es darauf an, das Schicksal herauszufordern, und setzte sein ganzes Hab und Gut auf die 23. Das machen ihm die Russen bis heute nach. Manche setzen zwar trotz Dostojewskis Empfehlung auf die 32, was aber in der Regel auf dasselbe hinausläuft. Das Geld ist weg. Deswegen sehen die Russenhotels in Baden-Baden immer irgendwie unfertig aus.
Vielleicht ist das heute mein letzter Barbesuch, überlegte ich. Ich saß an diesem wunderbaren frühlingshaften Spätabend am Beckenrand des Swimmingpools. Der Whiskey Sour mit Eiweiß schmeckte hervorragend, links und rechts von mir gab es gleich zwei Junggesellenabschiede: Schicke junge Frauen in Abendkleidern und High Heels gaben sich ordentlich die Kante. In einer stillen Ecke saßen unterdessen die Russen, tranken schweigsam Wodka aus Cognacschwenkern, betrachteten ernst den Frauenspaß und wirkten irgendwie fremd auf diesem Fest des Lebens. Nichts erinnerte hier an die erlahmte Welt da draußen, an das Virus. Vom Dach des Hotels aus konnte man in die vielen erleuchteten Fenster auf der gegenüberliegenden Straßenseite schauen: Die Menschen saßen vor ihrem Fernseher, kochten, spielten Karten, rauchten auf dem Balkon. Nichts deutete auf das Ende der Welt hin, unserer gemütlichen, schönen Welt, die so vielen Kriegen und Krisen getrotzt hatte, von einer mikroskopisch kleinen Zellstruktur nun aber in die Knie gezwungen wurde. Vielleicht stand sie noch einmal auf, doch diese dann auferstandene Welt würde wohl eine ganz andere sein, überlegte ich auf dem Dach des Hotels sitzend. Die Welt, wie wir sie kannten, neigte sich dem Ende zu.
Am nächsten Tag wartete ich am Bahnhof Baden-Baden beinahe allein auf den Zug. Die Bundesregierung hatte die Warnung ausgesprochen, alle Bürger sollten Reisen, die nicht lebensnotwendig waren, verschieben. Besonders Flugzeuge und Züge galten als perfekte Übertragungs- und Vermehrungsorte für das Virus. Die Bahn bereitete sich auf eine drastische Reduzierung des Verkehrs vor. In ganz Deutschland wurden die von den Virologen empfohlenen Ausgangssperren diskutiert, aber man wusste noch nicht, ob sie unabdingbar wären, um das Virus zu bremsen.
In der Bahnhofshalle standen zwei Zeugen Jehovas neben mir. Ein älterer mit traurigem Gesicht, gehüllt in einen schwarzen Mantel, der nicht zu dem warmen sonnigen Wetter passte. Ein Mantelrelikt aus der Zeit, als der Winter noch ein Winter war. Der zweite Zeuge war jung und gut drauf. Er hatte ein strahlendes Lächeln und trug einen perfekt sitzenden hellgrauen Anzug mit Weste und Krawatte. Der altmodische Zeuge hielt die Zeitschrift in der Hand, der junge ein Tablet. Auch die Zeugen hatten auf die Anforderungen der neuen Zeit reagiert und umgerüstet. Ich hatte sie schon häufig mit Tablets und Laptops in Bahnhofshallen gesehen. Einige konnten das Ende der Welt inzwischen mit einer PowerPoint-Präsentation sehr glaubhaft und anschaulich in 3D zeigen. Sie waren meist enthusiastisch und fröhlich aufgeregt. Das lang ersehnte Ende der Welt und das Letzte Gericht, von dem sie schon so lange geträumt hatten, rückten mit dem Einmarsch des Virus jetzt in unmittelbare Nähe.
Wir sprachen über die letzten Tage und wie man das Gericht am besten überstand. Die passenden Schuhe seien sehr wichtig. Am besten solle man Turnschuhe oder Fußballschuhe tragen, meinte der junge Zeuge, denn man werde auf dem Rücken einer Riesenschlange zur Gerichtssitzung laufen müssen, einer sehr glatten Ebene also. Man sollte auch eine Sonnenbrille bei sich haben, weil es sehr hell werden würde, und dürfe auf keinen Fall nach rechts oder links schauen. Auf der rechten Seite des Gerichts würden nämlich die gefallenen Engel in den Abgrund gestoßen, auf der linken Seite die Bildnisse und Gleichnisse zerstört, die sich die Menschen trotz des Verbots gemacht hatten. Mit dem Richter zu reden oder einen Anwalt zu verlangen werde bei dieser Angelegenheit nicht nötig sein, weil das Gericht ohnehin alles wisse und jeden seinen Sünden entsprechend verurteile. Das Aussageverweigerungsrecht nach Paragraf 55 der Strafprozessordnung gelte aber auch beim Letzten Gericht, niemand müsse sich zusätzlich belasten. Am besten also schweigen und nicken, so die Empfehlung der Zeugen. Letzten Endes wisse ohnehin jeder, was er angestellt und mit welcher Strafe er zu rechnen habe.
»Ja, ja«, sagte ich und schaute auf die Uhr. Noch zwanzig Minuten bis zur Abfahrt des Zuges. Sie fragten mich nach meinen Sünden. »Na ja«, meinte ich, »nichts Besonderes. Keine exotischen Verbrechen. Ich habe mir kein Bildnis gemacht, ich habe niemanden getötet, ich war vielleicht ein untreuer Ehemann, ich bin faul, ich trinke gerne Rotwein, aber ich ehre meine Eltern und begehre nichts von meinen Nächsten. Die haben meiner Meinung nach aber auch nichts Begehrenswertes. Ich habe auch keine Freude an Besitz, sondern gebe gern alles aus.«
»Das ist eine komplizierte Geschichte«, meinten die Zeugen. »Gott ist gnädig. Bete!«
Ich habe die Bibel auch gelesen. Für Menschen wie mich sollte es beim Letzten Gericht den Stuhl des sogenannten Fröhlichen Sünders geben: Jemand, der eigentlich immer Gutes will, oft Mist baut, aber seine Sünden niemals bereut und gerne einen ausgibt. Solche Menschen sollten nicht in die Hölle kommen und nicht ins Paradies. Sie bleiben für immer in Deutschland, dürfen aber kein Bier vom Fass trinken.
Kapitel 2
Mama
Mein Plan war es, aufs Land zu fahren, während Mama zu Hause in Berlin bleiben sollte. Meine Mutter war 88 Jahre alt, sie gehörte damit zur Risikogruppe, war im Grunde immer vernünftig, ging aber gern aus dem Haus zum Einkaufen, Spazierengehen und um Freunde zu besuchen. Wie sollte ich ihr erklären, dass sie das nicht mehr durfte? Schwierig. Außerdem war sie von der deutschen Nachrichtenwelt abgeschnitten, sie folgte ausschließlich den russischen Nachrichten. Und Russland hatte da schon immer ganz andere als der Rest der Welt. Doch langsam zog auch Russland in die Krise. Die Kirche rief ihre Gläubigen auf, am Sonntag nicht in den Gottesdienst zu gehen, Theater und Kinos machten zu, und sogar das Lenin-Mausoleum wurde geschlossen. Man hatte es nach langem Zögern offiziell als mögliche Infektionsquelle eingestuft.
Die zwei wichtigsten Fragen, die die russischen Analytiker beschäftigten, waren: Was tun? Und: Wer ist schuld? Die meisten waren sich einig. Natürlich war der Westen schuld. Der Kapitalismus mit seiner rastlosen Globalisierung hatte die Infektion über die ganze Welt verbreitet. Über kurz oder lang würde er uns nun vollständig zugrunde richten.
Wir hatten das Ganze am Anfang auch unterschätzt. Die Gefahr war irgendwo weit weg in China in der Stadt Wuhan, von der ich noch nie gehört hatte. Diese Stadt, ein kapitalistisches Vorbild im sozialistischen China, galt nicht nur als die am schnellsten wachsende Metropole des Landes, sondern auch als geheime Hauptstadt der volkstümlichen chinesischen Küche. Chinesen mochten es gerne exotisch. Die echte chinesische Küche war in keinem deutschen China-Imbiss zu bekommen. Während Auslandschinesen am liebsten Ente süßsauer mit Gemüse anboten, standen Festlandchinesen angeblich auf andere Kost. Sie verschmähten nicht einmal Schlangen, Schnecken, Quallen und Kröten. Sie verzehrten sogar Fledermäuse. Ob gekocht, gebraten oder roh war nicht bekannt. Diese Lebewesen wurden für viel Geld auf speziellen Märkten für exotische Speisen verkauft, und der größte Markt für Exoten lag in diesem Wuhan. Dort trafen Reptilien, Vögel und Säugetiere aufeinander, die einander in der freien Natur niemals zu Gesicht bekommen hätten. Plötzlich standen ihre Käfige nebeneinander oder sogar übereinandergestapelt, und so hatte wohl irgendeine erkältete Schlange auf eine halbtote Fledermaus geniest, und daraus war ein mutiertes Virus entstanden, das auf die Menschen in Wuhan übersprang. Erschreckende Videos kursierten im Netz, die zeigten, wie Menschen in Wuhan über die Straße gingen, plötzlich husteten und auf der Stelle umfielen.
Bei uns in Deutschland hatten die Menschen den Kopf darüber geschüttelt, aber vorerst keine Panik bekommen. Warum sollten wir auch Angst vor einem Virus haben, das von Fledermäusen auf Menschen übertragen wird? Wir haben nichts zu befürchten, wir essen keine Fledermäuse, dachten sich die Menschen. Auf den Gedanken, dass das Virus sich auch ohne Fledermäuse verbreiten würde, von Mensch zu Mensch, und das in einer Welt, in der niemand gegen dieses Virus immun war, auf diesen Gedanken ist man fast zu spät gekommen.
Das Jahr 2020 hatte sowieso schon schlecht angefangen. Eine Naturkatastrophe jagte die nächste. Infolge des Klimawandels schien die Welt aus den Fugen zu geraten. Die Pole schmolzen weiter, die Eisbären verhungerten, die Hurrikans verwüsteten eine Insel nach der anderen, und Australien brannte fast vollständig ab. Auch Deutschland wurde von Stürmen heimgesucht, die aber hauptsächlich in den Nachrichten stattfanden. Kurz vor Ausbruch der Pandemie machten uns die Medien Angst, Sturmtief Sabine rolle mit noch nie da gewesener Kraft auf Deutschland zu. Schulen sollten geschlossen bleiben, die Bürger wurden dazu aufgerufen, ihre Wohnungen nicht ohne Not zu verlassen. Sogar Flohmärkte und alle Geschäfte mit Außenbereichen sollten schließen, um die Menschen vor eventuell umstürzenden Bäumen und durch die Luft fliegenden Autos zu schützen. Die Deutschen sind ein ordnungsliebendes Volk, sie sind den Anweisungen gefolgt. Und was war? Gar nichts. Bei uns im kleinen Garten auf dem Hinterhof kippte ein Plastikstuhl um.
An diesem Abend spazierte ich durch die Stadt. Ein frischer Wind riss Blätter von den Bäumen und ließ sie auf dem Asphalt kreisen. Junge grüne Blätter. Im Februar. Klimawandel eben. Das Mädchen Greta, unsere Kassandra des Klimawandels, trat sogar in der UNO-Vollversammlung auf. Sie schrie die Menschheit an, sie solle aufhören mit ihrem Konsum, aufhören, hin und her zu fliegen, Überflüssiges zu konsumieren und Öl aus der Erde zu pumpen. »Wir müssen die Umwelt, die Natur und unsere Zukunft schützen!«, wütete sie. Damals haben alle über das Mädchen gelacht. Wer hätte gedacht, dass es gar keine UNO brauchte, um die Weltwirtschaft zum Stehen zu bringen. Eine kleine Fledermaus und ein Virus hatten Gretas Wünsche Realität werden lassen. Alle saßen mit ihren Liebsten zu Hause, die Lufthansa hatte alle Flüge gestrichen, die Maschinen blieben am Boden, der Ölpreis war im Keller, und die Umwelt erholte sich. Wer hatte nun die Schuld an der ganzen Sache? Die Chinesen? Die Amerikaner? Die Fledermäuse? Das konnte ich Mama nicht erklären. Eins stand fest. Wir waren es nicht. Schuld sind noch immer die anderen gewesen.
»Ich bleibe gerne zu Hause«, meinte meine Mutter. »Was habe ich da draußen verloren. Ich muss nur genug Lesestoff haben. Ein paar neue Krimis, Kreuzworträtsel, Sudokus. Filme und Musik habe ich auch zur Genüge.«